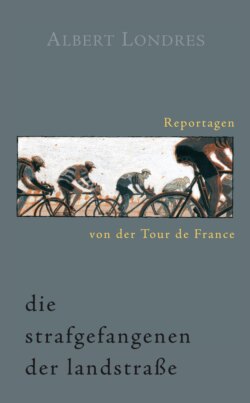Читать книгу Die Strafgefangenen der Landstraße. Reportagen von der Tour de France. - Albert Londres - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPROLOG: DER RASENDE REPORTER
»Die erste Aufgabe eines Befehlshabers ist es, seine Untergebenen vor dem Tod zu bewahren, andernfalls macht er sich zum Friedhofswärter.«
ALBERT LONDRES
Albert Londres, geboren 1884 in Vichy, war Kriegskorrespondent, Schriftsteller und Poet. Bis zum heutigen Tag gilt er in Frankreich noch immer als der große Reporter.
Nach anfänglicher Tätigkeit als Buchhaltungsgehilfe in Lyon – Londres langweilte sich zu Tode – zog es ihn 1903 nach Paris, wo er 1904 seine ersten Sporen beim Salut Public verdiente. Die Redaktion war nur ein Ableger des Lyoner Hauptsitzes. Immerhin ein Neubeginn.
Es war die Epoche, als das Layout noch Umbruch hieß, Schere und Klebstoff zum täglichen Werkzeug der Redakteure gehörten. In der Redaktion wurde umgebrochen, umgeschrieben, geschnippelt, geklebt, Korrektur gelesen…
Einige Wochen vor Weihnachten 1904 kam Florise, seine Tochter, auf die Welt. Doch ein Jahr später stürzte die vormals heile Welt ein: Marcelle (Marie) Laforest, seine Lebensgefährtin, starb im Pariser Krankenhaus Lariboisière.
1906 wechselte Londres zur Tageszeitung Le Matin und arbeitete zunächst als Parlamentschronist. Im September 1914 kam es zur Beschießung der Kathedrale von Reims durch die deutsche Artillerie. Charles Laurent aus der Redaktion delegierte Londres und Moreau, einen Fotografen, in die Champagne. Die Reportage – geschliffen, präzise und poetisch – schlug wie eine »Bombe« ein.
Nur zwei Tage nach der weitgehenden Zerstörung der einstigen Krönungskirche, dieses nationalen französischen Symbols, erschien Londres’ Artikel am 21. September 1914 in Le Matin. Er war namentlich gekennzeichnet, was ganz und gar nicht den Gepflogenheiten dieser überregionalen Zeitung entsprach.
Londres hatte den endgültigen Durchbruch geschafft und war fortan als rasender Reporter tätig. Für die Zeitschrit Excelsior, für die Pariser Blätter Le Petit Journal, Le Quotidien und schließlich Le Petit Parisien.
1922 begab sich Londres auf eine lange Dienstreise nach Japan und China – Kurzvisiten waren seine Sache nicht. Mit Kulis und zu Fuß erkundete er die chinesischen Bürgerkriegswirren, gelangte u.a. nach Shanghai, »diese Stadt von einer chinesischen Mutter und einem anglo-amerikanisch-französisch-germanisch-holländisch-italojapanisch-jüdisch-spanischen Vater« – dieses Bild zeichnete er in seiner Reportage »La Chine en folie« (Verrücktes China): eine Satire ersten Ranges.
Londres weiter: »Es gibt Städte, wo man Kanonen baut, Tuche webt, Schinken herstellt. In Shanghai macht man Geld. […] Man hatte mir gesagt, dass in Shanghai nur Englisch gesprochen wird – eine abscheuliche Lüge. Hier ist das Alphabet unbekannt. So ist die offizielle Landessprache eine Zahlensprache. Man begrüßt sich nicht mit den Worten: Guten Tag, wie geht es Ihnen?, sondern 88,53 – 19,05 – 10,60. Um Millionär zu werden, braucht man nicht lesen zu können, rechnen genügt.« Spätestens hier offenbart sich Londres’ Talent zur spöttischen Beobachtung.
Als ihm der Quotidien die Veröffentlichung einer Reportage über die Besetzung des Ruhrgebietes durch französische Truppen (1923) verwehrte, weil das Manuskript aus redaktioneller Sicht nicht »linientreu« genug war, sprach Londres die fortan geflügelten Worte: »Meine Herren, Sie werden auf eigene Kosten erfahren, dass ein Reporter nur eine Linie kennt – die der Eisenbahn«, setzte seinen legendären, breitkrempigen Hut auf, nahm den Stock und wechselte zum prestigeträchtigen Petit Parisien. Bei Londres steckte dahinter nicht etwa Eitelkeit, sondern eine gewisse Bewunderung für Élie-Joseph Bois, den Chefredakteur, der ihm für seine Arbeit genügend Freiraum ließ. Zuvor aber bot Londres seine Reportage der Zeitung L’Éclair an, die sie moralisch und politisch absegnete. Und veröffentlichte. Die Revanche war geglückt.
Dieser Albert Londres, Perfektionist und Weltenbummler, die Koffer immer parat, hasste die Zensur, verachtete Autoritäten. Für ihn bestand die Humanität stets aus zwei Kategorien: Die eine besitzt die Möbel, die andere die Koffer. Er war kein Schönwetter-Journalist, vielmehr ein Chirurg mit Skalpell. Sein Credo: Die Feder an die Wunde setzen – »porter la plume dans la plaie«. Auf dem Zenit seines Könnens hat er sie, wie gesagt, für den Petit Parisien, die letzte Sprosse seiner Karriereleiter, gesetzt. Unermüdlich, kritisch, augenzwinkernd.
An sozialem Konfliktstoff mangelte es nicht. So investigierte er 1923 in Französisch-Guayana, dort, wo in Saint-Laurent-du-Maroni und auf den Îles du Salut, den »Inseln des Heils«, – welch beißende Ironie – siebentausend Zwangsarbeiter von sechshundert beamteten Aufsehern überwacht wurden. Heute gilt diese idyllische Inselgruppe als Hochburg des Badetourismus.
Noch bevor Londres mit der Investigation überhaupt anfing, schlug ihm schon bei seiner Anreise per Schiff eine Welle des Rassismus entgegen. Auszug aus »Au Bagne« (Im Straflager):
»Als heute früh die Biskra, die unlängst Hammel von Algier nach Marseille transportierte – mittlerweile zur Kategorie der Passagierschiffe für die Karibik hochgestuft –, vor Port of Spain ankerte, waren Passagiere aller Haut- und Haarfarben an Bord: Chinesen, Kreolen, Weiße, Indios. Sie hörten den Kapitän Maguero von der Brücke schreien oder hätten ihn zumindest hören können: ›Nein! Und nochmals nein! Ich habe weder eine Eisenstange noch Handschellen noch bin ich bewaffnet. Ich will sie nicht!‹
Weiter unten, auf dem Wasser, warteten elf Weiße – genauer: elf Franzosen – und zwei schwarze Polizisten in einer Barkasse. Es waren Zwangsarbeiter, die man nach ihrer gescheiterten Flucht wieder nach Guayana abschieben wollte.«
Die brisante Reportage über die Käfighaltung der Sträflinge erschien im August und September 1923 im Petit Parisien. Nicht ohne Kalkül druckte das Blatt einen offenen Brief an Albert Sarrut, Minister für Koloniale Angelegenheiten, gleich mit. Die tickende Zeitbombe zündete – die berüchtigte Strafanstalt wurde im September 1924 aufgelöst, die Reportage bei Albin Michel mit dem Titel »Au Bagne« noch im selben Jahr verlegt und später als Bühnenstück adaptiert. Nur gut, dass seine kritischen Berichte über die Tour de France deren Fortbestand nicht gefährdeten…
Im Sommer 1924 nahm der »Prinz der Journalisten« seine Leser also mit auf die besagte Tour, auf einen Kreuzweg, wie er sie nannte, der indes fünfzehn Stationen – sprich: Etappen – zählte. Gar nicht zimperlich war er in der Wortwahl; wer will es ihm, dem Kriegsberichterstatter, übelnehmen? Worte sind auch Waffen. Londres’ Sprache wirkt lebendig und präzise. Es sind knappe Sätze, Farbtupfer – »die Mützen, am Start blütenweiß, sind verwaschen, fleckig, rötlich…«
Die Materie selbst war für ihn ein Buch mit sieben Siegeln. Er hatte keine Affinität zum Fahrrad, seine Welt waren Züge, Passagierschiffe und ferne Länder. Auch das wird man ihm gerne nachsehen, war er doch als Reporter mit sicherem Gespür stets zur rechten Zeit am richtigen Ort. So hält er mit entwaffnender Naivität die Verpflegungskontrolle – sie fand noch nicht »fliegend« statt – für ein Buffet und verschafft sich sogar Zutritt. Mit leerem Magen und unterzuckertem Hirn musste er von dannen ziehen. Man schmunzelt – und leidet mit.
Die Karawane beschreibt er als einen Trauerzug, jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Vorneweg die Fahrer, die das letzte Geleit geben, gleich dahinter der Leichenwagen. Unwillkürlich denkt man an den Besenwagen. Wollte Londres auf der siebten Etappe die Tour etwa zu Grabe tragen? Mitnichten. Schwarzer Humor à la Londres.
Er spürte die Brüder Pélissier und Maurice Ville im Café am Bahnhof in Coutances auf. Das Trio plauderte bei heißer Trinkschokolade aus dem Nähkästchen…
Vieles könnte auch heute noch publiziert werden. Freilich sind die Etappen nicht mehr ganz so lang und es müsste weniger über Pannen und Staubpartikel berichtet werden – vom antiquierten, schikanösen Reglement ganz zu schweigen. Doch die Sache mit dem »Dynamit« im Verpflegungsbeutel dürfte (und sollte) getrost stehenbleiben.
Und so erscheinen die Reportagen wie eine Zeitreise zurück in die 1920er Jahre, als die Rundfahrt – schon damals – nicht mit Wasser allein gewonnen wurde.
Die selbstinszenierte Aufrichtigkeit der Brüder Pélissier ist die allererste Dopingbeichte überhaupt, noch dazu ungeahndet. Es gibt an derem Wahrheitsgehalt keinen Zweifel. Henri und Francis schenkten Londres reinen Wein ein – »ungespritzt«. Der gewiefte Henri, meist Wortführer, wusste die Gunst der Stunde für sich zu nutzen: Le Petit Parisien war auflagenstark und angesehen, Londres berühmt und im Radsport unbedarft.
Bei diesem »Interview« – die Rollen schienen vertauscht zu sein – errang Henri gegen Desgrange, den allmächtigen Blattmacher von L’Auto und Tour-de-France-Organisator seit 1903, einen wichtigen Sieg: Mit Desgrange konnte Henri Pélissier keinen Konsens finden, weil er sich dem Patriarchen und dessen Medienmacht nicht beugen wollte. Pélissier blieb immer Pélissier, auch wenn ihm der Ruf der Aufsässigkeit anhing, weil er die Etappen der Tour de France als unmenschlich und schikanös empfand.
So lieferte er sich unter anderem am Vortag des Frühjahrsklassikers Paris–Roubaix (1921) mit dem Redakteur Ulcéré von L’Auto ein hitziges Wortgefecht. Letzterer kündigte an, die Namen der Brüder Pélissier aus der Zeitung zu verbannen. Nur 24 Stunden später wurde er wortbrüchig: Henri siegte vor Francis und dem Belgier Léon Scieur…
Über Henri Desgrange heißt es, dass er die Tour de France als »grausame Prüfung für Körper und Geist« erfand. Doch ins Leben gerufen hat er sie vornehmlich, um Aufmerksamkeit und Themen für seine am 16. Oktober 1900 lancierte Sportzeitung L’Auto zu generieren. Denn 1903 dümpelte das Blatt noch bei 20.000 Exemplaren vor sich hin, derweil der Rivale Le Vélo, der Spitzenreiter in der Gunst sportinteressierter Leser, zu dieser Zeit fast die vierfache Auflage erzielte [Quelle: Le premier Tour de France, Éditions Jacob-Duvernet, Paris, 2009].
Tour-Organisator Desgrange hatte ein gutes Näschen, was seine Leser verlangten. Echte Heroen, die die Zähne fleschten, sich die Berge hochquälten, den Ausreißern hinterherhechelten und die Sturzwunden ertrugen, in denen Schweiß und Staub brannten.
Das neue Sportereignis lebte also – von Anfang an – von seiner Aura aus Leiden und Legenden. Und L’Auto kam dabei nicht zu kurz. Die Emotionen ließen sich blendend verkaufen.
Später, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde aus L’Auto die Tagessportzeitung L’Equipe, bis heute das Tour-Organ. Für so manchen Leser ist dieses Blatt die Bibel, und – was schön ist – viele erweisen sich als durchaus »bibelfest«: Die Equipe wird häufig und richtig zitiert.
Zurück zur Tour de France von 1924. Nach dem Ausstieg der drei Rebellen hatte Ottavio Bottecchia meist die Nase vorn, die windschnittigste im Peloton. Seither siegte mancher Italiener auf dem Kreuzweg. Zuletzt: Marco Pantani, der »Elefantino«, wie ihn seine Landsleute wegen seiner Segelohren liebevoll nannten. Albert Londres lässt grüßen…
1932 recherchierte Londres erneut in China. Diesmal ging es offenbar um organisierte Drogenkriminalität. Bevor der Luxusdampfer, die »Georges Philippar«, in Shanghai ablegte, telegrafierte Londres: »Ich bringe Dynamit mit!« Es sollte die letzte Reise des Albert Londres werden: Das Schiff brannte ausgerechnet von seiner Jungfernfahrt heimkehrend im Roten Meer komplett aus. Londres kam bei dem Flammen-Inferno ums Leben. Es war der 16. Mai 1932.
Seither wird alljährlich am 16. Mai der Albert-Londres-Preis für die beste Reportage in den französischsprachigen Printmedien verliehen – erstmals 1933. Florise hatte diese Auszeichnung zum Gedenken an ihren Vater ins Leben gerufen. Das sagt eigentlich schon alles über diese Vater-Tochter-Beziehung.
Stefan Rodecurt, im April 2011
DIE XVIII. TOUR DE FRANCE
22. Juni - 20. Juli 1924 15 Etappen; 5.425 Kilometer