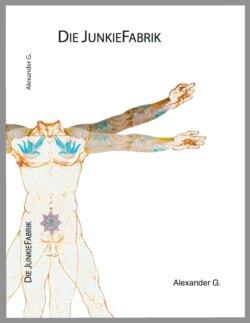Читать книгу Die JunkieFabrik - Alexander Golfidis - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 3
ОглавлениеDie neue Schule
Als Sascha von der Volksschule zur Hauptschule wechseln sollte, begann für ihn ein Albtraum und seine Kindheit nahm ein jähes Ende. Die Hauptschule lag im Hochhausgebiet - und dort gab es Gangs. Sascha hatte schon öfter durch das fremde Viertel gemusst. Zur Kirche und auch zur alten Schule hatte der Weg ein Stück weit durch das Neubauviertel geführt. Meistens hatte er eine sichere Strecke am unteren Rand des Viertels gewählt, aber an manchen Tagen, wenn er zu viel Angst hatte, machte er einen ganz großen Bogen darum und lief sicher die Hauptstraße entlang.
Alle mieden das Hochhausviertel, sogar die Erwachsenen. Sie sagten, es hätte einen schlechten Ruf.
In der Vergangenheit hatte Sascha schon schlechte Erfahrungen in diesem Viertel gemacht: Einmal, als er zum Kommunionsunterricht zu spät dran war, hatte er den Weg durch das andere Viertel abgekürzt. Er war mit dem Rad unterwegs. Am Spielplatz hingen ein paar Jugendliche herum und einer rief ihm nach: »Hey du, komm mal her.« Sascha hatte zwar Angst, aber er war kein Feigling und so fuhr er die paar Meter, die er schon an ihnen vorüber war, wieder mit dem Fahrrad zurück. »Wer is’n des?«, rief einer der Jungs, die sich um ihn herum aufstellten. Zwei der Jungs waren beinahe einen Kopf größer wie Sascha und bestimmt ein oder zwei Jahre älter. Der dritte Junge war in Saschas Alter. Er hatte die Rolle des Rädelsführers übernommen und es war ihm anzusehen, wie sicher er sich mit seinen größeren Freunden fühlte. »Der hat ja Mädchensandalen an«, spottete er. Sascha hatte keine Ahnung, dass er Mädchensandalen anhaben sollte. Er hatte die Sandalen zwar von seiner Schwester geerbt, aber dass es sich demzufolge um Mädchensandalen handeln musste, war ihm nicht klar gewesen. »Das sind keine Mädchensandalen«, gab er trotzig zurück. Und schon schubste ihn einer von seinem Fahrrad herunter. »Jetzt gibt’s Ponches«, hörte er eine Stimme hinter sich und da boxte ihm der etwa gleichaltrige Junge von der Seite ins Gesicht. Sascha wirbelte herum und warf ihn zu Boden. Blitzschnell hatte er ihn überrumpelt und saß auf ihm drauf, so dass dieser nicht mehr zuschlagen konnte. Damit hatte der Gleichaltrige gar nicht gerechnet. Doch dann zogen ihn die beiden Größeren von hinten herunter, und jeder von ihnen kniete sich auf einen von Saschas Armen, sodass er sich nicht mehr wehren konnte. Und der Junge, den er eigentlich schon besiegt hatte, drehte ihm solange die Nasenspitze, bis sie rot und lila leuchtete. Als sie endlich mit ihm fertig waren, ließen sie ihm noch die Luft aus dem Reifen und Sascha musste sein Rad schieben. Seine Jacke war zerrissen, die Fahrradreifen waren platt und aus Saschas Augen rannen unaufhaltsam Tränen. Er hatte so eine Stinkwut. Es war so ungerecht!
Und nun sollte Sascha dort, in dem Neubauviertel, zur Schule gehen. Er war zwar mutig, aber er war kein Schläger – immer wenn er zuschlagen wollte, hatte er eine Hemmung in sich verspürt und seine Schläge wurden wie von Watte abgebremst. Er konnte einfach niemandem wehtun.
Sascha stand alleine da. Und so träumte er sich Rache, er wollte auch zu einer Gang gehören, zu einer Rockergang und dann sollten sie alle vor ihm zittern. So wie in seinen Träumen!
Am ersten Tag in der neuen Schule war Sascha von der gewaltträchtigen Atmosphäre so verängstigt, dass er sich in die Hosen machte. Am Schuleingang hatten zwei größere Schüler einen kleineren blutig geschlagen. Einer hatte den Jungen von hinten festgehalten, der andere hatte davor gestanden und wie beim Fußballspielen mit seinen Füßen auf ihn eingetreten.
Sascha hatte sich an ihnen vorbeigestohlen und war dann so angstvoll in seinem Klassenzimmer gesessen, dass er sich nicht zu fragen traute, ob er auf die Toilette dürfe. Eisern hatte er es verdrückt. Als der Mittagsgong ertönte, war er aus der Schule gestürmt und gerade, als er durch den Haupteingang kam, konnte er es nicht mehr halten. Ein nasser Fleck prangte pfannkuchengroß vorne mitten auf seiner Hose. Sascha hielt die Schultasche davor und rannte, als wäre der Teufel hinter ihm her, den ganzen weiten Weg bis nach Hause.
Den Tag darauf bot sich ihm ein ähnliches Bild. Er hörte lautes Geschrei, als er von dem Teerweg in den mit grauem Schiefer gepflasterten Vorhof zur Schule bog. Kaum war er um die Ecke, sah er in einem Halbkreis angeordnet etwa acht Mädchen, die um eine liegende Gestalt herumstanden.
Nachdem er noch ein paar Schritte näher heran war, sah er, dass es sich um einen schmächtigen Jungen handelte, der sich Zuflucht suchend am Boden wie ein Igel zusammengerollt hielt. Doch sein eigener Körper bot ihm wenig Schutz. Die Mädchen traten mit ihren Füßen nach ihm. Gemeine, fiese Stöckelschuhe hieben in seinen Leib. Die Anführerin, ein hässliches Mädchen mit einer wild abstehenden Frisur, vielen Pickeln im Gesicht und einem knallrot geschminkten Mund, zog ihn an den Haaren hoch und fuhr ihm mit ihren lila lackierten Fingernägeln quer über das Gesicht. Blut lief über seine Wange und tropfte auf die Pflastersteine. Dann kreischte sie ihm noch eine Drohung ins Ohr: »Nächstes Mal kommst du nicht so leicht davon!« Mit einem kräftigen Schubs stieß sie ihn wieder zu Boden. Noch einmal trat eine jede zu, endlich ließen sie von ihm ab. Der Schulgong war ertönt.
Zurück auf den Pflastersteinen blieb ein Junge, der zitterte und wimmerte wie ein zu Tode erschrockenes Tier. Es war ein Siebtklässler, Sascha sollte ihn später noch kennenlernen.
Diese Schule war die Hölle: Im Pausenhof und in der Vorhalle standen immer wieder solche Grüppchen zusammen, die auf Schwächere losgingen. Der Toilettengang zwischen den Schulstunden wurde zum Spießrutenlauf: Jedes Mal blieb offen, ob man wieder heil zurück ins Klassenzimmer fand, oder ob man in die Arme der Acht- oder Neuntklässler lief, die sich einen Spaß daraus machten, jüngere Mitschüler mit dem Kopf in die Toilettenschüssel zu tauchen. Gewalt, Schläge und Erpressung waren an der Tagesordnung.
Selbst die Lehrer hatten es nicht leicht: Lehrer wurden aus dem Fenster gehängt, geohrfeigt, oder, wenn ihnen so nicht beizukommen war, wurden auf dem Lehrerparkplatz ihre Autos beschädigt.
Doch mit der Zeit arrangierte sich Sascha mit der Situation. Er hatte sich mit Marcel angefreundet. Marcel war ein kräftiger, drahtiger Junge und drückte neben ihm die Schulbank.
Marcels ganzer Körper schien nur aus Muskeln zu bestehen – er war sogar so stark, dass er es gar nicht nötig hatte, sich gegen Schwächere zu wenden. Marcel konnte es mit jedem aufnehmen, denn obendrein hatte er auch Mut.
Eigentlich trumpfte Marcel überall dort, wo Sascha nichts zu bieten hatte. Im Sport war er immer unter den Ersten. Er hatte viele Freunde. Und er war sogar der Kopf einer Jungenbande.
In seinem Viertel hatte Sascha früher auch Freunde gehabt. Helmut, Robin und Karl wohnten alle in seiner Straße.
Sie waren gute Freunde gewesen, die täglich miteinander spielten. Im Winter, wenn tiefer Schnee in den Straßen und Gärten lag, zogen sie mit ihren Schlitten zu einem nahegelegenen Hügel und donnerten in halsbrecherischer Fahrt hinunter. Im Sommer fuhren sie mit ihren Rädern raus vor die Stadt zu einem Baggersee zum Baden. Manchmal hatten sie auf dem Weg zum See, an einer Brücke haltgemacht. Dort hatten sie am Geländer um die Wette gepisst. Sieger war, wer am weitesten kam. Karl hatte den stärksten Strahl, er lag immer um einen Meter in Führung.
… Und so etwas machten doch nur wirklich gute Freunde miteinander.
Doch seit Sascha in die neue Schule gewechselt war und nun zu seinen Freunden Marcel aus dem Hochhausviertel gehörte, hatten die Eltern von Helmut, Karl und Robin ihren Kindern verboten mit ihm zu spielen, sie hatten ihnen erzählt, Sascha sei jetzt ein »Rocker«.
Die Freundschaft zwischen Sascha und Marcel wurde schnell enger, innerhalb kürzester Zeit waren die beiden beste Freunde. Außerdem hatte Sascha etwas, womit von Marcels Freunden niemand aufwarten konnte. Er hatte ein eigenes Haus mit Garten.
Von nun an spielten die beiden oft auf der Wiese vor Saschas Haus – sie wetteiferten im Bogenschießen mit selbst geschnitzten Pfeil und Bogen, oder kletterten auf den Obstbäumen umher, die sich ebenfalls im Garten befanden. Und manchmal ging Sascha auch mit Marcel rüber ins andere Viertel. Nachdem dort alle mitbekommen hatten, dass Sascha nun Marcels neuer Freund war, war auch er dort willkommen. Sascha stand unter Marcels Obhut, wie unter einem unsichtbaren Schutzschild.
So kam es, dass sich nach und nach ein Wandel vollzog: Erst war Sascha noch brav zur Schule gegangen, hatte um acht im Bett gelegen und kannte die Krimis aus dem Abendprogramm nur vom Hörensagen, während die anderen Mitschüler und Freunde damit prahlten, dass sie länger aufbleiben durften und was sie alles für Serien gesehen hatten. Sonntags war er sogar des Öfteren in der Kirche gewesen und nur der Umstand, dass ihm regelmäßig vom Weihrauch schlecht wurde, hatte ihn von dieser Pflicht befreit.
Doch nun vollzog sich zeitgleich mit dem Eintreten der Pubertät eine Änderung, die sich bald über alle Bereiche seines Lebens ausweitete.
In Saschas näherem Umfeld gab es keine erwachsenen Vorbilder, an denen er sich orientieren wollte: Da war ein entfernter Onkel, der sich selbst für den Größten hielt, alles besser wusste und darüber hinaus ständig über andere am schimpfen war. Er trug Tag für Tag denselben blauen Arbeitskittel, in dem ordentlich in der Brusttasche ein Phasenprüfer und ein kleiner Meterstab steckte. Im Ganzen hatte der Onkel keine einzige Eigenschaft, die Sascha als toll oder nachahmenswert empfunden hätte. Dann gab es noch den Vater eines Freundes, der ständig besoffen auf der Couch vor dem Fernsehapparat saß. Ein weiterer Onkel, ein Lustgreis mit Hitlerbärtchen und streng gezogenem Scheitel, der fortwährend versuchte die kleinen pfirsichgroßen Brüste von Saschas pubertierenden Schwestern zu berühren, taugte ebenfalls nicht als Vorbild.
»Hier hast du nen Zehner«, sagte der Onkel übermäßig laut und reichte Sascha einen Geldschein, während die Schwestern mit nach unten zeigenden Mundwinkeln zu Sascha starrten.
»Deine Schwestern kriegen nichts, die waren nicht nett zu mir«, betonte der Onkel mit dem Hitlerbärtchen, damit sich Saschas Schwestern ärgern sollten. Sie hatten sich nicht von ihm betatschen lassen und gingen deshalb nun leer aus.
Von weiblichen Vorbildern hielt Sascha auch nichts – schließlich waren Frauen als Vorbilder für einen Jungen, mehr als untauglich.
Wenn sich Sascha mit seinen Fragen an die Erwachsenen wandte, »Warum muss man zur Schule gehen? Warum muss man arbeiten?«, hörte er jedes Mal die gleichen altgedienten Antworten. »Weil man es so macht! Weil sich das so gehört!«
Ihm kam es so vor, als würden sie nur das weiter geben, was sie selbst einmal gehört hatten. Doch weil sich die Erwachsenen über ihre Arbeit und über ihr Leben ständig beschwerten und dennoch immer wieder das Gleiche taten, zweifelte Sascha daran, dass dies der richtige Weg sei.
Es war ihm, als wollten sie ihn klein machen, gering halten, ihn nicht das große Leben, die Freiheit leben lassen. Vielmehr wollten sie Sascha zu dem machen, was sie selbst waren. Zu einem Gefangenen. Sie wollten das, was sie sich selbst nicht zutrauten, auch keinem Anderen zugestehen. Er sollte sich ihr Lebensmodell überstülpen: Sie waren gut gekleidet, hatten jedoch keinen individuellen Stil; sie waren klug, hatten aber keine eigenen Ideen; sie besaßen Talent, wussten es jedoch nicht zu nutzen; sie hatten Herz, dachten jedoch vordergründig immer nur an sich. Kurzum, sie waren wie alle: Massenware, gewöhnlich – keine Piraten, keine Eroberer, keine Entdecker. Die Erwachsenen waren wie Klone, die sich zwar in Aussehen und Größe unterschieden, jedoch ansonsten kein eigenständiges Denken besaßen – sie waren süchtig an öffentlichen Meinungen. Und diesen Stempel wollte sich Sascha nicht aufdrücken lassen.
Am meisten hasste es Sascha jedoch, wenn seine Verwandten zu Besuch kamen. Dann gab es schon Tage vorher Stress. Es wurde aufgeräumt, die Böden gewischt und das Haus auf Hochglanz getrimmt. Kurz vor der Ankunft der Verwandtschaft wurden dann noch die Kinder herausgeputzt. Die Haare der Schwestern wurden gekämmt, bis es Tränen gab. Steife unbequeme Sonntagskleidung musste angezogen werden und dann sollten die Kinder als Aushängeschild für eine tolle Familie einen guten Eindruck machen. Sascha stand dann etwas abseits und beobachtete die Erwachsenen. Er durchleuchtete sie wie mit einem Röntgenapparat. Er registrierte jede Lüge, jedes falsche Lächeln, jedes sich Hervorheben wollen, und er verabscheute das alles zutiefst. Während sie beieinanderstanden und sich gegenseitig oberflächliche Dinge erzählten, die sie nicht berührten, und sich wechselseitig anlogen, wie toll es ihnen ginge und wie weit sie im Leben gekommen waren – stand Sascha daneben und hasste sie dafür.
In dieser Zeit musste Sascha für den Schwimmunterricht ein Stadtviertel weiter zum nahegelegenen Schwimmbad fahren. Es war ein kalter Novembermorgen gegen 6:50 Uhr mitten im Berufsverkehr. Der S-Bahnhof wimmelte von Menschen. Als der Zug einfuhr, hatte sich Sascha einen Weg durch die Menschenmassen gebahnt und war im Zugabteil nach hinten gestiegen, um einen der freien Sitzplätze zu erhalten. Dies war der Vorteil, wenn man so dünn war wie Sascha, konnte man sich leicht hindurchschlängeln. Doch leider waren die hinteren Plätze schon belegt, so griff er nach oben in die Haltestange, damit er nicht durch den Zug geworfen wurde, sobald dieser anfuhr.
Während der Fahrt sah sich Sascha die Gesichter der Mitfahrenden genauer an. Eng an eng standen die Menschen gedrängt nebeneinander. Wie Gefangene, fremdbestimmt und unterwürfig standen sie da. Nichtssagende Gesichter mit satten Tränensäcken. Es waren sehr traurige Gesichter, dicke und dünne, kurze und lange – bei manchen hatte sich der Trübsinn in verbissene, zornige Mienen verwandelt, in denen hineingeworfene Münder versucht waren, falsches Lächeln anzudeuten. Andere wirkten abwesend in weit fernen Ländern, wieder andere standen krumm, mit gesenktem Kopf, als würden sie sich vor Schlägen ducken. An manchen haftete der Geruch von Alkohol und Nikotin und das Unglück schien ihnen aus den leidenden, mit Falten übersäten Gesichtern zu triefen. Alle hatten leere und ausgebrannte Augen und niemand hatte ein Lachen im Gesicht. Sie liefen den ganzen Tag unsinnig in ihrem Leben hin und her, doch ihre Rastlosigkeit ergab keinen Sinn – denn es bereitete ihrem Herzen keine Freude.
In einem undurchsichtigen, verworrenen Gedankengang kam Sascha das Wort »Schafe« in den Sinn …
Als er an diesem Tag nach Hause kam, sagte er zu seiner Mutter: »Die Menschen sind wie Schafe … Du brauchst bloß am Morgen in die S-Bahn kucken und du siehst Schafe.«
Die Mutter erwiderte empört:
»Die Menschen sind doch keine Schafe.«
»Doch nur Schafe«, antwortete Sascha.
Alle sprangen sofort in die Bresche, sobald jemand die Gesellschaft anging, dabei war ihnen nicht klar, dass sie selbst zu den Verdummten gehörten. Sie fühlten sich manipuliert und überfordert, der Sache nicht gewachsen, und sie hatten das Gefühl, dass ihnen ihr Leben vermiest wurde. Und es stimmte.
Die Menschen hatten ein System erschaffen, in dem sie sich gegenseitig ausnahmen, bis ihnen die Luft ausging. Und das nannten sie Kapitalismus. Obendrein hatten sie in der Politik ein System, in dem die ganze Zeit lautstark geredet wurde, und sie einem dabei so viele Lügen erzählten, bis die Allgemeinheit alles zu fressen begann, was ihnen erzählt worden war. Das nannte man Demokratie.
Die Erwachsenen gingen in die Arbeit, kamen nach Hause und beschwerten sich darüber. Am nächsten Tag gingen sie wieder hin. Sie waren wie fremdbestimmt. Blökend und einander Parolen zurufend, liefen sie alle in eine Richtung. Sie folgten einem Schilderwald – hier lang – dort lang – da lang – hier nicht lang – und diese Schildersprache riefen sie sich gegenseitig zu, während sie versucht waren, mit der Herde mitzuhalten. Eigennutz und Kleinherzigkeit saßen manchen auf den Schultern und flüsterten anspornend in die Ohren »lauf schneller, lauf schneller, dann bekommst du mehr«, was etliche noch eifriger werden ließ.
Doch sie liefen wie die Blinden – mit jedem Schritt, den sie vorankamen, gerieten sie mehr und mehr in die Mühlen und Abhängigkeiten.
Wie ehemals die Menschen ihr Herz für Glanz und Glorie dreingaben, reichten sie es nun für Qualifikation und Besitz, aber sie hinterfragten nicht. Niemals.
Die Maschinerie zermanschte sie und spie sie dann wieder aus – mit aufgesetzten, grotesken Masken der Anständigkeit.
Sie hatten nicht verstanden, dass sie einstmals eigenständige Lebewesen waren. Sie identifizierten sich mit der Masse und je mehr sie das taten, umso stärker stutzten sie sich zurecht. Bis hin zur Unkenntlichkeit.
Schließlich hatten sie sich, in dem Wahn, angepasst zu sein, das letzte Stück Persönlichkeit herausgebügelt, das sie ausgemacht hatte.
Nun quakten sie den ewigen Singsang ihres individuellen Fortschritts, mit der inhärenten Angst, jemand könne ihr Weltbild mit nur einem Furz in tausend Stücke zerschlagen.
Halbtot, krank und siech vom Arbeiten, Fernsehen und Zeitunglesen gab es am Ende für die, die es geschafft hatten, Rente, Altenheime, Pflegeheime und Gehwägelchen.
Und für die anderen gab es schon vorher Tüten voll Arzneien gegen die blumenkohlartigen, kranken Gewächse, die aus ihren Körpern wucherten, und die anderen Erkrankungen, die sie sich in ihrem Stress zugezogen hatten.
Sascha hatte keine Worte für das, was er sah, wenn er in die Gesichter der Erwachsenen blickte, es war nur ein Gefühl, das ihn überkam: Das Gefühl von Lug und Trug, ein Falschsein was ihnen tief zugrunde lag. Eine ewig kreisende Sinnlosigkeit, die ihr Dasein ausmachte, das eine einzige Lüge war.
Sascha wusste nur eines: So wollte er nicht werden.