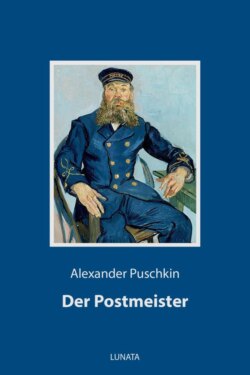Читать книгу Der Postmeister - Alexander Puschkin - Страница 6
Der Postmeister
ОглавлениеWer hätte nicht schon die Postmeister verflucht? Wer hätte sich nicht mit ihnen gezankt? Wer hat nicht in zornigen Augenblicken von ihnen das verhängnisvolle Buch gefordert, um eine unnütze Klage über Grobheit, Bedrückung, Fahrlässigkeit und Unzuverlässigkeit einzutragen? Wer hätte sie nicht für Scheusale in Menschengestalt gehalten oder sie doch wenigstens mit den Vizesekretären in Kanzleien oder mit Räubern zusammengestellt?
Doch laßt uns gerecht sein. Versetzen wir uns nur in ihre Lage, und unser Urteil wird vielleicht milder ausfallen.
Was ist denn ein Postmeister? Ein wahrer Märtyrer vierzehnter Klasse, den nur sein Amt vor Schlägen schützt, und auch das nicht immer (ich frage meine Leser auf Ehr' und Gewissen). Was für ein Amt hat denn ein solcher »Diktator«, wie Fürst Wjäsemski scherzhaft den Postmeister nennt? Lebt er nicht in Wahrheit wie ein Galeerensträfling? Weder Tag noch Nacht hat er Ruhe. Allen Ärger, den ein Passagier auf einer langweiligen Fahrt aufspeichert, läßt er am Postmeister aus. Ist das Wetter miserabel, der Weg schlecht, der Kutscher betrunken, die Pferde störrisch – der Postmeister ist an allem schuld. Sobald der Passagier die Wohnung betritt, betrachtet er ihn wie einen Feind. Gut ist's noch, wenn es ihm gelingt, den ungebetenen Gast wieder los zu werden.
Aber wenn es keine Pferde gibt? … Gott, welche Schimpfwörter, welche Drohungen fallen da aufs Haupt des armen Postmeisters. In Schmutz und Regen muß er auf den Höfen herumrennen; in Sturm und Frost geht er in seine Stube, um nur einige Minuten von dem Geschimpfe und den Rippenstößen des Passagiers auszuruhen. Es kommt ein General, der zitternde Postmeister gibt ihm die beiden letzten Dreigespanne mit den Kurierpferden. Ohne zu danken, fährt der General ab. Fünf Minuten später … es klingelt schon wieder – und ein Feldjäger wirft seinen Fahrbefehl auf den Tisch.
Über das alles wollen wir gerecht urteilen, und statt mit Zorn wird sich unser Herz mit Mitleid füllen. Zwanzig Jahre lang habe ich Rußland nach allen Richtungen durchzogen. Fast alle Poststraßen sind mir bekannt. Ich kenne einige Generationen von Postkutschern, beinahe alle Postmeister habe ich persönlich gesehen. Und nur wenige mögen es sein, mit denen ich nicht zu tun hatte.
Im Mai des Jahres 1816 reiste ich gerade durch das Gouvernement N. auf einer Poststraße, die nicht mehr existiert. Ich bekleidete damals nur ein unbedeutendes Amt, reiste mit der Post und bezahlte für zwei. Darum machten auch die Postmeister nicht viel Umstände mit mir, und oft mußte ich mit Gewalt erkämpfen, was mir von Rechts wegen zustand. Ich war damals noch jung und lustig und nicht wenig erzürnt auf den gemeinen und unverschämten Postmeister, wenn er die Pferde, die eigentlich für mich bestimmt waren, vor den Wagen eines Beamten spannte, der einen höheren Rang hatte. Genauso konnte ich mich lange Zeit nicht damit abfinden, daß bei den Mahlzeiten beim Gouverneur der Bediente dem Range nach vorlegte. Jetzt scheint mir beides in Ordnung zu sein. Wie würde es um uns stehen, wenn statt der vernünftigen Regel: »Der Rang ehre den Rang!« eine andere eingeführt würde, etwa: »Der Verstand ehre den Verstand!« Was für Streitigkeiten würden da entstehen und bei wem sollten die Bediensteten anfangen, das Essen zu servieren? Doch ich will meine Erzählung beginnen.
Es war ein heißer Tag. Drei Werst von der Station fielen einzelne Tröpfchen, und alsbald durchnäßte mich ein Platzregen durch und durch. Bei der Ankunft an der Station war es daher meine erste Sorge, mich so rasch als möglich umzukleiden und dann Tee zu verlangen. »He, Dunja!« rief der Postmeister. »Setze den Teekessel auf und hole Rahm!« Auf dieses Wort erschien ein Mädchen von vierzehn Jahren und trat in den Flur. Ich staunte über ihre Schönheit. »Ist das Ihre Tochter?« fragte ich den Postmeister. »Jawohl«, antwortete er selbstgefällig, »und wie sie verständig ist und so rasch, ganz die verstorbene Mutter.« Drauf schrieb er meinen Paß ab. Ich besah mir indes die Bilder, welche die Wand der Behausung schmückten. Sie stellten die Geschichte vom verlorenen Sohn dar. Auf dem ersten entläßt ein ehrwürdiger Greis in Schlafrock und Schlafmütze den ungestümen Jüngling, der eiligst den Segen und einen Sack voll Geld dahinnimmt. Auf dem zweiten ist in grellen Farben das liederliche Leben des Jünglings geschildert. Er sitzt an einem Tische, umgeben von falschen Freunden und schamlosen Weibern. Weiter hütet der Jüngling, nachdem er sein Gut verpraßte, die Schweine. Er ist in Lumpen gehüllt und teilt mit den Tieren das Futter. Auf seinem Gesicht ist tiefe Trauer und Reue ausgeprägt. Endlich wird die Rückkehr zum Vater dargestellt. Der gute Greis eilt ihm in demselben Schlafrock und derselben Schlafmütze entgegen. Der verlorene Sohn liegt vor ihm auf den Knien; in einiger Entfernung schlachtet der Koch das gemästete Kalb, und der ältere Bruder fragt die Diener nach dem Grunde dieser Freude. Unter jedem Bilde las ich passende deutsche Verse. Das alles blieb fest in meinem Gedächtnis, auch die Blumentöpfe mit den Balsaminen und das Bett mit der bunten Gardine und alle übrigen Gegenstände auch. Noch sehe ich den Wirt, als wenn es heute wäre, einen Mann von fünfzig Jahren, frisch und gesund, mit einem langen, grünen Rock bekleidet, auf dem drei Medaillen an verblichenen Bändern prangten.
Ich hatte noch keine Zeit gehabt, den Kutscher zu bezahlen, als Dunja schon mit der Teemaschine hereintrat. Beim zweiten Blick bereits merkte die kleine Kokette, welchen Eindruck sie auf mich gemacht hatte. Sie schlug die großen blauen Augen nieder und unterhielt sich mit mir. Sie antwortete ohne jede Schüchternheit wie ein Mädchen, das schon die große Welt gesehen hat. Dem Vater gab ich ein Glas Punsch, ihr reichte ich eine Tasse Tee, und wir sprachen so vertraulich zusammen, als ob wir schon eine Ewigkeit miteinander bekannt wären.
Die Pferde standen bereit, obschon ich nicht eben große Lust hatte abzureisen. Endlich aber nahm ich doch Abschied. Der Vater wünschte eine glückliche Reise, die Tochter begleitete mich bis an den Wagen. Im Hausflur blieb ich stehen und bat sie um einen Kuß. Dunja willigte ein. – Ich habe schon manchen Kuß gegeben, aber keiner ließ in mir eine so lange und so angenehme Erinnerung zurück.
Mehrere Jahre vergingen. Umstände führten mich auf dieselbe Straße, an denselben Ort. Ich gedachte der Tochter des alten Postmeisters und freute mich schon im voraus, sie wiederzusehen. Doch, dachte ich wieder, der Alte ist vielleicht versetzt worden, die Tochter ist verheiratet. Bisweilen dachte ich auch, einer von ihnen kann ja gestorben sein. Mit banger Ahnung näherte ich mich der Station. Die Pferde hielten am Posthause, ich ging in die Stube, da sah ich wieder die Bilder vom verlorenen Sohne. Tisch und Bett standen noch auf demselben Platz. Aber am Fenster waren keine Blumen mehr, alles umher war veraltet und vernachlässigt. Der Postmeister, in einen Schafpelz gehüllt, lag da und schlief. Meine Ankunft weckte ihn. Er stand auf … Ja, es war wirklich Simeo Wyrich. Aber wie sehr war er gealtert! Während er da saß und meinen Paß abschrieb, schaute ich auf sein graues Haar, sein mit tiefen Furchen durchzogenes Gesicht, das seit langem kein Rasiermesser mehr gesehen hatte, den gebeugten Rücken – und ich konnte mich nicht genug wundern, wie drei, vier Jahre einen rüstigen Mann in einen schwachen Greis umgewandelt hatten. »Kennst du mich nicht?« fragte ich ihn. »Wir sind ja alte Bekannte!« – »Das ist möglich«, entgegnete er düster. »Es geht ja hier eine belebte Poststraße vorüber.« – »Ist denn deine Dunja noch gesund?« fragte ich weiter. Die Züge des Greises veränderten sich. »Ach, Gott weiß«, antwortete er. »Also ist sie verheiratet?« sagte ich. Der Alte tat, als hätte er meine Frage gar nicht gehört, und las murmelnd meinen Paß weiter. Ich fragte nicht mehr und ließ die Teemaschine aufsetzen. Neugier peinigte mich, und ich hoffte, der Punsch werde die Zunge des Alten schon lösen.
Ich irrte mich nicht. Der Alte schlug das Glas nicht aus. Merklich heiterte der Rum seine düstere Miene auf. Schon beim zweiten Glase wurde er gesprächiger; er sann nach, stellte sich, als ob er mich kenne, und ich erfuhr von ihm eine Geschichte, die mich damals tief bewegte.
»Sie kannten ja alle meine Dunja«, begann er. »Wer sollte sie auch nicht gekannt haben. Ach, Dunja, Dunja! Was war es für ein Mädchen! Wer hier nur immer durchfuhr, jeder lobte sie, niemand tadelte sie. Durchreisende Damen schenkten ihr bald ein Taschentuch, bald Ohrringe. Die Herren hielten absichtlich an, um hier Mittag- oder Abendessen zu nehmen, in Wahrheit aber nur, um sie länger zu sehen. Und wenn ein Herr auch noch so zornig war, in ihrer Nähe wurde er still und sprach freundlich mit ihr. Sie mögen es glauben oder nicht, mein Herr, aber Kuriere und Feldjäger plauderten oft halbe Stunden lang mit ihr. Sie besorgte den Haushalt, räumte alles auf und kam mit allem zurecht. Auch ich alter Narr, ich konnte mich an ihr nicht satt sehen, ich konnte mich nicht genug über sie freuen. Habe ich meine Dunja nicht geliebt? Habe ich mein Kind nicht gut behandelt? Hatte sie es nicht gut bei mir? Aber nein, vor aller Not kann man sich nicht hüten. Dem Schicksal kann niemand entgehen.« Hier fing er nun an, mir sein Leid ausführlicher zu erzählen. Vor drei Jahren, an einem Winterabend war es gewesen, als der Postmeister gerade ein neues Postbuch liniierte und seine Tochter sich ein neues Kleid nähte, da hielt ein Dreigespann, und ein Passagier stieg aus mit einer Tscherkessenmütze und einem Militärmantel. Er trat in die Stube und verlangte Pferde. Alle Pferde waren auswärts. Fast hätte bei dieser Nachricht der Passagier seine Peitsche erhoben. Doch Dunja, solche Szenen gewohnt, trat heran und wendete sich sanft an den Passagier mit der Frage: »Wollen Sie nicht etwas essen?« Dunjas Erscheinung wirkte, wie gewöhnlich. Der Zorn des Passagiers legte sich, er beschloß, auf die Pferde zu warten, und bestellte Abendbrot.
Er nahm die durchnäßte wollene Mütze ab, zog den Mantel aus, und ein schlanker junger Husar stand da mit schwarzem Schnurrbärtchen. Er blieb beim Postmeister, sprach fröhlich und lustig mit ihm und seiner Tochter. Das Abendessen wurde aufgetragen. Unterdessen kamen die Pferde an, und der Postmeister befahl, sie nicht erst zu füttern, sondern gleich an den Wagen des Passagiers zu spannen. Als er aber zurückkam, da lag der junge Mann fast besinnungslos auf der Bank. Es war ihm übel geworden, er hatte Kopfschmerzen und konnte in solcher Lage unmöglich die Reise fortsetzen. Was war da zu tun? Der Postmeister gab sein Bett her, und wenn das Befinden des Kranken sich nicht besserte, wollte man am anderen Morgen aus S. den Arzt kommen lassen.
Tags darauf wurde es dem Husaren noch schlechter. Sein Diener ritt in die Stadt zum Arzt. Dunja band ihm ein Tuch, mit Essig befeuchtet, um den Kopf und setzte sich mit dem Nähzeug ans Bett. Der Kranke sah zu ihr auf, seufzte und sprach kein Wort. Doch trank er zwei Tassen Kaffee und bestellte seufzend das Mittagessen. Ständig forderte er zu trinken, und Dunja reichte ihm einen Krug mit Limonade, die sie selbst zubereitet hatte. Der Arme netzte seine Lippen, und sooft er den Krug zurückgab, drückte er leise Dunjas Hand. Zur Mittagszeit erschien der Arzt. Er fühlte ihm den Puls, sprach deutsch mit ihm und erklärte auf russisch, nur Ruhe sei nötig, in zwei Tagen könne er getrost seine Reise fortsetzen. Der Husar gab ihm 25 Rubel für den Besuch und lud ihn zum Mittagessen ein. Er war's zufrieden. Beide aßen mit großem Appetit, tranken eine Flasche Wein und trennten sich sehr vergnügt.
Noch ein Tag verging, und der Husar wurde völlig gesund. Er war nun sehr aufgeräumt, machte Späße bald mit Dunja, bald mit dem Postmeister, pfiff Lieder, unterhielt sich mit den Durchreisenden, schrieb ihren Paß ins Postbuch, so daß es am dritten Tage dem Postmeister gar schwer ankam, sich von seinem lieben Gaste zu trennen. Es war gerade Sonntag. Dunja war im Begriff, zur Kirche zu gehen. Der Wagen fuhr vor. Er nahm Abschied vom Postmeister, nachdem er ihn reichlich belohnt hatte, nahm auch Abschied von Dunja und wollte sie bis zur Kirche fahren, die am Ende des Dorfes lag. Dunja aber zögerte. »Warum fürchtest du dich?« fragte der Vater. »Der Herr ist ja kein Wolf, der dich auffressen könnte. Fahre immer hin bis zur Kirche.« Dunja setzte sich in den Wagen, neben den Husaren, der Bedienstete sprang hinten auf, der Kutscher pfiff, und die Pferde eilten davon.
Der arme Postmeister konnte nicht begreifen, daß er es selbst Dunja erlaubt hatte, mit dem Husaren zu fahren. Keine halbe Stunde verging, und sein Herz wurde unruhig. Die Angst stieg, er ging zur Kirche. Dort sah er, wie die Leute schon wieder auseinandergingen, aber Dunja war weder am Zaun noch am Eingang der Kirche. Er betrat das Gotteshaus. Der Priester kam hinter dem Altar hervor, der Küster löschte die Kerzen, zwei alte Frauen beteten noch in einer Ecke; aber Dunja war nicht zu sehen. Der arme Vater fragte den Küster, ob seine Tochter beim Gottesdienst gewesen sei. Der verneinte. In einer peinlichen Lage begab sich der Postmeister wieder nach Hause. Nur eine Hoffnung blieb ihm noch. Vielleicht, dachte er, hat Dunja im jugendlichen Leichtsinn Lust bekommen, bis zur nächsten Station mitzufahren, wo ihre Pate wohnte. In einem schrecklichen Seelenzustand erwartete er die Rückkehr des Gespannes, mit dem er sie entlassen hatte. Endlich am Abend kam der Kutscher, etwas berauscht, mit der Schreckensnachricht zurück: »Dunja ist mit dem Husaren von der andern Station weitergereist!«
Das Unglück des Greises war groß. Er legte sich alsbald ins Bett, in dem am vorigen Tage der junge Betrüger gelegen hatte. Jetzt, als er sich alle Ereignisse aneinanderreihte, sah er nur zu gut ein, daß die Krankheit nur vorgeschützt war. Er verfiel in ein schreckliches Nervenfieber, man brachte ihn nach S., und sein Posten wurde inzwischen von einem andern versehen. Derselbe Arzt, der den Kranken besucht hatte, kurierte ihn, und er versicherte dem Postmeister, der junge Mann sei ganz gesund gewesen und habe ihm schon damals das boshafte Vorhaben verraten; doch habe er aus Furcht vor der Peitsche geschwiegen. Mochte nun auch der Deutsche die Wahrheit sagen oder nur damit prahlen wollen, genug, trösten konnte er den armen Kranken nicht im geringsten. Kaum war er wieder gesund, so bat er um Urlaub auf zwei Monate, und ohne jemandem von seinem Vorhaben etwas zu sagen, machte er sich zu Fuß auf den Weg, um seine Tochter zu suchen. Aus dem Passe wußte er, daß der Rittmeister Minsky von Smolensk nach Petersburg reiste. Der Kutscher, welcher ihn gefahren hatte, sagte, Dunja habe den ganzen Weg geweint, doch sei es ihm vorgekommen, als sei sie mit der Flucht einverstanden gewesen. »Vielleicht«, dachte der Postmeister, »bringe ich mein verirrtes Schäfchen wieder nach Hause.« Mit diesem Gedanken kam er in Petersburg an, bezog das Haus eines verabschiedeten Unteroffiziers, seines alten Kameraden, und begann nachzuforschen. Es dauerte nicht lange, so erfuhr er, daß der Rittmeister sich wirklich in Petersburg aufhalte und im Hotel Demutow wohne. Der Postmeister beschloß, zu ihm zu gehen.
Am frühen Morgen stand er im Vorzimmer und bat, der Exzellenz zu melden, ein alter Soldat wünsche sie zu sprechen. Der Diener, der gerade Stiefel putzte, erklärte, sein Herr schlafe noch und werde vor elf Uhr niemanden vorlassen. Der Postmeister ging fort, kam aber zur bestimmten Zeit wieder. Minsky erschien in einem Schlafrock und einer roten Mütze. »Was willst du denn, Bruder?« fragte er. Das Herz des Greises schlug zum Zerspringen. Tränen rollten aus seinen Augen, und mit zitternder Stimme sprach er: »Euer Exzellenz, erweisen Sie mir ein großes Zeichen der Gnade!« Minsky blickte auf, wurde rot, ergriff seine Hand, führte ihn in sein Zimmer und schloß die Tür. »Euer Exzellenz«, fuhr der Greis fort, »was vom Wagen gefallen, ist verloren. Geben Sie mir wenigstens meine arme Dunja wieder, Sie haben sich ja nun an ihr erfreut. Lassen Sie meine Tochter nicht zugrunde gehen.« – »Das Geschehene läßt sich nicht ungeschehen machen«, sagte der junge Mann in großer Verlegenheit. »Wohl bin ich schuldig und muß dich um Verzeihung bitten. Aber glaube mir, ich konnte nicht von Dunja lassen. Sie wird glücklich sein, darauf gebe ich dir mein Ehrenwort. Was willst du mit ihr? Sie liebt mich, ist ganz aus ihrem früheren Leben herausgewachsen, und weder du noch sie wird vergessen, was geschehen ist.« Darauf steckte er dem Postmeister etwas in den Ärmel, öffnete die Tür, und ehe er sich's versah, stand der Postmeister plötzlich wieder auf der Straße. Lange stand er da. Endlich bemerkte er unter seinem Ärmelaufschlag eine Papierrolle. Er nahm sie heraus und entfaltete einige Rubelscheine. Aus seinen Augen rannen wieder Tränen, es waren Tränen der Entrüstung. Er knüllte die Papiere zusammen, warf sie zur Erde, trat sie mit den Stiefeln und ging davon. Nach wenigen Schritten aber besann er sich wieder und kehrte um. Allein die Geldscheine waren schon weg. Nur noch einmal wollte er seine arme Dunja sehen, bevor er wieder zu seiner Station fand. Darum ging er zwei Tage später wieder zu Minsky. Allein der Bedienstete sagte, sein Herr empfange niemanden, stieß ihn zum Hause hinaus und schlug ihm die Tür vor der Nase zu.
Am selben Abend ging er zur Kirche und ließ ein Te Deum singen. Plötzlich jagte eine elegante Droschke an ihm vorüber, und er erkannte Minsky. Vor einem großen Hause wurde gehalten. Der Husar eilte die Treppe hinauf. Da kam dem Postmeister ein glücklicher Gedanke. Er kehrte um, stellte sich zum Kutscher und fragte ihn: »Wem gehört das Pferd, Bruder? Dem Minsky, nicht wahr?« – »Ja, freilich«, antwortete der Kutscher, »aber was geht es dich an?« – »Das geht mich wohl an, dein Herr hat mir aufgetragen, seiner Dunja ein Briefchen zu bringen, und ich habe vergessen, wo sie wohnt.« – »Hier in der zweiten Etage. Du hast dich aber verspätet, Bruder, er ist jetzt selbst bei ihr.« – »Das schadet nichts«, antwortete der Postmeister ängstlich. »Ich danke dir, daß du mich auf den rechten Weg gebracht hast, ich werde meinen Auftrag schon besorgen.« Und so stieg er die Treppe hinauf. Die Tür war verschlossen. Er klingelte; einige Sekunden vergingen in peinlicher Erwartung. Da knarrte der Schlüssel, die Tür öffnete sich. »Wohnt denn Awodotja Samsonowa hier?« fragte er. »Ja«, antwortete ein junges Mädchen, »was willst du aber von ihr?« Ohne zu antworten, betrat der Postmeister den Saal. »Du kannst nicht zu ihr, sie hat Gäste«, schrie das Dienstmädchen. Allein der Postmeister beachtete ihre Rede nicht und ging weiter. Die beiden ersten Zimmer waren dunkel und erst das dritte erleuchtet. Er trat der offenen Tür näher und blieb dann stehen. Im reich geschmückten Zimmer saß Minsky, in Gedanken versunken; Dunja aber, angetan mit aller Modepracht, saß auf der Armstütze des Lehnstuhls wie eine Reiterin auf englischem Sattel. Zärtlich blickte sie ihren Minsky an und wickelte seine schwarzen Locken um ihren Finger. O, der arme Postmeister! Noch nie war ihm seine Dunja so schön vorgekommen. Ohne es zu wollen, mußte er sie anstaunen. »Wer ist da?« fragte sie, ohne das Köpfchen zu heben. Der Vater schwieg. Weil sie keine Antwort erhielt, blickte sie auf und fiel mit einem Schrei auf den Teppich. Minsky sprang erschrocken empor, um sie aufzuheben. Doch als er den Postmeister gewahrte, stürzte er vor Wut zitternd auf diesen los. »Was schleichst du hinter mir her wie ein Räuber?« donnerte er ihn zähneknirschend an. »Willst du mich ermorden? Fort mit dir!« – Und mit nerviger Faust ergriff er den Greis und stieß ihn die Treppe hinab.
Der Alte kam in sein Quartier. Der Freund riet ihm, zu klagen. Allein das wollte er nicht. Zwei Tage später reiste er von Petersburg ab und versah seinen Posten auf der Station wie vorher. »Es ist jetzt schon das dritte Jahr« – schloß er –, »daß ich ohne Dunja lebe, und man hört und sieht nichts von ihr. Gott mag wissen, ob sie noch lebt oder tot ist. Das ist nichts Neues. Sie ist nicht die erste und nicht die letzte, die ein durchreisender Lump verführte und dann verließ. In Petersburg gibt es ja viele solcher Törinnen; heute in Samt und Seide, und morgen kehren sie die Straßen in tiefster Armut. Wenn ich bisweilen daran denke, daß auch meiner Dunja ein solches Los zugefallen ist, dann wünsche ich mir freilich lieber den Tod, wenn dieser Wunsch auch eine Sünde ist!«
Das war die Geschichte meines Freundes, eine Geschichte, die mehr als einmal durch Tränen unterbrochen wurde, die er mit dem Rockzipfel abtrocknete. Wenn auch diese Tränen zum Teil durch den Punsch entstanden waren – denn er hatte fünf Gläser getrunken –, so rührten sie doch stark mein Herz, und nach der Trennung konnte ich den armen Postmeister gar lange nicht vergessen, und lange Zeit dachte ich an Dunja.
Erst neulich, als ich wieder durch das Dorf fuhr, erinnerte ich mich seiner. Ich erfuhr, daß jene Station nicht mehr existierte. Auf meine Frage, ob der alte Postmeister noch am Leben sei, konnte mir niemand Antwort geben. So beschloß ich, die bekannte Gegend zu besuchen. Ich nahm die Pferde und fuhr nach dem Dorf.
Es war im Herbst. Graue Wolken bedeckten den Himmel, ein kalter Wind wehte über die kahlen Felder und blies rote und gelbe Blätter von den Bäumen. Die Sonne ging gerade unter, als ich ins Dorf kam. Am Posthaus machte ich halt. Eine beleibte Frau erschien im Flur, wo Dunja mich einst küßte, und auf meine Frage nach dem alten Postmeister entgegnete sie, er sei schon ein Jahr tot. In seinem Hause aber habe sich ein Bierbrauer angesiedelt und sie sei dessen Frau. Die vergebliche Fahrt für sieben Rubel reute mich. »Woran ist er gestorben?« fragte ich die Frau. »Er hat sich zu Tode getrunken«, war die Antwort. »Wo liegt er begraben?« – »Hinter dem Zaun neben seiner Hausfrau.« – »Kann mich jemand an sein Grab führen?« – »Warum nicht! He, Johann! Hör' doch auf, dich mit der Katze herumzuschleppen. Führe den Herrn da zum Kirchhof und zeig' ihm das Grab des Postmeisters.«
Bei diesen Worten kam ein zerlumpter rothaariger Junge herbei und führte mich zum Friedhof.
»Hast du den Verstorbenen gekannt?« fragte ich ihn auf dem Wege.
»Warum sollte ich ihn nicht gekannt haben? Er hat mir ja gezeigt, wie man Pfeifen schneidet. Gott gebe ihm Frieden! Wenn er aus der Schenke kam, liefen wir hinter ihm her und schrien: ›Großväterchen, Großväterchen, Nüsse?‹ Und er teilte sie unter uns. Immer spielte er mit uns.«
»Denken denn die Reisenden noch an ihn?«
»Jetzt kommen nur wenige hier vorbei. Bisweilen fährt ein Gerichtsassessor hierher, aber der kümmert sich nicht um die Toten. Diesen Sommer kam eine Dame vorüber, sie erkundigte sich nach ihm und besuchte sein Grab.«
»Wer war die Dame?« fragte ich neugierig.
»Eine schöne Dame«, antwortete der Junge, »sie fuhr in einem Wagen mit sechs Pferden, hatte drei kleine Herrchen bei sich, eine Amme und einen schwarzen Hund, und als man ihr sagte, daß der alte Postmeister gestorben sei, weinte sie und sprach zu den Kindern: ›Bleibt ruhig, ich will auf den Kirchhof gehen.‹ Ich bot mich zum Führer an. Aber sie sagte: ›Ich kenne den Weg schon‹, und gab mir fünf Silber-Kopeken. Die gute Dame!«
Wir langten auf dem Kirchhof an; es war ein öder Platz mit hölzernen Kreuzen. In meinem ganzen Leben hatte ich nie einen so traurigen Kirchhof gesehen.
»Hier ist sein Grab!« sagte der Junge und sprang auf einen Sandhügel, in dem ein schwarzes Kreuz mit einem eisernen Heiligenbild eingegraben war.
»Und die Dame war auch hier?« fragte ich.
»Ja«, sagte Johann. »Ich betrachtete sie aus der Ferne. Sie hat sich hier niedergeworfen und blieb eine lange Zeit liegen. Dann ging sie ins Dorf zurück, rief den Priester, gab ihm Geld und mir fünf Silber-Kopeken. Eine nette Dame!«
Auch ich gab dem Jungen fünf Kopeken, und die Fahrt reute mich nun nicht mehr, auch nicht die sieben Rubel, die sie gekostet hatte.