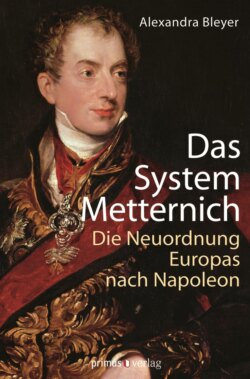Читать книгу Das System Metternich - Alexandra Bleyer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vorwort
ОглавлениеNach dem Sieg über Napoleon brach in Europa das Zeitalter der Restauration an. Beginnend mit dem Wiener Kongress versuchten die Großmächte gemeinsam als europäisches Konzert den Frieden zu sichern. Doch die neue Ordnung war bedroht. Gefährlicher als russische Expansionsgelüste, liberale Eskapaden des Zaren und die britische „No Intervention“-Politik waren Revolutionen. In der napoleonischen Ära waren die Völker auf den Geschmack politischer Freiheit gekommen; so mancher Fürst hatte nationale und liberale Töne angeschlagen.
„Geschwätz von gestern.“ Wie Goethes Zauberlehrling wollten die konservativen Eliten die gerufenen Geister wieder loswerden. Im Kampf zwischen alten und neuen Kräften übernahm Clemens Lothar Wenzel Fürst von Metternich die Rolle des Hexenmeisters. Der in Koblenz geborene Adelige hatte nach dem Besuch der berühmten Straßburger Diplomatenschule seine Karriere im Dienst des römisch-deutschen Kaisers Franz II. begonnen; nach dem Untergang des Heiligen Römischen Reichs diente er demselben Mann, der nun als Franz I. Kaiser von Österreich war. Die Urteile über Metternich reichen von Verdammung bis zu Verherrlichung. Unbestreitbar war er einer der größten Diplomaten seiner Zeit und bestimmte von seiner Ernennung zum Außenminister 1809 bis zu seinem Sturz 1848 die Außenpolitik Österreichs. „Mein Ehrgeiz ist, das gut zu machen, was ich tue, und das Böse überall da zu bekämpfen, wo ich es vorfinde“1, sagte Metternich über sich. Er setzte in Österreich wie auch im Deutschen Bund ein System der Überwachung und Verfolgung in Gang, das seinen Namen tragen sollte.
Unterstützt wurde er dabei von Friedrich Gentz. Der wortgewaltige Preuße entstammte dem Bildungsbürgertum und trat nach einem abgebrochenen Studium der Rechte 1785 in den preußischen Staatsdienst ein. Seine Beamtenlaufbahn befriedigte ihn wenig, er fühlte sich zu Höherem berufen. Als politischer Publizist und erklärter Gegner der Revolution und Napoleons versuchte er, die Eliten von seinen Ansichten zu überzeugen, und fand endlich das Ansehen, nach dem er strebte. Doch Preußen hatte sich 1795 für die Neutralität entschieden, Gentz geriet zunehmend in Widerspruch zum außenpolitischen Kurs der Regierung und stellte mit seinen Schriften deren Autorität in Frage. Ein letztes Mal gewährte Friedrich Wilhelm III. Gentz einen Urlaub, wies aber dessen Vorgesetzten klar an: „Nach Ablauf dieses Urlaubs müsst Ihr mit Ernst darauf halten, dass der Gentz seinen Dienstpflichten überall ein Genüge leiste.“2
Eheprobleme, steigende (Spiel-)Schulden und die Aussicht, an den verhassten Kanzleischreibtisch zurückkehren zu müssen: Gentz hielt nichts mehr in Berlin; 1802 gelang ihm der Wechsel in den österreichischen Staatsdienst. Mit dem Titel eines Kaiserlichen Rats und einem jährlichen Einkommen ausgestattet, aber ohne Einbindung in den Behördenapparat, sollte er weiter bei Bedarf „für die gute Sache“3 schreiben. Ansonsten wusste man aber auch in Wien wenig mit ihm anzufangen. Eine politisch verantwortliche Funktion erhielt er nie. Erst als Gentz 1810 Metternichs unpopulärem außenpolitischen Kurs zustimmte und die Heirat Napoleons mit der Kaisertochter Marie Luise als notwendig beurteilte, gewann er das Vertrauen des Außenministers und wurde von ihm zunehmend zu Beratungen herangezogen. Damit begann seine bedeutende Zeit.
Die beiden Rationalisten teilten politische Grundanschauungen, die im Ancien Régime wurzelten, und befürworteten ein Europa des Gleichgewichts; revolutionären Ideen und dem Konzept der Volkssouveränität standen sie kritisch gegenüber. Ungeklärt bleibt im Hinblick auf ihre Arbeitsgemeinschaft, ob der ältere Publizist den Staatsmann mit seinen Ideen beeinflusste oder Gentz „am Gängelband Metternichs“4hing. Die Beziehung war jedoch asymmetrisch: Metternich war der Vorgesetzte, und Gentz blieb „Werkzeug“.5
Zudem verband sie aufgrund ihrer Persönlichkeiten ein kompliziertes Verhältnis; beide waren eitel und von ihrer geistigen Überlegenheit (auch dem anderen gegenüber) überzeugt. „Er [Gentz] ist wie alle Gelehrte – unpraktisch. Sie müssen ihn stets leiten und ihm unverhohlen den Punkt unterschieben, welchen er verfolgen soll“6, wies Metternich beim Wiener Kongress seinen Stellvertreter Hudelist an. Gentz wiederum zweifelte manchmal an Metternichs politischem Weitblick, attestierte ihm teils durch amouröse Abenteuer geförderte Zerstreutheit und Charakterschwäche und vertrat öfters die Meinung, er selbst sei sehr viel fleißiger als der Staatskanzler.
Gentz blieb in Wien höchst umstritten. Kaiser Franz mochte ihn nicht. Wie viele Zeitgenossen hielt er den Publizisten für frivol, leichtfertig und verschwenderisch. Heinrich Friedrich Karl Freiherr vom und zum Stein nannte Gentz gar einen „Mensch von vertrocknetem Gehirn und verfaultem Charakter“7, wie Wilhelm von Humboldt überlieferte. Besonders anrüchig schien, dass er sich – vergleichbar mit Lobbyisten heutiger Zeit – seine scharfen Stellungnahmen gegen das revolutionäre und napoleonische Frankreich von England bezahlen ließ; seit 1812 korrespondierte er mit Metternichs Einverständnis mit dem Fürsten (Hospodar betitelt) der Walachei und informierte die Osmanische Regierung (Hohe Pforte) gegen gutes Geld über die Angelegenheiten Europas. Nicht nur die Gräfin Fuchs-Gallenberg war der Meinung: „Der Kerl verräth noch die ganze Monarchie“, denn wer „seine Feder verkauft, verkauft auch sich“.8
Metternich und Gentz polarisierten. Die einen priesen ihren politischen Weitblick und den Erfolg, in Europa für mehrere Jahrzehnte den Frieden gesichert zu haben. In den revolutionären Stürmen zeigten sich viele Staatsmänner dankbar, dass Metternich die Zügel in die Hand nahm. Wenn er der „Kutscher Europas“ war, dann saß Gentz zwei Jahrzehnte lang mit der Straßenkarte in der Hand neben ihm, um an jeder Kreuzung über den richtigen Weg zu debattieren. Die anderen, vor allem liberal und national Gesinnte, sahen in den beiden wohl eher ein „Duo infernale“.
Geschichte kann nicht auf einzelne Persönlichkeiten, auf „große Männer“, reduziert werden – der österreichische Staatskanzler war keinesfalls so allmächtig, wie seine erbitterten Gegner befürchteten oder er selbst manchmal in maßloser Selbstüberschätzung annahm. Die Konzentration der Erzählung auf Metternich und Gentz soll nicht den Eindruck erwecken, dass die beiden tatsächlich das Schicksal ganz Europas in der Hand hielten und alle anderen Staatsmänner nach ihrer Pfeife tanzen ließen; ebenso wenig soll ihr politisches Handeln beurteilt oder glorifiziert werden. Das Ziel dieser Schwerpunktsetzung besteht darin, einen lebensnahen Einblick in die Gedankenwelt und Motive jener konservativen Kräfte zu gewähren, die sich in einer Epoche des teils revolutionären Übergangs vom Ancien Régime in das bürgerliche 19. Jahrhundert gegen liberale und nationale Bewegungen stemmten.
In der neueren Forschung wird aber vor allem auf die friedenssichernde Funktion der Kongressära hingewiesen. 1814 wurde in Wien der Grundstein für ein neues politisches System gelegt, das der internationalen Diplomatie und gemeinschaftlichen Krisenbewältigung einen größeren Stellenwert einräumte. Unter dem erschreckenden Eindruck von mehr als zwanzig Jahren Krieg wollte man wie nach dem Ersten Weltkrieg mit dem Völkerbund oder nach dem Zweiten Weltkrieg mit dem UN-Sicherheitsrat ein Mittel finden, um Krieg nicht länger als „Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ (Carl von Clausewitz) zu gebrauchen.
Dabei bargen zwischenstaatliche Konflikte und Revolutionen, die einzelne Staaten erschütterten, das Potential für einen erneuten Krieg der Großmächte in sich. Wie heute standen schon damals die führenden Politiker vor dem Dilemma, die (noch sehr vage) Idee eines gemeinsamen Europas mit nationalstaatlichen Interessen in Einklang zu bringen. Erfolg und Scheitern der diplomatischen Bemühungen hingen auch vom Wollen, der Persönlichkeit und den Fähigkeiten der beteiligten Staatsmänner ab.
Hundert Jahre später taumelte Europa in den Ersten Weltkrieg; politische Krisen der Gegenwart bergen erschreckenden Sprengstoff in sich.
1814 – 1914 – 2014. Friede ist eben nicht selbstverständlich.