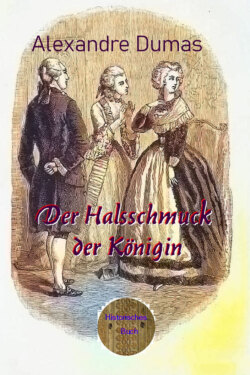Читать книгу Der Halsschmuck der Königin - Alexandre Dumas, Alexandre Dumas, The griffin classics - Страница 4
Prolog: Die Vorhersagen.
ОглавлениеI.- Ein alter Adeliger und eine alter Maître-d'Hôtel.
Es war Anfang April 1784, zwischen zwölf und ein Uhr. Unser alter Bekannter, der Marschall de Richelieu, hatte sich mit eigenen Händen die Augenbrauen mit einer parfümierten Farbe gefärbt, schob den Spiegel weg, den ihm sein Kammerdiener, der Nachfolger seines treuen Raffè, vorhielt, und schüttelte den Kopf in der ihm eigenen Weise: "Ah! ", sagte er, "jetzt sehe ich selbst aus", und erhob sich mit jugendlicher Lebhaftigkeit von seinem Sitz, begann den Puder abzuschütteln, der von seiner Perücke über seinen blauen Samtmantel gefallen war, und rief dann, nachdem er ein oder zwei Runden in seinem Zimmer auf und ab gegangen war, nach seinem Maître-d'hôtel.
In fünf Minuten erschien dieser, kunstvoll gekleidet.
Der Marschall wandte sich ihm zu und sagte mit einem dem Anlass angemessenen Ernst: "Sir, ich nehme an, Sie haben mir ein gutes Abendessen zubereitet?"
"Gewiss, Euer Gnaden."
"Sie haben die Liste meiner Gäste?"
"Ich erinnere mich genau an sie, Euer Gnaden; ich habe ein Dinner für neun Personen vorbereitet."
"Es gibt zwei Arten von Abendessen, Sir", sagte der Marschall.
"Stimmt, Euer Gnaden, aber..."
Der Marschall unterbrach ihn mit einer leicht ungeduldigen, aber immer noch würdevollen Bewegung.
"Wissen Sie, Sir, wann immer ich das Wort 'aber' gehört habe, und ich habe es im Laufe von achtundachtzig Jahren viele Male gehört, war es jedes Mal, so leid es mir tut, der Vorbote einer Torheit."
"Euer Gnaden..."
"Erstens, zu welcher Zeit speisen wir?"
"Euer Gnaden, die Bürger dinieren um zwei, die Bar um drei, der Adel um vier..."
"Und ich, Sir?"
"Euer Gnaden werden heute um fünf Uhr dinieren."
"Oh, um fünf!"
"Ja, Euer Gnaden, wie der König--"
"Und warum wie der König?"
"Weil auf der Liste Ihrer Gäste der Name eines Königs steht."
"Nicht so, Sir, Sie irren sich; alle meine Gäste heute sind einfach Adelige."
"Euer Gnaden scherzt sicher; der Graf Haga1, der unter den Gästen ist -"
"Nun, Sir!"
"Der Graf Haga ist ein König."
"Ich kenne keinen so genannten König."
"Euer Gnaden müssen mich also entschuldigen", sagte der Maître-d'hôtel und verbeugte sich, "aber ich glaubte, nahm an..."
"Ihre Aufgabe, Sir, ist weder zu glauben noch zu vermuten; Ihre Aufgabe ist es, die Befehle, die ich Ihnen gebe, kommentarlos zu lesen. Wenn ich will, dass eine Sache bekannt wird, sage ich sie; wenn ich sie nicht sage, wünsche ich, dass sie unbekannt bleibt."
Der Maître-d'hôtel verbeugte sich erneut, vielleicht respektvoller, als er es gegenüber einem regierenden Monarchen getan hätte.
"Deshalb, Sir", fuhr der alte Marschall fort, "werden Sie, da ich nur Adlige zum Abendessen habe, uns zu meiner üblichen Stunde, um vier Uhr, speisen lassen."
Bei diesem Befehl verdüsterte sich die Miene des Maître-d'hôtel, als ob er sein Todesurteil gehört hätte; er wurde totenbleich; dann, als er sich wieder erholte, sagte er mit dem Mut der Verzweiflung: "Auf jeden Fall können Euer Gnaden nicht vor fünf Uhr dinieren."
"Warum denn, Sir?" rief der Marschall.
"Weil es ganz und gar unmöglich ist."
"Sir", sagte der Marschall mit hochmütiger Miene, "es ist jetzt, glaube ich, zwanzig Jahre her, dass Sie in meinen Dienst getreten sind?"
"Einundzwanzig Jahre, einen Monat und zwei Wochen."
"Nun, Sir, zu diesen einundzwanzig Jahren, einem Monat und zwei Wochen werden Sie weder einen Tag noch eine Stunde hinzufügen. Sie verstehen mich, mein Herr", fuhr er fort, indem er sich auf die dünnen Lippen biss und die Augenbrauen zusammenzog; "heute Abend suchen Sie einen neuen Herrn. Ich wähle nicht, dass das Wort unmöglich in meinem Hause ausgesprochen wird; ich bin jetzt zu alt, um seine Bedeutung zu lernen."
Der Maître-d'Hôtel verbeugte sich ein drittes Mal.
"Heute Abend", sagte er, "werde ich mich von Euer Gnaden verabschieden, aber wenigstens bis zum letzten Augenblick wird meine Pflicht so erfüllt worden sein, wie sie sein sollte", und er machte zwei Schritte zur Tür.
"Was nennen Sie, wie es sein sollte?" rief der Marschall. "Lernen Sie, Sir, dass es so zu tun, wie es mir passt, heißt, es so zu tun, wie es sein sollte. Nun, ich möchte um vier Uhr zu Abend essen, und es passt mir nicht, wenn ich um vier Uhr zu Abend essen möchte, bis fünf Uhr warten zu müssen."
"Euer Gnaden", erwiderte der Maître-d'Hôtel mit ernster Miene, "ich habe als Butler seiner Hoheit des Prinzen von Soubise und als Haushofmeister seiner Eminenz des Kardinals von Rohan gedient. Mit dem ersten speiste seine Majestät, der verstorbene König von Frankreich, einmal im Jahr, mit dem zweiten der Kaiser von Österreich einmal im Monat. Ich weiß also, wie ein Souverän behandelt werden sollte. Als er den Prinzen de Soubise besuchte, nannte sich Ludwig XV. vergeblich Baron de Gonesse; im Hause des M. de Rohan wurde der Kaiser Joseph als Graf de Packenstein angekündigt; aber er war nichtsdestoweniger Kaiser. Heute empfangen Euer Gnaden auch einen Gast, der sich vergeblich Graf Haga nennt - Graf Haga ist noch König von Schweden. Ich werde heute Abend Ihren Dienst verlassen, aber Graf Haga wird wie ein König behandelt worden sein."
"Aber das", sagte der Marschall, "ist genau das, was ich mir zu Tode mühe, zu verbieten; Graf Haga will sein Inkognito so streng wie möglich wahren. Ich durchschaue wohl Ihre absurde Eitelkeit; nicht die Krone, sondern sich selbst wollen Sie verherrlichen; ich wiederhole, dass ich nicht wünsche, dass man sich einbildet, ich hätte einen König hier."
"Wofür hält mich denn Euer Gnaden? Es ist nicht so, dass ich wünsche, dass man weiß, dass hier ein König ist."
"Dann seid um Himmels willen nicht starrköpfig, sondern lasst uns um vier Uhr zu Abend essen."
"Aber um vier Uhr, Euer Gnaden, wird das, was ich erwarte, noch nicht eingetroffen sein."
"Was erwartet Ihr? Einen Fisch, wie M. Vatel?"
"Wünscht Euer Gnaden, dass ich es Euch sage?"
"Bei meinem Glauben, ich bin neugierig."
"Dann, Euer Gnaden, erwarte ich eine Flasche Wein."
"Eine Flasche Wein! Erklären Sie sich, Sir, die Sache beginnt mich zu interessieren."
"Hört denn, Euer Gnaden; Seine Majestät der König von Schweden - ich bitte um Verzeihung, der Graf Haga hätte ich sagen sollen - trinkt nichts als Tokajer."
"Nun, bin ich so arm, dass ich keinen Kognak in meinem Keller habe? Wenn ja, muss ich meinen Butler entlassen."
"Nicht so, Euer Gnaden; im Gegenteil, Sie haben etwa sechzig Flaschen."
"Nun, glauben Sie, dass Graf Haga sechzig Flaschen zu seinem Abendessen trinken wird?"
"Nein, Euer Gnaden; aber als Graf Haga das erste Mal Frankreich besuchte, als er noch Prinz war, speiste er mit dem verstorbenen König, der zwölf Flaschen Tokajer vom Kaiser von Österreich erhalten hatte. Sie wissen, dass der Tokajer der besten Jahrgänge ausschließlich für den Keller des Kaisers reserviert ist, und dass die Könige selbst ihn nur trinken können, wenn er ihn ihnen zukommen lässt."
"Ich weiß es."
"Dann, Euer Gnaden, sind von diesen zwölf Flaschen, von denen der königliche Prinz getrunken hat, nur noch zwei übrig. Eine ist im Keller seiner Majestät Ludwig XVI..."
"Und die andere?"
"Ah, Euer Gnaden!" sagte der Maître-d'Hôtel mit einem triumphierenden Lächeln, denn er fühlte, dass nach dem langen Kampf, den er geführt hatte, der Augenblick des Sieges nahe war, "die andere wurde gestohlen."
"Von wem denn?"
"Von einem meiner Freunde, dem Butler des verstorbenen Königs, der mir gegenüber sehr verpflichtet war."
"Oh! Und so gab er es Ihnen."
"Gewiss, Euer Gnaden", sagte der Maître-d'Hôtel mit Stolz.
"Und was haben Sie damit gemacht?"
"Ich habe es sorgfältig in den Keller meines Herrn gebracht."
"Deines Herrn! Und wer war Ihr Herr zu dieser Zeit?"
"Seine Eminenz, der Kardinal de Rohan."
"Ah, mon Dieu! In Straßburg?"
"In Saverne."
"Und Ihr habt geschickt, um diese Flasche für mich zu suchen!" rief der alte Marschall.
"Für Sie, Euer Gnaden", antwortete der Maître-d'Kôtel in einem Ton, der deutlich sagte: "undankbar, wie Sie sind."
Der Herzog de Richelieu ergriff die Hand des alten Dieners und rief: "Ich bitte um Verzeihung; Sie sind der König der maîtres d'Hôtel."
"Und Sie hätten mich entlassen", erwiderte er mit einem unbeschreiblichen Achselzucken.
"Oh, ich werde Ihnen hundert Pistolen für diese Flasche Wein bezahlen."
"Und die Kosten für den Transport hierher betragen weitere hundert; aber Sie werden mir zugestehen, dass er es wert ist."
"Ich gewähre Ihnen alles, was Sie wünschen, und für den Anfang verdopple ich von heute an Ihr Gehalt."
"Ich suche keine Belohnung, Euer Gnaden; ich habe nur meine Pflicht getan."
"Und wann wird Ihr Kurier eintreffen?"
"Euer Gnaden mögen beurteilen, ob ich Zeit verloren habe: an welchem Tag hatte ich meine Bestellungen für das Essen?"
"Nun, vor drei Tagen, glaube ich."
"Ein Kurier braucht bei größter Eile vierundzwanzig Stunden für den Hinweg und ebenso lange für den Rückweg."
"Es bleiben noch vierundzwanzig Stunden", sagte der Marschall; "wie wurden sie genutzt?"
"Ach, Euer Gnaden, sie waren verloren. Die Idee kam mir erst an dem Tag, nachdem ich die Liste Ihrer Gäste erhalten hatte. Berechnen Sie nun die Zeit, die für die Verhandlung nötig ist, und Sie werden sehen, dass ich mit der Bitte, bis fünf Uhr zu warten, nur das tue, was ich unbedingt tun muss."
"Die Flasche ist also noch nicht da?"
"Nein, Euer Gnaden."
"Ach, mein Herr, wenn Ihr Kollege in Saverne dem Prinzen von Rohan so zugetan wäre wie Sie mir, und die Flasche ablehnen würde, wie Sie es an seiner Stelle tun würden -"
"Ich? Euer Gnaden..."
"Ja; Sie hätten wohl kaum eine solche Flasche weggegeben, wenn sie mir gehört hätte?"
"Ich bitte untertänigst um Verzeihung, Euer Gnaden; aber hätte ein Freund, der einen König zu versorgen hat, mich um Ihre beste Flasche Wein gebeten, so hätte er sie sofort bekommen."
"Oh!", sagte der Marschall mit einer Grimasse.
"Nur wenn wir anderen helfen, können wir Hilfe in unserer eigenen Not erwarten, Euer Gnaden."
"Nun, dann können wir wohl damit rechnen, dass sie gegeben wird, aber es gibt noch ein anderes Risiko - wenn die Flasche zerbrochen wird?"
"Oh! Euer Gnaden, wer würde eine Flasche Wein von diesem Wert zerbrechen?"
"Nun, ich glaube nicht; wann erwarten Sie denn Ihren Kurier?"
"Um genau vier Uhr."
"Warum dann nicht um vier Uhr zu Abend essen?", antwortete der Marschall.
"Euer Gnaden, der Wein muss eine Stunde ruhen; und wäre es nicht eine Erfindung von mir gewesen, so hätte er drei Tage gebraucht, um sich zu erholen."
In allen Punkten geschlagen, gab der Marschall nach.
"Außerdem", fuhr der alte Diener fort, "seien Sie sicher, Euer Gnaden, dass Ihre Gäste nicht vor halb fünf eintreffen werden."
"Und warum nicht?"
"Bedenken Sie, Euer Gnaden: um mit M. de Launay zu beginnen; er kommt von der Bastille, und bei dem Eis, das zurzeit die Straßen von Paris bedeckt -"
"Nein; aber er wird nach dem Essen der Gefangenen um 12 Uhr abreisen."
"Verzeiht mir, Euer Gnaden, aber die Abendessenszeit auf der Bastille wurde geändert, seit Euer Gnaden dort waren; sie ist jetzt eins."
"Sir, Sie sind in allen Punkten gelehrt; bitte fahren Sie fort."
"Madame Dubarry stammt von den Luciennes ab, eine fortgesetzte Abstammung, und das bei diesem Frost."
"Das würde sie nicht daran hindern, pünktlich zu sein, da sie nicht mehr der Liebling eines Herzogs ist; sie spielt nur die Königin unter den Baronen; aber lassen Sie mich Ihnen sagen, mein Herr, dass ich früh zu Abend zu essen wünsche wegen M. de la Pérouse, der heute Abend abreist, und nicht zu spät kommen möchte."
"Aber, Euer Gnaden, M. de la Pérouse ist beim König und bespricht Geographie und Kosmographie; er wird nicht zu früh abreisen."
"Das ist möglich."
"Das ist sicher, Euer Gnaden, und so wird es auch mit M. de Favras sein, der beim Grafen von Provence ist und zweifellos über das neue Stück des Kanoniers de Beaumarchais spricht."
"Sie meinen die 'Hochzeit des Figaro'?"
"Ja, Euer Gnaden."
"Nun, Sie sind auch ziemlich literarisch, wie es scheint."
"In meinen freien Momenten lese ich, Euer Gnaden."
"Wir haben jedoch M. de Condorcet, der als Geometer zumindest pünktlich sein sollte."
"Ja; aber er wird in irgendeine Berechnung vertieft sein, von der er, wenn er sich erhebt, wahrscheinlich mindestens eine halbe Stunde zu spät kommt. Was den Grafen Cagliostro betrifft, so wird er, da er ein Fremder ist und die Gepflogenheiten von Versailles nicht gut kennt, uns aller Wahrscheinlichkeit nach auf ihn warten lassen."
"Nun", sagte der Marschall, "Sie haben alle meine Gäste, außer M. de Taverney, auf eine Weise abgefertigt, die Homer oder meinem armen Raffè würdig ist."
Der Maître-d'Hôtel verbeugte sich. "Ich habe", sagte er, "M. de Taverney nicht genannt, denn da er ein alter Freund ist, wird er wahrscheinlich pünktlich sein."
"Gut; und wo dinieren wir?"
"Im großen Speisesaal, Euer Gnaden."
"Aber wir werden dort frieren."
"Es ist seit drei Tagen geheizt, Euer Gnaden, und ich glaube, Sie werden es sehr angenehm finden."
"Sehr gut; aber da schlägt eine Uhr! Es ist doch schon halb fünf!", rief der Marschall.
"Ja, Euer Gnaden; und da ist der Kurier, der mit meiner Flasche Tokajer den Hof betritt."
"Möge ich noch zwanzig Jahre auf diese Weise bedient werden", sagte der Marschall und wandte sich wieder seinem Spiegel zu, während der Maître-d'Hôtel die Treppe hinunterlief.
"Zwanzig Jahre!" sagte eine lachende Stimme und unterbrach den Marschall in seiner Selbstbetrachtung; "zwanzig Jahre, mein lieber Herzog! Ich wünsche sie Ihnen; aber dann werde ich sechzig sein - ich werde sehr alt sein."
"Sie, Gräfin!" rief der Marschall, "Sie sind meine erste Ankunft, und, mon Dieu! Sie sehen so jung und reizend aus wie immer."
"Herr Graf, ich bin erfroren."
"Dann kommen Sie ins Boudoir."
"Oh! Tête-à-tête, Herr Marschall?"
"Nicht so", antwortete eine etwas gebrochene Stimme.
"Ah! Taverney!" sagte der Marschall; und dann flüsterte er der Gräfin zu: "Die Pest soll ihn holen, weil er uns gestört hat!"
Madame Dubarry lachte, und sie gingen alle in das Nebenzimmer.
II.-M. De la Perouse.
Im selben Moment wurde der Marschall durch das Geräusch von Kutschen auf der Straße gewarnt, dass seine Gäste ankamen; und bald darauf saßen dank der Pünktlichkeit seines Maître-d'Hôtel neun Personen um den ovalen Tisch im Esszimmer. Neun Lakaien, leise wie Schatten, schnell ohne Hektik und aufmerksam ohne Aufdringlichkeit, glitten über den Teppich und gingen zwischen den Gästen hindurch, ohne jemals ihre Stühle zu berühren, die mit Pelzen umgeben waren, die um die Beine der Sitzenden gewickelt waren. Diese Felle verbreiteten zusammen mit der Wärme der Öfen und den Gerüchen des Weins und des Abendessens einen Grad von Behaglichkeit, der sich in der Fröhlichkeit der Gäste, die gerade ihre Suppe beendet hatten, manifestierte.
Kein Geräusch war von außen zu hören, und keines von innen, außer dem der Gäste selbst; denn die Teller wurden gewechselt und die Schüsseln mit vollkommener Ruhe umhergeschoben. Auch vom Maître d'Hôtel war kein Flüstern zu hören; er schien seine Anweisungen mit den Augen zu geben.
Die Gäste hatten daher das Gefühl, allein zu sein. Es schien ihnen, dass die so schweigsamen Diener auch taub sein mussten.
M. de Richelieu war der erste, der das Schweigen brach, indem er zu dem Gast zu seiner Rechten sagte: "Aber, Herr Graf, Sie trinken nichts."
Dies war an einen Mann von etwa achtunddreißig Jahren gerichtet, kurz, blond und mit hohen Schultern; sein Auge war ein klares Blau, manchmal hell, aber öfter mit einem nachdenklichen Ausdruck, und der Adel war unverkennbar auf seiner offenen und männlichen Stirn eingeprägt.
"Ich trinke nur Wasser, Herr Marschall", antwortete er.
"Außer bei Ludwig XV.", erwiderte der Marschall; "ich hatte die Ehre, mit Ihnen an seiner Tafel zu speisen, und Sie haben sich an jenem Tag herabgelassen, Wein zu trinken."
"Ah! Sie rufen eine angenehme Erinnerung wach, Herr Marschall; das war im Jahre 1771. Es war Tokajer, aus dem kaiserlichen Keller."
"Es war wie der, mit dem mein Maître-d'Hôtel jetzt die Ehre haben wird, Ihr Glas zu füllen", erwiderte Richelieu und verbeugte sich.
Graf Haga hob sein Glas und blickte hindurch. Der Wein funkelte im Licht wie flüssige Rubine. "Es ist wahr", sagte er; "Herr Marschall, ich danke Ihnen."
Diese Worte wurden so edel ausgesprochen, dass sich die Gäste wie aus einem gemeinsamen Impuls heraus erhoben und riefen
"Lang lebe der König!"
"Ja", sagte Graf Haga, "lang lebe seine Majestät, der König von Frankreich. Was sagen Sie, M. de la Pérouse?"
"Mein Herr", erwiderte der Hauptmann mit jenem Ton, der zugleich schmeichelhaft und respektvoll ist, wie man es von gekrönten Häuptern zu sagen pflegt, "ich habe soeben den König verlassen, und seine Majestät hat mir so viel Freundlichkeit erwiesen, dass niemand bereitwilliger 'Lang lebe der König' rufen wird als ich. Nur, da ich Euch in einer Stunde verlassen muss, um mich den beiden Schiffen anzuschließen, die seine Majestät mir zur Verfügung gestellt hat, werde ich mir, sobald ich dieses Haus verlassen habe, die Freiheit nehmen, zu sagen: 'Lang lebe ein anderer König, dem zu dienen ich stolz wäre, wenn ich nicht schon ein so guter Herr wäre.'"
"Diese Gesundheit, die Ihr vorschlagt", sagte Madame Dubarry, die zur linken Hand des Marschalls saß, "sind wir alle bereit zu trinken, aber der Älteste von uns sollte den Anfang machen."
"Sind Sie es, den das betrifft, oder ich, Taverney?" sagte der Marschall lachend.
"Ich glaube nicht", sagte ein anderer auf der gegenüberliegenden Seite, "dass M. de Richelieu der Älteste in unserer Gruppe ist."
"Dann sind Sie es, Taverney", sagte der Herzog.
"Nein, ich bin acht Jahre jünger als Sie! Ich bin 1704 geboren", erwiderte er.
"Wie unhöflich", sagte der Marschall, "meine achtundachtzig Jahre zu entblößen."
"Unmöglich, Herzog! Dass Sie achtundachtzig sind", sagte M. de Condorcet.
"Es ist aber nur zu wahr; es ist eine Berechnung, die leicht zu machen ist, und daher eines Algebraikers wie Sie, Marquis, unwürdig. Ich stamme aus dem letzten Jahrhundert - dem großen Jahrhundert, wie wir es nennen. Mein Datum ist 1696."
"Unmöglich!", rief de Launay.
"Oh, wenn Ihr Vater hier wäre, würde er nicht unmöglich sagen, er, der, als er Gouverneur der Bastille war, mich 1714 als Untermieter hatte."
"Der Älteste hier aber", sagte M. de Favras, "ist der Wein, den Graf Haga jetzt trinkt."
"Sie haben Recht, M. de Favras; dieser Wein ist hundertzwanzig Jahre alt; dem Wein gebührt also die Ehre -"
"Einen Augenblick, meine Herren", sagte Cagliostro und hob seine Augen, die vor Intelligenz und Lebhaftigkeit strahlten; "ich beanspruche den Vorrang."
"Sie beanspruchen den Vorrang vor dem Tokajer!" riefen alle Gäste im Chor aus.
"Gewiss", erwiderte Cagliostro ruhig, "denn ich habe ihn abgefüllt."
"Sie?"
"Ja, ich; am Tag des Sieges von Montecucully über die Türken im Jahre 1664."
Auf diese Worte, die Cagliostro mit vollkommenem Ernst ausgesprochen hatte, folgte ein Ausbruch von Gelächter.
"Nach dieser Rechnung wären Sie etwa hundertdreißig Jahre alt", sagte Madame Dubarry; "denn Sie müssen mindestens zehn Jahre alt gewesen sein, als Sie den Wein in Flaschen abgefüllt haben."
"Ich war mehr als zehn Jahre alt, als ich diese Operation durchführte, Madame, denn am folgenden Tag hatte ich die Ehre, von seiner Majestät, dem Kaiser von Österreich, entsandt zu werden, um Montecucully zu gratulieren, der durch den Sieg von St. Gothard den Tag bei Especk in Sclavonien gerächt hatte, an dem die Ungläubigen die Kaiserlichen, die 1536 meine Freunde und Waffengefährten waren, so grob behandelt hatten."
"Oh", sagte Graf Haga, so kalt wie Cagliostro selbst, "Sie müssen mindestens zehn Jahre alt gewesen sein, als Sie bei jener denkwürdigen Schlacht waren."
"Eine schreckliche Niederlage, Graf", erwiderte Cagliostro.
"Aber weniger schrecklich als Cressy", sagte Condorcet lächelnd.
"Gewiß, mein Herr, denn in der Schlacht von Cressy wurde nicht nur eine Armee, sondern ganz Frankreich geschlagen; aber diese Niederlage war kaum ein gerechter Sieg für die Engländer; denn König Eduard hatte Kanonen, ein Umstand, von dem Philipp de Valois nichts wusste, oder vielmehr, den er nicht glauben wollte, obwohl ich ihn warnte, dass ich mit eigenen Augen vier Geschütze gesehen hatte, die Eduard von den Venezianern gekauft hatte."
"Ah", sagte Madame Dubarry; "Sie kannten Philipp de Valois?"
"Madame, ich hatte die Ehre, einer der fünf Lords zu sein, die ihn vom Schlachtfeld eskortierten; ich kam mit dem armen alten König von Böhmen nach Frankreich, der blind war und sein Leben wegwarf, als er hörte, dass die Schlacht verloren war."
"Ach, mein Herr", sagte M. de la Pérouse, "wie sehr bedaure ich, dass es statt der Schlacht von Cressy nicht die von Actium war, bei der Sie assistierten."
"Warum denn, Sir?"
"Oh, weil Sie mir einige nautische Details hätten geben können, die mir trotz Plutarchs schöner Schilderung immer unverständlich geblieben sind."
"Welche, Sir? Es wäre mir eine Freude, Ihnen zu Diensten zu sein."
"Oh, Sie waren also auch dort?"
"Nein, Sir; ich war damals in Ägypten. Ich war von Königin Kleopatra beauftragt worden, die Bibliothek in Alexandria zu restaurieren - ein Amt, für das ich besser qualifiziert war als jeder andere, da ich die besten Autoren des Altertums persönlich kannte."
"Und Sie haben Königin Kleopatra gesehen?", fragte Madame Dubarry.
"So wie ich Sie jetzt sehe, Madame."
"War sie so schön, wie man sagt?"
"Madame, Sie wissen, Schönheit ist nur vergleichbar; eine charmante Königin in Ägypten, in Paris wäre sie nur eine hübsche Grisette gewesen."
"Sagen Sie nichts Schlechtes über Grisetten, Graf."
"Gott bewahre!"
"Dann war Kleopatra..."
"Klein, schlank, lebhaft und intelligent; mit großen mandelförmigen Augen, einer griechischen Nase, Zähnen wie Perlen und einer Hand wie die Ihrige, Gräfin - eine geeignete Hand, um ein Zepter zu halten. Sehen Sie, hier ist ein Diamant, den sie mir geschenkt hat, und den sie von ihrem Bruder Ptolemäus hatte; sie trug ihn am Daumen."
"An ihrem Daumen?", rief Madame Dubarry.
"Ja; es war eine ägyptische Mode; und ich, sehen Sie, ich kann ihn kaum auf meinen kleinen Finger stecken", und er nahm den Ring ab und reichte ihn Madame Dubarry.
Es war ein prächtiger Diamant, von so feinem Wasser und so schön geschliffen, dass er dreißigtausend oder vierzigtausend Franken wert war.
Der Diamant wurde um den Tisch herumgereicht und an Cagliostro zurückgegeben, der ihn ruhig wieder an seinen Finger steckte und sagte: "Ah, ich sehe gut, dass Sie alle ungläubig sind; mit diesem fatalen Unglauben habe ich mein ganzes Leben lang zu kämpfen gehabt. Philipp von Valois wollte nicht auf mich hören, als ich ihm sagte, er solle Edward einen Rückzugsort offen lassen; Kleopatra wollte mir nicht glauben, als ich sie warnte, Antonius würde geschlagen werden; die Trojaner wollten mir nicht glauben, als ich ihnen in Bezug auf das hölzerne Pferd sagte: 'Kassandra ist inspiriert; hört auf Kassandra.'"
"Oh! Es ist reizend", sagte Madame Dubarry, sich vor Lachen schüttelnd; "ich habe noch nie einen Mann getroffen, der gleichzeitig so ernst und so unterhaltsam ist."
"Ich versichere Ihnen", entgegnete Cagliostro, "dass Jonathan viel mehr war. Er war wirklich ein reizender Gefährte; bis er von Saul getötet wurde, hat er mich vor Lachen fast verrückt gemacht."
"Wissen Sie", sagte der Herzog von Richelieu, "wenn Sie so weitermachen, treiben Sie den armen Taverney in den Wahnsinn; er fürchtet sich so sehr vor dem Tod, dass er Sie mit allen Augen anstarrt und hofft, Sie seien ein Unsterblicher."
"Unsterblich kann ich nicht sagen, aber eines kann ich versichern -"
"Was?", rief Taverney, der der eifrigste Zuhörer war.
"Dass ich all die Menschen und Ereignisse gesehen habe, von denen ich Ihnen erzählt habe."
"Sie haben Montecucully gekannt?"
"So gut, wie ich Sie kenne, M. de Favras; und in der Tat viel besser, denn dies ist erst das zweite oder dritte Mal, dass ich die Ehre hatte, Sie zu sehen, während ich fast ein Jahr lang unter demselben Zelt mit dem lebte, von dem Sie sprechen."
"Sie kannten Philipp de Valois?"
"Wie ich bereits die Ehre hatte, Ihnen zu sagen, M. de Condorcet; aber als er nach Paris zurückkehrte, verließ ich Frankreich und kehrte nach Böhmen zurück."
"Und Kleopatra."
"Ja, Gräfin; Kleopatra, das kann ich Ihnen sagen, hatte Augen so schwarz wie die Ihren und Schultern fast so schön."
"Aber was wissen Sie schon von meinen Schultern?"
"Sie sind so, wie die von Kassandra einst waren; und es gibt noch eine weitere Ähnlichkeit - sie hatte wie Sie, oder besser gesagt, Sie haben wie sie, einen kleinen schwarzen Fleck auf Ihrer linken Seite, genau über der sechsten Rippe."
"Ach, Graf, jetzt sind Sie wirklich ein Zauberer."
"Nein, nein", rief der Marschall lachend, "ich habe es ihm gesagt."
"Und woher wisst Ihr das, bitte?"
Der Marschall biss sich auf die Lippen und antwortete: "Oh, es ist ein Familiengeheimnis."
"Also wirklich, Herr Marschall", sagte die Gräfin, "man sollte sich doppelt schminken, bevor man Sie besucht", und wandte sich wieder an Cagliostro, "dann, mein Herr, haben Sie die Kunst, Ihre Jugend zu erneuern? Denn obwohl Sie sagen, Sie seien drei- oder viertausend Jahre alt, sehen Sie kaum wie vierzig aus."
"Ja, Madame, ich besitze dieses Geheimnis."
"Oh, dann, Sir, teilen Sie es mir mit."
"An Sie, Madame? Es ist nutzlos; Ihre Jugend ist bereits erneuert; Ihr Alter ist nur das, was es zu sein scheint, und Sie sehen nicht wie dreißig aus."
"Ah! Sie schmeicheln."
"Nein, Madame, ich spreche nur die Wahrheit, aber das ist leicht erklärt: Sie haben meine Quittung schon versucht."
"Wie das?"
"Sie haben mein Elixier genommen."
"I?"
"Sie, Gräfin. Oh! Sie können es nicht vergessen haben. Erinnert Ihr Euch nicht an ein bestimmtes Haus in der Rue St. Claude und daran, dass Ihr dort in einer Angelegenheit von M. de Sartines wart? Erinnert Ihr Euch, dass Ihr einem meiner Freunde namens Joseph Balsamo einen Dienst erwiesen habt und dass dieser Joseph Balsamo Euch ein Fläschchen mit einem Elixier gab und Euch empfahl, jeden Morgen drei Tropfen einzunehmen? Erinnern Sie sich nicht, dass Sie dies regelmäßig getan haben bis zum letzten Jahr, als die Flasche leer war? Wenn Sie sich an all das nicht erinnern, Gräfin, ist das mehr als Vergesslichkeit - es ist Undankbarkeit."
"Oh! M. Cagliostro, Sie erzählen mir Dinge..."
"Die nur Ihnen selbst bekannt waren, das weiß ich; aber was würde es nützen, ein Zauberer zu sein, wenn man die Geheimnisse seines Nächsten nicht kennen würde?"
"Dann hat Joseph Balsamo, wie Sie, das Geheimnis dieses berühmten Elixiers?"
"Nein, Madame, aber er war einer meiner besten Freunde, und ich habe ihm drei oder vier Flaschen gegeben."
"Und hat er noch welche?"
"Oh! Davon weiß ich nichts; in den letzten zwei oder drei Jahren ist der arme Balsamo verschwunden. Das letzte Mal habe ich ihn in Amerika gesehen, an den Ufern des Ohio: er war auf dem Weg zu einer Expedition in die Rocky Mountains, und seither habe ich gehört, dass er tot ist."
"Kommt, kommt, Graf", rief der Marschall, "lasst uns das Geheimnis unbedingt erfahren."
"Meinen Sie das ernst, mein Herr?", fragte Graf Haga.
"Sehr ernst, Majestät, ich bitte um Verzeihung, ich meine, Graf", und Cagliostro verbeugte sich so, dass man erkennen konnte, daß sein Fehler ein freiwilliger war.
"Dann", sagte der Marschall, "ist Madame Dubarry nicht alt genug, um wieder jung gemacht zu werden?"
"Nein, auf mein Gewissen."
"Nun, dann werde ich Ihnen ein anderes Thema geben: hier ist mein Freund, M. Taverney - was sagen Sie zu ihm? Sieht er nicht aus wie ein Zeitgenosse von Pontius Pilatus? Aber vielleicht ist er, im Gegenteil, zu alt."
Cagliostro sah den Baron an. "Nein", sagte er.
"Ah! Mein lieber Graf", rief Richelieu; "wenn Sie seine Jugend erneuern, werde ich Sie zu einem wahren Schüler der Medea erklären."
"Sie wünschen es?" fragte Cagliostro den Wirt, und blickte zugleich auf alle Versammelten umher.
Alle riefen: "Ja."
"Und Sie auch, M. Taverney?"
"Ich mehr als jeder andere", sagte der Baron.
"Nun, das ist leicht", erwiderte Cagliostro, zog eine kleine Flasche aus seiner Tasche und goss etwas von der darin enthaltenen Flüssigkeit in ein Glas. Dann mischte er diese Tropfen mit einem halben Glas eisgekühlten Champagners und reichte es dem Baron.
Alle Augen folgten gespannt seinen Bewegungen.
Der Baron nahm das Glas, aber als er trinken wollte, zögerte er.
Alle begannen zu lachen, aber Cagliostro rief: "Trinken Sie, Baron, oder Sie werden einen Likör verlieren, von dem jeder Tropfen hundert Louis d'Ors wert ist."
"Zum Teufel", rief Richelieu; "das ist ja noch besser als Tokajer."
"Ich soll also trinken?" sagte der Baron, fast zitternd.
"Oder reichen Sie das Glas an einen anderen weiter, Sir, damit wenigstens einer davon profitiert."
"Reichen Sie es hierher", sagte Richelieu und hielt seine Hand hin.
Der Baron hob das Glas und, zweifellos durch den köstlichen Geruch und die schöne rosa Farbe, die diese wenigen Tropfen dem Champagner verliehen hatten, bewogen, nahm er einen Schluck des magischen Getränks. In einem Augenblick durchlief ihn eine Art Schauer; er schien zu fühlen, wie sein ganzes altes und träges Blut schnell durch seine Adern rauschte, vom Herzen bis zu den Füßen, seine faltige Haut schien sich auszudehnen, seine Augen, die halb von ihren Lidern bedeckt waren, schienen sich ohne seinen Willen zu öffnen, und die Pupillen wuchsen und wurden heller, das Zittern seiner Hände hörte auf, seine Stimme wurde kräftiger, und seine Glieder gewannen ihre frühere jugendliche Elastizität zurück. In der Tat schien es, als ob die Flüssigkeit in ihrem Abstieg seinen ganzen Körper regeneriert hätte.
Ein Schrei der Überraschung, des Erstaunens und der Bewunderung schallte durch den Raum.
Taverney, der langsam mit dem Zahnfleisch gegessen hatte, fing an, sich hungrig zu fühlen; er ergriff einen Teller und bediente sich ausgiebig an einem Ragout, dann zerlegte er ein Rebhuhn mitsamt Knochen und rief, dass seine Zähne zu ihm zurückkämen. Er aß, lachte und weinte vor Freude, eine halbe Stunde lang, während die anderen ihn verblüfft anstarrten; dann versagte er allmählich wieder, wie eine Lampe, deren Öl ausbrennt, und alle früheren Anzeichen des Alters kehrten zu ihm zurück.
"Oh", stöhnte er, "noch einmal adieu zu meiner Jugend", und er stieß einen tiefen Seufzer aus, während zwei Tränen über seine Wangen rollten.
Instinktiv wurde der Seufzer bei diesem traurigen Anblick des alten Mannes, der erst wieder jung gemacht wurde und dann durch den Kontrast noch älter zu werden schien als zuvor, rund um den Tisch widerhallt.
"Es ist leicht zu erklären, meine Herren", sagte Cagliostro; "ich gab dem Baron nur fünfunddreißig Tropfen des Elixiers. Er wurde also nur für fünfunddreißig Minuten jung."
"Oh, mehr, mehr, Graf!" rief der alte Mann eifrig.
"Nein, mein Herr, denn die zweite Probe würde Sie vielleicht umbringen."
Von allen Gästen schien Madame Dubarry, die bereits die Wirkung des Elixiers getestet hatte, am meisten interessiert zu sein, während sich die Jugend des alten Taverney auf diese Weise zu erneuern schien; sie hatte ihn mit Entzücken und Triumph beobachtet und sich halb eingebildet, bei diesem Anblick wieder jung zu werden, während sie sich kaum zurückhalten konnte, Cagliostro das wunderbare Fläschchen entreißen zu wollen; aber jetzt, da sie sah, wie er sein Alter noch schneller wiedererlangte, als er es verloren hatte, "Ach! " sagte sie traurig, "alles ist Eitelkeit und Betrug; die Wirkung dieses wunderbaren Geheimnisses dauert fünfunddreißig Minuten."
"Das heißt", sagte Graf Haga, "dass man, um zwei Jahre lang wieder jung zu werden, einen vollkommenen Fluss trinken müsste."
Alle lachten.
"Oh!" sagte De Condorcet, "die Rechnung ist einfach; ein bloßes Nichts von 3.153.000 Tropfen für ein Jahr Jugend."
"Eine Überschwemmung", sagte La Pérouse.
"Aber, Monsieur", fuhr Madame Dubarry fort; "nach Ihren Angaben habe ich nicht so viel gebraucht, denn eine kleine Flasche, etwa viermal so groß wie die, die Sie in der Hand halten, hat ausgereicht, um den Lauf der Zeit für zehn Jahre aufzuhalten."
"Genau so, Madame. Und Sie allein nähern sich dieser geheimnisvollen Wahrheit. Der Mann, der schon alt geworden ist, braucht diese große Menge, um eine sofortige und starke Wirkung zu erzielen; aber eine Frau von dreißig Jahren, wie Sie es waren, oder ein Mann von vierzig Jahren, wie ich es war, als ich anfing, dieses Elixier zu trinken, immer noch voller Leben und Jugend, braucht nur zehn Tropfen in jeder Periode des Verfalls; und mit diesen zehn Tropfen kann er sein Leben und seine Jugend an demselben Punkt ewig fortsetzen."
"Wie nennen Sie die Perioden des Verfalls?" fragte Graf Haga.
"Die natürlichen Perioden, Herr Graf. Im Naturzustand nimmt die Kraft des Menschen bis zum fünfunddreißigsten Lebensjahr zu. Dann bleibt sie stationär bis zum vierzigsten Lebensjahr; und von da an beginnt sie abzunehmen, aber fast unmerklich, bis zum fünfzigsten Lebensjahr; dann wird der Prozess immer schneller bis zum Tag seines Todes. In unserem Zivilisationszustand, wenn der Körper durch Überfluss, Sorgen und Krankheiten geschwächt ist, beginnt das Versagen mit fünfunddreißig. Die Zeit, die Natur zu nehmen, ist also, wenn sie stillsteht, um dem Beginn des Verfalls zuvorzukommen. Wer, wie ich, das Geheimnis dieses Elixiers besitzt und den glücklichen Augenblick zu nutzen weiß, wird so leben wie ich; immer jung, oder wenigstens immer jung genug für das, was er in der Welt zu tun hat."
"Oh, M. Cagliostro", rief die Gräfin; "warum haben Sie, wenn Sie sich Ihr Alter aussuchen könnten, nicht mit zwanzig statt mit vierzig aufgehört?"
"Weil, Madame", sagte Cagliostro lächelnd, "es mir lieber ist, ein Mann von vierzig Jahren zu sein, der noch gesund und kräftig ist, als ein roher Jüngling von zwanzig."
"Oh!", sagte die Gräfin.
"Zweifellos, Madame", fuhr Cagliostro fort, "gefällt man mit zwanzig den Frauen von dreißig Jahren; mit vierzig regiert man die Frauen von zwanzig und die Männer von sechzig Jahren."
"Ich gebe nach, Herr", sagte die Gräfin, "denn Sie sind ein lebendiger Beweis für die Wahrheit Ihrer eigenen Worte."
"Dann bin ich", sagte Taverney kläglich, "verdammt; es ist zu spät für mich."
"M. de Richelieu ist geschickter gewesen als Sie", sagte La Pérouse naiv, "und ich habe immer gehört, dass er irgendein Geheimnis hat."
"Es ist ein Bericht, den die Frauen verbreitet haben", lachte Graf Haga.
"Ist das ein Grund, es nicht zu glauben, Herr Herzog?" fragte Madame Dubarry.
Der alte Herzog verfärbte sich, was selten für ihn war, antwortete aber: "Wünschen Sie, meine Herren, meine Quittung zu bekommen?"
"Oh, auf jeden Fall."
"Nun, dann ist es einfach, auf sich selbst aufzupassen."
"Oh, oh!", riefen alle.
"Aber, M. Cagliostro", fuhr Madame Dubarry fort, "ich muss mehr über das Elixier wissen."
"Nun, Madame?"
"Sie sagten, Sie hätten es zum ersten Mal im Alter von 40 Jahren benutzt..."
"Ja, Madame."
"Und dass Sie seit dieser Zeit, also seit der Belagerung von Troja..."
"Ein wenig früher, Madame."
"Dass Sie immer vierzig Jahre alt geblieben sind?"
"Sie sehen mich jetzt."
"Aber dann, Sir", sagte de Condorcet, "argumentieren Sie nicht nur für die Verewigung der Jugend, sondern für die Erhaltung des Lebens; denn wenn Sie seit der Belagerung von Troja immer vierzig waren, sind Sie nie gestorben."
"Stimmt, Marquis, ich bin nie gestorben."
"Aber seid Ihr denn unverwundbar, wie Achilles, oder noch mehr, denn Achilles wurde durch den Pfeil des Paris getötet?"
"Nein. Ich bin nicht unverwundbar, und das ist mein großes Bedauern", sagte Cagliostro.
"Dann, Sir, könnten Sie getötet werden."
"Leider! Ja."
"Wie sind Sie dann seit dreitausendfünfhundert Jahren allen Unfällen entkommen?"
"Es ist Zufall, Marquis, aber werden Sie meiner Argumentation folgen?"
"Ja, ja", riefen alle mit Eifer.
Cagliostro fuhr fort: "Was ist die erste Voraussetzung für das Leben?", fragte er und breitete seine weißen und schönen Hände aus, die mit Ringen bedeckt waren, unter denen der von Kleopatra auffällig glänzte. "Ist es nicht die Gesundheit!"
"Gewiss."
"Und der Weg zur Erhaltung der Gesundheit ist?"
"Richtige Verwaltung", sagte Graf Haga.
"Richtig, Graf. Und warum sollte mein Elixier nicht die bestmögliche Behandlungsmethode sein? Und diese Behandlung habe ich angenommen, und damit habe ich meine Jugend bewahrt, und mit der Jugend die Gesundheit und das Leben."
"Aber alle Dinge erschöpfen sich; die feinste Konstitution, wie auch die schlechteste."
"Der Körper von Paris, wie der von Vulkan", sagte die Gräfin. "Vielleicht kannten Sie Paris, nebenbei bemerkt?"
"Durchaus, Madame; er war ein feiner junger Mann, hat aber wirklich nicht alles verdient, was über ihn gesagt worden ist. Erstens hatte er rotes Haar."
"Rotes Haar, furchtbar!"
"Unglücklicherweise, Madame, war Helen nicht Ihrer Meinung: aber um auf unser Thema zurückzukommen. Sie sagen, M. de Taverney, dass sich alle Dinge erschöpfen; aber Sie wissen auch, dass sich alles wieder erholt, regeneriert oder ersetzt wird, wie auch immer Sie es nennen wollen. Das berühmte Messer des heiligen Hubertus, das so oft Klinge und Griff wechselte, ist ein Beispiel dafür, denn durch jede Veränderung blieb es immer noch das Messer des heiligen Hubertus. Die Weine, die die Mönche von Heidelberg so sorgfältig in ihren Kellern aufbewahren, bleiben immer noch derselbe Wein, obwohl sie jedes Jahr einen frischen Vorrat hineinschütten; daher bleibt dieser Wein immer klar, hell und köstlich: während der Wein, den Opimus und ich in den irdenen Krügen versteckten, als ich ihn nach hundert Jahren probierte, nur eine dicke schmutzige Substanz war, die man vielleicht hätte essen, aber sicher nicht trinken können. Nun, ich folge dem Beispiel der Mönche von Heidelberg und konserviere meinen Körper, indem ich jedes Jahr neue Elemente in ihn einführe, die die alten regenerieren. Jeden Morgen ersetzt ein neues und frisches Atom in meinem Blut, meinem Fleisch und meinen Knochen ein Teilchen, das zugrunde gegangen ist. Ich halte den Verfall auf, den die meisten Menschen unmerklich in ihr ganzes Wesen eindringen lassen, und ich zwinge alle jene Kräfte in Aktion, die Gott jedem Menschen gegeben hat, die aber die meisten Menschen schlummern lassen. Dies ist das große Studium meines Lebens, und da in allen Dingen derjenige, der eine Sache tut, diese Sache ständig besser tut als andere, werde ich geschickter als andere, um Gefahren zu vermeiden. So würden Sie mich nicht dazu bringen, ein wackelndes Haus zu betreten; ich habe zu viele Häuser gesehen, um nicht auf einen Blick die sicheren von den unsicheren zu unterscheiden. Sie würden mich nicht mit einem Mann auf die Jagd gehen sehen, der schlecht mit seiner Waffe umgeht. Von Cephalus, der seine Frau tötete, bis hinunter zum Regenten, der dem Prinzen ins Auge schoss, habe ich zu viele ungeschickte Leute gesehen. Ihr könntet mich nicht dazu bringen, in der Schlacht den Posten anzunehmen, den manch einer ohne nachzudenken einnehmen würde, weil ich in einem Augenblick die Chancen der Gefahr an jedem Punkt berechnen würde. Sie werden mir sagen, dass man eine verirrte Kugel nicht voraussehen kann; aber der Mann, der tausend Schüssen entgangen ist, wird kaum jetzt einem zum Opfer fallen. Ah, Sie schauen ungläubig, aber bin ich nicht ein lebender Beweis? Ich sage nicht, dass ich unsterblich bin, sondern nur, daß ich besser als andere weiß, wie man die Gefahr vermeidet; zum Beispiel würde ich jetzt hier nicht allein mit M. de Launay bleiben, der meint, wenn er mich in der Bastille hätte, würde er meine Unsterblichkeit durch Verhungern auf die Probe stellen; auch würde ich nicht bei M. de Condorcet bleiben, denn er denkt daran, den Inhalt des Rings, den er an der linken Hand trägt und der voller Gift ist, einfach in mein Glas zu leeren - nicht in böser Absicht, sondern nur als wissenschaftliches Experiment, um zu sehen, ob ich sterben sollte."
Die beiden Genannten sahen sich an und färbten sich.
"Gestehen Sie, M. de Launay, wir befinden uns nicht in einem Gerichtssaal; außerdem werden Gedanken nicht bestraft. Habt Ihr nicht gedacht, was ich gesagt habe? Und Sie, M. de Condorcet, hätten Sie mich nicht gern das Gift in Ihrem Ring kosten lassen, im Namen Ihrer geliebten Geliebten, der Wissenschaft?"
"In der Tat", sagte M. de Launay lachend, "ich gebe zu, Sie haben recht; es war eine Torheit, aber diese Torheit ging mir durch den Kopf, kurz bevor Sie mich beschuldigten."
"Und ich", sagte M. de Condorcet, "werde nicht weniger offen sein. Ich dachte, wenn Sie den Inhalt meines Rings probieren würden, würde ich nicht viel für Ihr Leben geben."
Ein Schrei der Bewunderung brach aus der übrigen Gesellschaft hervor; diese Geständnisse bestätigten nicht die Unsterblichkeit, sondern die Durchdringung des Grafen Cagliostro.
"Sie sehen", sagte Cagliostro leise, "dass ich diese Gefahren geahnt habe; nun, so ist es auch mit anderen Dingen. Die Erfahrung eines langen Lebens offenbart mir auf einen Blick viel von der Vergangenheit und von der Zukunft derer, denen ich begegne. Meine Fähigkeiten erstrecken sich auf diese Weise sogar auf Tiere und unbelebte Gegenstände. Wenn ich in eine Kutsche steige, kann ich am Blick der Pferde erkennen, ob sie weglaufen werden, und am Blick des Kutschers, ob er mich umwerfen wird. Wenn ich an Bord eines Schiffes gehe, kann ich sehen, ob der Kapitän unwissend oder starrköpfig ist und mich deshalb in Gefahr bringen könnte. Ich sollte dann den Kutscher oder den Kapitän verlassen, von diesen Pferden oder dem Schiff fliehen. Ich leugne den Zufall nicht, ich mindere ihn nur, und anstatt hundert Zufälle zu erleben, wie der Rest der Welt, verhindere ich neunundneunzig davon und bemühe mich, den hundertsten zu verhindern. Das ist das Gute daran, dreitausend Jahre gelebt zu haben."
"Dann", sagte La Pérouse lachend, inmitten der Verwunderung und Begeisterung, die diese Rede Cagliostros hervorrief, "sollten Sie mit mir kommen, wenn ich mich einschiffe, um die Welt zu bereisen; Sie würden mir einen großen Dienst erweisen."
Cagliostro antwortete nicht.
"M. de Richelieu", fuhr La Pérouse fort, "da der Graf Cagliostro, was sehr verständlich ist, eine so gute Gesellschaft nicht zu verlassen wünscht, müssen Sie mir erlauben, dies ohne ihn zu tun. Entschuldigen Sie, Graf Haga, und Sie, Madame, aber es ist sieben Uhr, und ich habe Seiner Majestät versprochen, um Viertel nach aufzubrechen. Aber da Graf Cagliostro nicht versucht sein wird, mit mir zu kommen und meine Schiffe zu sehen, kann er mir vielleicht sagen, was mit mir zwischen Versailles und Brest geschehen wird. Von Brest bis zum Pol frage ich nichts; das ist meine eigene Sache."
Cagliostro sah La Pérouse mit einer so melancholischen Miene an, so voller Mitleid und Freundlichkeit, dass die anderen davon beeindruckt waren. Der Seemann selbst bemerkte es jedoch nicht. Er verabschiedete sich von der Gesellschaft, zog seinen pelzbesetzten Reitmantel an, in dessen eine Tasche Madame Dubarry eine Flasche köstlichen Likörs schob, der einem Reisenden willkommen war, den er aber nicht für sich selbst besorgt hätte, um ihn, wie sie sagte, an seine abwesenden Freunde während der langen Nächte einer Reise in so bitterer Kälte zu erinnern.
La Pérouse, immer noch voller Frohsinn, verbeugte sich respektvoll vor Graf Haga und reichte dem alten Marschall die Hand.
"Adieu, lieber La Pérouse", sagte letzterer.
"Nein, Herzog, au revoir", erwiderte La Pérouse, "man könnte meinen, ich ginge für immer fort; jetzt habe ich nur noch die Welt zu umrunden - fünf oder sechs Jahre Abwesenheit; da lohnt es sich kaum, 'adieu' zu sagen."
"Fünf oder sechs Jahre", sagte der Marschall; "man könnte ebenso gut fünf oder sechs Jahrhunderte sagen; Tage sind in meinem Alter Jahre, darum sage ich 'adieu'."
"Bah! Fragen Sie den Zauberer", erwiderte La Pérouse, immer noch lachend; "er wird Ihnen zwanzig Jahre mehr Leben versprechen. Wollt Ihr das nicht, Graf Cagliostro? Oh, Graf, warum habe ich nicht früher von Euren kostbaren Tropfen gehört? Wie hoch auch immer der Preis sein mag, ich hätte eine Tonne verschifft. Madame, noch einen Kuss von dieser schönen Hand, so einen werde ich gewiss nicht mehr sehen, bis ich wiederkomme; au revoir", und er verließ das Zimmer.
Cagliostro bewahrte noch immer das gleiche traurige Schweigen. Sie hörten die Schritte des Hauptmanns, als er das Haus verließ, seine fröhliche Stimme im Hof und seinen Abschiedsgruß an die Leute, die sich versammelt hatten, um ihn abreisen zu sehen. Dann schüttelten die Pferde ihre Köpfe, die mit Glocken bedeckt waren, die Tür des Wagens schloss sich mit einigem Lärm, und man hörte die Räder die Straße entlang rollen.
La Pérouse war zu jener Reise aufgebrochen, von der er nie mehr zurückkehren sollte.
Als kein Geräusch mehr zu hören war, richteten sich alle Blicke wieder auf Cagliostro; in seinen Augen schien eine Art inspiriertes Licht zu liegen.
Graf Haga brach zuerst das Schweigen, das einige Minuten gedauert hatte. "Warum haben Sie nicht auf seine Frage geantwortet?", erkundigte er sich bei Cagliostro.
Cagliostro fuhr auf, als hätte ihn die Frage aus einer Träumerei geweckt. "Weil", sagte er, "ich entweder eine Unwahrheit oder eine traurige Wahrheit gesagt haben muß."
"Wie das?"
"Ich muss zu ihm gesagt haben: 'M. de la Pérouse, der Herzog hat recht, wenn er zu Ihnen adieu sagt und nicht au revoir.'"
"Oh", sagte Richelieu und wurde blass, "was meinen Sie?"
"Seien Sie beruhigt, Herr Marschall, diese traurige Vorhersage betrifft Sie nicht."
"Was", rief Madame Dubarry, "diese arme La Pérouse, die mir gerade die Hand geküsst hat -"
"Er wird sie nicht nur nie wieder küssen, Madame, sondern auch nie wieder die sehen, die er gerade verlassen hat", sagte Cagliostro und blickte aufmerksam auf das Glas Wasser, das er hochhielt.
Ein Schrei des Erstaunens brach aus allen hervor. Das Interesse des Gesprächs steigerte sich von Augenblick zu Augenblick, und man hätte nach der feierlichen und ängstlichen Miene, mit der alle Cagliostro betrachteten, meinen können, es handele sich um ein uraltes und unfehlbares Orakel, das sie konsultierten.
"Bitte, Herr Graf", sagte Madame Dubarry, "sagen Sie uns, was der armen La Pérouse widerfahren wird."
Cagliostro schüttelte den Kopf.
"Oh ja, lasst uns hören!", riefen die anderen.
"Nun, M. de la Pérouse beabsichtigt, wie ihr wisst, eine Weltreise zu machen und die Forschungen des armen Kapitän Cook fortzusetzen, der auf den Sandwichinseln ums Leben kam."
"Ja, ja, das wissen wir."
"Alles deutet auf einen glücklichen Ausgang dieser Reise hin; M. de la Pérouse ist ein guter Seemann, und seine Route ist vom König sehr geschickt geplant worden."
"Ja", unterbrach Graf Haga, "der König von Frankreich ist ein geschickter Geograph; nicht wahr, M. de Condorcet?"
"Geschickter, als es für einen König nötig ist", erwiderte der Marquis; "Könige sollten die Dinge nur ein wenig kennen, dann lassen sie sich von denen führen, die sie gründlich kennen."
"Ist das eine Lektion, Herr Marquis?" sagte Graf Haga lächelnd.
"Oh, nein. Nur eine einfache Überlegung, eine allgemeine Wahrheit."
"Nun, er ist fort", sagte Madame Dubarry, bestrebt, das Gespräch wieder auf La Pérouse zu lenken.
"Ja, er ist fort", antwortete Cagliostro, "aber glauben Sie trotz seiner Eile nicht, dass er sich bald einschiffen wird. Ich sehe voraus, dass er in Brest viel Zeit verliert."
"Das wäre schade", sagte de Condorcet; "jetzt ist die Zeit zum Aufbruch: es ist sogar schon ziemlich spät - Februar oder März wäre besser gewesen."
"Oh, gönnen Sie ihm diese paar Monate nicht, M. de Condorcet, denn während dieser Zeit wird er wenigstens leben und hoffen."
"Er hat gute Offiziere, nehme ich an?", sagte Richelieu.
"Ja, derjenige, der das zweite Schiff kommandiert, ist ein hervorragender Offizier. Ich sehe ihn - jung, abenteuerlustig, tapfer, unglücklich."
"Warum unglücklich?"
"Nach einem Jahr suche ich ihn und sehe ihn nicht mehr", sagte Cagliostro, der ängstlich sein Glas betrachtete. "Niemand hier ist mit M. de Langle verwandt?"
"Nein."
"Keiner kennt ihn?"
"Nein."
"Nun, der Tod wird mit ihm beginnen."
Ein Gemurmel des Entsetzens entrang sich allen Gästen.
"Aber er, La Pérouse?", riefen mehrere Stimmen.
"Er segelt, er landet, er geht wieder an Land; ich sehe ein, zwei Jahre erfolgreicher Seefahrt; wir hören Nachricht von ihm, und dann..."
"Dann?"
"Jahre vergehen..."
"Und schließlich?"
"Das Meer ist weit, der Himmel ist wolkenverhangen, hier und da tauchen unbekannte Länder auf, und Gestalten, scheußlich wie die Ungeheuer des griechischen Archipels. Sie beobachten das Schiff, das im Nebel zwischen die Brandung getragen wird, von einem Sturm, der weniger furchterregend ist als sie selbst. Oh, La Pérouse, La Pérouse, wenn du mich hören könntest, würde ich zu dir schreien. Du bist aufgebrochen, wie Kolumbus, um eine Welt zu entdecken; hüte dich vor unbekannten Inseln!"
Er hörte auf, und ein eisiger Schauer lief durch die Versammlung.
"Aber warum haben Sie ihn nicht gewarnt?" fragte Graf Haga, der trotz seiner selbst dem Einfluss dieses außergewöhnlichen Mannes erlegen war.
"Ja", rief Madame Dubarry, "warum nicht nach ihm schicken und ihn zurückholen? Das Leben eines Mannes wie La Pérouse ist sicher einen Kurier wert, mein lieber Marschall."
Der Marschall erhob sich, um die Glocke zu läuten.
Cagliostro streckte den Arm aus, um ihn aufzuhalten. "Ach!", sagte er, "alle Ratschläge wären nutzlos. Ich kann das Schicksal vorhersehen, aber ich kann es nicht ändern. M. de la Pérouse würde lachen, wenn er meine Worte hörte, wie der Sohn des Priamos lachte, als Kassandra prophezeite; und sehen Sie, Sie fangen selbst an zu lachen, Graf Haga, und Lachen ist ansteckend: Ihre Gefährten fangen es auf. Halten Sie sich nicht zurück, meine Herren - ich bin an ein ungläubiges Publikum gewöhnt."
"Oh, wir glauben", sagten Madame Dubarry und der Duke de Richelieu; "und ich glaube", murmelte Taverney; "und ich auch", sagte Graf Haga höflich.
"Ja", erwiderte Cagliostro, "Sie glauben, weil es La Pérouse betrifft; aber wenn ich von Ihnen selbst sprechen würde, würden Sie nicht glauben."
"Ich gestehe, was mich zum Glauben gebracht hätte, wäre gewesen, wenn Sie zu ihm gesagt hätten: 'Hüte dich vor unbekannten Inseln;' dann hätte er wenigstens die Möglichkeit gehabt, sie zu meiden."
"Ich versichere Ihnen, nein, Herr Graf; und wenn er mir geglaubt hätte, wäre es nur noch schrecklicher gewesen, denn der Unglückliche hätte sich jenen Inseln nähern sehen, die ihm zum Verhängnis werden sollten, ohne die Kraft, vor ihnen zu fliehen. So wäre er gestorben, nicht einen, sondern hundert Tode, denn er hätte alles in Erwartung durchgemacht. Die Hoffnung, deren ich ihn beraubt hätte, ist das, was einen Menschen unter allen Prüfungen am besten aufrechterhält."
"Ja", sagte de Condorcet; "der Schleier, der unsere Zukunft vor uns verbirgt, ist das einzige wirkliche Gut, das Gott dem Menschen verbürgt hat."
"Dennoch", sagte Graf Haga, "würde ein Mann wie Sie zu mir sagen, ich solle einen bestimmten Menschen oder eine bestimmte Sache meiden, so würde ich mich hüten, und ich würde Ihnen für den Ratschlag danken."
Cagliostro schüttelte den Kopf, mit einem schwachen Lächeln.
"Ich meine es ernst, M. de Cagliostro", fuhr Graf Haga fort; "warnen Sie mich, und ich werde Ihnen danken."
"Sie wünschen, dass ich Ihnen sage, was ich La Pérouse nicht sagen wollte?"
"Ja, ich wünsche es."
Cagliostro öffnete den Mund, als wollte er beginnen, hielt dann aber inne und sagte: "Nein, Graf, nein!"
"Ich flehe Sie an."
Cagliostro schwieg immer noch.
"Nehmen Sie sich in Acht", sagte der Graf, "Sie machen mich ungläubig."
"Ungläubigkeit ist besser als Elend."
"M. de Cagliostro", sagte der Graf ernst, "Sie vergessen eines, nämlich dass es zwar Menschen gibt, die ihr Schicksal besser nicht kennen, dass es aber andere gibt, die es kennen sollten, da es nicht nur sie selbst, sondern Millionen anderer betrifft."
"Dann", sagte Cagliostro, "befehlen Sie mir; wenn Ihre Majestät es befiehlt, werde ich gehorchen."
"Ich befehle Ihnen, mir mein Schicksal zu enthüllen, M. de Cagliostro", sagte der König mit einer ebenso höflichen wie würdevollen Miene.
In diesem Augenblick, als Graf Haga sein Inkognito fallen ließ, um mit Cagliostro zu sprechen, trat M. de Richelieu auf ihn zu und sagte: "Danke, Sire, für die Ehre, die Sie meinem Haus erwiesen haben; wollen Eure Majestät den Ehrenplatz einnehmen?"
"Lasst uns bleiben, wie wir sind, Herr Marschall; ich möchte hören, was M. de Cagliostro zu sagen gedenkt."
"Man spricht vor Königen nicht die Wahrheit, Majestät."
"Bah! Ich bin nicht in meinem Reich; nehmt wieder Euren Platz ein, Herzog. Fahren Sie fort, M. de Cagliostro, ich bitte Sie."
Cagliostro blickte wieder durch sein Glas, und man hätte sich vorstellen können, wie die Partikel, die durch diesen Blick aufgewühlt wurden, im Licht tanzten. "Sire", sagte er, "sagen Sie mir, was Sie zu wissen wünschen?"
"Sagt mir, durch welchen Tod ich sterben werde."
"Durch einen Gewehrschuss, Sire."
Die Augen von Gustavus leuchteten auf. "Ah, in einer Schlacht!" sagte er; "der Tod eines Soldaten! Danke, M. de Cagliostro, tausendmal Dank; oh, ich sehe Schlachten voraus, und Gustavus Adolphus und Karl XII. haben mir gezeigt, wie ein König von Schweden sterben sollte."
Cagliostro ließ den Kopf sinken, ohne zu antworten.
"Oh!", rief Graf Haga, "wird meine Wunde dann nicht in der Schlacht gegeben?"
"Nein, Sire."
"In einem Aufruhr?-Ja, das ist möglich."
"Nein, nicht in einem Aufruhr, Majestät."
"Aber, wo dann?"
"Auf einem Ball, Majestät."
Der König schwieg, und Cagliostro vergrub den Kopf in seinen Händen.
Alle sahen bleich und erschrocken aus; dann nahm M. de Condorcet das Glas Wasser und untersuchte es, als ob er darin das Problem von allem, was vorgefallen war, lösen könnte; aber da er nichts fand, was ihn befriedigte, "Nun, auch ich", sagte er, "werde unseren erlauchten Propheten bitten, für mich seinen Zauberspiegel zu konsultieren: leider bin ich kein mächtiger Herr; ich kann nicht befehlen, und mein obskures Leben betrifft keine Millionen von Menschen."
"Herr", sagte Graf Haga, "Sie befehlen im Namen der Wissenschaft, und Ihr Leben gehört nicht nur einer Nation, sondern der ganzen Menschheit."
"Danke", sagte De Condorcet; "aber vielleicht wird Ihre Meinung zu diesem Thema von M. de Cagliostro nicht geteilt."
Cagliostro hob den Kopf. "Ja, Marquis", sagte er in einer Weise, die zu erregen begann, "Sie sind in der Tat ein mächtiger Herr im Reich der Intelligenz; sehen Sie mir also ins Gesicht, und sagen Sie mir, ernsthaft, ob Sie auch wünschen, dass ich Ihnen prophezeie."
"Ernsthaft, Graf, bei meiner Ehre."
"Nun, Marquis", sagte Cagliostro mit heiserer Stimme, "Ihr werdet an dem Gift sterben, das Ihr in Eurem Ring tragt; Ihr werdet sterben -"
"Oh, aber wenn ich ihn wegwerfe?"
"Werfen Sie ihn weg!"
"Du gibst zu, dass das einfach wäre."
"Wirf ihn weg!"
"Oh, ja, Marquis", rief Madame Dubarry; "werfen Sie dieses schreckliche Gift weg! Werfen Sie es weg, und sei es nur, um diesen Propheten des Bösen zu verfälschen, der uns allen so viel Unglück androht. Denn wenn du es wegwirfst, kannst du nicht daran sterben, wie M. de Cagliostro voraussagt; da wird er sich also wenigstens geirrt haben."
"Madame la Comtesse hat recht", sagte Graf Haga.
"Bravo, Gräfin!", sagte Richelieu. "Kommen Sie, Marquis, werfen Sie das Gift weg, denn jetzt, wo ich weiß, dass Sie es bei sich tragen, werde ich jedes Mal zittern, wenn wir zusammen trinken; der Ring könnte sich von selbst öffnen und -"
"Es ist nutzlos", sagte Cagliostro leise; "M. de Condorcet wird es nicht wegwerfen."
"Nein", erwiderte de Condorcet, "ich werde ihn nicht wegwerfen; nicht, weil ich meinem Schicksal nachhelfen will, sondern weil es sich um ein einzigartiges Gift handelt, das von Cabanis zubereitet wurde, und das der Zufall vollständig gehärtet hat, und dieser Zufall könnte nie wieder eintreten; deshalb werde ich ihn nicht wegwerfen. Triumphieren Sie, wenn Sie wollen, M. de Cagliostro."
"Das Schicksal", erwiderte er, "findet immer einen Weg, seine eigenen Ziele zu verwirklichen."
"Dann werde ich durch Gift sterben", sagte der Marquis; "nun, so sei es. Es ist ein bewundernswerter Tod, denke ich; ein wenig Gift auf die Zungenspitze, und ich bin weg. Es ist kaum ein Sterben: es ist nur ein Aufhören zu leben."
"Es ist nicht nötig, dass Sie leiden, mein Herr", sagte Cagliostro.
"Dann, mein Herr", sagte M. de Favras, "haben wir einen Schiffbruch, einen Gewehrschuss und eine Vergiftung, die mir den Mund wässrig macht. Wollen Sie mir nicht auch den Gefallen tun, mir ein kleines Vergnügen der gleichen Art vorauszusagen?"
"Oh, Marquis!" erwiderte Cagliostro, der unter dieser Ironie warm zu werden begann, "beneiden Sie diese Herren nicht, Sie werden noch Besseres haben."
"Besser!" sagte M. de Favras lachend; "das ist ein Versprechen auf viel. Es ist schwer, das Meer, das Feuer und das Gift zu schlagen!"
"Es bleibt die Kordel, Herr Marquis", sagte Cagliostro und verbeugte sich.
"Die Kordel! Was meinen Sie?"
"Ich meine, dass Sie gehängt werden", antwortete Cagliostro, der nicht mehr Herr seiner prophetischen Wut zu sein schien.
"Gehängt! Der Teufel!", rief Richelieu.
"Monsieur vergisst, dass ich ein Edelmann bin", sagte M. de Favras kalt; "oder wenn er meint, von einem Selbstmord zu sprechen, so warne ich ihn, dass ich mich selbst in meinen letzten Augenblicken genügend respektieren werde, um keinen Strick zu benutzen, solange ich ein Schwert habe."
"Ich spreche nicht von einem Selbstmord, Sir."
"Dann sprechen Sie von einer Bestrafung?"
"Ja."
"Sie sind ein Fremder, Sir, und deshalb verzeihe ich Ihnen."
"Was?"
"Ihre Unwissenheit, Sir. In Frankreich enthaupten wir Adlige."
"Das können Sie, wenn Sie können, mit dem Henker regeln", antwortete Cagliostro.
M. de Favras sagte nichts mehr. Ein paar Minuten lang herrschte allgemeines Schweigen und Zurückweichen.
"Wisst Ihr, dass ich zuletzt zittere", sagte M. de Launay; "meine Vorgänger sind so schlecht davongekommen, dass ich um mich fürchte, wenn ich jetzt an die Reihe komme."
"Dann sind Sie vernünftiger als sie; Sie haben Recht. Versuchen Sie nicht, die Zukunft zu kennen; gut oder schlecht, lassen Sie es ruhen - es liegt in den Händen Gottes."
"Oh! M. de Launay," sagte Madame Dubarry, "ich hoffe, Sie werden nicht weniger mutig sein als die anderen."
"Das hoffe ich auch, Madame", sagte der Gouverneur. Dann wandte er sich an Cagliostro: "Mein Herr", sagte er, "bitte geben Sie mir meinerseits mein Horoskop, wenn Sie wollen."
"Es ist leicht", antwortete Cagliostro, "ein Schlag mit dem Beil auf den Kopf, und alles ist vorbei."
Ein Blick des Entsetzens war wieder allgemein. Richelieu und Taverney baten Cagliostro, nichts mehr zu sagen, aber die weibliche Neugier setzte sich durch.
"Wenn man Sie reden hört, Graf", sagte Madame Dubarry, "könnte man meinen, das ganze Universum müsse einen gewaltsamen Tod sterben. Hier waren wir, acht von uns, und fünf sind bereits von Ihnen verurteilt worden."
"Ach, Sie verstehen doch, dass das alles vorbereitet ist, um uns zu erschrecken, und wir werden nur darüber lachen", sagte M. de Favras und versuchte, dies zu tun.
"Gewiss werden wir lachen", sagte Graf Haga, "ob es nun wahr ist oder nicht."
"Oh, dann werde ich auch lachen", sagte Madame Dubarry. "Ich will die Versammlung nicht durch meine Feigheit entehren; aber, ach! Ich bin nur eine Frau, ich kann nicht zu euch gehören und eines tragischen Endes würdig sein; eine Frau stirbt in ihrem Bett. Mein Tod, eine kummervolle alte Frau, die von allen verlassen wird, wird der schlimmste von allen sein. Nicht wahr, M. de Cagliostro?"
Sie hielt inne und schien darauf zu warten, dass der Prophet sie beruhigte. Cagliostro sprach nicht, und da ihre Neugierde die Oberhand über ihre Ängste gewann, fuhr sie fort. "Nun, M. de Cagliostro, wollen Sie mir nicht antworten?"
"Was wünschen Sie von mir zu hören, Madame?"
Sie zögerte, dann nahm sie ihren Mut zusammen: "Ja", rief sie, "ich werde das Risiko eingehen. Erzählen Sie mir das Schicksal von Jeanne de Vaubernier, der Gräfin Dubarry."
"Auf dem Schafott, Madame", antwortete der Prophet des Bösen.
"Ein Scherz, mein Herr, nicht wahr?", sagte sie und sah ihn mit flehender Miene an.
Cagliostro schien es nicht zu sehen. "Warum glauben Sie, dass ich scherze?", fragte er.
"Oh, weil man, um auf dem Schafott zu sterben, ein Verbrechen begangen haben muss - gestohlen, gemordet oder etwas Schreckliches getan haben muss; und es ist unwahrscheinlich, dass ich das tun werde. Es war ein Scherz, nicht wahr?"
"Oh, mon Dieu, ja", sagte Cagliostro; "alles, was ich gesagt habe, ist nur ein Scherz."
Die Gräfin lachte, aber kaum auf eine natürliche Weise. "Kommen Sie, M. de Favras", sagte sie, "lassen Sie uns unsere Beerdigung anordnen."
"Oh, das wird für Sie nicht nötig sein, Madame", sagte Cagliostro.
"Warum denn, Monsieur?"
"Weil Sie in einem Wagen zum Schafott fahren werden."
"Oh, wie furchtbar! Dieser furchtbare Mann, Herr Marschall! Wählen Sie um Himmels willen das nächste Mal fröhlichere Gäste, oder ich werde Sie nie wieder besuchen."
"Verzeihen Sie, Madame", sagte Cagliostro, "aber Sie möchten, dass ich spreche, wie alle anderen auch."
"Zumindest hoffe ich, dass Sie mir Zeit geben, meinen Beichtvater zu wählen."
"Das wird überflüssig sein, Gräfin."
"Warum?"
"Der letzte Mensch, der in Frankreich mit einem Beichtvater das Schafott besteigen wird, wird der König von Frankreich sein." Und Cagliostro sprach diese Worte mit einer so erregenden Stimme aus, dass alle von Entsetzen ergriffen waren.
Alle waren still.
Cagliostro hob das Glas Wasser, in dem er diese schrecklichen Prophezeiungen gelesen hatte, an seine Lippen, aber kaum hatte er es berührt, setzte er es mit einer Bewegung des Ekels ab. Er wandte seinen Blick zu M. de Taverney.
"Oh", rief er entsetzt, "sagen Sie mir nichts; ich will es nicht wissen!"
"Nun, dann werde ich an seiner Stelle fragen", sagte Richelieu.
"Sie, Herr Marschall, seien Sie froh; Sie sind der einzige von uns allen, der in seinem Bett sterben wird."
"Kaffee, meine Herren, Kaffee", rief der Marschall, verzaubert von der Vorhersage. Alle erhoben sich.
Doch bevor sie in den Salon gingen, wandte sich Graf Haga an Cagliostro und sagte
"Sagen Sie mir, wovor ich mich hüten soll."
"Vor einem Muff, Sir", antwortete Cagliostro.
"Und ich?", sagte Condorcet.
"Vor einem Omelett."
"Gut; ich verzichte auf Eier", und er verließ den Raum.
"Und ich?" sagte M. de Favras; "was habe ich zu befürchten?"
"Einen Brief."
"Und ich?" sagte de Launay.
"Die Einnahme der Bastille."
"Oh, Sie beruhigen mich sehr." Und er ging lachend davon.
"Nun zu mir, Sir", sagte die Gräfin zitternd.
"Sie, schöne Gräfin, meiden die Place Louis XV."
"Ach", sagte die Gräfin, "ich habe mich schon einmal dort verloren; an diesem Tag habe ich sehr gelitten."
Sie verließ das Zimmer, und Cagliostro war im Begriff, ihr zu folgen, als Richelieu ihn aufhielt.
"Einen Augenblick", sagte er; "es bleiben nur noch Taverney und ich, mein lieber Zauberer."
"M. de Taverney bat mich, nichts zu sagen, und Sie, Herr Marschall, haben mich nichts gefragt."
"Oh, ich will nichts hören", rief Taverney erneut.
"Aber kommen Sie, um Ihre Macht zu beweisen, sagen Sie uns etwas, was nur Taverney und ich wissen", sagte Richelieu.
"Was?", fragte Cagliostro und lächelte.
"Sagen Sie uns, was Taverney dazu bringt, nach Versailles zu kommen, anstatt ruhig in seinem schönen Haus in Maison-Rouge zu leben, das der König vor drei Jahren für ihn gekauft hat."
"Nichts einfacher als das, Herr Marschall", sagte Cagliostro. "Vor zehn Jahren wollte M. de Taverney seine Tochter, Mademoiselle Andrée, dem König Ludwig XV. schenken, aber es ist ihm nicht gelungen."
"Oh!", knurrte Taverney.
"Nun, Monsieur möchte seinen Sohn Philippe de Taverney der Königin Marie Antoinette schenken; fragen Sie ihn, ob ich die Wahrheit sage."
"Bei meinem Wort", sagte Taverney, zitternd, "dieser Mann ist ein Zauberer; der Teufel soll mich holen, wenn er es nicht ist!"
"Sprich nicht so kavalierhaft vom Teufel, mein alter Kamerad", sagte der Marschall.
"Es ist furchtbar", murmelte Taverney, und er wandte sich um, um Cagliostro zu beschwören, diskret zu sein, aber er war fort.
"Kommen Sie, Taverney, in den Salon", sagte der Marschall, "oder sie werden ihren Kaffee ohne uns trinken."
Aber als sie dort ankamen, war das Zimmer leer; niemand hatte den Mut, dem Urheber dieser schrecklichen Vorhersagen erneut gegenüberzutreten.
Die Wachslichter brannten in den Kandelabern, das Feuer brannte auf dem Herd, aber alles umsonst.
"Ma foi, alter Freund, es scheint, wir müssen unseren Kaffee tête-à-tête nehmen. Aber wo zum Teufel ist er hin?" Richelieu sah sich um, aber Taverney war verschwunden wie die anderen. "Macht nichts", sagte der Marschall, kicherte, wie Voltaire es hätte tun können, und rieb sich die verdorrten, aber immer noch weißen Hände; "ich werde der einzige sein, der in meinem Bett stirbt. Nun, Graf Cagliostro, glaube ich wenigstens. In meinem Bett! Das war's; ich werde in meinem Bett sterben, und ich hoffe, nicht für lange Zeit. Hola! Mein Kammerdiener und meine Tropfen."
Der Kammerdiener trat mit der Flasche ein, und der Marschall ging mit ihm in das Schlafzimmer.
ENDE DES PROLOGS.