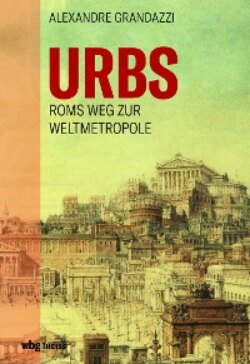Читать книгу Urbs - Alexandre Grandazzi - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prolog: In situ
ОглавлениеTräumerei auf dem Kapitol
Vor einiger Zeit hielt ich mich in Rom auf anlässlich eines Kolloquiums, das sich in die Länge zog, weshalb ich mich für einen Moment davonmachte und auf das Kapitol ging. Ich hatte das vorliegende Buch in Arbeit, wie man so schön sagt, und wollte vor meiner Rückkehr nach Paris noch ein wenig von der antiken Stadt und ihren Ruinen wiedersehen. Es versprach, ein heißer Tag zu werden, aber an diesem Morgen wehte dort oben eine angenehme Brise. Bereits im 19. Jahrhundert hatte ein großer deutscher Historiker davon geschrieben, wie sehr es ihn bewegt habe, um sich den gleichen Wind pfeifen zu hören, „wie er wohl um Romulus gepfiffen“ habe. Jugendlicher Enthusiasmus eines Gelehrten, der sich im weiteren Verlauf seiner Karriere als einer der schärfsten Kritiker der Gründungslegende erweisen sollte! Ich für meinen Teil betrachtete neben der eleganten Architektur der Paläste, die den Platz säumen, ebenso Heerscharen von Touristen, die jenen Hügel erstürmten, auf den einst, umjubelt von zahllosen Menschen, die siegreichen Feldherren mit ihren Legionen gezogen waren. Wenige Zeremonien haben so viel zur städtebaulichen Entwicklung Roms beigetragen wie dieses triumphale Ritual. Inzwischen jedoch hat sich der Schauplatz derart gewandelt, dass einem vor dem etwas steifen Reiterstandbild Marc Aurels nur noch die wilde Motorradfahrt in den Sinn kommt, mit dem Fellinis Film Roma endet …, wobei es sich auch bei diesem Triumph um eine Vergangenheit handelt, da der gesamte Hügel glücklicherweise inzwischen für den Verkehr gesperrt ist. Heute erfolgt der Zugang von der anderen Seite über eine der beiden von der Piazza Venezia heraufführenden Treppen, wodurch die in der Antike so wesentliche Verbindung zwischen Kapitol und Forum an Bedeutung verloren hat. Es ist derselbe Ort und doch derart verändert, dass man sich woanders wähnt.
Nachdem mich mein Spaziergang bald darauf in eines der angrenzenden Museen geführt hatte, gelangte ich über einen vor gut 15 Jahren angelegten Rundgang in die große offene Galerie des antiken Tabularium, jenes an den Hang geschmiegten Gebäudes, von dem aus man das gesamte Forum überblickt. An die Brüstung gelehnt, schaute ich dort durch eine römische Arkade in die Vergangenheit und träumte von jener Antike, deren Überreste sich vor mir ausbreiteten. Welch eindrucksvollen Anblick diese Stadtlandschaft bot, die voller eingestürzter Steine und wildwuchernder Gräser inzwischen beinahe wieder natürlich erscheint! Die seit anderthalb Jahrhunderten freigelegten Ruinen existierten vor uns, und sie werden auch nach uns noch existieren. Sie haben keinen praktischen Nutzen, und wenn sie auch schön sind, so ist ihr Reiz doch eher intellektueller denn unmittelbarer Natur. Dieser liegt weniger im eigentlichen Anblick der Ruinen als in Bildern, die sie hervorrufen. Welche Fragen stellen wir ihnen, und was haben sie uns zu erzählen? Mehr als ein Jahrtausend Geschichte, gefolgt von beinahe einem Jahrtausend Vergessen, und danach wiederum ein halbes Jahrtausend gelehrter Forschung … Als Ergebnis von Entscheidungen und Teilrekonstruktionen durch Archäologen berichten sie uns von der Fragilität nicht nur dieser ‚ewigen‘ Stadt, sondern aller Zivilisationen. Das brodelnde Leben aber, das diese Ruinen einst erfüllte, hat in antiken Schriften Zuflucht gefunden, deren Seiten man nur aufzuschlagen brauchte, um die Rufe der Menge und die mitreißenden Worte der Redner zu hören oder die schillernden Stoffe und den glänzenden Marmor zu sehen. Dazu allerdings müsste man diese Texte lesen oder überhaupt erst einmal wissen, dass es sie gibt! „Es liegt an dem, der vorübergeht, ob ich Grab bin oder Schatz“, spricht dank dem Dichter Paul Valéry auch das Pariser Musée de l’Homme von seinem Giebel herab. Und genau das beschäftigte mich hier: Wie den Schatz wieder sichtbar machen, wo auf den ersten Blick nur das Grab der Jahrhunderte zu erkennen war?
Ich habe lange nach einer Antwort gesucht und dabei unentwegt über ein Paradox nachgegrübelt: Nie zuvor wurde die Antike gründlicher erforscht, analysiert und begriffen, und gleichzeitig schien sie noch nie so weit von der Kultur und den Interessen der Gegenwart entfernt zu sein. Denn lange ist es her, dass europäische Zeitungen fasziniert die archäologische Erkundung des Forums verfolgten! Inzwischen ist das antike Rom gleichsam vom geistigen Horizont unserer Zeitgenossen verschwunden. Sollten die Entstehungsgeschichte und Entwicklung dieser Stadt, die nach und nach zum Zentrum der damaligen Welt wurde und in ihrer Architektur und Anlage einen gleichermaßen unerbittlichen wie assimilierenden Imperialismus artikulierte, uns wirklich nichts mehr zu sagen haben? Stehen wir Fragen nach urbanem Wachstum, Einwanderung und Globalisierung derart gleichgültig gegenüber? Und sind all diese Entdeckungen, all diese neuen Erkenntnisse tatsächlich nur für den kleinen Kreis der Experten relevant, die sie hervorbringen?
Weder ich noch irgendein anderer kann ernsthaft dieser Ansicht sein. Und aus diesem Grund fühlte ich mich, als ich an jenem Tag von der beinahe menschenleeren Galerie des Tabularium herab über das Forum blickte, schließlich in meinem Vorhaben bestätigt, während mir gleichzeitig die damit verbundenen Schwierigkeiten deutlicher bewusst waren denn je. Ja, es lohnte sich, diese große Geschichte zu erzählen, diesen auf wahren Tatsachen beruhenden Roman der Urbs niederzuschreiben! Aber wie sollte ich das anstellen, und – noch wichtiger – wo sollte ich anfangen?
Das fragte ich mich, während mein Blick geistesabwesend auf den Höhenzügen der friedlichen Albaner Berge ruhte, die sich in der Ferne hinter dem Forum und der Stadt abzeichneten. Für die Römer der Antike hatte Rom erst mit Romulus begonnen, doch das gilt für uns heute nicht mehr. Dank der Geowissenschaften wissen wir, dass jene nach römischem Verständnis seit jeher unveränderte Landschaft tatsächlich das Ergebnis einer langen Folge unvorstellbarer Metamorphosen ist, was mir, da ich mich schon lange für die Legenden und Landschaften der Albaner Berge interessierte, durchaus bewusst war. Und hatte ich nicht gerade während des Fluges nach Rom in einer Abendzeitung gelesen: „Unweit von Rom erwacht langsam ein Vulkan“,1 was sich auf geologische Beobachtungen der jüngsten Zeit und auf eben jene Albaner Berge bezog, die mithin sehr viel weniger friedlich waren, als es den Anschein hatte. Fachleuten zufolge soll es allerdings noch einbis zweitausend Jahre dauern, bevor der betreffende Vulkan tatsächlich erwacht! Dann jedoch könne ein neuer Eruptionszyklus beginnen, vergleichbar mit jenen Zyklen, die das römische Gelände einst so formten, wie wir es heute kennen. Was – man wagt kaum, daran zu denken – die gesamte menschliche Geschichte, die sich an diesem Ort abgespielt hat, auf ein bloßes Intermezzo zwischen zwei Kataklysmen reduzieren würde … Daher lohnt es meiner Ansicht nach, sich für einen Moment jener zugegebenermaßen vorsintflutlichen, aber im wahrsten Sinne des Wortes grundlegenden Vergangenheit zuzuwenden: Natürlich erklärt die Geologie nicht die Geschichte, sie bereitet ihr lediglich den Boden, doch das ist schon viel wert. Zu dem kurzen vulkanologischen Exkurs, der nun als Prolog zur historischen Darstellung folgt, möchte ich also lediglich mit Stendhals Worten anmerken, dass er „an solcherlei Einzelheiten interessierten Lesern ermüdende Nachforschungen ersparen wird“. Wer jedoch schnellstmöglich zur römischen Zeit im eigentlichen Sinne gelangen möchte, der möge dem Rat des Verfassers der Römischen Spaziergänge folgen: „Dennoch lege ich der Mehrzahl meiner Leser ans Herz, die folgenden fünf, sechs Seiten zu überspringen.“2
Vom Werden einer Landschaft
Diese Geschichte ist älter als die Menschheit und spielt in einer schier endlosen Zeit, in der Jahrmillionen so viel zählten wie für uns Jahrhunderte und Jahrhunderte so viel wie Jahre. Ihre einzige Protagonistin war damals und für lange Zeit die Erde …3
An einem Ort, der bei 41°54’ nördlicher Breite und 12°29’ östlicher Länge liegt, sollten sich durch das Aufeinandertreffen zweier tektonischer Platten Meeresböden hier zu Ebenen und dort zu Bergketten anheben. Mehrfach erloschene und aufs Neue erwachte Vulkane sollten sich schließlich in friedliche Seen verwandeln, während der Meeresspiegel um mehrere Dutzend Meter schwankte und das Klima viele Male zwischen subtropischer Hitze und glazialer Kälte wechselte. Jede dieser Episoden sollte ihre Spuren in der Landschaft hinterlassen und auf die eine oder andere Weise Auswirkungen haben auf das, was in einer noch mehrere 100.000 Jahre entfernten Zukunft bevorstand.
Zunächst jedoch gab es in dieser Region nichts als eine gewaltige Wasserfläche, in der sich nach und nach Sand und Schlamm der umliegenden Landmassen in immer dickeren Sedimentschichten ablagerten:4 Dieses mit Inseln übersäte Meer muss damals in etwa so ausgesehen haben wie heute die Bahamas. Doch als sich die eine Kontinentalplatte immer weiter unter die andere schob, presste der dadurch erzeugte Druck vor ungefähr 18 Millionen Jahren den Meeresboden erst zusammen, um ihn dann in die Höhe zu heben, bis er sich etwa 15 Millionen Jahre später als eine hohe Bergkette auftürmte und sich eine mehrere hundert Kilometer lange, von Nordwest nach Südost ausdehnende Halbinsel bildete. Etwa auf halber Höhe dieser Halbinsel erstreckte sich an ihrem westlichen Rand eine Küstenebene. Vor etwas mehr als drei Millionen Jahren war es dort sehr heiß, und entlang der zahllosen Sümpfe, in denen Elefantenherden und Nashörner Erfrischung suchten, wuchsen gewaltige Mangrovenwälder. Eine halbe Million Jahre später hatte sich das Klima abgekühlt, und auf die Elefanten war eine andere, artenreiche Fauna gefolgt: neben Mammuts auch Bären, Bisons, Rinder, Wölfe, Luchse, Damwild, Pferde und Hyänen.
Wieder eine Million Jahre später zog sich das Meer noch weiter zurück und gab riesige Sand- und Lehmböden frei, von denen einige Stück für Stück angehoben wurden. In dieser Phase des Pleistozäns entwickelte sich die natürliche Umgebung, wobei ungefähr alle 100.000 Jahre ein Klimawechsel auftrat: Etwa zehn Mal folgten auf unerbittliche Kälte, die das Meerwasser gefrieren und den Meeresspiegel sinken ließ, erneute Warmphasen, in denen Gletscher und Packeis schmolzen. Jedes Absinken des Meeresspiegels beschleunigte die Strömung von Flüssen und Bächen, die Täler auswuschen, während das Ansteigen des Meeresspiegels die Geschwindigkeit der Fließgewässer bremste, woraufhin diese ihre Ablagerungen auf umso breiteren Flächen verteilten. So formte sich ganz allmählich auch der Untergrund jenes Landstrichs, der Schauplatz dieses Buches sein wird. Doch das geologische Ereignis, besser gesagt die Serie von geologischen Ereignissen, die ihm seine frühgeschichtliche Gestalt verleihen sollte, erfolgte erst vor relativ Kurzem: Ihre Anfänge reichen etwas mehr als eine halbe Million Jahre zurück, und sie endeten vor 36.000 Jahren – in erdgeschichtlichen Begriffen also gestern erst!
Zu beiden Seiten einer zentralgelegenen Ebene, die ein reißender und sich gen Nordosten noch verbreiternder Strom teilte, entstanden imposante Vulkansysteme, deren fortgesetzte Eruptionen die Landschaft über einige 100.000 Jahre hinweg vollständig verwandeln sollten: Gewaltige Naturkatastrophen, deren Rhythmus und Intensität sich im Laufe der Zeit abschwächten, zerstörten eine Welt und schufen gleichzeitig eine neue. Allein in seiner ersten Eruptionsphase spuckte der südlichere der beiden Vulkane nicht weniger als 283 Kubikkilometer Material, das er über eine Fläche von beinahe 2000 Quadratkilometer verteilte. Zum Vergleich sei daran erinnert, dass der philippinische Pinatubo in den 1990er-Jahren bei einem der schwersten Vulkanausbrüche des 20. Jahrhunderts zehn Kubikkilometer Asche erzeugte. Die unermessliche Wucht dieser ersten Eruptionen eines Vulkans, der doppelt so groß war wie der heutige Vesuv, resultierte daraus, dass das Magma durch einen riesigen See aufstieg, dessen Wasser beim ersten Kontakt mit dem geschmolzenen Gestein verdampfte, und in gigantischen Feuersäulen explodierte. So türmten sich beeindruckende vulkanische Gebilde auf, welche nach und nach erodierten, bevor weitere Eruptionen immer wieder neue Massive in die Höhe wachsen ließen. Auch verschoben die Lavaströme der beiden Vulkane von beiden Seiten den Lauf des Flusses in ihrer Mitte und verschlangen die Sedimentböden, wo diese nicht bereits zuvor angehoben worden waren. Auf jede Explosion folgte eine Ruhephase, die von einigen zehn- bis zu einigen 100.000 Jahren dauern konnte: In dieser Zeit wurde glühende Lava zu Fels, Asche zu Sand, bildete sich Humus an der Oberfläche, und eine immer üppigere Vegetation kehrte zurück, bevor Feuer und Lava wieder alles zerstörten und neu erschufen.5
300.000 Jahre später waren die glühenden Ströme am großen Fluss endlich zum Stillstand gekommen. Sie hatten sich an beiden Ufern zu Hochebenen verfestigt, die nun der Erosion preisgegeben waren. Eine letzte Kaltzeit, die vor 80.000 Jahren begann und vor etwa 20.000 Jahren endete, beschleunigte diesen Prozess erheblich, indem sie den Grund der Täler bis auf das Sedimentsubstrat absenkte. Anschließend wurde dieses aufs Neue mit Anschwemmungen bedeckt, die der Fluss infolge eines vor einigen 10.000 Jahren erfolgten Anstiegs des Meeresspiegels herantrug, bevor dieser sich 4000 Jahre später auf dem heutigen Niveau stabilisierte.
So fand allmählich alles seinen Platz: Während der vergangenen 300.000 Jahre hatten Wasser und Erosion ausreichend Zeit, die alten vulkanischen Plateaus zu modellieren und zu strukturieren, sodass sie nun in freistehende Erhebungen zersplittert waren, von denen einige wie Vorgebirge über dem linken Ufer des Flusses aufragten, der sich an ihnen entlangschlängelt. Nun endlich bietet sich unseren Blicken ein vertrautes Gelände dar, dessen Einzigartigkeit sich nur durch seine Entstehungsgeschichte erklärt: Die zentrale Ebene in der Mitte der langgestreckten Halbinsel ist Latium, eingerahmt von den beiden Massiven der Sabatiner Berge im Norden und der Albaner Berge im Süden. Dem Strom, der sie durchquert, werden die Menschen den Namen Tiber geben, und auf dem von Tuffsteinhügeln geprägten Areal wird sich eines Tages Rom erheben.
Ein erst vor einigen Jahren entdecktes spektakuläres Phänomen zeigt indes, dass die natürliche Gestaltung der Landschaft bis in die Frühgeschichte hinein andauerte. So setzte der größte jener Seen, die im Südosten an die Stelle der einstigen Krater getreten waren, mehrmals gewaltige Schlammlawinen frei, sogenannte Lahare, die zwischen dem alten Vulkanmassiv und dem Fluss Erosionsrinnen in der Hochebene auffüllten. So gestaltete die Erde noch wenige Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung weiterhin jene Bühne, auf der sich die antike Geschichte abspielen sollte: eine Ebene mit weiten Horizonten und fruchtbaren Böden, die damals noch nicht von den majestätischen Aquädukten der Urbs durchzogen war.
Wenden wir uns nun dem eigentlichen Gelände Roms zu, dessen geologische Gestaltung sich noch heute, wenn auch unmerklich, fortsetzt.6 Und zwar bevor eine in drei Jahrtausenden ununterbrochene menschliche Besiedelung es auf spektakuläre Weise verwandelte, bevor durch sie Talsohlen angehoben, Hänge abgetragen und Kuppen eingeebnet wurden, sodass der ursprüngliche Boden überall verändert und überlagert wurde und heute unter einer Dutzende Meter dicken Schicht von Aushub aller Art verborgen liegt (vgl. Karte 1). Die beschriebenen geologischen Prozesse haben hier zu vielfach gepriesenen Vorzügen geführt, denn was den Standort der Stadt Rom auszeichnet, ist neben der Nähe zum Meer das Zusammentreffen eines bedeutenden Flusses mit markanten Anhöhen, die an seinem linken Ufer einige klar voneinander abgegrenzte Hügel bilden. Während die von der Erosion in das Sedimentplateau gegrabenen Täler auf der rechten Flussseite parallel zum Strom verlaufen, sodass dieser in einiger Entfernung vom Ufer lückenlos von Klippen überragt wird, haben am linken Ufer die Lavaströme bis unmittelbar an den Fluss herangereicht und ihn nach Westen abgedrängt. So scheint er an dieser Stelle regelrecht kehrtzumachen und dem Widerstand des Tuffgesteins zu weichen. Die auf diese Weise entstandene Biegung verlangsamte die Strömung und begünstigte in der Mitte des Flusses Ablagerungen, die sich nach und nach verfestigten, bis zunächst Sanddünen über die Wasseroberfläche hinauswuchsen und schließlich eine Insel entstand, an deren Seite sich bis ins 19. Jahrhundert ein zweites, kleineres Eiland befand wie das Beiboot eines größeren Schiffs.7 Somit war die Tiberinsel ein Spätankömmling im römischen Gelände, denn es ist zweifellos noch keine 5000 Jahre her, dass sie sich aus den Fluten erhob.
Am linken Ufer ragt ein steiler Hügel über der Insel auf: das künftige Kapitol. Anders als in heutiger Zeit, da hier nur eine Anhöhe mit einer weitläufigen ebenen Fläche in der Mitte anzufinden ist, ragten damals zwei durch eine deutliche Senke voneinander getrennte Hügelkuppen empor, wobei die größere näher am Fluss lag. Die Längsseiten dieses Ensembles erstrecken sich über nahezu 500 Meter, während die kurzen Seiten nur knapp halb so lang sind. Mit ihren auf drei Seiten gleichmäßig abfallenden, über vierzig Meter hohen Flanken bilden die beiden Zwillingskuppen eine Art natürliche Festung. Die Beschaffenheit des Ortes gab daher bereits damals zu erkennen: Wer das Kapitol beherrscht, hat ganz Rom im Griff. Von dort oben überwachte man nicht nur den direkt unterhalb des Hanges gelegenen Fluss und die Ebene am rechten Ufer, sondern auch eine kleine Niederung im Südosten, die das Kapitol von der nächsten Anhöhe trennt. Dieser mehr als doppelt so große Hügel, der damals noch nicht den Namen Palatin trug, ist die zweite große Erhebung des Terrains: Auf einen Untergrund aus fluvio-lakustrischen Sedimenten hatten der Sabatiner und der Albaner Vulkan – heute Vulcano Sabatino und Vulcano Laziale genannt – Ablagerungen geschoben, die ihrerseits wiederum im Pleistozän teilweise von Anschwemmungen des Tibers bedeckt wurden, der damals so mächtig war wie der Amazonas. Als Folge davon besteht ein Großteil des Palatins aus fruchtbarem Weidegrund. Ein wenig vom Ufer zurückgesetzt, aber dennoch nicht allzu weit vom Tiber entfernt, erhebt er sich zu einem massiven Plateau, das, anders als lange vermutet, keinerlei Einschnitte aufweist. Er hat die Form eines unregelmäßigen Trapezes, das man mit ein wenig gutem Willen auch als Quadrat betrachten könnte. Während er auf drei Seiten frei steht, verbindet ihn auf der vierten eine Art Pass mit einem weiteren Hügel, der Velia, und somit mit dem gesamten nördlichen Bereich des zentralen Areals. Die heute fast gänzlich eingeebnete Velia überragte die Ebene damals um gut dreißig Meter. Südlich wiederum trennt ein weites Tal den Palatin deutlich vom gegenüberliegenden Hügel, vom Aventin, der aufgrund seiner etwas abgeschiedenen Lage lange eine Außenseiterstellung unter den römischen Hügeln einnehmen sollte. Steil ragt dieser auf der einen Seite über dem Fluss auf, der sich an dieser Stelle wieder nach Westen wendet, und auf der anderen Seite fällt er sanft zum Landesinneren hin ab, ein bequemer Zugang, der eine Verteidigung jedoch so gut wie unmöglich macht. Der im Sommer von kühlenden Winden umgebene Palatin hingegen, nahe beim Fluss gelegen, weitläufiger und weniger schroff als der Kapitolshügel, aber dank seines Reliefs trotzdem deutlich isoliert, bietet ausgezeichnete Bedingungen zur Verteidigung und Besiedelung. Östlich des Palatins verbindet eine große Anhöhe mit drei Kuppen, der künftige Caelius, das römische Areal nahtlos mit jener riesigen Hochebene, welche die Lavaströme des Vulcano Laziale im Laufe der Zeit erschaffen hatten. Und so müssen wir die übrigen Anhöhen, auf denen sich die früheste Geschichte der Stadt abspielen sollte, weiter nördlich suchen, gegenüber dem Palatin und in der Verlängerung des Kapitols.
Dabei handelt es sich weniger um isoliert stehende Hügel als vielmehr um eine Art lang gestreckten Höhenzug, eine von Nordost nach Südwest verlaufende Verlängerung des Hochplateaus, die gegenüber dem Kapitol in mindestens drei kleinen, miteinander verbundenen Erhebungen endet. Nahezu parallel zu diesem Quirinal liegt, durch zwei Wasserläufe aus dem vulkanischen Tuffmassiv geschnitten, der künftige Viminal. Von seiner Kuppe, die sich auf gleicher Höhe befindet wie die vulkanische Ebene, fällt er ebenso zur zentralen Senke in der Mitte des Areals hin ab wie der schmale Cispius und der breite Oppius, westliche Ausläufer jenes Bereichs, der später den Namen Esquilin erhalten sollte. So sind die Hügel Roms also letztlich nichts anderes als die Folge von Erosion auf einem ursprünglich einheitlichen vulkanischen Plateau, mit dem die meisten von ihnen auf natürliche Weise verbunden bleiben. Daher sollte man sie auch weniger einzeln, als vielmehr in der Gesamtschau behandeln. So betrachtet scheinen, obwohl sich die Erhebungen beinahe ringförmig um ein zentrales Erosionstal gruppieren, einander zwei Blöcke beiderseits der Niederung gegenüberzustehen: Einer Achse Palatin-Velia, die sich gewissermaßen an den Caelius anlehnt, steht im Nordwesten die Achse Kapitol-Quirinal gegenüber, während Esquilin und Aventin beide zu weit entfernt liegen, um in dieser Formation, welche die Erdgeschichte der Menschheitsgeschichte hinterlassen hat, eine Rolle zu spielen.
Kapitol, Palatin, Aventin, Caelius, Oppius, Viminal, Quirinal, diese willkürlich ausgewählten sieben Hügel, sind also keineswegs die einzigen im Gebiet der späteren Urbs, und auch das rechte Flussufer darf man nicht einmal für Betrachtungen zur Zeit vor der Stadtgründung außer Acht lassen, selbst wenn sich Rom für lange Zeit ausschließlich am linken Tiberufer entwickeln sollte. Auf dieser Seite sind die Erhebungen, der künftige Vatikanhügel und der Gianicolo, auf ganz andere Weise zugeschnitten, wie wir gesehen haben. Sie sind deutlich höher als ihre Pendants am anderen Ufer – der Gianicolo etwa ragt achtzig Meter in die Höhe und der Monte Mario sogar 139 Meter – und bilden eine lang gestreckte Klippe über dem Tal. Erosion und tektonische Verschiebungen hatten sie zu Anhöhen geformt, in denen Sedimente, Sand und Lehm vorherrschen. Und gerade dort, wo sie am weitesten vom Fluss entfernt liegen, umstreicht jener die Hügel des linken Ufers und formte mit der Zeit eine Insel. Für die Römer der ersten Jahrhunderte ihrer Geschichte war dieses Ianiculum eher eine natürliche Begrenzung als eine Expansionsfläche.
Kehren wir also an das linke Ufer zurück, das einzige, das für lange Zeit römisch sein sollte. Wovon dieses Gebiet lebt und was es im Grunde, nach dem Erlöschen der Vulkane in der Region erschaffen hatte, war das Wasser: Der Strom und seine zahlreichen Zuflüsse hatten die Umrisse der römischen Hügel aus dem Tuffgestein gewaschen. Heutzutage kanalisiert, versteckt oder schlichtweg versiegt, ist das Wasser in jener Zeit überall auf dem mit weiten sumpfigen Flächen übersäten Areal präsent. Aus den natürlichen Wasserspeichern des Apennins und der nahe gelegenen alten Vulkane strömt es sowohl ober- als auch unterirdisch in das untere Tibertal. Begünstigt durch die Überlagerung verschiedener mehr oder weniger durchlässiger Gesteinsschichten, entspringen am Fuß der römischen Hügel, insbesondere am linken Ufer, zahlreiche Quellen – ein großer Vorteil in Zeiten, da Menschen noch von ihrer unmittelbaren Umgebung abhingen. Auch die Täler zwischen den Hügeln sind von Flüssen durchzogen, die mancherorts tosend ein Hindernis überwinden, das ihnen ein noch junges Gelände in den Weg stellt, während sie sich an anderen, flacheren Stellen weiteten und ihr träge abfließendes Wasser Sümpfe bildet. Im südlichen Teil des Areals vereinen sich mehrere kleine Wasserläufe in der weiten Senke zwischen Palatin und Aventin und münden ein Stück stromabwärts der Insel, an der Stelle, wo sich der Fluss nach Westen wendet, in den Tiber. In diese Senke ergießt sich auch ein zweites Wassersystem, das möglicherweise zuvor in Richtung des künftigen Forums geflossen war, dann aber durch etliche Barrieren im Bereich der Velia nach Süden umgelenkt wurde: Infolgedessen durchzieht tatsächlich ein kleines Tal jenen Bereich, in dem sich in ferner Zukunft das Kolosseum erheben sollte, jedoch bildete das Wasser dort, anders als vermutet, niemals einen See. Und somit ist der Palatin seit jeher auf drei Seiten von Gewässern umgeben.
Weiter nördlich, jenseits des durch Velia und Oppius gebildeten Riegels, mündet das durch drei Täler zwischen Quirinal und Oppius herabströmende Wasser in das weite Becken, das diese Hügel von Kapitol und Palatin trennt. Dort fließt es durch die lehmigen Böden, denen dieser Bereich später den Namen Argiletum verdanken sollte, bis zur Spitze des Bogens, den der Tiber an dieser Stelle beschreibt. Hier stößt der Fluss wieder an die Hügel, nachdem er zuvor in einem nahezu rechten Winkel nach Osten abbiegt, wodurch nordwestlich der Anhöhen eine weite, vollkommen ebene Fläche zu finden ist, die mehrere von den Höhen des Quirinals herabfließende Wasserläufe durchziehen. Einer oder zwei davon münden ein kleines Stück oberhalb jener Insel in den Tiber, zu deren Entstehen sie beigetragen hatten, ein weiterer durchquert die gesamte Schwemmlandebene von Ost nach West in einem Verlauf, der dem des heutigen Corso Vittorio Emanuele II entspricht, und mündet weiter nördlich in die große Biegung, die der Fluss dort beschreibt. Im Zentrum der Ebene jedoch ist das Bodenniveau so niedrig – der Name der Kirche Sant’Andrea della Valle erinnert daran –, dass sich das Wasser dort sammelte und einen mehrere Hektar großen Sumpf bildete. Dasselbe Phänomen war, wenn auch in kleinerem Maßstab, im Becken des künftigen Forums und vor allem im Bereich zwischen Kapitol und Palatin zu beobachten, wo sich die aus den Hügeln herabfließenden Bäche mit dem Flusswasser auf einem Schwemmland vereinen, bevor sich der Strom wieder gen Westen wendet. Aber nicht nur dort, so gut wie überall tritt der Tiber häufig über seine grasbewachsenen Ufer und überschwemmt jene Ebenen, die er selbst entlang des Ufers zu natürlichen Terrassen geformt hatte.
So also stellte sich das Areal dar, bevor die Anwesenheit der Menschen es, zunächst kaum merklich und später immer deutlicher, verändern sollte. Doch welche Vor- und Nachteile bot der Platz in Hinblick auf die künftige Geschichte der Menschheit? Paradoxerweise scheinen auf den ersten Blick die Nachteile zu überwiegen: Hier gab es kein großes, zusammenhängendes Plateau, wie sie im nahen Etrurien in so großer Zahl zu finden waren und sowohl hervorragende Verteidigungsmöglichkeiten als auch dutzende Hektar Siedlungsfläche boten. Ebenso fehlten die Metalle, deren reiche Vorkommen – nach antiken Maßstäben, wohlgemerkt – Etrurien zum Eldorado aller Seefahrer des archaischen Mittelmeerraums machen sollte und jene Städte, welche die Abbaustätten kontrollierten, zu reichen, mächtigen Fürstentümern. Hier haben wir stattdessen einen Ort, der räumlich nicht von seinem Hinterland getrennt war, sondern im Norden und Südosten gewissermaßen dessen Verlängerung bildete. Einen Ort, gleichsam zersplittert, fragmentiert und aus mehreren Hügeln bestehend, die durch tiefe Täler nahezu vollständig voneinander isoliert waren, einen Ort also, der in topografischer Hinsicht weder Einheit noch Kohärenz aufwies.
Doch schon in jenen fernen Epochen, bevor die Menschheitsgeschichte im großen Lauf der Zeit den Staffelstab übernahm, machte seine geologische Beschaffenheit diesen Ort zu etwas Besonderem. Denn der Fluss, der das Hügelareal säumte, ohne es zu durchqueren, war mit seinen 400 Kilometern Länge und rund vierzig Nebenflüssen der mächtigste Strom der gesamten mittleren und südlichen Halbinsel. Der Po war natürlich bedeutender, doch verlief er viel weiter nördlich, wohingegen der Tiber Landschaften durchquerte, die im Zentrum der fruchtbarsten und zugänglichsten Seite einer Halbinsel lagen, die ihrerseits das Zentrum des Mittelmeers bildete, jenes Weltmeers der antiken Welt. Und dieser Fluss machte gleichsam Halt am Fuß der Hügel, die an genau der Stelle über seinem Bett aufragten, wo er vom Meer aus dank einer Furt und einer Insel zum ersten Mal passierbar war. Und exakt auf diesen strategisch günstigen Ort einer ‚ersten Brücke‘ liefen schräg abfallende Täler zu, die eines Tages Menschen dorthin führen sollten. So hatten, noch bevor die Geschichte sie auserwählte, Erde und Zeit hier eine einzigartige Stätte geschaffen, die mit ihrem Fluss, ihren Tälern und ihren Höhen eines Tages sowohl Durchzugsort als auch Ankerplatz sein würde. Die sich zum Lebensraum entwickeln konnte, weil sie zuvor ein unumgänglicher Kreuzungspunkt gewesen war: Hier trafen Wege aufeinander, die zum einen das gebirgige Landesinnere mit der Küste verbanden und zum anderen zwei äußerst fruchtbare Regionen im Norden und Süden.
Auch die Materialien, die die Urbs benötigen sollte, um entstehen, wachsen und sich im Laufe der Jahrhunderte unablässig wandeln zu können, waren bereits vorhanden: Die Sedimente des Pleistozäns lieferten neben dem für zukünftige Bauwerke und Infrastruktur nötigen Sand und Kies auch den Lehm für Dach- und Mauerziegel. Den dicken Schichten vulkanischen Ursprungs entstammten die verschiedenen Varianten des gleichermaßen kompakten wie leicht zu bearbeitenden Tuffgesteins, während noch später die Lava des südöstlichen Plateaus dem Pflaster der römischen Straßen seine legendäre Festigkeit verleihen würde. Und schließlich hätten die Römer ohne die Verfügbarkeit vulkanischer Sande niemals den Zement erfinden können, dessen Einführung zu Zeiten des Kaiserreichs eine regelrechte Revolution in der Baukunst bedeuten sollte.
Die geologische Vorgeschichte des Ortes schuf somit die Voraussetzungen für die Geschichte der Menschen: ein mächtiger Wasserlauf, der das Innere der Halbinsel mit den Küstenebenen verbindet, eine Insel, die seine Überquerung ermöglicht, zwei besonders frei stehende und flussnahe Anhöhen, zwei einander gegenüberstehende Hügelsysteme mit einer zentralen Niederung in der Mitte, reich fließende Quellen, der Kontrast zum nördlichen Flussufer mit seiner vollkommen anderen Landschaftsform, Zugang zum nahen Meer und somit zu fernen Gestaden, aber gleichzeitig auch die Notwendigkeit, erhebliche Umgestaltungen vorzunehmen, ohne die ein solcher Ort nicht dauerhaft bewohnbar wäre.
Solches Potenzial barg also dieses einzigartige, noch namenlose Areal, während im fernen Fruchtbaren Halbmond bereits mächtige Städte entstanden, erblüht, wieder gesunken und vollständig verschwunden waren. Doch eines Tages sollten diese Hügel beim Fluss von einem bloßen Durchgangsort zum Sitz einer Stadt werden, die bald schon von ihren Nachbarn gefürchtet wurde und weit über die Region hinaus Einfluss hatte. Wann, wie und aus welchem Grund kam es zu diesem Entree in die Geschichte? Der Philosoph fragt sich mit Leibniz, wieso es eher Etwas gibt als Nichts. Der Historiker hingegen stellt die Frage nach den Ursprüngen Roms: Wieso entstand Rom genau dort und nicht anderswo? Oder genauer gesagt: Wieso konnte an diesem Ort etwas entstehen, und wieso wurde aus diesem Etwas Rom?