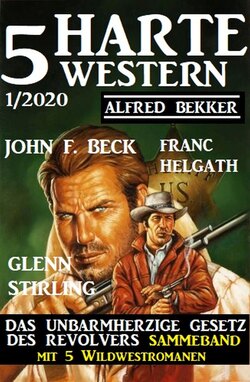Читать книгу 5 harte Western 1/2020: Das unbarmherzige Gesetz des Revolvers: Sammelband mit 5 Wildwestromanen - Alfred Bekker - Страница 8
Roman
ОглавлениеAm Tag, als sein Vater starb, war der junge Wolf neun Wochen alt. Es war ein Tag im Juni, heiß, erfüllt vom Duft der Blüten und in der Luft das Summen Tausender von Insekten. Der Himmel war blau, die Bäume grün und sogar das Grau der Felsen am Rande der Höhle, in der die Welpen mit ihrer Mutter lagen, schien zu leuchten. Und da hörten sie den fernen Schuss. Es klang gar nicht sehr laut, und doch zuckte die große schwarze Wölfin zusammen, als habe sie einen Schlag erhalten. Und ihre großen hellen Augen waren auf den Höhleneingang gerichtet. Keines ihrer Jungen wagte sich zu rühren, als spürten alle sechs, dass etwas Schlimmes, etwas Furchtbares passiert war...
*
Der Alte setzte die Sharps ab und blickte auf seinen Sohn, der neben ihm im Gras zu sehen war.
„Wir haben ihn. Diesmal hat es ihn erwischt. Ich glaube, es ist der Wolf. Es war ein sauberer Schuss. Hoffentlich ist jetzt Schluss mit dem Kälberreißen. Diese Bestie hat uns verdammt viel Ärger in den letzten Monaten gemacht.“
„Komm, sehen wir uns das Tier mal genau an“, schlug sein Sohn Ben vor und bewegte sich einige Schritte in Richtung des reglosen Kadavers. Sein Vater folgte ihm. Aber er blieb immer noch misstrauisch und behielt seine Sharps schussbereit. Dieses Misstrauen bestätigte sich, als er weitere Einzelheiten sah.
„Eh, das ist kein Wolf, Ben, das ist... das muss ein riesiger Hund sein. Komm, sieh ihn dir an!“
Ben hatte noch nie einen Hund wie diesen gesehen, so wolfsähnlich. „Ein Hund, Pa? Sieht so ein Hund aus?“
Der Alte nickte. „Gewiss, ich weiß doch, German-Joe hat so einen. Er hat ihn aus Deutschland mitgebracht. Schäferhund nennen die diese Viecher. Sind wie Wölfe und sollen unheimlich treu sein. Das hier, das ist so einer. Verwildert vielleicht. Mann, sieh dir den mal genau an. Kein Wunder, dass wir so viele Kälber verloren haben. Und ich wette, Ben, das ist auch der Bursche, der das Rudel letzten Winter angeführt hat. Der ist ja glatt noch mal so groß wie ’n Wolf."
Er beugte sich hinab, um den leblosen Körper aufzuheben. „Verdammt, Ben, greif mit an, der ist schwer wie Blei!“
Der junge Bursche zeigte auf die Einschusswunde an der Brust. „Glatt aufs Blatt, Pa, prima gezielt.“
„Da, überall Narben. Der ist off genug getroffen gewesen, der Kerl. Aber diesmal war es aus. Nimm ihn an beiden Hinterbeinen! Etwas anziehen, gut so!“
„Was willst du mit dem Kadaver, Pa?“
„Weg damit von der Weide. Weiter drüben, da schmeißen wir ihn in die Schlucht. Und dann...“
„Die Wölfin?“
„Noch nicht. Wir warten bis nächste Nacht. Da wird sie sich aus ihrem Loch wagen. Ich wette, die sitzt irgendwo drüben in den Felsen mit ihrer Brut. Wenn sie dort ist, kriegen wir sie nicht.“
„Und wenn wir die Hunde mitnehmen?“
„Du weißt, dass die Hunde vor dem hier Angst hatten. Die Wölfin suchen wir allein. Vielleicht kommt sie. Hierher, um den da zu suchen. Und dann knallen wir sie ab. Und dann die Hunde, erst dann, verstehst du?“
*
Sie hatten Hunger, der wie ein Messer in ihren Eingeweiden stach. Knurrend und fiepend sahen sie auf ihre Mutter, die groß und gewaltig am Höhleneingang stand und hinaus in die Nacht starrte.
Die sechs Welpen winselten und drängten sich aneinander. Vier Schwestern hatte der junge Wolf, die alle ungefähr so groß waren wie er selbst. Kleiner und ganz am Schluss geboren worden. Er trollte auch jetzt wieder zur Mutter und versuchte zu saugen, aber es passte ihr nicht und sie verscheuchte ihn knurrend.
Die anderen hatten kein Verlangen mehr nach Muttermilch. Sie wollten Fleisch. Bisher hatte der Vater immer welches gebracht. Vater, dieser riesige Bursche, der etwas anders aussah als Mutter. Größer, stärker und mit einem wuchtigeren Kopf. Auch war sein Fell nicht so grau am Bauch wie bei Mutter. Dinge jedoch, die keiner der sechs Welpen beschäftigten. Sie hatten Hunger. Vater war nicht mit Fleisch gekommen. Und die Mutter wich nicht von den Jungen, als fürchtete sie, jemand werde sie in der Zeit finden und töten, während sie die Höhle verließ.
Sie spähte nach draußen, den Kopf weit vorgereckt, die Nase spürend gebläht. Ihre Augen funkelten im matten Mondschein wie Irrlichter.
Wieder scheuchte sie unwillig ihren Kleinsten von sich, machte einen Schritt nach vorn, witterte, noch ein Schritt, und plötzlich trabte sie den schmalen Pfad ins Tal hinab.
Immer wieder blieb sie stehen, witterte, schien zu lauschen, doch dann trabte sie weiter, hinab ins Tal mit seinen saftigen Weiden, wo irgendwo in weiter Ferne die Holzgebäude der Farm standen, wo Rinder weideten und wo man aufpassen musste, wollte man nicht von einem dieser Menschen gesehen und erschossen werden, die dort lebten.
Die Wölfin, schwarz wie die Nacht, in der sie lief, kam hinab ins Tal, ins hohe Gras, das oft höher war als sie selbst, und sie streifte durch Büsche, deren Blätter kaum raschelten, so geschickt bewegte sie sich.
Sie war ein starkes Tier, eine Königin ihres Rudels gewesen. Und sie hatte es geführt, dieses Rudel. Dann aber, vor zwei Wintern, war er gekommen, der Große mit den steil stehenden Ohren. Er kam, und sofort fielen die jüngeren Wölfe des Rudels über ihn her. Es dauerte wenige Minuten, da hatte der Riese sie zu winselnden Bündeln gemacht und war an die Leitwölfin herangekommen. Und sie war nicht auf ihn losgegangen. Sie musste wohl gespürt haben, wer er war, dieser große König.
Noch einmal versuchten die Wölfe im Rudel, den Fremdling zu vertreiben, besonders ein junger, sehr starker Wolf, der die Wölfin gerne für sich allein haben wollte, kämpfte verzweifelt, doch dann, als der Kampf vorbei war, trollte sich der junge Wolf blutend, während der Fremde das Rudel anführte, von da an den ganzen Winter lang.
Und von dieser Stunde ging es dem Rudel gut. Sie wurden an Farmen herangeführt, wo sie sichere Beute machen konnten. Sie erwischten nicht nur Wild, sie überfielen Gehöfte, drangen in Ställe ein, schlugen Kälber und Schweine. Sie jagten, wo das Risiko klein und die Beute gross war. Der neue Leitwolf führte sie, und erst, als der Frühling kam, als sich das Rudel auflöste und zu Paaren davontrollte, verschwand er mit der schwarzen Wölfin in den Bergen. Und wieder wurde er zum Schrecken der Farmer.
Im ersten Sommer gebar ihm die Wölfin sieben prachtvolle Junge, die größer wurden als andere Wolfswelpen. Und die im Winter dann den Ton bei den Jungtieren im Rudel bestimmten. Es wurde ein langer, ein harter Winter. Viele Wölfe in anderen Rudeln verhungerten. Bei dem großen Leitwolf aber kriegten sie mehr als sonst. Er strich mit dem Rudel weit nach Süden hinunter, wagte sich geschickt bis in eine Eisenbahnstadt, wo das Rudel unverfroren eines Nachts in einen Mietstall eindrang, eine Panik unter den entsetzten Pferden anrichtete, wobei sich zwei Pferde losrissen.
Das Rudel jagte den Pferden in die Nacht hinein nach und riss beide gut zwei Meilen von der Stadt entfernt. Als die Bewohner der Stadt die Wölfe stellen wollten, fanden sie erst gegen Morgen die Kadaver der beiden Pferde und das, was davon noch übrig war.
Die schwarze Wölfin mochte vielleicht an diesen Husarenstreich gedacht haben, möglich, dass sie sich nur um ihren Mann sorgte, um den Riesenwolf, der so stark und so schön war, dass sie sich ihm einfach untergeordnet hatte.
Sie trabte weiter, und um sie raschelte das Gras. Oben am Himmel stand der Mond bleich und wie die Laterne einer geisterhaften Grotte. Schwarz und drohend ragten die Äste der Bäume in den nächtlichen Himmel.
Irgendwo weit weg brüllte ein Stier. Danach war nur noch das Zirpen der Grillen zu hören. Später, als die Wölfin den Bach erreicht hatte, hörte sie eine Eule rufen, die Wölfin verhielt, reckte den Kopf witternd, und fast zehn Minuten blieb sie nahezu reglos.
Der Wind wehte von den Bergen. Die Wölfin spürte, dass sie vom Tal her keine Witterung bekam und änderte ihre Laufrichtung. Sie wollte jetzt am Rande des Baches entlang zum Rand der großen Weide traben. Auf diese Weise konnte sie wieder Witterung bekommen, denn der Wind trieb ihr etwas von dem zu, was sich auf der Weide befand.
Immer noch trabte sie am Bach, dessen Plätschern alle anderen Geräusche übertönte. Endlich kam eine Stelle im Gebüsch, durch das sie schlüpfte, um auf die Weide zu gelangen.
Hohes Gras schlug ihr gegen die Nase. Sie blieb stehen, reckte den Kopf und schnupperte. Der Wind kam nun ein wenig von der Seite. Er trug ihr keine ungewöhnlichen Gerüche zu.
Sie trabte weiter, aber irgend etwas warnte sie. Abermals blieb sie stehen, witterte, lauschte, aber nichts verriet einen Feind. Und doch sagte ihr der Instinkt große Gefahr voraus.
Sie zögerte, wartete, Dabei war sie von ungewöhnlicher Wachsamkeit. Nichts schien ihr zu entgehen. Aber da verriet sich nichts. Alles schien wie sonst. Und doch spürte die Wölfin eine tiefe Unruhe.
Geduckt machte sie einen Schritt nach vorn durchs hohe Gras.
Nichts geschah, In der weiteren Umgebung zirpten die Grillen, und wieder schrie in der Ferne eine Eule.
Die Wölfin duckte sich noch tiefer, kroch fast, als sie sich voranschob. Einen Schritt, zwei...
Plötzlich zuckte der Blitz von einem der Bäume halbrechts. Der Blitz, der Schlag in den Rücken der Wölfin. Dann der Knall.
Die schwarze Wölfin machte einen Satz in die Luft, fegte herum, als sie auf allen Vieren landete, jagte ins Gebüsch zurück.
Noch einmal blitzte und krachte es, aber die Wölfin war weit weg von der Stelle, wo das Projektil die Erde auffetzte.
Sie hechelte in einem dichten Gebüsch, lag am Boden, den Kopf auf die kühle Erde gepresst, während auf ihrem Rücken eine große Wunde klaffte, während dort der Saft des Lebens davonrann.
Plötzlich hörte sie Stimmen. Eine tiefe Stimme sagte etwas, dann antwortete eine jüngere Stimme.
Schritte, Stimmen und die anderen Menschengeräusche entfernten sich. Verstummten schließlich.
Die Wölfin war allein mit sich und ihrem wahnsinnigen Schmerz, der immer stärker wurde.
Sie versuchte die Wunde zu lecken, aber sie konnte den Kopf nicht drehen. Alles war wie steif, und diese Lähmung nahm offenbar zu. Als sie versuchte aufzustehen, versagten ihr die Hinterbeine den Dienst.
Sie schleppte sich kriechend durch die Büsche. Und aus der Rückenwunde floss das Blut, während in ihrem Unterleib die Schmerzen wüteten.
Weit kam sie nicht, bis zum Bach gerade. Und dort sackte sie zusammen, als das kühlende Nass vorübergehende Linderung brachte.
Sie lag mit jämmerlichen Schmerzen halb im Wasser, fast eine Stunde lang. Und da hörte sie plötzlich die Hunde.
Das Kläffen schallte weit durch die Nacht. Zwei waren es, und sie schienen kaum noch zu halten sein.
Die Wölfin versuchte sich aufzurichten, aber auch dazu hatte sie keine Kraft mehr. Ihr Unterleib schmerzte jetzt nicht mehr. Da war alles wie tot. Dort empfand sie nichts, dort bewegte sich nichts mehr.
Und plötzlich kamen sie. Der eine von rechts, der andere von links. Zwei mittelgroße, struppige Burschen mit kleinen, runden Ohren und stumpfen Schnauzen, kupierten Schwänzen und Halsbändern, die zum Schutz gegen Halsbisse außen mit Stacheln versehen waren.
Mit wildem Gekläffe stürzten sie auf die schwarze Wölfin zu.
Die Wölfin war halb gelähmt, durch den Blutverlust nahezu völlig geschwächt und bot kaum noch Gefahr.
Aber das sah nur so aus. Denn plötzlich sprang der Hund mit den weißen Flecken auf sie los. Er versuchte sie am Hals zu schnappen.
„Zim! Zim! Hierher!“, schrie eine Männerstimme. „Boll, Zim, hierher! Alle beide!“
Boll hörte so wenig wie Zim. Aber Boll zögerte, stutzte, wich einen Schritt zurück. Doch Zim, der weißgefleckte, war wie irr. Er schnappte nach dem Hals der Wölfin. Und da auf einmal nahm sie alle Kraft zusammen. Ihr Kopf kam noch einmal hoch, der Fang öffnete sich, die Zähne leuchteten im Mondlicht, dann schnappte der Fang blitzschnell zu. Und der Weißgefleckte heulte auf, dann gurgelte er, und das schützende Halsband, das solche Fangbisse verhindern sollte, war nach oben gerutscht. Die Wölfin hatte den Weißgefleckten an der Kehle, und ihr Kiefer schloss sich mit einer Unaufhaltsamkeit, der dieser weißgefleckte Bastard nichts entgegenzusetzen hatte. Er bekam keine Luft, mehr, gurgelte, röchelte, und dann lief die aufgerissene Schlagader aus wie ein Schlauch.
Boll, der andere Hund, bellte, wagte sich aber keinen Zoll näher an die schwarze Wölfin und den tödlich verletzten Zim heran.
Doch plötzlich trat ein Mann neben ihn, gab ihm einen Tritt, und Boll machte jaulend, dass er ein Stück davonkam. Kurz danach krachte ein Schuss.
Alles, was die schwarze Wölfin sah, während sie sich in dem Hund festgebissen hatte, war der Blitz, der auf ihre Augen zuschoss und sie blendete. Den Einschlag in den Schädel spürte sie nicht mehr. Aber selbst dann, als sie in sich zusammensackte, löste sich der Krampf ihrer Kiefermuskeln nicht. Im Tode noch hielt sie ihr Opfer fest.
Ein zweiter Schuss erlöste den Hund Zim von seinen Schmerzen.
Der Mann lud das Gewehr wieder auf, drehte sich halb um und rief: „Sie ist es. Verdammt, Ben, jetzt haben wir Ruhe mit den Wölfen. Morgen suchst du am besten nach den Jungen.“
„Die verhungern sowieso, Pa“, rief der junge Bursche von der Weide her.
„Weiß der liebe Kuckuck, wie groß sie schon sind. Such sie und schlag sie tot. Morgen. Jetzt hilf mir, dieses gelbgezähnte Mistvieh wegzuschaffen. Sie hat mir Zim umgebracht. Im Tode noch. Ich sage dir, Ben, das ist fast so ein Teufel wie der Kerl gestern. Aber sie ist eine Wölfin. Sieh sie dir mal an!"
Der Junge kam und starrte auf die beiden toten Tiere.
„Mann, du hast ihr ja beim ersten Schuss den ganzen Rücken aufgerissen.“
Der Alte nickte. „Aber du siehst, man muss sie richtig treffen, sonst sind sie noch zu allem imstande. Na ja, Zim war zwar ganz gut, aber wir ziehen uns einen anderen. Sieh mal nach, wohin Boll gelaufen Ist! Dieses feige Warzenschwein! Aus dem wird nie mehr was Gescheites. Such ihn, Ben!“
Der Alte riss Zim aus den Fängen der Wölfin, packte den schwarzen Räuber und zog ihn aus dem Bach.
*
Sie winselten, duckten sich zusammen und sträubten vor Angst ihr Fell. Vergeblich spähten sie zum Höhleneingang, aber die Mutter, die sie dort erwarteten, tauchte nicht auf. Die Nacht verging, und der Tag kam. Ein heißer, ein schwüler Tag. Drohende schwarze Wolken zogen auf. Im Westen leuchtete der Himmel zwischen den grauschwarzen Vorhängen quittegelb. Aber schließlich verfinsterte sich der Himmel auch im Norden.
Die jungen Wölfe spürten die Gefahr des Unwetters nicht. Ihre Angst um die immer noch verschwundene Mutter war größer.
Der junge Wolf war der stärkste des Wurfs. Wie selbstverständlich, dass er sich vorsichtig zum Höhleneingang wagte. Er steckte den Kopf ins Freie. Eine Hummel näherte sich, umsummte ihn, und er versuchte nach ihr zu schnappen. Doch sie brummte davon.
Er sah sich nach allen Seiten um. Einige der Gefahren, die da lauerten, kannte er schon. Da gab es in der Gegend einen Wolverine, der ebenfalls mit seinem Weibchen Junge hatte und nach allem suchte, was fressbar war. Dieser fast bärengroße Vielfraß hatte so manches Huhn geraubt, das die Farmer den Wölfen andichteten. Vielleicht, weil sie den Vielfraß noch nicht gesehen hatten und seine Spuren nicht fanden.
Es gab auch noch den Adler, der oft genug oben am Himmel schwebte und vielleicht auch einen jungen Wolf angreifen würde. Aber schlimmer noch waren die Wespen, auf deren Nest Ser einmal gestoßen war, als er und seine Geschwister von der Mutter auf Streifzug mitgenommen worden waren. Wespen, das wusste er, konnten einem das Leben ganz schön vermiesen.
Die Sorge um die Mutter ließ ihn seine Angst vergessen. Er machte einen Schritt ins Freie, noch einen, dann einen kleinen Sprung bis zu dem Podest vor der Höhle; er sah sich um, und außer der Hummel, die wieder über ihm brummte, war keine Gefahr.
Als er nach vorn blickte, schlängelte sich eine Eidechse davon, und weiter unten im Tal flog kreischend ein Häher von einer Birke. Auf sein Geschrei hin, das den jungen Wolf der Mitwelt ankündigte, schwiegen alle anderen Vögel.
Er begann weiterzugehen. Eine heiße, stechende Sonne strahlte vom hohen Himmel, und der junge Wolf sah nicht, dass diese Sonne in wenigen Minuten von pechschwarzen, gelbumrandeten Wolken verdeckt sein würde.
Seine Mutter hätte ihn jetzt schleunigst zur sicheren Höhle zurückgeführt. Aber da war keine Mutter. Da waren nur die Geschwister, die sich ängstlich am Höhleneingang zusammendrängten und dem mutigen Bruder zusahen, der mittlerweile ganze zwanzig Meter weit allein in die wilde Freiheit gekommen war.
Er schien selbst überrascht von seinem Heldenmut, dass er sich nach den Geschwistern und der trauten Höhle umsah, wieder nach vorn in die drohende Ungewissheit blickte, sich dann aber doch entschied, weiterzugehen.
Ein paar Schritte kam er, als vor ihm voller Entsetzen ein Kaninchen aufsprang. Er war so erschrocken, dass er zusammenzuckte, als sei er geschlagen worden. Dann aber kam sofort der Jagdinstinkt. Das Kaninchen floh. Flucht, das bedeutete Feind.
Der junge Wolf sprang dem Kaninchen nach. Er war langsam, viel zu ungeschickt. Dann stolperte er auch noch über einen morschen Ast, überschlug sich, rannte weiter talwärts, und das Kaninchen schlug einen Haken, tauchte irgendwo unter, und er raste den Hang hinunter, hatte zuviel Fahrt, konnte sich nicht mehr halten, überschlug sich wieder und kollerte, während er jämmerlich winselte, den Steilhang hinab bis zu dem Bach, in den er mit einem Klatschen stürzte.
Der Bach war nicht sehr reißend, aber er nahm das Wollknäuel doch ein gutes Stück mit, schwemmte es gegen herabhängendes Dornengestrüpp, und hier erfuhr der junge Wolf, dass nicht nur Wespen Stacheln haben.
Quiekend versuchte er, an Land zu kommen, strampelte, planschte, und hatte endlich Grund unter den Füßen. Aufgeregt und mit bis zum Halse pochendem Herzen strampelte er ans sichere Ufer.
Dort hockte er sich mit eingeklemmter Rute hin, schüttelte sich, schnaubte und zwinkerte verdutzt. Denn da bewegte sich etwas vor ihm, das er noch nie gesehen hatte. Aber er empfand sofort Angst und Wut zugleich beim Anblick dieses sich schlängelnden, schillernden Körpers.
Er wusste nicht, dass es ein Reptil war. Er hatte auch noch nie von einer Waldklapperschlange gehört. Und dass sie sehr giftig war, ahnte er vielleicht.
Möglich, dass er sein Heil in der Flucht gesucht hätte, wäre da hinter ihm nicht der Bach gewesen. Und dieser Bach mitsamt dem Dornenbusch gehörte zu einer sehr frischen, höchst unangenehmen Erinnerung für ihn. Also blieb nur Abwarten.
Es ringelte, glitt, schob da vor ihm, und ein leises, sehr eigenartiges Rasseln ertönte. Der Kopf des Reptils näherte sich Sam. Er sah eine zuckende, tanzende Zunge aus dem Rachen des merkwürdigen Tieres kommen, und er entdeckte zwei riesige Zähne.
Und jetzt kam sein Instinkt ins Spiel, der ihm einen angeborenen Zorn und einen Todesmut allen Schlangen gegenüber einflößte. Das hatten Wölfe, Coyoten und Greifvögel gemeinsam.
Auch die Schlange schien zu ahnen, dass sie hier ein zwar noch sehr junges, aber doch zum Todeskampf entschlossenes Exemplar der Gattung vor sich hatte, die zu ihren erbittertsten Feinden zählte.
Das Nackenhaar des jungen Wolfes sträubte sich. Er stemmte die Vorderbeine ein, knurrte böse, als das Rasseln des Schlangenschwanzes noch lauter wurde.
Die Schlange war von der Witterung aufs höchste gereizt. Hier unten am Bach, wo die Schwüle noch deutlicher war als oben auf dem Berg, hatte sich das Reptil auf die Jagd gemacht, um Frösche zu fangen. Nun befand es sich einem jungen Wolfsblut gegenüber.
Der Hass der Schlange auf den jungen Feind war womöglich noch größer und entschiedener als der des Vierbeiners.
Entschlossen, es rasch und endgültig zu entscheiden, ließ die Klapperschlange ihren Kopf nach vorn zucken, bereit, sofort zuzubeißen.
Der junge Wolf sah es, machte einen Sprung zur Seite, und während der Kopf der Schlange wie ein Pfeil an ihm vorbeizischte, biss er reaktionsschnell in den Leib des Reptils.
Der Kopf der Schlange zuckte herum.
Der junge Wolf machte wieder einen Satz, war jetzt hinter der Schlange, biss wieder in ihren Leib, ließ aber sofort wieder los, sprang zurück, und als der Schlangenkopf mit den Giftzähnen abermals auf ihn zuschoss, sprang er blitzschnell von ihr weg. Dabei fiepte und knurrte er abwechselnd vor Aufregung.
Die Schlange peitschte mit dem Schwanz. Die kleinen Zähne des jungen Vierbeiners hatten sie nur leicht, aber doch schmerzhaft verletzt. Die Wut des Reptils stieg jäh, und immer wieder schoss ihr Kopf auf den jungen Feind zu.
Er entkam diesmal nur um Haaresbreite den Giftzähnen, deren Biss binnen weniger Minuten zum Abschluss seines Lebenslaufes geführt hätten.
Aber er war geschickt, und sein Jagdtrieb ließ seinen Zorn noch wachsen. Immer wieder biss er zu, sprang geschickt um die Schlange, biss wieder, wich ihrem Stoß aus, und da kam ihr Kopf abermals auf ihn zu, schon ermüdeter, erschöpfter und vielleicht auch geschwächter von den nunmehr sieben Bissstellen, an denen die Schlange blutete.
Erneut sprang der junge Wolf zur Seite, aber jetzt wagte er es, sie nicht nur irgendwo in den Leib zu beißen. Er wirbelte blitzschnell herum, sein Fang war weit offen, als er vorsprang und kühn in den dünnen Hals der Schlange dicht hinter dem Kopf biss.
Sofort, da sie in den Zähnen des Feindes hing, ringelte sich der Leib der Schlange und versuchte den Gegner zu umschlingen.
Und er war noch zu jung, um so fest zuzubeißen, dass er die Schlange damit umbrachte. Er hielt sie wie im Schraubstock eingeklemmt, aber sie lebte. Und ihre Kraft zeigte sich jetzt im verzweifelten Todeskampf. Sie war viel stärker als er. Wie alle Waldklapperschlangen übertraf sie die Artgenossen aus der Prärie an Länge. Ihr anderthalb Meter langer Körper war in der Mitte so dick wie der Unterarm eines kräftigen Mannes. Und in ihm waren mindestens so viele Muskeln.
Der junge Wolf fand sich plötzlich vom kräftigen Leib der Schlange umringelt und spürte, wie sie ihm die Eingeweide im Bauch zusammenpresste.
Jetzt war er es, der keine Luft mehr bekam, der spürte, dass es ihm ans Leben ging.
In der Not hatte die Schlange Kraft bekommen, in der gleichen Not mobilisierte auch er alle seine Kraftreserven.
Während die Zunge der Schlange ins Leere zuckte und fächelte, gelang es dem Leib des Reptils, eine weitere Schlinge um den Körper des jungen Wolfs zu bilden. Und damit schlang sie den Bauch des Feindes zusammen.
Ihm wurde die Luft abgepresst. Er wollte am liebsten die Schlange loslassen, doch irgendwie ahnte er, dass dies sein eigenes Ende bedeuten würde. Das sichere Ende. In dieser Verzweiflung wurde sein Biss am Hals der Schlange kräftiger. Noch einmal ruckten die Fänge des jungen Vierbeiners zusammen, entwickelte der Kiefer eine Kraft, die normalerweise gar nicht möglich schien. Ein Knacken und ein Schwall warmen Blutes, das sich über die Zunge des Wolfs ergoss, waren die Signale vom Ende. Plötzlich erschlaffte die Kraft der Schlange, wurde die Schlinge um den Leib des jungen Wolfs lockerer.
Er bekam auf einmal wieder Luft, und während es mit einem Mal anfing zu regnen, zog er sich aus den Umschlingungen heraus.
Den Regen spürte er noch gar nicht. Er war noch ganz mit der Schlange beschäftigt und biss wieder und wieder in ihren leblosen Leib. Schließlich gab er es auf, knurrte den Kadaver noch einmal siegesbewusst an und spürte nun erst, wie es vom Himmel hoch auf ihn herabgoss.
Nässe war nicht sein Lebenselement. Schon der Bach hatte ihm wenig Freude gemacht, Regen wie der hier unterschied sich da wenig von einem Bach.
Nach einem letzten Blick des Triumphs auf den bösartigen und von ihm erledigten Gegner trollte er sich. Er suchte Schutz vor der Nässe und, sprang unter einen Baum, der unweit vom Bach stand.
Er wusste nicht, was ein Gewitter ist. Und so erschrak er entsetzt, als ein Blitz die Gewitterdämmerung jäh erhellte. Etwas später erfolgte der Donner, der abermals eine panische Angst in ihm auslöste, dass er sich mit gesträubtem Fell und eingekniffener Rute auf den Boden duckte. Der Schreck war so groß, dass er starken Drang zum Urinieren verspürte und sofort am Baum ein Geschäft verrichtete. Ein neuer Blitz, ein neuer Donner, diesmal in rascher Folge, lösten einen neuen Schock bei ihm aus.
Er winselte vor Angst, und er, der eben noch eine gefährliche Klapperschlange besiegte, war das ganze Gegenteil eines strahlenden Siegers. In den etwas mehr als sechs Wochen seines Daseins hatte er noch nie etwas Derartiges wie ein Gewitter erlebt. Hätte er jetzt seine Mutter oder den großen Vater neben sich gehabt, dann wäre sicher alles ganz harmlos für ihn gewesen. Aber so ...
Blitz und Donner in ständiger Folge, immer häufiger, immer näher die Blitze und lauter die Donner, schließlich im nächster Nähe ein Einschlag in einen Baum, der von der Stichflamme des Blitzes unter heftigem Schwefelgestank gespalten wurde. Prasselnd und vom Donner übertönt, kam die mächtige Krone herunter. Blätter, Zweige und größere Aststücke regneten wie Hagel herab. Völlig verdattert floh der junge Wolf, verschreckt von diesem ungewohnten Unwetter, das ihm ein Inferno war und das Ende der Welt bedeutete.
Es kam noch schlimmer. Aus dem Regen wurde ein Wolkenbruch, der binnen Minuten die Sohle des Tals überschwemmte. Wiederum geriet er in die Fluten, die er so verabscheute, und abermals musste er schwimmen, ohne diesmal sehen zu können, wo fester Boden zu erreichen sein würde.
Und ganz plötzlich kam die Flut. Über ihn und ein paar andere Tiere hier im Tal brach sie herein wie das Jüngste Gericht. Er konnte nicht wissen, dass er dieses Unheil einem Stausee verdankte, den die Farmer angelegt hatten und damit die Trockenperioden überwanden. Ein fünf Morgen großer See mit einer Tiefe von wenigen Metern, gestaut durch einen Damm aus Erde und Stammholz. Und diesen Damm hatten die Wassermassen gesprengt, die oben aus den Bergen in den See geschossen waren. Mit einem Mal ergoss sich nahezu der ganze Inhalt des Stausees ins Tal.
Für den jungen Wolf war es, wie es ihm schien, das Ende. Als ihn die Flutwelle packte und mitriss, wurde er untergetaucht, mit dem Kopf gegen einen Ast gerammt, dass ihm übel wurde, und als ihn dieselbe Welle wieder an die Oberfläche spülte, bekam er gerade ein Quäntchen Luft, bevor ein riesiger belaubter Ast mit vielen Zweigen wie eine gewaltige Fliegenklatsche auf ihn niederfuhr und ihn abermals unters Wasser drückte.
Er kribbelte und krabbelte, um aus dem Wirrwarr der Hickoryzweige herauszukommen, und als er das, halb ertrunken, erreichte und wieder nach oben kam, erbrach er sich, schlang wieder Frischluft in sich hinein, erbrach abermals, und ohne dass er es bemerkte, schoss er in der Strömung auf einen riesigen, sehr scharfkantigen Felsbrocken zu, der eben erst vom Wasser unterwaschen worden und in die Strömung gestürzt war.
Mit der Schnelligkeit eines galoppierenden Pferdes bewegte sich der junge Wolf in der Flutwelle auf eben diesen Felsen zu. Da sah er ihn!
Verzweifelt paddelte er, aber es war, als wollte er pustend eine Windmühle zum Anhalten bringen. Er konnte machen, was er wollte, es trieb ihn rasend schnell weiter, und die spitze Kante des Felsklotzes ragte ihm entgegen wie das Schwert eines Samurai.
Da plötzlich tauchte etwas auf, das er nie aus der Nähe gesehen hatte. Es war auf einmal da, und schon prallte er dagegen, etwas umkrampfte seinen Balg am Genick, riss ihn empor aus dem Wasser, und während er erschrocken strampelte, war er schon am Ende seiner Luftreise und landete auf dem Schoß eines Menschen.
Verschreckt und erleichtert zugleich blickte er in eine große helle Fläche, entdeckte Einzelheiten, einen blonden Schnurrbart, blaue Augen, eine nicht ganz gerade Nase, eine wettergebräunte hohe Stirn und blondes Wuschelhaar. Unter dem Kopf war ein rotes Tuch, dann war da noch ein graugrünes Hemd. Einzelheiten, die ihm wenig sagten. Weit mehr beschäftigte ihn der Geruch, der von diesem unheimlichen Wesen ausging. Ein Geruch von Gefahr, von Feind, wie ihm sein Instinkt warnend sagte. Der Geruch des größten Feindes, den Wölfe kennen: dem Menschen.
Und die Hand, die da sein nasses Fell zärtlich streichelte, die ihn so sehr unterm Kinn kraulte, dass er gar nicht an eine Gefahr glauben wollte, das war die Hand eines Menschen.
Niemand hatte ihn vor den Menschen gewarnt. Er wusste nur, dass seine Mutter auf den Streifzügen, zu denen sie ihre Kinder mitgenommen hatte, geknurrt hatte, wenn sie auf Menschenspuren gestoßen war. Und die hatten auch so gerochen wie dieser Mensch. So ähnlich jedenfalls, wenn auch Menschenspuren jedesmal ein wenig anders gerochen haben.
Der Mensch hier, der ihn in letzter Sekunde aus dem Wasser gefischt hatte, war so nass wie er selbst.
„Du kleiner Knäuel“, sagte der Mann mit dunkler, ein wenig spröder Stimme. „Du hast noch mal Schwein gehabt. Und nun sitzen wir beide hier auf dieser verdammten Insel, als sollte es so sein. Als wollten sie uns wirklich nicht, die anderen. Dich nicht und mich nicht. Na, wer wird denn knurren? Sei froh, dass du lebst. Hm, bist du nun ein Wolf oder ein Hund? Siehst wie ein Wolf aus. Und hungrig bist du auch, was?“
Der Mensch, der so freundlich sprach, hielt ihm ein Stück Brot hin. Brot, was ist Brot? Es roch jedenfalls so eigenartig, so nach Mensch wiederum. Der junge Wolf hatte zwar wahnsinnigen Hunger, aber er knurrte nur und bleckte die Zähne, biss aber nicht ins Brot.
„Du bist nicht gescheit, Wollknäuel“, sagte der Mensch. „Ich rette dich, ich gebe dir Brot, und du knurrst. Was würdest du sagen, wenn ich dich wieder ins Wasser schmeiße?“
Der junge Wolf sah ihn an, als ahnte er, was hinter diesen Worten steckte. Und dabei leuchteten seine Augen grün.
„Du hast Augen wie grüner Marmor. Ich kannte mal jemand, der solche Augen hatte. Er hieß Sam, und so werde ich dich Sam nennen, Wollknäuel. Hast du gehört? Ich bin Tom Cadburn. Und du bist Sam. Ist das klar zwischen uns beiden?“
Sam schnupperte. Das Brot roch doch gut, denn der Menschengeruch war auf einmal gar nicht mehr so abstoßend. Und das Kraulen unter dem Kinn kam ihm im Grunde auch recht angenehm vor.
Er schnupperte am Brot, das immer noch zwischen den Fingern der einen Menschenhand klemmte. Er wollte danach schnappen, aber die Hand entfernte sich von seiner Schnauze, und er biss ins Leere.
„Schön anständig, Bürschchen!“, sagte der Mensch, der sich Tom Cadburn genannt hatte. „Selbst einer wie ich, den sie hängen wollten, bewahrt Anstand. Also, wer was will, sagt bitte.“
Sam verwechselte das irgendwie, denn er knurrte, und Tom nahm das nicht als höfliche Geste. Trotzdem gab er ihm ein Stück Brot, das Sam gierig verschlang. Als Sam auf den richtigen Geschmack gekommen war und mehr wollte, begann seine Lehre. Er musste lernen, dass er Tom mit der rechten Vorderpfote betasten sollte, wenn er etwas von ihm wollte. Zuerst nahm Tom die Pfote von Sam in die Hand und zeigte ihm das. Sam war darüber so wütend, dass er beißen wollte, und dafür erntete er einen liebevollen Klaps auf den Po.
Bevor Sam dazu kam, beleidigt zu sein, hatte ihm Cadburn eine winzige Belohnung in Form eines Stück Brotes verabfolgt. Und von da an hatte Sam etwas sehr Wichtiges gelernt: Er wurde belohnt, wenn er etwas tat, was der Mensch wollte. Und der Hunger, der in Sam wütete, sorgte dafür, dass er solche Belohnungen nicht ausschlug, sondern anstrebte.
Als das Stück Brot von Sam restlos vertilgt worden war, konnte er sich schon bemerkbar machen, falls er etwas von seinem neuen Herrn verlangte. Er konnte es so gut und er war noch so hungrig, dass er unaufgefordert immerzu mit der rechten Vorderpfote Zeichen gab. Aber der Mensch hatte nichts mehr, was er hätte geben können. Und schließlich kapierte auch Sam, dass dieser Tom Cadburn ihm sein einziges Stück Brot abgegeben hatte.
*
Drei Tage vor dem Unwetter, als für Sam die Welt noch heil war, hatte auch Tom Cadburn keine blasse Ahnung von dem, was ihm drohte.
Es war ein Dienstag. Ein besonderer Dienstag, denn da wollte Colonel Carpound eine Rede halten, eine Wahlrede. Zur Vorbereitung der Wahl des Sheriffs hatte der Rancher in den Empire Saloon von Musselshell City eingeladen. Die große Rede sollte am Abend stattfinden. Um auch einen Anreiz zu bieten, dass möglichst viele Menschen aus den verstreuten Anwesen in die Stadt kämen, ließ Colonel Carpound durch Boten im Lande verkünden, es werde eine Girltruppe aus New York tanzen, und ein berühmter Zahnarzt werde kostenlos alle Zahnkranken den ganzen Dienstag und Mittwoch über behandeln. Behandelt würde, wer an der Wahlversammlung teilgenommen hatte.
An diesem Dienstag also war auch der siebzehnjährige Tom Cadburn in der Stadt. Ein sommersprossiger, blondgelockter Bursche, schlaksig, ein wenig krummbeinig wie alle, die das Reiten vor dem Laufen gelernt haben, ein Junge also, nach dem sich die Mädchen umgesehen hätten, wenn ...
Ja, wenn Tom Cadburn nicht der Sohn von Hennie Cadburn gewesen wäre, einer Frau, deren Ruf bis weit über das nördliche Montana hinausreichte. Sie war, sagte man hinter der vorgehaltenen Hand, jahrelang die Geliebte eines Indianerhäuptlings gewesen. Und Tom, ihr Sohn, sagte man weiter, sei ein Halbindianer. Ein Halbblut.
Etwas vernünftigere Leute, die nüchterner darüber nachdachten, erinnerten sich an John Stafford, einen Scout und Waldläufer, der mitunter zu Hennie kam, um sie zu besuchen. Er lebte irgendwo weit im Norden allein in der Wildnis, wenn er nicht gerade eine Militärpatrouille führte. Den Namen Stafford hatte Tom als zweiten Vornamen, aber er benutze ihn nur ganz selten.
Aber das dürfte wohl das einzig Gewählte an Toms Dasein gewesen sein. Denn ansonsten wohnte Tom nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens. Der alte Cliff Vancard, der Lagerverwalter im Webster-Store, fasste das auf seine Weise in dem Satz zusammen: „Tom ist ein besonders armes Schwein und tut mir leid.“
Doch mit dieser Ansicht stand der gutmütige Alte allein. Die meisten anderen in Musselshell City mochten nicht, was mit Hennie Cadburn zusammenhing. Sie misstrauten Tom, weil er Hennies Sohn war. Wenn er es nicht hörte, nannten sie ihn Indianer-Bastard.
Und dann kam der Tag der Wahlversammlung. Der Tag, an dem alle Welt Toms Namen im Munde führte. Es war gegen vier Uhr am Nachmittag, als es passierte …
*
Richard Webster, der Eigentümer des General Store, hakte die Daumen in die Weste, drückte den ohnehin schon umfangreichen Bauch nach vorn, so dass sich die goldene Uhrkette spannte wie die Verankerung eines Schiffes in aufkommendem Wind.
Webster, den seine Frau zärtlich „Dicky“ nannte, ließ seinen Unternehmerblick prüfend durchs weiträumige Lager schweifen. Kisten, Fässer, Kartons, Dosen, alles war fein säuberlich aufgestapelt, geordnet, aufgereiht. In den Regalen türmten sich die Vorräte, ohne die man in dieser Stadt wie in der Steinzeit gelebt hätte.
Richard „Dicky“ Webster war zufrieden. Mit schwerem Schritt durchmaß er das Lager, und am anderen Ende stieß er prompt auf den alten Cliff Vancard, wohl der einzige Mensch auf dieser Erde, der nicht den Rücken vor Webster krümmte, der auch nicht schweigen musste, wenn Webster es befahl. Cliff, den man in der Stadt nur Old Cliff nannte, hatte schon bei Websters Vater drüben in einer Stadt im Osten gearbeitet, war mit den Websters in den Westen gezogen und kannte Richard Webster von dessen Kindheit an.
Old Cliff war mittlerweile hoch in den Sechzigern, sein Chef musste etwa zwanzig Jahre jünger sein. Aber im Gegensatz zu Old Cliff, der noch volles, wenn auch schneeweißes Haar besaß, hatte Richard außer seinem dicken Bauch eine richtig schöne Spiegelglatze. Er trug einen Schnurrbart, und damit sah er einem Seehund irgendwie entfernt ähnlich. Viele nannten ihn heimlich, manchmal auch so, dass er es gerade noch hören konnte, „Seal“, was englisch ist und Seehund bedeutet. Das konnte Webster auf den Tod nicht ausstehen.
Old Cliff stand, auf den Besen gestützt, und las eine uralte Zeitung, die er beim Aufräumen gefunden hatte. Als Webster auftauchte, hob er nur kurz den Kopf und wollte weiterlesen.
„Eh, was tust du, Cliff?“, bellte Webster.
Der Alte sah ihn aus schmalen Schalkaugen an. „Das siehst du doch. Ich lese eine Zeitung, die so alt ist, dass sie neu war, als es in dieser verfluchten Stadt nur drei Bretterhütten gab.“ Und respektvoll fügte er hinzu: „Es ist eine Zeitung aus Detroit.“
Webster kannte den Ausgang solcher Gespräche. Um seinen Ruf nicht in Gefahr zu bringen, brach er das Thema abrupt ab und fragte: „Was tut der Junge?“
„Er hat das Papier und den ganzen Plunder auf einen Haufen geworfen und brennt ihn ab. Was soll er?“
„Ist er draußen?“, wollte Webster wissen.
Der Alte nickte.
Webster kraulte sich am Kinn, machte eine strenge Chef-Miene und fragte barsch: „Ist er fleißig?“
„Ich bin mit ihm zufrieden. Für den Hungerlohn, den du ihm zahlst, arbeitet er viel zuviel. Du hast ihn als Expressreiter und Buggyfahrer eingestellt, und die meiste Zeit muss er im Lager herumwurschteln.“
„Als Indianerbastard ist er überbezahlt, merk dir das!“, fauchte Webster. Sein hoher Blutdruck machte sich bemerkbar, das Gesicht färbte sich dunkel.
Der Alte machte sich da wenig Sorgen. Es reizte ihn, Webster zu ärgern. „Ein Mensch, der sechzehn Stunden am Tage für dich schuftet, ist mit einem Dollar am Tag nicht überbezahlt. Und ein Indianerbastard ist er auch nicht, das weißt du ganz genau.“
„Man sagt eben so“, knurrte Webster. „Ich will...“
„Hallo, Mr. Webster?“, rief es vorn.
„Ja! Sind Sie es, Colonel?“, antwortete Webster.
„Colonel, pshaw!“, murmelte Old Cliff abfällig, dass nur Webster es hörte. „Den Rang hat sich dieser aufgeblasene Ochsenfrosch selber zugelegt. Wenn der jemals einem Feind gegenübergestanden hat, dann waren bei ihm bestimmt hinterher die Hosen bis zum Rand voll!“
„Sei still! So einen Kunden haben wir nur einmal!“, zischte Webster, dann ging er nach vorn durch die Reihen seiner Regale und setzte sein freundlichstes Seehundlächeln auf.
„Hallo, lieber Colonel, auch wieder in der Stadt? Ich wette, man wird Ihnen heute begeistert zujubeln, wenn Sie Ihre Rede halten ... Was darf es sein, Colonel?“
Diese letzte Frage hörte auch Tom noch mit, als er von der Laderampe her das Lager betrat, in der einen Hand ein langes Schüreisen, in der anderen eine alte, total verrostete Hawkenbüchse, die er aus einer der Kisten gefischt hatte, die er verbrennen sollte.
Er hatte sie mitgebracht, um Old Cliff zu fragen, was man damit vielleicht noch anfangen könnte. Er hielt die Büchse am Lauf und benutzte sie wie einen Krückstock.
Aber er musste an dem Colonel und Webster vorbei. Er hasste Webster, der ihn schikanierte, wo er konnte. Aber von dem Geld, das ihm Webster zahlte, musste er seine Mutter mitenähren. Infolgedessen konnte er es sich nicht erlauben, Webster zu sagen, was er von ihm dachte.
Webster entdeckte ihn und bellte ihn an: „Was schleppst du da herum? Hast du keine Arbeit, dass du mit diesem Gerümpel herumrennst? Was ist das für ein altes Gewehr?“
Tom sah sie alle beide an. Den Rancher, der sich von aller Welt Colonel nennen ließ, obgleich der liebe Kuckuck wusste, ob Carpound je ein Colonel gewesen war. Ein hagerer, ziemlich großer Mann mit glattem Gesicht, buschigen Augenbrauen und spärlichem grauem Haar, das jetzt unter dem wuchtigen Breitkremper verborgen war. Sein Prince-Albert-Rock war makellos dunkelblau, kein Stäubchen auf den Revers, kein speckiges Glänzen. Ebenso tadellos waren die grauen Hosen, das Krawattentuch mit der Perlennadel, die schneeweißen Manschetten mit Brillantknöpfen. Der Colonel wusste, dass er bei Frauen Eindruck machte, und die Männer respektierten ihn als den reichsten und größten Viehzüchter weit und breit, ein Mann, der sogar mit den Indianern auszukommen wusste.
Webster war für Tom ein Anblick, der ihm vor Augen führte, wie er selbst einmal nicht auszusehen hoffte. Dieser fette, glatzköpfige Pascha mit der sadistischen Freude am Quälen all jener, die von ihm abhängig waren, war Tom so etwas wie ein rotes Tuch.
Er gab daher keine Antwort und wollte sich einfach vorbeizwängen. Der Colonel trat auch zur Seite, sah auf den etwas kleineren Burschen herab, blickte auf das Gewehr und sagte interessiert: „Oh, eine alte Hawken! Damit haben wir die Indianer vertrieben. Tom, zeig mal her!“ Und sofort sah er Webster an. „Ist das eine von den Waffen Ihres Vaters, Mr. Webster?“
Webster sah nur Tom und erinnerte sich, dass der ihm noch keine Antwort gegeben hatte. Und während der Colonel schon nach dem Gewehr griff und Tom es ihm auch geben wollte, weil er nichts gegen den Colonel hatte, schrie Webster keifend:
„Hast du verdammter Indianerbastard keine Antwort auf meine Frage nötig?“
Tom wurde steif wie ein Stock. Sein Gesicht verlor plötzlich alle Farbe. Noch nie hatte ihn einer offen Indianerbastard zu nennen gewagt.
„Aber mein lieber Webster!“, rief der Colonel beschwichtigend. „Er ist doch kein...“
In diesem Augenblick schlug Webster wütend nach dem alten Gewehr, um es Tom aus der Hand zu reißen. Die Waffe bekam eine halbe Drehung, so dass die Mündung genau auf die Brust des Colonels zeigte. Und genau in dem Moment löste sich ein Schuss.
Zunächst war der Knall, eine Stichflamme, eine Rauchwolke und unmittelbar danach der schrille Schrei des Colonels.
Webster flog vor Schreck auf den Allerwertesten, während Tom noch immer das Gewehr hielt.
Der Colonel stand noch eine, stand noch zwei Sekunden, ehe er zusammenbrach und das Blut aus einer riesigen Brustwunde quoll.
Der alte Cliff kam von hinten und sah zunächst auch nur Tom mit dem Gewehr und die Rauchwolke. Von der Strasse her rannten zwei Männer herbei, und in dieser Situation schrie Webster gellend: „Der Bastard hat den Colonel erschossen! Der gottverdammte Indianerbastard hat den Colonel umgebracht!“
Tom glaubte zu ersticken, nicht am Rauch, aber an Websters gemeiner Lüge. Völlig fassungslos, weil ihm der Vorgang des Schusses unbegreiflich war, warf er die Waffe von sich, packte Webster, der gerade aufstehen wollte, am Kragen, schüttelte ihn, würgte ihn und schrie: „Ich habe ihn nicht erschossen! Sie gemeines Schwein, ich habe ihn nicht erschossen! Sie haben ihn umgebracht! Sie!“
„Hilfe! Hilfe, er würgt mich! Hilfe, er bringt mich um!“, kreischte Webster.
Da wurde Tom von hinten gepackt, von Webster weggerissen, und zugleich spürte er einen knallharten Schlag am Hinterkopf. Er sah bunte Ringe vor Augen, dann meinte er in eine endlose tiefe Grube zu sinken …
*
Als er aufwachte, spürte er dumpfen Kopfschmerz. Dann ließ das ein wenig nach, und er öffnete die Augen. Es war dunkel um ihn her. Aber es roch so eigenartig. Woher kannte er nur diesen Geruch? Nein, das war kein Stall, obgleich es nach Urin roch. Es musste ... ja, das war es! Das Sheriff-Office war es! Ja, hinten, wo die Zellen waren, dort roch es so... Die Zellen? Bin ich in einer der beiden Zellen?, fragte er sich.
In der Dunkelheit erkannte er den hellen Schein weiter oben. Ein Fenster. Davor Eisenstäbe. Also doch die Zelle. Und vorn? Er sah sich um, aber dort erkannte er nichts. Doch er hörte etwas. Ein leises Schnarchen, mehr ein geräuschvolles Atmen.
Er versuchte aufzustehen. Wieder dieser jähe Kopfschmerz. Als er den Platz abtastete, auf dem er lag, spürte er, dass es sich um eine Pritsche handeln musste. Aus dem Verdacht, in der Sheriff-Zelle zu liegen, wurde Gewissheit.
Er stand auf, tastete sich in Richtung auf das Schnarchen und prallte plötzlich gegen Eisenstäbe. Es schepperte durch den ganzen Raum, und irgendwo fiel etwas klirrend zu Boden. Das Schnarchen brach brüsk ab. Ein Streichholz wurde angerissen, der Docht einer Kerze brannte, und der Lichtschein erhellte schlagartig den Raum. Tom erkannte durch Eisenstäbe hindurch das Büro des Sheriffs, sein Feldbett, auf dem der Deputy Wolters hockte und über die Kerze hinweg zu Tom herüberstarrte.
„Eh, was rammelst du herum, wie?“, rief Wolters. Er war ein kleiner Mann mit schütterem Haar, Stupsnase und breitem Mund. Tom kannte ihn als heiteren Zeitgenossen, doch in der Stadt hieß es, Wolters sei ein stahlharter Bursche. •
„Was ... was habt ihr mit mir getan? Ich ...“
Tom verschluckte sich, musste husten und dabei überkam ihn die Erinnerung an all das, was vor seiner Bewusstlosigkeit passiert war.
Wolters zog sich seinen Waffengürtel heran, dass er den Colt griffbereit hatte und hängte sich die Decke über die Schultern.
„Mitten in der Nacht den Komiker spielen, wie? Ich habe ein Recht darauf zu pennen, mein Junge. Dass du dir nun ausgerechnet den Colonel ausgesucht hast, will mir zwar auch nicht in den Kopf. Der war ja zu dir immer recht anständig. Bei Webster, da hätte ich es begriffen. Oder hast du Webster umlegen wollen, und es hat nur den Colonel getroffen?“
„Es war doch ganz anders!“, empörte sich Tom.
Wolters nickte. „Ja, Junge, es war immer ganz anders. Wenn du wie ich fünfzehn Jahre lang in den Städten als Marshal oder Sheriff gearbeitet hast, dann kennst du die Sprüche. Es ist immer anders. Natürlich, vielleicht ist es wirklich immer anders. Ich begreife ja, dass ein Mann, der von einem anderen bis zur Weißglut gereizt wird, die Nerven verlieren kann. Ich weiß, wie es ist, wenn einen so ein Misthund wie Webster schikaniert und man eines Tages zuviel bekommt. Tja, Junge, nun hast du aber den Colonel erwischt. Und der konnte seine schöne Reden nicht mehr halten. Und außerdem bezahlt jetzt keiner den Dentisten, der extra gekommen ist, weil sich der Colonel soviel davon versprochen hat. Tja, mein Junge, alles solche Sachen.“
„Aber Old Cliff muss doch die Wahrheit kennen!“, rief Tom.
Wolters zuckte die Schultern. „Er hat gesagt, dass du das Gewehr in der Hand gehalten hättest, und vor dir hätte unter einer Rauchwolke der Colonel am Boden gelegen. Webster, sagt Old Cliff, hätte zugesehen. Was willst du noch wissen, Junge? Wann sie dich hängen? Sie werden dich hängen, Junge, bestimmt werden sie das. Die Witwe vom Colonel hat extra einen Verein gegründet, damit sich auch die Weiber einsetzen, dass du auch wirklich gehängt wirst.“
„Aber Webster lügt! Er hat doch ...“
„Ja, versteh’ ich doch, Junge. Keiner will gehängt werden. Ist doch klar, Junge. Aber sie hängen dich. Wann? Ich weiß nicht. Sie holen den Militärrichter vom Fort. Wenn er da ist, machen wir die Verhandlung. Und was dabei herauskommt, ist ja klar. Old Cliff stellen sie nicht als Geschworenen auf. Und der sogar hat dich mit dem Gewehr gesehen. Tja, Jungchen, was soll es da noch geben? Höchstens, dass sie dich nicht hängen, sondern in eines dieser neumodischen Straflager schicken. Na, da wäre ich lieber gehängt, Junge. Dann lieber tot, als von den Aufsehern jeden Tag durchgepeitscht, arbeiten wie irr und nichts Richtiges zu fressen. Nein, Jungchen, dann lieber tot.“
Tom fasste sich an den Hals, als würde ihn die Schlinge jetzt schon würgen.
„Ich bin unschuldig!“, beteuerte er.
Wolters nahm es gelassen hin. „Klar, bist du am Ende wirklich. Es steckt im Menschen drin, sage ich immer. Dafür kann er ja nichts. Er hat sich nicht selbst gemacht. Also hast du sogar recht. Bist unschuldig. Aber da sind diese Gesetze. Und wer einen anderen einfach killt und einen anderen angreift, um ihn auch umzubringen - das wolltest du ja nachher noch mit Webster - den hängen sie auf, die Menschen. Ob es nun in dir dringesteckt hat oder nicht. Menschen sind so. Und jetzt leg dich hin, penn weiter und halt die Klappe! Ich bin hundemüde. Es hat ja doch keinen Sinn, hier herumzuquasseln.“
Er pustete die Kerze wieder aus, und Tom hörte die Bretter des Feldbettes knarren.
*
Etwa um die Zeit, da die schwarze Wölfin im Feuer des Farmers starb und die bleiche Scheibe des Mondes über dem nächtlichen Land stand, hockte Tom auf seiner Pritsche und versuchte einen klaren Gedanken zu fassen.
Hängen wollten sie ihn, unschuldig hängen!, dachte er verzweifelt. Indianerbastard hatte ihn dieser fette Webster genannt. Indianerbastard nannten ihn viele. Und sie wussten genau, dass er keinen Indianer zum Vater hatte.
Hängen! Einfach aufhängen. Und Webster, dieser Lump, der es getan hatte, blieb unangetastet. Sicher, mit Absicht hatte der das auch nicht getan. Ein Unfall war es - ein Unfall. Aber Webster hatte schon unmittelbar nach dem Schuss alles von sich abwälzen wollen und würde das immer wieder tun. Nein, sie wollten ihm kein Recht geben. Sie wollten ihn hängen, den verdammten Bastard von Hennie Cadburn, die sie Indianer-Hennie nannten ...
Flucht!, dachte er. Flucht blieb ihm, nichts weiter. Ich muss hier raus! Ich muss!
Er entsann sich, was ihm Old Cliff immer von der Stadtpolitik erzählt hatte. Von Sheriff Klein, Dutch-Billy, der aus Deutschland stammte und deshalb wie auch die Holländer Dutch genannt wurde. Ein harter, bolzengerader Mann, auf dessen Seite die kleinen Leute standen, weil sie in seinem Schatten gegen die Großen ihre Rechte gewahrt wussten. Dann war Eric Ferguson, des Colonels Favorit, ein Mann aus des Colonels Ranchmannschaft, der auch als zukünftiger Sheriff nach des Colonels Pfeife tanzen würde.
Die Farmer waren gegen Ferguson. Aber in der geplanten und nun ins Wasser gefallenen Wahlversammlung hatte der Colonel gerade den Farmern seinen Mann schmackhaft machen wollen, indem er den Farmern gewisse Angebote machen wollte. Damit würde es aus sein. Und somit hatte Ferguson bei der Wahl am Sonntag nicht mehr Chancen als ein Fisch auf einem Sandhaufen.
Wenn ich Dutch-Billy sprechen könnte, dachte Tom. Vielleicht würde der mir glauben.
Nein, überlegte er weiter, Dutch-Billy kann mir ja nicht glauben. Webster würde seine Lüge wahrscheinlich sogar beschwören. Und sogar Old Cliff weiß es ja nicht besser, als dass er mich mit dem Gewehr in der Hand vor dem erschossenen Colonel stehen sah ...
Es klopfte an der vorderen Tür.
Wolters hatte den Schlaf eines Hundes und war sofort hoch. „Verdammt, was ist schon wieder los?“
Die Kerze wurde wieder angezündet. Dann ging Wolters in Unterhosen, die Decke um die Schultern, zur Tür. Der Riegel quietschte, die Tür ruckte auf. Aber da war noch eine zweite Tür, die äußere. Bevor er sie öffnete, fragte Wolters:
„Wer, in drei Teufels Namen, will was?“
„Ich bin es, Wolters, ich, Eliza Klein. Du sollst sofort zu Bill kommen. Er hat den Posträuber bei uns im Stall!“, rief eine Frauenstimme.
Wolters schlug hastig den Riegel der zweiten Tür auf, und schon flog sie nach außen. Er sah eine Frau vor sich, die er für Mrs. Klein, die Frau des Sheriffs, hielt.
„Ich komme, Mrs. Klein, ich muss nur...“
Der Schlag, der seinen Kopf traf, kam von der Seite, und er sah den Mann nicht, der sich hart an die Hauswand gedrückt hatte. Er spürte auch nur noch den Schlag, dann sank er zu Boden.
„Hilf mir ihn hineinschaffen, Hennie!“, sagte eine schon etwas brüchige Männerstimme.
„Hoffentlich hast du ihn nicht erschlagen, Cliff“, erwiderte die Frau.
Zu zweit schleiften sie Wolters ins Sheriff-Büro, und der Mann schloss die Tür, während die Frau die Kerze nahm und zur Zelle ging.
Tom sah plötzlich, wer da kam. Das war nicht Eliza Klein. Das war seine Mutter!
„Ma! Um Himmels willen, was hast du getan?“, rief er.
„Psst! Nicht so laut! Ja, das wollte ich dich gerade fragen, Junge. Cliff, den Schlüssel! Das Ding ist zugesperrt.“
„Klar, sonst würden diese Mordbuben ja frei herumspazieren“, knurrte der Alte.
Tom sah ihn im Kerzenschein. „Old Cliff!“, rief er.
„Schießt diesen alten Coyoten über den Haufen, und nun sitzt er selbst in der Falle! Dummer Junge!“, fauchte der Alte.
„Ich habe es nicht getan!“, beteuerte Tom, während Cliff aufschloss. „Webster hat es getan, aber auch nicht mit Absicht. Er wollte mir das alte Gewehr aus den Händen reißen. Und keiner hat gewusst, dass es geladen gewesen war.“
„Geladen? Das Ding? Das ist ein Vorderlader, Junge! Dann müsste das einer vor zehn Jahren geladen haben."
„Es war verrostet. Ich wollte ...“
„Junge, jetzt musst du hier heraus und weiter nichts. Du hast diese Nacht Zeit, so weit und so lange zu laufen, wie du kannst. Ein Pferd würde dich zwingen, im Tal zu bleiben. Zu Fuß kommst du über die Berge, wo sie dich nicht verfolgen. Deine Mutter hat dir Proviant mitgegeben. Los, Wolters in die Zelle, zugeschlossen und dann nichts wie weg!“
„Du hast es wirklich nicht getan, Tommy?“, fragte die Frau und nahm Toms Kopf zwischen die Hände. „Wirklich nicht?“
„Nein, Ma, wirklich nicht“, erklärte Tom bestimmt.
Sie küsste ihn auf die Stirn. „Gott sei dafür Dank. Nun komm, mein Junge. Und sieh dir bei Tage den Plan an, den dir Cliff gezeichnet hat. Wenn du diesen Weg gehst, werden sie dich nicht erwischen. Der Weg führt dich zu deinem Vater. Zu Wild John Stafford ...“
*
Niemand verfolgte ihn, denn in der Richtung, die er auf Grund von Old Cliffs Ratschlägen hin eingeschlagen hatte, suchten sie ihn nicht. Sie alle fielen auf einen Trick herein, von dem Tom auch nichts wusste. Old Cliff hatte eines von Websters Pferden, genau das, auf dem Tom eilige Nachrichten aus der Stadt zu einsamen Gehöften schaffen musste, aus Websters Stall geholt und war damit ein Stück aus der Stadt geritten, nachdem Tom schon weg war. Nachher hatte er das Tier ins seichte Uferwasser des Missouri getrieben und es ohne eine Spur zu hinterlassen auf die Weide im Osttal geschafft. Von da war er zu Fuß in die sehr nahe Stadt zurückgekehrt.
Am Morgen dann - an jenem Mittwoch, an dem das Gewitter kam - begann die Suche nach Tom. Das Aufgebot fand heraus, dass ein Pferd bei Webster fehlte, das Pferd, das meist von Tom geritten worden war. Prompt begann man nach Spuren zu suchen, fand eine deutliche und frische Spur, und ihr folgte man genau bis zu der Stelle, wo sie den Fluss erreichte. Man nahm aber an, der Fliehende sei durch den Fluss geritten und würde ihn irgendwo westlich verlassen haben.
Doch die Suche nach dem Austritt der Spuren aus dem Fluss war umsonst. Dennoch führte Sheriff Klein das Aufgebot noch weit nach Westen, bis sie alle ins Gewitter gerieten und völlig durchnässt den Rückritt antraten.
Tom kam über die Berge im Norden und geriet in jenes Tal, als der Damm brach, so dass er sich vor der plötzlichen Flutwelle nur noch auf diese Felseninsel retten konnte. Wenige Minuten später gelang es ihm, außer sich selbst, noch ein Lebewesen auf festen Grund zu ziehen: ein Wollknäuel, dem er den Namen Sam gab.
*
Es begann zu dunkeln. Der Wasserspiegel sank allmählich, und bald war der Bach wieder, was er zuvor schon gewesen war, ein sprudelndes, knietiefes Gewässer, harmlos, wie es schien. Und nur der Schlamm, das Geröll und die mitgerissenen, verstreut liegenden Büsche und kleinen entwurzelten Bäume bewiesen, dass er eben noch ganz anders gewesen war.
Sam fror erbärmlich und kuschelte sich dicht an den warmen Körper des Menschen, der eine so anheimelnde Stimme und so liebevolle Hände hatte.
Immer wieder kraulten ihn diese Hände.
Die Stimme sagte: „Sam, ich weiß, du hast Hunger, aber in diesem verdammten Wasser ist mir mein Proviant aus der Hand gerissen worden, bis auf das Stück Brot von meiner Mutter, das du schon gefressen hast. Wir beide müssen jetzt zwei Dinge tun, kleiner Mann: Wir müssen erstens sehen, dass wir hier verschwinden, und zweitens müssen wir uns irgendwo etwas zu essen besorgen. Einverstanden?“
Sam spürte die Zuneigung dieses Menschen. Er hatte trotzdem noch etwas Angst, rechnete mit neuen Überraschungen, aber es kam keine. Plötzlich nahm ihn der Mensch auf den Arm, presste ihn an sich und sagte: „Also, uns bleibt nichts weiter übrig, als abzuhauen. Sonst kommen Dutch-Billys Männer noch, und dann, Sam, dann ist keiner mehr da, der für dich sorgt. Und mich hängen sie auf, diese Lügner! Mann, wenn ich es wenigstens gewesen wäre. Aber ich bin auch noch unschuldig. Glaubst du mir das?“
Sam sah ihn an, neigte den Kopf etwas schief und machte treuherzige Augen. Es sah aus, als würde er über das nachdenken, was ihm der Mensch gerade gesagt hatte. Die warme, anheimelnde Stimme hatte etwas Beschützendes, Mütterliches, auf alle Fälle etwas, wo sich Sam geborgen fühlte. Und dann ließ er es sogar zu, dass der Mensch seinen Arm um seinen Hals schlang, ein Zustand, der zunächst auch Sam aufs äußerste erschreckte, an den er sich aber gewöhnte, weil er den Menschen nicht fürchtete, diesen Menschen Tom Cadburn nicht.
Kein Wolf und kein verwilderter Hund ließe sich den Kopf von einem Menschen widerstandslos unter den Arm nehmen, weil diese Tiere instinktiv meinten, in einer Falle zu sitzen. Ein Ring um den Hals, aus dem sie womöglich nicht mehr entrinnen konnten. Auch Sams Fell sträubte sich, als Tom etwas tat, wobei er sich nichts dachte, was ihm sogar als Zeichen zärtlicher Freundschaft vorkam, in dem das Wolfsblut aber meinte, sich absolut unterworfen zu haben.
Etwas später gingen sie los. Zunächst hatte Tom seinen neuen Bekannten auf dem Arm. Aber das geschah gegen Sams Willen. Der wollte auf den Boden, und als ihn Tom absetzte, wieselte Sam ein Stück weit davon, setzte sich hin und blickte den Mann mit schiefgeneigtem Kopf an. So etwa, als wollte er sagen: Wieso soll ich mit dir gehen? Weil du mir mein Leben gerettet hast? Ich bin hier zu Hause und nicht dort, wo du hingehst. Warum also soll ich mitkommen?
„Also wenn du nicht kommen willst, bleib ruhig da sitzen. Hörst du? Das Gewitter kommt wieder. Vielleicht schwimmst du diesmal ein Stückchen weiter als vorhin. Na?“
Sam rührte sich nicht. Er hielt den Kopf schief, starrte Tom an, zeigte aber keine Miene, zu ihm zu kommen. Da ging Tom weiter.
Der alte Cliff hatte Tom einen Whitneyville Walker-Revolver gegeben, ein schweres Monstrum, dessen Trommel von vorn geladen wurde. Bestimmt war das Schwarzpulver nass geworden, aber Tom wollte die Waffe jetzt nicht neu aufladen. Und so klatschte sie ihm bei jedem Schritt an den rechten Schenkel. Jedesmal, wenn dieses lederne Klatschen ertönte, zwinkerte Sam mit den Augen.
Tom war schon ein ziemliches Stück den Hang hinaufgegangen, als Sam plötzlich aufstand, ein Stück unentschlossen hinter Tom herlief, wieder stehenblieb und dann abermals hinter ihm hertrabte.
Der Mann sah sich nicht einmal nach ihm um. Er ging einfach weiter. Da blieb Sam erneut sitzen, witterte plötzlich und schnupperte an einer Fährte, folgte ihr ins Gestrüpp hinein, lief jetzt, sprang, und als dicht vor ihm ein Kaninchen aufgeschreckt würde, jagte er dem Tier nach. Aber da war ein Bau, und schwupp! Das Kaninchen verschwand, und Sam beschäftigte sich mit brotloser Kunst, als er versuchte, den Bau mit den Pfoten auszuscharren.
Als er trotz des starken Kaninchengeruchs, der ihm den Speichel im Munde zusammenlaufen ließ, nicht ans Ziel kam, gab er auf, winselte enttäuscht und pirschte wieder zurück zum alten Platz, nahm die Spur des Mannes auf und folgte ihr.
Er war nicht sehr groß, und mit seinem Vater verglichen wäre er ein Krümel gewesen. Doch schon begann sich sein Körper zu strecken, wurden die Beine länger, verlor sich das pummelige Aussehen allmählich. Er war ein Kämpfer, hatte schon eine Schlange besiegt, wenn ihn dabei außer seinem tollkühnen Übermut auch ein bisschen viel Glück begünstigt hatte. Immerhin war er wie ein Feldherr über einen tiefen Strom gegangen und hatte die Brücken zur Vergangenheit hinter sich abgebrochen. Er tat es nicht bewusst, aber er tat es, und ein unerklärlicher Drang zwang ihn, diesem Menschen zu folgen, der dort im Gestrüpp auf dem Bergpfad verschwunden war. Nur der Duft seines Körpers, der über seiner Spur schwebte, erinnerte daran. Und Sam hatte die feine Nase, um das genau zu riechen.
Es fiel ihm leicht, auf der Spur zu bleiben. Dazu hätte es noch schwärzere Nacht sein können, obgleich sich Sam nachts, ehrlich gesagt und zugegeben, ziemlich fürchtete.
Plötzlich wurde der Geruch von seinem neuen Bekannten so stark, dass Sam stehenblieb, und da sah er den Mann hinter einem vom Blitz umgeschlagenen Baum stehen.
„Also hast du es dir überlegt?“, sagte Tom.
Sam erwartete noch mehr in diesem leicht vorwurfsvollen Ton vorgetragenen Stil, aber Tom stieß sich vom Baumstumpf ab und brummte: „Also, dann weiter!“
Er ging, und Sam hopste ihm nach. Als er mit Tom auf gleicher Höhe war, sah er einmal kurz zu ihm hoch. Und Tom bückte sich, streichelte ihn am Hals, kraulte ihn im Nacken und ging dann weiter. Sam trottete ihm nach.
Sie marschierten übers Gebirge. So jedenfalls hatte es Tom vor, denn so war es auf dem Plan von Cliff eingezeichnet. Der Weg zu seinem Vater! Ja, wer dieser Wild John Stafford war, hatte er schon von seiner Mutter gehört. Er kannte Stafford nur flüchtig. Der war manchmal bei Hennie gewesen, bei seiner Mutter. Aber dass Stafford sein Vater ,.. Nein, das hatte sie ihm erst unmittelbar vor der Flucht gesagt. Gut, sagte er sich, ich will den Mann sehen, der die Frau nicht heiratet, mit der er ein Kind hat. Aber sah das nicht anders aus? Hatte seine Mutter nicht immer gesagt, sie wollte nicht heiraten?
Verdammt, wenn ich es mir richtig überlege, dann ist meine Mutter... ja, sie ist eine... eine ... Er konnte es einfach nicht zu Ende denken. Es beschäftigte ihn so sehr wie schon all die Jahre in Websters Diensten.
Wind kam auf und blies dichte Staubschleier über den Felsenhang. Für Mann und Tier wurde es hart. Der feine Staub drang in alle Winkel. Der Wind wurde zu Sturm, und jetzt wurde die Nacht noch finsterer, denn Wolken verdunkelten den Mond und die Sterne.
Tom sah nichts, und Sam war einfach noch zu jung und zu unerfahren, um Tom etwas nützen zu können.
Geröll stürzte polternd den Felsenhang herab, donnerte keine zwei Schritt an Tom und Sam vorbei, der erschrocken bis zu Tom hopste und sich schutzsuchend an Toms Stiefel drängte. Ausgerissene Büsche fegten vorbei wie riesige Besen, die von den Händen eines Riesen geführt schienen.
Der Sturm nahm noch zu. Tom fand eine Nische im Felsen, packte den winselnden und von Angst gepeinigten Sam und nahm ihn auf die Arme. Der Kleine ließ es geschehen, froh, Schutz gefunden zu haben.
*
Der Sturm rüttelte an der Hütte des Jägers Tracy Johnson. Libbie, seine sechzehnjährige Tochter, kauerte vor dem Kamin und löschte das Feuer.
Tracy, ein nicht sehr großer, aber kräftiger Mann mit grauem, sehr kurz geschnittenem Haar, lehnte neben der Tür. Er hielt sich am Pfosten fest, humpelte dann von der Tür weg zum Tisch, der mitten in der Hütte stand. Mit schmerzverzerrtem Gesicht ließ er sich nieder, legte sein rechtes Bein auf die Bank, so dass der Schein der Sturmlaterne auf den dicken Verband aus grauer Baumwolle fiel, der um Fuß und Unterschenkel gewickelt war.
„Der Sturm hat mir im Knochen gesteckt, sage ich dir!“, polterte Tracy Johnson. „Ich wette, es kommt noch viel mehr, Libbie! Wer jetzt draussen herumrennt, der wird sein blaues Wunder erleben. Libbie, bring mir die Decke, ich friere.“
Das Mädchen drehte sich um und sah ihn an. Der Lampenschein ließ ihr blondes Haar wie gesponnenes Gold erscheinen. In ihren blauen Augen blitzte es, als würden Edelsteine angeleuchtet.
Libbie war nicht gerade wunderschön, aber sie war hübsch und gewann durch ihre Art. Ein bisschen Kind noch, eine sichtliche Portion Frau. Der Vater sah das Kind in ihr und glaubte, die Entwicklung übersehen zu müssen, die dieses Mädchen unaufhaltsam erlebte.
„Pa, warum legst du dich nicht ins Bett?“
Sie deutete auf den Anbau hinten, der durch eine Wand vom übrigen getrennt war. Dahinter stand Vaters Bett, auch das von Mutter, aber dafür hatten sie momentan keine Verwendung. Mutter war im letzten Herbst gestorben.
„Ja, vielleicht hast du recht. Ich fühle mich miserabel.“
Er stemmte sich von der Bank, angelte sich seinen Stock und humpelte auf den Verschlag zu, zog sich im Vorbeigehen eine Flasche vom Bord und verschwand in seinem Schlafzimmer, das im Grunde nur ein relativ kleiner Raum war.
Libbie zuckte zusammen, als sie hörte, wie er den Korken aus der Flasche zog, und sie hörte es bis hier draußen gluckern, als Vater trank. Dann wurde die Tür mit dem Stock zugestoßen. Danach hörte Libbie nur noch den Sturm wieder toben, der eben noch ein kleines bisschen zur Ruhe gekommen schien.
Aus dem Lärm, den der heulende Wind und das Prasseln losgerissener Zweige an den Hüttenwänden vollführten, wurde infernalischer Krach. Der Sturm nahm zu.
Libbie hockte sich fröstelnd hinter die Lampe, als könnte Licht sie vor schlimmen Überraschungen bewahren.
Einmal meinte sie, ihren Vater gehört zu haben. Sie ging nach nebenan, aber er lag auf seinem Bett, die halbgeleerte Flasche noch in der einen Hand. Sie wusste, dass er seit seinem Unfall mit der Axt, die ihm in den Fuß gefahren war, sich das Trinken angewöhnt hatte, um Schmerzen zu überwinden. Der Fuß war mittlerweile ganz gut verheilt, nässte nur noch an einer Stelle. Aber Vater trank umso mehr. Sie lebten ärmlich genug, Vorräte an Salzfleisch machten sie zur Zeit nicht, denn Johnson konnte nicht jagen. Was er wirklich schoss, das musste schon direkt an der Hütte vorbeikommen, dass er es vom Fenster aus erwischen konnte. Mit Glück war ihm das sogar ein paarmal gelungen.
Jetzt hatte ihn der Alkohol eingelullt. Die Mengen, die er vertilgte, wurden immer größer. Neuerdings schüttete er eine halbe Flasche in einem Zug in sich hinein.
Er schlief fest, und Libbie war froh darüber, denn so spürte er wenigstens keine Schmerzen. Hatte er welche, konnte er sehr gemein werden. Auch das war neu an ihm, aber sie wusste, dass ihn der Schmerz erheblich zu quälen schien. Dann wurde er gereizt, nervös, unduldsam. Aber sobald der Schmerz nachließ, zeigte er sich so liebevoll und väterlich wie früher.
Sie schloss leise die Tür, als hätte das angesichts des tobenden Sturmes mit seinem Lärm einen Sinn. Als sie gerade im Zimmer stand und sich wieder hinter die Sturmlaterne setzen wollte, polterte etwas an die Tür.
Sie glaubte erst, es müsste ein Ast oder etwas anderes sein, das der Wind losgerissen hatte. Aber da wiederholte es sich, und es klang so methodisch, dass jeder Zweifel ausgeschlossen war: dort draußen stand ein Mensch.
Libbie hatte Angst. Jedesmal, wenn Fremde kamen, hatte sie Angst. Dabei träumte sie oft genug von einem jungen Mann, von einem Prinzen, der sie besuchen käme, einen riesigen Strauß bunter Frühlingsblumen im Arm.
Sie riss sich von ihren Gedanken los, nahm die Lampe, ging zur Tür und rief: „Wer ist da?“
Draußen antwortete eine Männerstimme, die sie nicht erkannte und auch in dem Geheul und dem Prasseln nicht verstand.
Sie hängte die Lampe seitlich an den Türpfosten, nahm Vaters Parkerflinte, spannte sie und nahm sie in die Rechte, den Finger um beide Abzüge. Dann stieß sie mit der Linken den Riegel der Tür auf.
Kaum war das geschehen, flog die Tür auf. Sofort war Libbie einen Schritt zurück und richtete die Flinte auf einen Mann, der in der Türöffnung stand und etwas auf dem Arm trug. Ein junger Mann, dessen Gesicht ihr irgendwie bekannt vorkam. Sein Haar war klitschnass, die Kleidung ebenfalls, und Schmutz klebte überall an seiner Jacke. In seinem Arm aber hielt er einen jungen Hund, wie Libbie meinte.
Der Sturm trieb Blätter und Zweige ins Zimmer, und die Laterne drohte zu erlöschen.
„Kommen Sie!“, rief sie und senkte die Flinte, als ihr einfiel, dass der junge Mann bei Webster in Musselshell gearbeitet hatte. Ja, von daher war er ihr bekannt.
Er trat ein, ging an ihr vorbei und lehnte sich an die Wand, beugte sich vor, um den vermeintlichen Hund abzusetzen, und sie sah, wie muskulös er war. Irgendwie sah er ganz anders aus als der Prinz in ihrem Traum. Er hatte statt der Blumen auch einen Hund..
Sie wollte die Tür schließen, schaffte es gegen den Wind nicht. Da kam der junge Mann, half ihr wortlos, sah sie dann im Lampenlicht an und fragte: „Ist Ihr Vater nicht da, Libbie? Sie sind doch Libbie Johnson, nicht wahr?“
Sie nickte, schluckte, weil sie keinen Ton herausbekam und war mit einem Mal so verlegen wie ein kleines Schulmädchen.
„Der ist aber süß!“, sagte sie schließlich, nachdem sie Sam angesehen hatte, als sei der das erste Tier, das sie im Leben sah.
Sam war noch nie in einem Haus gewesen. Diese so überaus stark und fast penetrant nach Mensch riechende Höhle mit so merkwürdigen Gegenständen in ihrem Innern flößte ihm erneut Angst ein. Er suchte instinktiv Schutz und sauste zum Kamin, dessen Feuer erloschen war. Doch die Steine gaben noch viel Wärme ab, und Sam spürte das, als er fast in das Loch gekrochen wäre, das sich direkt neben der Feuerstelle in der Wand befand und wo sich Tracy Johnson im Winter die Pantoffeln wärmte oder wo die von der Jagd nassen Socken getrocknet wurden.
Schließlich fand Sam ein Versteck hinter der Mehlkiste, und hier verkroch er sich und ließ sich nicht mehr sehen.
„Ich habe ihn gefunden“, sagte Tom, der sich heiß wünschte, Libbies Vater sollte auftauchen. Denn er war in einem Alter, wo man einem Mädchen wie Libbie nicht mehr so ganz unbefangen gegenüberstand, zumal Tom Mädchenbekanntschaften nur selten gehabt hatte. Viele der anständigen Mädchen lehnten ihn ab, so gut er ihnen auch gefiel, weil er eben der Sohn von Indianer-Hennie war.
Libbie kannte diese Geschichte mit seiner Mutter auch. Aber er war ihr trotzdem sympathisch, und da sie hier in der Wildnis an andere Menschen sowieso ganz andere Maßstäbe anlegte als die Leute in der Stadt, störte sie das nun überhaupt nicht.
„Setzen Sie sich, Tom“, sagte sie. „Sie heißen doch Tom?“
Das war so eine Retourkutsche auf seine Frage von vorhin, als er wissen wollte, ob sie Libbie Johnson sei. Als wenn er das nicht gewusst hätte.
Sie hatte aber keine Ahnung von dem, was in Musselshell vorgefallen war. Nur, das wusste Tom nicht. Er hätte etwas darum gegeben, sicher zu wissen, ob sie ahnungslos war oder nicht.
„Ja“, wiederholte er, „ich habe den dort gefunden.“ Er zeigte auf die Mehlkiste, hinter der Sam mit gesträubtem Fell lag und der Dinge harrte, die kommen mochten. „Er ist ein halber Wolf und ein halber Hund. Ich habe von German-Joe gehört, dass er so große Hunde hat, die wie Wölfe aussehen. Da ist auch ein Leitwolf im letzten Winter gewesen. Auf den waren die Farmer wie verrückt. Das soll auch so einer von German-Joes großen Hunden gewesen sein. Vielleicht ist der hier der Sohn von dem Leitwolf.“
Sam hatte den Kopf neugierig hinter der Truhe hervorgesteckt und blickte treuherzig auf die beiden Menschen, die ihn ansahen. Das Mädchen hob die Sturmlaterne etwas hoch, so dass sie Sam besser sehen konnte.
„Er sieht wirklich nicht wie ein Wolf aus. Er wird auch mal sehr groß, glaube ich“, sagte Libbie.
Tom nickte eifrig, während das Regenwasser von seiner Kleidung troff und Lachen unten auf dem festgestampften Boden bildete.
Libbie bemerkte es und sagte: „Wollen Sie sich nicht die Sachen trocknen? Ich habe nur kein Feuer mehr. Pa sagt immer, dass man bei schwerem Sturm das Feuer löschen muss.“
„Ist Ihr Pa nicht da?“, fragte er wieder.
Sie zeigte auf den Verschlag. „Er schläft. Er hat was am Bein. Hat sich die Axt in den Fuß geschlagen, vor sechs Wochen schon. Es wollte nicht heilen. Doc Roland war schon einmal hier, und seitdem geht es etwas besser. Aber der Doc hat für den einen einzigen Besuch zwanzig Dollar gewollt. Wir hatten überhaupt nur neunzehn im Haus und schulden ihm noch einen. Pa hat die ganze Zeit nicht viel gejagt gehabt, weil irgendeine Krankheit umgeht unter dem Wild, Räude oder so etwas. Und jetzt ist das zwar nicht mehr, aber nun sitzt Pa mit dem Fuß fest. Wir haben kaum Fleisch. Der Colonel hat uns manchmal jemanden geschickt, der uns Rindfleisch und Kartoffeln gebracht hat. Einmal war er auch selbst hier und hat uns Tabak und eine Korbflasche mit Schnaps mitgebracht. Der Schnaps sollte eigentlich zum Reinigen von Pa's Wunde sein. Aber Pa wollte sich wohl auch innerlich reinigen. Jedenfalls hat er bis auf einen Rest den ganzen Brandy getrunken und nicht auf den Fuß getan. Für diesen Zweck wäre der Schnaps zu schade, hat er gesagt. Es ist nicht gut, wenn ein Mann solche Schmerzen hat, dass er sie mit Schnaps betäubt.“
Tom hatte schon von Old Cliff gehört, dass der Jäger Johnson zum Säufer geworden sein sollte. Jetzt fiel ihm das ein. Und dann so eine Tochter, dachte er. Mensch, die ist Klasse. Das habe ich bisher nie gesehen, dass sie so Klasse ist. Aber was die da vom Colonel sagt und wie sie es sagt, da wird alles ganz anders sein, wenn sie erfährt, was mit dem Colonel passiert ist und dass diese Hunde mir das anhängen wollen. Verdammte Lügnerbande!
„Warum machen Sie ein so böses Gesicht, Tom?“, fragte sie.
Er erzwang ein Lächeln. „Libbie, Sam und ich - ich habe ihn Sam genannt - haben verdammten Hunger. Ob Sie vielleicht ein kleines Stück Brot...?“
Sie nickte eifrig und sprang auf. „Aber entschuldigen Sie, dass ich daran nicht gedacht habe! Wohin wollten Sie eigentlich, Tom? So am späten Abend noch, und dann so ein Unwetter.“
Ich muss sie belügen, es hat sonst keinen Zweck, dachte er.
„Libbie, das mit dem Unwetter ist ja schuld, sonst wäre ich längst weiter“, sagte er. Und er fragte sich, ob er es überzeugend genug erzählte. „Wissen Sie, ich wollte schon längst in der Stadt sein. Mein Pferd ist mir weggelaufen, aber ...“
Plötzlich wieherte draußen ein Pferd. Dann schrie eine Männerstimme, aber der Sturm verschluckte die Worte.
„Ob es Ihr Pferd ist?“, fragte Libbie überrascht.
Tom war herumgefahren und antwortete nicht. Sie sind da!, dachte er. Sie haben mich eingeholt! Verdammt, ich bin ihnen in die Falle gesprungen, hier in dieser verdammten Hütte!
*
„Warten Sie!“, keuchte Tom, nahm die Parkerflinte, die Libbie an die Wand gelehnt hatte, und sagte: „Machen Sie auf! Öffnen Sie die Tür! Man muss wissen, wer da kommt.“
„Aber Tom, warum sind Sie auf einmal so aufgeregt?“, wunderte sich Libbie, ging aber zur Tür und stieß den Riegel zurück. Als sie öffnete, fiel der Lampenschein auf zwei wildfremde Männer in flatternden schwarzen Ölmänteln.
„Hallo! Mein Gott, sind wir froh, dass hier Menschen sind! Vor uns ist der halbe Berg zusammengerutscht. Eine Lawine. Können wir herein? Wir sind von der Cornfield-Ranch mit dem Kreuz im Kreis-Zeichen. Wir sollten einen Stier zu Colonel Carpound bringen. Aber den Stier hat der Berg erschlagen. Jetzt sehen wir fein aus!“
Tom hatte das Gewehr gesenkt, und Libbie ließ die beiden hereinkommen. Sie sahen nicht nur wie Cowboys aus. Ihre Hände waren hornig, die Gesichter ledern, die Vorderzähne beim Bulldogging eingeschlagen, dass es wie bei vielen Cowboys beim Reden zischelte. Sie schälten sich aus ihren Ölhäuten, klopften sich das Wasser von den Hosenbeinen und schnallten sich die schweren Beinschützer ab.
Der eine war groß, rotblond und hatte ein breitknochiges, von Sommersprossen übersätes Gesicht. Der andere wirkte kleiner, hatte schwarze Haare und schien mexikanischer Herkunft zu sein.
Der Rotblonde tippte sich auf die Brust. „Ich bin Terry Prowder, und mein Partner ist Pablo Varganzo. Mann, ist das ein Wetter. Das ganze Tal schwimmt weg. Würde mich nicht wundern, wenn diese Hütte wie eine Arche Noah plötzlich zu schwimmen beginnt. Er schnupperte. „Hier riecht es nach Wolf. Verdammt, meine Nase ist fast soviel wert wie mein Pferd. Und ich rieche Wölfe. Wohnt hier ein Jäger oder ein Fallensteller?“
Da entdeckte er Sam, der ein Stück weit hinter der Truhe vorlugte, knurrte und die Rückenhaare gesträubt hielt.
„Ein Wölfchen! Menschenskind, sieh dir das an, Pablo, ein Wölfehen! Ist das Ihr Herzenswärmer, junge Frau?“, rief er und sah Libbie auf eine Art an, dass Tom fast kochte vor Wut.
Libbie lächelte zurückhaltend und sagte kühl: „Ich bin nicht verheiratet, Mr. Prowder.“
Terry Prowder lachte polternd, schlug sich auf die Schenkel, dass es wie ein Schuss krachte und brüllte amüsiert: „Na wunderbar, Schätzchen, das höre ich gerne. Und er ist wohl Ihr Bruder, wie?“ Er machte eine nicht sehr respektvolle Handbewegung in Toms Richtung.
„Nein, er ist mein Freund“, behauptete sie so überraschend, dass Tom aufgeregt schlucken musste.
„Na, da musst du aber noch ’ne Menge Grütze vertilgen, Sunny!“, meinte Prowder und grinste Tom so herausfordernd an, dass dem das Blut ins Gesicht stieg. Und hämisch fügte Prowder hinzu: „Die kleine Miss sieht nicht aus, als gäbe sie sich mit halben Sachen zufrieden! Hahaha!“
Sein Lachen steckte auch den Mexikaner an, und als beide noch meckerten, hatte Tom auf einmal die Parker in der Hand und richtete sie auf Prowder.
„Raus! Los, raus mit euch!“
Libbie sah überrascht auf Tom. „Aber warum ... Tom, man kann doch bei diesem Sturm keinen Menschen hinausjagen!“
Prowder war mit einem Schlage ernst geworden. „Sag mal, du halbe Figur, soll das vielleicht ein Witz sein?“
„Dann ist es ein schlechter Witz“, fügte Pablo hinzu.
„Es ist kein Witz. Ich zähle bis drei. Eins...“
Prowder blickte auf Libbie. „Holen Sie ihn wieder von seinem Turm, Kleine, sonst nehme ich ihn mir zur Brust, und das bekommt ihm bestimmt nicht.“
„Zwei...“ Tom zählte völlig unbeeindruckt von Prowders Drohung.
Prowder begriff wohl, dass Tom es wissen wollte. Er räusperte sich, sah kurz zu Pablo, und der erwiderte den Blick, nickte leicht und ging dann zur Tür, als wolle er aufgeben.
„Also gut“, sagte auch Prowder, als resigniere er, wandte sich um und schien Pablo folgen zu wollen.
Sie waren beide nahe der Tür, als sie auf ein Zeichen von Prowder hin blitzschnell nach rechts und links sprangen. Pablo riss dabei einen Hocker um, warf sich zu Boden und zog fallend seinen Revolver. Fast einen Atemzug später schoss er auf Tom.
Tom war mehr aus Überraschung als aus einer Ahnung heraus einen kleinen Schritt zur Seite getreten, und so fehlte ihn der Schuss. Obgleich er die Flinte in den Händen hielt, drückte er nicht ab, vielleicht aus Sorge um Libbies Vater, der hinter dem Verschlag aus relativ dünnen Brettern schlief. Womöglich durchdrangen die Schrotkugeln die Wand und trafen einen Unschuldigen.
Um seine Schussrichtung zu verändern und einem zweiten Schuss von Prowder zu entgehen, sprang Tom nach rechts. Er achtete einen Augenblick lang nicht auf den Mexikaner, zumal Libbie zwischen dem und Tom stand.
Pablo kniete, packte ein Stück Holz und schleuderte es mit ungeheurer Vehemenz dicht an Libbie vorbei. Das Scheit flog mit der Brisanz eines Wurfmessers und traf ebenso genau. Tom spürte plötzlich einen Schlag an der Schläfe, spürte noch, wie ihm die Beine unterm Leib wegglitten, dann wurde ihm schwarz vor Augen.
Der Mexikaner erhob sich. „Na also! Terry, steck die Kanone ein. Junge ist fix und fertig.“ Pablo strahlte Libbie an, die den Blick voller Entsetzen erwiderte. „Ist nicht gut mit erfahrene Mann anlegen. Werde ich diese kleine Stinktier an frische Luft setzen. Er und nicht wir dann draußen.“
Er packte den ausgestreckt liegenden Tom am Gürtel und hob ihn an. Pablo hatte Kraft, und Tom hing schlaff mit dem Oberkörper einerseits und den Beinen andererseits herab.
„Mach Tür auf, Terry!“, sagte er.
Der Rotblonde grinste, steckte den Revolver ein und wollte zur Tür. Da kam Sam. So klein er noch war, er flog plötzlich durch die Luft, landete unmittelbar neben Tom, und Pablo zuckte erschrocken zusammen, ließ aber Tom nicht los. Da sprang ihn Sam an, und weil er noch nicht so groß war, erreichte er Pablo nur über dem Knie. Hier biss er zu, und seine kleinen Zähne kamen glatt durch den Stoff der Hose.
Prompt ließ Pablo los, schlug mit beiden Händen nach dem Wolfsblut, das ihn blitzschnell in die linke Hand biss, dann ins Gelenk der Linken, und als Pablo nach Sam trat, wurde das Wolfsblut ein paar Meter weit durch die Luft geschleudert, heulte schrill, fegte wieder heran, und Pablo war nicht schnell genug, den Revolver zu ziehen. Da biss ihm Sam ins Knie.
Pablo schrie auf und hatte nun den Revolver heraus. In diesem Augenblick zerriss ein donnernder Schlag die Luft. Ein Feuerblitz schoss auf Pablo zu, und gleichzeitig quoll dicker schwarzer Rauch ins Zimmer. Ein zweiter Donner, während Pablo einen Todesschrei ausstieß. Wieder ein Feuerstrahl und danach noch mehr Rauch, der die ganze Hütte einnebelte.
In dieses Inferno hinein brüllte eine heisere, überschnappende Stimme vom Verschlag her: „Libbie! Komm hierher, Libbie! Ich bringe sie alle um, diese Hundesöhne!
*
Er blinzelte, schloss wieder die Augen, weil ihn die Lampe blendete, machte sie um einen Spalt auf, und dann entrang sich seiner Brust ein Stöhnen.
Er hatte das Gefühl, in seinem Schädel hätten sich Hornissen einquartiert. Es summte und brummte. Doch nach einer Weile ließ das nach, und er war imstande, sich an das zu erinnern, was ihm zunächst wie ein böser Traum vorkam. Aber das schien doch kein Traum gewesen zu sein.
Dort dieses Gesicht, das war doch wirklich Libbie Johnson. Er hörte, wie sie sagte: „Nun hör bloß auf! Ich will ihm doch helfen!“
Und er hörte zudem ein Knurren, schielte nach rechts und gewahrte das Wolfsblut, das tapsig noch und doch so engagiert mitgewirkt hatte in diesem Kampf heute Nacht.
„Wo ... wo bin ich?“, fragte Tom heiser, als er über sich eine niedrige, von Rundhölzern gebaute Decke sah, links und rechts fellbespannte Wände und am hinteren Ende eine Art Regal, auf dem wenige Vorräte lagerten.
Er blickte wieder auf Libbie. Sie hatte es aufgegeben, Tom die Stiefel auszuziehen und setzte sich nun zu ihm auf den Rand der Pritsche.
Ihre Blicke trafen sich, und Libbie sagte leise: „Es war furchtbar. Diese beiden Kerle wollten Sie hinauswerfen und den jungen Wolf erschießen. Aber da kam mein Vater dazwischen. Er hat gedacht, dass die beiden mich bedroht hätten und hat beide erschossen. Mit seiner Greener, und die steht immer an seinem Bett, geladen mit Hackblei.“
Tom erinnerte sich, einmal vor Jahren einen Mann gesehen zu haben, der durch einen Schuss mit gehacktem Blei aus näherer Entfernung erschossen worden war, als er Hühner stehlen wollte. Es war eine von Toms schrecklichsten Erinnerungen, an das Bild zu denken, das dieser Tote abgegeben hatte.
„Und jetzt?“, fragte Tom. „Das waren Cowboys der Cornfield-Ranch. Die liegt weiter im Osten, glaube ich. Ich habe schon mal von denen gehört. Der Colonel hat mit denen Geschäfte gemacht. Webster nicht.“
„Vater hat darüber noch gar nicht nachgedacht, meine ich. Wenn er richtig daran denkt, wird er bestimmt erschrecken“, sagte sie leise.
„Wo ist Ihr Vater jetzt, Libbie?“
„Ich habe ihm geholfen, die beiden auf ihre Pferde zu laden. Er wird sie irgendwohin gebracht haben. Er wollte es allein tun, hat er gesagt. Obgleich er kaum mit seinem Fuß auftreten kann. Ich weiß nicht, Tom, was er vorhat.“
„Vielleicht stürzt er sie in eine Schlucht.“
„Und die Pferde?“, fragte Libbie.
„Er wird wissen, was er tut. Dein Vater ist nicht dumm.“ Er hatte sie unabsichtlich geduzt, und sie lächelte, als sie es bemerkte.
„Die beiden haben gedacht, du wärst mein Bruder“, erwiderte sie und ging nun glatt auf sein Duzen ein.
„Du hast ihnen gesagt, dass ich dein Freund wäre. Bin ich dein Freund, Libbie?“
„Willst du es denn sein?“, fragte sie verschmitzt.
Er nickte eifrig, aber davon tat ihm sein Kopf plötzlich wieder weh, und er zuckte wie unter einem Schlag zusammen, schloss die Augen und rührte sich nicht, in der Hoffnung, der jähe Kopfschmerz werde sich so am ehesten verlieren.
„Was hast du?“, fragte Libbie erschrocken.
Er gab keine Antwort. Dafür knurrte Sam.
Libbie sah auf das Wolfsblut. Er hielt den Kopf in Richtung auf die äußere Wand, und die Ohren standen ebenfalls in dieser Richtung.
Tom hatte die Augen wieder geöffnet, sah Sam an, lauschte und sagte: „Reiter!“
„Vielleicht ist es Pa?“, meinte Libbie.
„Er knurrt nicht, wenn dein Vater kommt. Es sind Fremde!“, behauptete Tom, als würde er Sam und dessen Verhalten seit Jahr und Tag kennen. Er stemmte sich hoch, und wieder war der rasende Kopfschmerz so stark, dass er ein paar Sekunden ganz still bleiben musste, damit es nachließ.
Libbie war ans Fenster getreten, hatte die Lampe kleingedreht und spähte durch einen Schlitz des Ladens. „Es wird schon hell. Zwei Reiter und mein Vater. Einer der Männer ist Sheriff Klein ...“
Tom war es, als habe er in Feuer gegriffen. Er spürte auf einmal keinen Kopfschmerz mehr. Sheriff Klein! Und jetzt waren sie wirklich hier!
Libbie, die Toms Erschrecken gar nicht bemerkt hatte, noch immer am Fenster stand und nach draußen spähte, sprach weiter: „Der andere hat auch einen Stern. Es ist Wolters, ich erkenne ihn. Komisch, er trägt etwas um den Kopf, hat gar keinen Hut. Ein Verband. Deshalb hätte ich ihn fast nicht erkannt. Mein Gott, ob sie Vater dabei beobachtet haben, wie er...“ Sie sah Tom an. „Tom, sie kommen hierher!“
Tom dachte weniger an die Sache mit den beiden Cowboys. Er konnte sich einen ganz anderen Grund dafür erklären, wieso Dutch-Billy und Wolters gekommen waren.
Aber sie schienen draußen von Tracy Johnson aufgehalten zu werden. Tom hörte sie sprechen; ein Pferd schnaubte, und er verstand deutlich, als Wolters sagte: „Eine ganz schöne Leistung für so einen jungen Burschen. Ich hätte geschworen, dass er nicht nur Hilfe hatte, als er geflohen ist. Vielleicht ist er nicht allein, Mr. Johnson. Könnte nicht ein zweiter Mann in der Nähe gewesen sein, als es zu der Schießerei mit Cornfields Cowboys gekommen ist? Mein Gott, denken Sie nach, Mr. Johnson! Dieser Terry war kein Greenhorn. Der ließ sich doch nicht einfach von Indianer-Hennies Jungen abknallen, dazu noch mit einer Greener. Und der andere, dieser Greaser, der hatte doch auch mehr auf dem Kasten, als eine Zielscheibe abzugeben. Schlimm, Mr. Johnson, dass Sie kein zweites Gewehr hatten, um sich Ihre Flinte wiederzuholen ...“
„Ich habe ein zweites Gewehr, zwei sogar, aber zu der Zeit waren sie nicht geladen. Die Parker nicht, und auch nicht die Marlin.“
„Hat sich der Bastard irgendwie Ihrer Tochter genähert?“, fragte Dutch-Billy. Die Stimme des Sheriffs kannte Tom sehr gut.
„Nein, ich kam ja gleich heraus, als ich ihn hörte. Die Schmerzen, verstehen Sie, Billy, die Schmerzen im Bein. Ich kam heraus, und da hatte er sich das Gewehr geangelt. Und schon war er wieder weg. Kaum war er draußen, sah ich die beiden Cowboys und der eine, ich glaube, dass es Terry war, schrie: ,Das ist der Indianer-Bastard! Sie suchen ihn! Sie sind hinter ihm her! Wir verdienen uns die Belohnung! Los!’ Und die beiden sind ihm nach. Ja, und auf einmal knallte es zweimal. Ich bin hin, und da lagen sie schon.“
„Hm, Tracy“, hörte Tom den Sheriff sagen, „ich frage mich nur, woher sie gewusst haben, dass Tom Cadburn den Colonel umgelegt hat.“
„Na, vielleicht von Ihnen, Billy. Mir haben Sie’s doch vorhin auch erzählt.“
„Tja, ich habe die beiden nicht getroffen, aber es sind ja wahrhaftig genug Leute in der Weltgeschichte herumgeturnt diese Nacht. Also gut, Tracy, ich schicke jemanden heraus, der sie abholt. Oder meinst du, wir sollten sie hier irgendwo begraben? Wenn es richtig hell ist, knallt die Sonne drauf, und dann ...“
„Wenn mir Wolters hilft, könnte ich ...“, begann Johnson, aber Dutch-Billy unterbrach ihn.
„Mit deinem Fuß? Auch was, ich schicke ein paar Leute aus der Stadt, die können die beiden holen. Bis später mal, Tracy. Und denk dran, es könnte sein, dass wir deine Aussage brauchen, wenn wir Tom Cadburn eingefangen haben. Vergiss nicht, was du gesehen hast!“
„Macht es gut!“, rief Johnson. Dann ertönte Hufschlag.
Dutch-Billy antwortete ihm aus etwas größerer Entfernung: „Auch so, und pass ein bisschen auf die Geier auf, Tracy, bis meine Leute die beiden holen!“
„Mach’ ich!“, brüllte Johnson. Der Hufschlag wurde leiser.
*
Tom sah Libbie an, deren Busen sich vor Aufregung stark hob und senkte. Sie erwiderte seinen Blick. „O Gott, was hat er ihnen nur erzählt!“, keuchte sie.
„Er hat mir die beiden, die er erschossen hat, der Einfachheit halber mit angehängt.“ Tom wischte sich enttäuscht über die Augen. „Und ich habe geglaubt, dass er anständig ist.“
„Du hast den Colonel erschossen, nicht wahr? Ist das anständig?“, fauchte Libbie.
Tom schüttelte den Kopf. „Der Colonel wurde von Webster erschossen. Aus Versehen. Aber Webster hat es mir so angehängt, wie dein Vater das eben mit den beiden Cornfield-Cowboys getan hat.“
„Ehrlich?“, fragte sie zweifelnd.
„Leider, Libbie, leider. Ich jedenfalls könnte mich an deines Vaters Stelle nicht mehr im Spiegel besehen. Ich bin gespannt, was er sich jetzt für mich ausgedacht hat. Aber so blöd, wie er meint, bin ich auch nicht.“
Und damit ergriff er Johnsons Jagdwaffe, die Marlin.
„Tom! Tom, was willst du tun?“, rief sie.
„Ich will nur nicht, dass er den Skalp bekommt, den er sich jetzt holen will. Vermutlich“, erwiderte Tom und hebelte die Marlin durch.
Sie sah ihn bestürzt an. „Das glaubst du?“, fragte sie erschüttert.
Er nickte. „Ich habe eben eine Menge gehört und dabei gelernt. Sam, komm her zu mir!“
Das Wolfsblut knurrte nur zur Tür hin, rührte sich aber nicht von der Stelle. Und dann kam Tracy Johnson herein. Er sah zunächst nur Libbie und fragte:
„Wo ist der Junge?“
Tom hatte sich an die Wand gelehnt, so dass ihn Tracy nicht gleich sehen konnte, zumal an einem Haken Mäntel und Jacken hingen, die ihn etwas verdeckten. Und das Licht der Lampe brannte immer noch klein.
Tracy Johnson trat zwei Schritte weiter, und da entdeckte er nicht nur Tom, den Wolfshund und das Gewehr, sondern sah auch, dass Tom fest entschlossen war, seine Freiheit zu verteidigen.
Aber Tracy Johnson war auch nicht von gestern. Er grinste plötzlich, humpelte zum Tisch, legte die Flinte darauf und sagte scheinheilig: „Die beiden Armleuchter sind weg. Die habe ich vielleicht geleimt, was?“
„Sie haben sich reingewaschen und mich beschuldigt“, platzte Tom heraus.
Tracy Johnson winkte belustigt ab. „Das musste ich doch sagen. Sie haben mich doch an der Schlucht gesehen. Was sollte ich denen denn sagen? Jetzt bin ich aus dem Schneider, in Ordnung. Aber du doch auch, Junge. Dich suchen sie nicht hier, wo du bist, sie suchen dich sonstwo.“
„Und sollten sie mich schnappen, dann ...“
„Mein Junge, auch mit einem Gewehr in der Hand bist du für mich kein Grund, in die Hosen zu machen, weil du einfach noch zu grün bist. Du hast den Colonel umgelegt, aus welchem Grund auch immer. Wir hier sind dem Colonel dankbar. Nun, ich habe Schulden bei ihm, und am Ende hast du mir einen Gefallen getan. Nur, wenn du frech werden willst, dann nimm deinen Kram und dieses Vieh und verschwinde!“ Er deutete auf die Marlin. „Die lass aber schön hier, denn die gehört mir.“
„Ich werde gehen und tun, was ich für gut halte. Ihre Tochter ist in Ordnung, Mr. Johnson, aber Sie selbst... Sie nicht!“ Er nahm die Flinte, entlud sie. Die andere war ohnehin noch nicht wieder geladen. „Packt mir Vorräte ein!“, befahl er.
„Ja“, sagte das Mädchen bereitwillig.
Der Jäger schrie sie empört an: „Und wovon leben wir? Willst du etwa das bisschen, was wir haben, diesem Tramp mitgeben?“
„Es war wirklich nicht richtig, was du zu Dutch-Billy gesagt hast“, erwiderte das Mädchen.
„Was ich tue, ist immer richtig, merke dir das!“, polterte er. „Und jetzt scher dich hinaus, Tom Cadburn. Scher dich hinaus, oder erschieß mich! Denn wenn du nicht freiwillig gehst, schmeiße ich dich eigenhändig aus meinem Haus!“
Er war aufgestanden und humpelte heran. In diesem Augenblick wurde die Tür aufgestoßen. Die Helligkeit des frühen Morgens fiel in die Hütte. Und dann war dort eine Gestalt mit einem Gewehr in der Hand. An der Brust blitzte es kurz, als sich der Oberkörper des Mannes ein wenig zur Seite drehte, dass Licht darauf fiel. Sheriff Klein, genannt Dutch-Billy.
„Wir sind nicht auf Sie hereingefallen, Tracy. Deshalb sind wir auch zurückgekommen! Hände hoch, ihr alle!“, und zu Tom sagte er: „Lass die Marlin fallen! Wolters steht am Fensterladen und schießt dich durchs Fenster über den Haufen!“
Nein, dachte Tom. Plötzlich warf er sich zur Seite, stieß sich ab, sprang auf die Tür zu, wo der Sheriff mit dem Gewehr stand. Dutch-Billy wollte das Gewehr auf Tom richten, wollte es etwas anheben, aber in diesem Augenblick war Sam da, der hinter Tom aus der Hütte ins Freie strebte, Dutch-Billy zwischen die Füße geriet, so dass der Sheriff aus dem Gleichgewicht kam. Und da war Tom schon da, während der Sheriff von Sam abgelenkt worden war.
Tom riss Dutch-Billy um, sprang an ihm vorbei ins Freie, blickte nach links, wo er Wolters vermutete, und da stand der Deputy schon am Fensterladen.
Wolters zuckte herum, und Tom dachte: Jetzt kommt seine Revanche. Jetzt möchte er es mir heimzahlen.
Der Deputy wirbelte das Gewehr herum und drückte ab.
Tom spürte, wie ihn etwas am Ärmel zupfte, doch mehr nicht. Aber Wolters hebelte durch, wollte erneut schießen. Doch jetzt war Tom heran, schlug ihm den Lauf mit dem Kolben der Marlin herunter, und so fauchte der Schuss in die Erde. Der Gewehrkolben glitt vom Lauf ab und sprang Wolters genau ins Gesicht. Der Deputy brüllte auf, ließ seine Winchester fallen und stürzte rücklings gegen die Hüttenwand.
Dutch-Billy war wieder auf den Beinen, wollte jetzt mit dem Revolver auf Tom schießen, doch gerade, als er seinen Peacemaker im Anschlag hatte, stieß ihn Libbie an, krampfte die Hand um den Lauf von Dutch-Billys Revolver und schrie, während sie so die Mündung auf sich selbst richtete:
„Drücken Sie ab, Sheriff! Schießen Sie doch!“
Sheriff Klein war so überrascht, dass er eine wertvolle halbe Minute brauchte, um Libbie abzuschütteln. Genau die Zeit, die Tom benötigte, um sich auf das Pferd des Sheriffs zu schwingen, die Zügel des Braunen von Wolters zu packen und mit beiden Pferden loszujagen.
Wolters, der gerade wieder hochkam, wollte mit dem Revolver auf Sam schießen, der etwas unschlüssig stehengeblieben war und noch überlegte, ob er Tom und den beiden Pferden nachlaufen sollte oder nicht. Als er es dann doch tat, hob Wolters die Waffe und zielte über den Lauf auf den Wolfshund.
Dutch-Billy schlug ihm den Lauf nieder und bellte: „Was kann denn nun dieses Tier dafür? Johnson hat die Pferde der beiden Cowboys. Hilf mir, sie zu satteln. He, Johnson, wo sind denn die Sättel? Die Cowboys sind doch nicht ungesattelt gekommen und...“
Er wandte sich Johnson zu, der mit der Parker in der Tür aufgetaucht war. „Hallo, nimm das Ding weg!“, rief er dem Jäger zu.
Johnson grinste die beiden Sheriffs an. „Ihr beiden verschwindet. Ohne Pferde. Die beiden Pferde sind mir Cornfields Cowboys schuldig. Weil sie mir beide Geld schulden. Versteht ihr, sie schuldeten mir Geld. Und da sie beide tot sind und nicht bezahlt haben, behalte ich die Pferde, basta.“
„Das lügen Sie sich zusammen!“, rief der Sheriff.
„Die Pferde waren in meinem Besitz, Sheriff. Sie sind es noch. Wollen Sie mir die ohne gerichtlichen Beschluss wegnehmen?“
„Hör mal, Freundchen“, sagte Wolters jetzt, „wir können dich einsperren. Womöglich hast du die beiden umgelegt und nicht Tom Cadburn, wie?“
„Womöglich bist du ein riesengroßer Spinner, Wolters, und was für einer“, rief ihm Johnson zu. Und dann höhnte er: „Nimm mich doch fest, wenn es dir Spaß macht!“
Dutch-Billy war kein Anfänger. Als ihn Johnson einmal kurz aus den Augen ließ, feuerte er aus dem Revolver, traf den Lauf der Parker, so dass der herumgerissen wurde. Johnson drückte vor Schreck ab, und während er noch selbst davon schockiert war, sprang der Sheriff schon auf ihn zu, entriss ihm das Gewehr und drückte ihm den Revolver mit der Mündung zwischen die Rippen.
„Es ist anders gelaufen, Tracy. Wolters, nimm die Sättel! Mach die beiden Cornfield-Pferde fertig. Dann bringst du Johnson in die Stadt. So etwas lasse ich grundsätzlich nicht durch. Ich werde mir Tom Cadburn allein holen. Dazu brauchen wir nicht zu zweit sein.“
„Ihr könnt ihn nicht mitnehmen!“, schrie Libbie. „Mein Vater ist am Fuß verletzt.“
Der Sheriff winkte ab. „Wir werden sehr rücksichtsvoll sein. Und außerdem bekommt er einen Doc, auf Kosten des Countys. Vielleicht heilt der Fuß dann erst einmal richtig. Stellt euch vor, regelmäßig essen, einen Doc, das hat er hier nie gehabt. Nicht umsonst. Wolters, mach endlich die Pferde fertig!“
*
Tom dachte an den Rat, den ihm der alte Cliff gegeben hatte, und ritt aufs Hochgebirge zu, das in den Big Snowy Mountains gipfelte. Lange kam er zu Pferde schwer voran. Das Gelände war unwirtlich und von Felsen durchsetzt, manchmal gab es nur schmale Grate, auf denen er weiterkommen konnte. Es war eine Frage der Zeit, wann er die Pferde einfach nicht mehr weiter mitnehmen konnte.
Er dachte an Sam, den er seit der Flucht nicht mehr gesehen hatte. Sicher ist der kleine Bursche nicht nachgekommen oder hat sich wieder verkrümelt, dachte er.
Aber da irrte er sich. Und als er am Abend rasten musste und dazu eine Felsbucht auswählte, in die von oben her ein kleiner Wasserfall stürzte, kam auf einmal, hechelnd und die Zunge fast am Boden, der schwarze Wolfshund, die Pfoten wund, das Fell voller Dornen und mit Staub gepudert. Er kam einfach, schleppte sich mit fast letzter Kraft bis zu Tom und legte sich ihm zu Füßen, sah ihn aus seinen großen Augen an, als wollte er sagen: Na, jetzt bist du platt, was?
„Sam!“, rief Tom. Nahm das junge Tier und zog es sich auf den Schoß, hielt ihm den Trinkbecher hin, der wohl Wolters gehörte, und ließ ihn vom perlenden Quellwasser trinken, das er selbst eben erst vom Wasserfall geholt hatte.
Sam schlabberte mit der Zunge, leckte danach dankbar Toms Hand und winselte vor Freude, als ihm Tom ein Stück Trockenfleisch gab, das aus Dutch-Billys Packtasche stammte.
Mit dem zähen Fleisch hatte Sam so sehr zu tun, dass er müde wurde, bevor er sich sättigen konnte. Er begrub den Fleischrest unter sich und schlief fast augenblicklich ein. Tom streichelte ihn fröhlich und schwor sich, Sam nie wieder zurückzulassen.
Erst jetzt ging ihm auf, dass Sam keine Zufallsbekanntschaft war, die so ging, wie sie kam. Irgendwie hatte er verstanden, was dieses Wolfsblut wirklich für ihn bedeutete. Dass ihm da ein Freund geschenkt worden war, treu, zuverlässig, redlich. Aber welch ein großer und einmaliger Freund Sam wirklich war, das wusste Tom auch jetzt noch nicht.
*
Old Cliffs Rat, ohne Pferd direkt übers Felsengebiet zu marschieren, erwies sich als goldrichtig. Tom war seinen Verfolger dort los, wo er die Pferde zurückgelassen hatte. Aber das wusste Tom nicht, das konnte er nur hoffen. Er kam nur sehr bald dahinter, dass ihm niemand mehr folgte.
Sam war müde und erschöpft. Der steinige, manchmal mit Schotter bedeckte Boden tat seinen noch weichen Pfoten weh. Steinsplitter hatten ihm die Sohlen aufgeritzt, Staub biss ihm zwischen den Zehen in die weiche Haut, und vom Lauf durch den Busch hatten sich ihm Dutzende von Zecken ins Fell und seine Haut gesetzt, um ihm nun das Blut abzusaugen.
Manchmal gelang es ihm, einige durch Schaben am harten Fels abzustreifen oder abzuquetschen. Doch die meisten blieben, und erst als Tom selbst eine Zecke am Bein hatte, kam er darauf, sie auch bei Sam zu suchen. Der ließ es sich gefallen, dass Tom sie ihm herausholte.
Immer, wenn Tom den jungen Wolfshund auf den Schoß nahm, um ihm die Pfoten zu reinigen oder ihm wie jetzt die Zecken herauszuknipsen, schloss Sam wohlig die Augen, knurrte wie ein schnurrender Kater und reckte sich genießerisch.
Tom besaß die Marlin, wenn auch nur mit wenig Munition. Er hatte in Dutch-Billys Satteltasche elf Schuss .3030 gefunden, die genau in die Marlin passten.
Gestern war es Tom gelungen, ein Wiesel zu schießen, aber davon war Sam satter geworden als Tom. Zudem schmeckte das Fleisch fade.
Tom spürte also wieder ziemlichen Hunger, als er in der Mittagsstunde das Dickhornschaf oben auf dem Grat eines Felsens entdeckte. Es war ein Widder mit seinem gewaltigen Gehörn. Er wirkte groß und kräftig, und Tom kannte die Dickhornschafe eigentlich nur vom Hörensagen oder aus größerer Entfernung. Aber dieser kräftige Kerl dort oben wirkte riesig, zumal die Sonne hinter ihm stand und er wie eine Statue aussah.
Bis zu diesem Widder waren es von Tom aus gut hundert Schritt... nur konnte er die nicht gehen. Denn zwischen dem Grat, auf dem der Widder stand und herüberäugte, und dem Platz, wo Tom beim Anblick des Widders wie versteinert stehengeblieben war, befand sich eine Schlucht. Wie tief sie war, wie breit sie sein mochte, das alles konnte Tom von hier aus nicht erkennen. Davon wusste er noch nicht mal etwas. Er hielt es für eine flache Vertiefung.
Sam, der instinktiv den Gegner in jenem fernen Widder erkannte, der das Tier auch riechen konnte, weil der Wind ihm die Witterung zutrug, stand mit gesträubtem Fell, knurrte dumpf und bleckte gierig die Zähne. Aus seinen Lefzen troff der Speichel. Sam hatte Hunger, und was für welchen. Jetzt war er der Sohn der schwarzen Wölfin, nicht mehr und nicht weniger. Und dort drüben stand Futter.
Der Widder bekam keine Witterung von den beiden, aber er sah sie. Und für den Moment war er erschrocken, stand einfach still. Der Kuckuck wusste, warum er sich nicht mit einem Sprung hinter den Felsengrat rettete.
Tom handelte kurzentschlossen und rasch. Er riss die Marlin an die Schulter, zielte und schoss.
Der Schuss traf genau aufs Blatt, und der Widder machte einen gewaltigen Satz nach vorn, überschlug sich in der Luft... und verschwand.
Tom stürzte vorwärts, das Gewehr in der Rechten. Noch schneller fegte Sam nach vorn, um jäh mit allen Vieren zu stoppen, dass er noch ein Stück auf den Pfoten über den Fels rutschte und unmittelbar an einer scharfen Kante zum Stillstand kam. Als er vor sich blickte, sah er den Abgrund, der sich da vor ihm auftat. Indessen war auch Tom da, konnte gerade noch anhalten und spähte in die Tiefe.
„Eine Schlucht, zum Teufel! Er ist in die Schlucht gestürzt!“, stöhnte er, und ihm krampfte sich vor Hunger der Magen zusammen.
In diesem Augenblick hörte Tom seinen vierbeinigen Freund böse knurren. Er sah Sam an, gewahrte dessen Blickrichtung, und als er selbst dorthin schaute, entdeckte er sie.
Sie hatte einen rötlich-grünen Körper, den sie zusammengeringelt hatte. Ihr Kopf aber war kupferrot. Und ihre gespaltene Zunge vibrierte in nächster Nähe von Toms Knie. Sie hielt den Kopf und den Hals erhoben, wie es Schlangen tun, die jeden Augenblick zum Biss zustoßen wollen.
Da sie auf einem kleinen Felsenvorsprung saß, war sie hoch genug, um Toms Knie zu erreichen, sobald er es bewegen sollte.
Aber da flog Sam wie von der Sehne geschnellt auf den Vorsprung hoch. Er, der schon eine Waldklapperschlange besiegt hatte, die bedeutend größer war als diese hier, schien Schlangen zu hassen.
Wie ein Berserker ging er auf die Kupferkopfschlange los, und sie zuckte sofort herum, wollte ihn beißen, doch er wirbelte um sie herum, biss sie kurz, fuhr zurück, wich ihrem vorstoßenden Kopf aus, biss geschickt wieder von hinten, und als sie abermals herumzuckte, hatte er sie mit einem blitzschnellen Biss am Genick und hielt sie fest, während sie sich rasend ringelte und versuchte, ihn zu umschlingen. Er strengte sich an, und dann knackte es wieder, wie er es schon von der Klapperschlange her kannte. Diesmal war alles leichter gegangen, und als tödliche Zuckungen den glatten Leib durchfuhren, wirbelte Sam den besiegten Feind hin und her, ehe er endlich losließ und knurrend auf das zuckende Bündel blickte.
Tom packte die Schlange an der Schwanzspitze, schlug ihr mit dem Bowiemesser den Kopf ab und sagte zu Sam: „Wir werden sie braten und zwischen uns teilen. Danke, Sam!“ Er streichelte Sam mit der freien Hand, was der Wolfshund mit einem freudigen Jaulen quittierte.
*
Er stand vor seiner aus schweren Baumstämmen errichteten Hütte wie eine Statue. Die Abendsonne fiel auf sein kantiges, von tiefen Furchen durchzogenes Gesicht. Kühn blickte das Augenpaar auf Tom und den Wolfshund, die sich müde, mit wunden Füßen den Hang herauf quälten.
Wild John Stafford trug eine abgeschabte, in undefinierbaren Farben schillernde Wildlederkleidung, die ganz deutlich die indianische Herkunft verriet. Und nicht nur die Weste, das Lederhemd und die Hosen stammten von Indianern, auch die Mokassins, die Wild John trug. Nur sein Hut, der auf dem langen weißen Haar saß, der war von Weißen gemacht. Und auch das Gewehr, eine langläufige Büchse, wie sie Tom noch nie gesehen hatte. Der Lauf schien versilbert zu sein und war vom Schaft bis zur Mündung mit herrlichen Gravierungen verziert.
Tom kannte seinen Vater, wenn der in Musselshell gewesen war. Kurze Besuche, bei denen sich Wild John am meisten Hennie Cadburn gewidmet hatte. Doch er sollte, wie Hennie Cadburn behauptete, sich immer sehr für den Werdegang seines Sohnes interessiert haben. Tom erinnerte sich, dass ihm seine Mutter einmal erzählt hatte, sie wäre einige Zeit mit Wild John in den Wäldern im Norden gewesen, hätte dann aber ihr Bündel gepackt, um in eine Stadt zurückzukehren.
Wild John aber war in der Einsamkeit der Wildnis geblieben. Und hier, auf diesem Berg, da war seine Heimat in Form einer halb in die Erde gebauten Hütte, deren Wände aus so dicken Stämmen bestand, dass diese Hütte bestimmt einige Jahrzehnte überstehen konnte.
Als Tom dann vor seinem Vater stand, sahen sie sich an. Sie waren beide gleich groß, aber Tom war noch etwas schmaler in den Schultern und hatte noch nicht so muskulöse Arme wie sein Vater. Aber die Ähnlichkeit konnte niemand übersehen.
„Was ist?", fragte Wild John rau. „Was willst du mit diesem Halbwolf?“
Er sah Sam an, der ihn misstrauisch anblickte und gereizt knurrte, wie er es stets tat, wenn er in die Nähe von Menschen geriet. Dass dieser dort in der merkwürdig riechenden Kleidung der Vater seines Freundes war, konnte Sam nicht wissen.
Tom fand die Begrüßung nicht gerade überaus herzlich und erwiderte: „Sie wollten mich aufhängen. In Musselshell. Old Cliff und Mutter haben mich aus dem Jail befreit. Dutch-Billy ist hinter mir her.“
Die Stirn des Mannes schlug Falten. „Der Sheriff?“
Tom nickte.
Wild John nickte. „Hm, so also. Warum?"
Tom erzählte es. Zwischendurch dachte er: Warum gibst du uns nichts zu essen und zu trinken, verdammt? Statt dessen machst du dieses verdammte Verhör.
Wild John wusste genau, wie es um Tom und seinen kleinen Freund stand. Doch für ihn, der es gewohnt war, zu hungern, Durst zu leiden, Selbstdisziplin zu wahren, hatte Tom sich zusammenzunehmen. Das musste er eben lernen, falls er es noch nicht gewohnt war.
Sam sah das anders. Er hatte den Duft von Fleisch in die Nase bekommen und nahm diese Witterung jetzt so deutlich auf, dass er angestrengt in die Richtung auf die Hütte blickte, neben der dieser Geruch zu sein schien.
Um die Sache genauer zu erkunden, machte sich Sam völlig unbeachtet auf den Weg. Ohne dass Wild John ihm Aufmerksamkeit schenkte und Tom es in seiner innerlichen Erregung merkte, schlich Sam auf die Hütte zu. Und da plötzlich geschah etwas, das Sams Leben völlig verändern sollte.
Sam roch Fleisch, und weil er wieder einmal entsetzlichen Hunger hatte, zog ihn diese Witterung an wie ein Magnet ein Stück Eisen. Er sah auch, woher der Geruch kam. Da hing ein ausgeweidetes Stück Wild, ein Wapitihirschkalb, an der Hüttenwand zum Ausbluten. Das Fell war abgezogen und bereits aufgespannt zum Trocknen.
Der Fleischgeruch stieg in Sams Nase wie ein betäubendes Parfüm. Und so sah er den Husky nicht.
Der Husky war pechschwarz, auch an Bauch und Beinen. Er war für einen Schlittenhund ungewöhnlich kräftig und groß, und wie alle Huskys stand er dem Wolf von der Herkunft her sehr nahe. Das sah man ihm an, wenn es auch nicht so ausgeprägt war wie bei Sam.
Das allerdings waren Dinge, die im Augenblick Sam einen feuchten Staub kümmerten, und den viel größeren Husky womöglich noch weniger.
Sam sah ihn, als er fast bei diesem herrlichen Fleisch angekommen war und praktisch den Speichel, der da in seinem Mund zusammenlief, kaum mehr in der Schnauze halten konnte.
Im selben Moment schoss der Husky schon vor. Er flog durch die Luft wie ein schwarzer Strich.
Sam dachte in diesem Augenblick nur eines: Flucht! Der Gegner war viermal größer als er selbst, und da half nur Schnelligkeit.
Aber Sam konnte sich nicht einmal mehr ganz umdrehen, da landete der schwarze Rüde schon neben ihm, und während Sam abermals herumfuhr, um sich nun zu wehren, weil Flucht nicht mehr möglich war, da gelang ihm gerade noch ein harmloser Biss in die dicht behaarte Brust des Schlittenhundes. Soweit ließ es der Husky gerade noch kommen, dann schnappte sein gewaltiger Fang zu.
Sam spürte die Reißzähne des viel größeren Hundes im Genick, fühlte sich dort so fest gepackt, dass er sekundenlang wie gelähmt war. Und da hob ihn der Husky auf; während er dabei so drohend knurrte, dass Sam die helle Angst überkam.
Dann ließ der Husky plötzlich los, und Sam plumpste auf den Boden. Wie ein Riese stand der Husky über ihm, und Sam fuhr der heiße Atem des erwachsenen, so viel größeren Tieres in Nase und Augen.
Sam hatte keine Chance und wusste es. Und so tat er instinktiv, was Wölfe und Hunde tun, wenn sie sich untereinander balgen und bekämpfen: er streckte sich und zeigte dem Gegner zum Zeichen der Aufgabe den ungeschützten Hals. Ein Signal, das von all den Hunden und Wölfen beim Artgenossen respektiert wurde, wenn sie nicht darauf abgerichtet waren, auch den Artgenossen zu morden. Oder wenn sie, wie es Wölfe in größter Hungersnot im tiefem Winter mitunter tun, in nacktem Kampf ums Überleben den Artgenossen, der verletzt ist, töten.
Der Husky tötete Sam nicht. Als ihm Sam seine empfindlichste Stelle zeigte, ließ er von ihm ab, blieb aber bei ihm knurrend stehen, als wollte er damit sagen: Dich bringe ich um, wenn du nicht hier schön liegenbleibst.
Und als Sam nur den Kopf hob, zuckte der Fang des schwarzen Huskys wieder vor. Sam begriff und lag still.
Da sah er auf einmal die Gestalt des alten Pfadfinders auftauchen, daneben die von Tom. Sam sah den Jungen an, voller Hoffnung und Erwartung.
Doch es war der Ältere, der etwas sagte. „Lass ihn, Fedor!“, schnarrte er mit tiefer Stimme, und sofort setzte sich der schwarze Husky an die Seite seines Herrn, knurrte aber immer noch und ließ Sam nicht aus den Augen.
Sam stand auf, immer noch ängstlich, dass der schwarze Riese wieder auf ihn zuschießen würde. Doch der verstärkte nur sein Knurren, kam aber nicht.
Das war Sams erste Bekanntschaft mit einem Husky, mit einem, der dazu wie er selbst Wölfe in der engeren Verwandtschaft hatte.
Die Hand des älteren Mannes näherte sich Sam. Er wich zuerst etwas zurück, dann knurrte er mit seiner noch hellen Stimme. Aber die Hand kam näher. Sam wollte nicht, dass sie ihn berührte, und so schnappte er danach.
Prompt schoss Fedor vor, bereit, den kleinen und viel jüngeren Wolfshund zu fassen. Aber die Stimme seines Herrn scheuchte ihn zurück.
„Komm her! Komm her, Kleiner, du sollst keine Angst haben!“, sagte die Stimme dann in Sams Richtung.
Sam hatte Angst vor dem großen schwarzen Artgenossen. Er begriff auch, dass der abermals zupacken würde, verhielte er selbst sich nicht ruhig. Und noch spürte er den Biss des Großen im Nacken.
„Nun komm schon!“
Und da berührte ihn die Hand, streichelte ihn, und Sam sträubte sein Fell. Plötzlich war noch eine Hand da, und von ihr ging ein überwältigender Fleischgeruch aus. Ein herrlicher Geruch. Ein Geruch, bei dem Sam alle Angst zu vergessen schien.
Da sah er es schon. Ein Zipfel Speck. Der Geruch war schon betäubend. Der Speck näherte sich seiner Nase. Aber zugleich war da noch die Angst vor dem Großen. Sam schielte zu Fedor hin. Der saß da, als könnte er kein Wässerchen trüben. Und hinter Fedor stand Tom, der gespannt auf Sam blickte.
Sam wollte nach dem Speck schnappen, da sagte Tom schrill: „Nein! Lass es!“
Zugleich aber murmelte die Stimme des älteren Mannes etwas Beruhigendes, Einschmeichelndes.
Sam hatte wahnsinnigen Hunger. Und dieses Stück Speck baumelte vor seiner Nase. Doch mit Toms Zuruf war alles Misstrauen wieder geweckt.
„Lass es!“, rief Tom wieder, und in seiner Stimme schwang ein stark befehlender Ton, den Sam kannte. So hatte Tom immer gesprochen, wenn er Sam vor Gefahr bewahren oder warnen wollte.
Sam zuckte zurück, knurrte, als sei der heiß begehrte Speck etwas, das er bekämpfen müsste.
Die Hand wedelte den Speck wiederum vor seiner Nase herum, und die Stimme sprach sanft. Doch wieder rief Tom: „Nein!“
Und Sam knurrte noch böser. Die Angst vor dem großen Artgenossen war weg. Auf einmal wollte er nicht mehr, dass ihm jemand diesen Speck vor die Nase hielt.
Der Trapper richtete sich auf, gab Tom den Speck und sagte: „Gut, Junge, gut ist er. In Ordnung, gib es ihm jetzt. Und dann komm in die Hütte. Wir müssen überlegen, was wir tun. Diesen Wolf machen wir zu einem Prachttier. Er ist in Ordnung, verdammt, Junge, er ist wirklich gut. Das ist das Material, aus dem man so etwas machen kann, wie ich es aus Fedor gemacht habe..
Tom nickte nur, nahm den Speck, rief Sam zu sich, der sofort kam, kauerte sich und hielt ihm den Speck hin. „Nimm schon!“
Und da nahm ihn Sam. Und er brummte glücklich, als er den Speck verschlang, während Tom neben ihm kauerte, als wollte er dafür sorgen, dass niemand käme, Sam dieses herrliche Futter wieder wegzunehmen.
*
Am nächsten Tag begann für Sam ein neues Leben, für Tom aber zerplatzte die Hoffnung, beim Vater bleiben zu können.
Wild John Stafford war schon auf der Morgenpirsch gewesen, als Tom gerade erwachte und sich aus den Felldecken schälte. Er suchte zuerst nach Sam, doch den entdeckte er erst, als Wild John Stafford in die Hütte trat, neben sich seinen schwarzen Husky Fedor ... und an den mit einer Rohlederleine angebunden: Sam.
„Ich bin schon unterwegs gewesen, Junge. Du musst weg hier. Ich bringe dich nachher zu Freunden. Es sind Schwarzfußindianer. Da bist du sicher, und ich will, dass du eine Zeit bei ihnen bleibst und bei ihnen eine Menge lernst, wie man in der Wildnis lebt. Das ist für dich wichtiger als das, was du bei Webster getan hast. Ich weiß, du bist ein guter Reiter und guter Schütze. Das langt nicht. Denn wie ich deinen Schwarzwolf abrichte, so wirst du bei den Indianern in die Schule gehen. Sie sind meine Freunde, Tom. Und wenn Dutch-Billy kommt oder sonst einer von denen aus Musselshell City, können die wieder umkehren. Nirgendwo bist du so sicher wie bei ,Rotes Pferd’, so nennen wir den Stammeshäuptling.“
„Ich will Sam mitnehmen“, sagte Tom entschieden.
Sein Vater schüttelte den Kopf. „Noch nicht. Die Indianer haben ganze Rudel von verwilderten Kötern, die dir dein Tier für alle Zeit verderben. Nein, er muss erst einiges lernen. Du hast mir vorhin erzählt, woher du ihn hast, und ich kann mir fast denken, von wem er abstammt. Als ich zum letzten Mal in Musselshell war, hat mich Farmer Shaddow gefragt, ob ich nicht dieses Wolfspaar abknallen könnte. Er sprach von einem Rüden, der riesig groß und fast wie einer von German-Joes Schäferhunden ausgesehen haben soll. Ich hatte an der Jagd auf die Wölfe trotz der Prämie kein Interesse. Aber es ist möglich, dass dein Sam von diesem Paar abstammt. Und es zeigt auch, dass es den Farmern gelungen sein muss, die Alten abzuschießen. Denn so früh lassen Wölfe ihre Jungen nicht allein jagen. Für dich ein Glück. Es macht ihn für den Menschen zugänglich. Er wird eine Menge lernen, was du ihm nicht beibringen kannst.“
So geschah es, dass sie sich trennen mussten. Und für beide begann eine harte Lehrzeit.
*
Es war eine Woche später, als Dutch-Billy Klein sein Pferd unweit der Hütte zügelte. Er lehnte sich aufs Sattelhorn, spähte zur Hütte empor und wartete darauf, dass Wild John Stafford auftauchen sollte. Und der alte Trapper kam. Er näherte sich vom Wald her auf einem Maultier, während sein großer Husky neben ihm trabte. Und da war etwas, das Dutch-Billy hoffen ließ. Durch eine Rohlederleine mit dem Husky verbunden, lief ein junges schwarzes Wolfsblut mit.
Er ist also da, wenn auch sein Schwarzwolf da ist, und ich bin nicht umsonst den weiten Weg geritten, dachte der Sheriff.
„Hoh!“, rief der Trapper seinem Maultier zu, schwang sich aus dem Fellsattel und sah Dutch-Billy entgegen. Die beiden Wolfshunde knurrten in Richtung auf den Sheriff, besonders Sam, der Dutch-Billy sehr gut in Erinnerung hatte. Und sein jäh entflammter Zorn auf diesen Zweibeiner sagte auch Fedor, dass der dort drüben nicht gerade zu den Freunden der Familie zählte. Also knurrte auch Fedor böse.
„Seid still, ihr beiden Narren!“, fauchte Wild John, doch er selbst ließ auch die Hand nicht von seiner langläufigen Spezial-Sharps, seinen guten Freund, wie er das Gewehr nannte.
Dutch-Billy saß ab, kam steifbeinig auf Wild John zu und blieb dann vor ihm stehen, während die beiden Wolfshunde ihn grimmig ansahen und nur noch verhalten knurrten.
„Er ist also hier“, sagte der Sheriff und hakte die Daumen in den Gürtel.
„Nein, ich habe ihn weitergeschickt. Nur sein Schwarztimber ist da. Du kommst vergeblich, Billy.“
Der Sheriff nickte, als hätte er nichts anderes erwartet. Dann drehte er sich eine Zigarette, zündete sie in der hohlen Hand an und wandte sich wieder dem Trapper zu. „Er ist also bei den Schwarzfuß-Indianern, oder sehe ich das falsch?“
„Gewiss, du siehst das goldrichtig, Billy“, bestätigte Wild John grinsend. „Ich glaube es wird Zeit für einen Drink. Ich habe einen, den ich letzten Herbst gebrannt habe. Aus Hickory-Nüssen. Hast du schon mal einen Schnaps getrunken, der von Nüssen gebrannt ist?“
„Nein, aber es würde mich interessieren. Kannst du inzwischen die beiden Tiger irgendwo in einer Kiste verpacken? Die Hose von mir hat vierzehn Dollar gekostet.“
Wild John lächelte. „Die rühren dich nicht an, wenn ich das nicht will.“
Der Sheriff blickte auf Sam. „Hast du Hoffnung, dass aus dem was wird?“
„Zerbrich dir darüber nicht den Kopf. Ich hatte bisher immer erstklassige Hunde. Versorge dein Pferd, dann komm herein.“
Wenig später saßen sie in der behaglich, wenn auch schlicht eingerichteten Hütte, und Wild John goss selbstgebrannten Walnussschnaps in tönerne Becher, die er ebenfalls selbst gedreht und gebrannt hatte.
Sie tranken, und Dutch-Billy nickte anerkennend. Dann sagte er: „Und wenn ich zu den Schwarzfüßen reite?“
„Du hast bei ihnen nichts verloren, und sie wissen das, Billy. Wenn wir auch mit den Blackfeet keinen Ärger haben, manchmal können auch sie ziemlich böse werden. Übrigens war Tom es nicht.“
„Nein, das mit den beiden Cowboys war er nicht. Aber die Sache mit dem Colonel, die stinkt. Da müsste ihn sogar Old Cliff belasten. Überlege dir doch: er hatte die Hawkenbüchse in der Hand, vor ihm lag der Colonel erschossen, und alle anderen Leute sind bis auf Webster weit entfernt. Webster steht auch gut zwei Schritt weg, als Old Cliff kommt. Und der Junge sagt, Webster wäre es gewesen. Nicht absichtlich, aber doch der Täter.“
„Und ich sage das auch. Ich war nicht dabei, Billy, aber ich kenne den Jungen, ich habe eine Nase für Menschen. Vielleicht, weil ich so weit von ihnen entfernt lebe. Er ist ein guter Junge, naiv, unerfahren, ungeschickt, aber von gutem Holz. Er hat viel von seiner Mutter, und die ist auch besser als viele von euch. Ihr nennt sie eine Dirne, aber das ist sie gar nicht. Eigentlich nicht. Sie hat nur das richtige Gefühl dafür, was ein Mann wirklich gerne mag. Und sie gibt es ihm.“
„Du hättest sie heiraten sollen.“
„Das wollte ich. Aber sie wollte nicht, weil sie die Stadt liebte, ich aber hier oben blieb und das von ihr nicht verlangen mochte. Billy, bleib über Nacht, und morgen reitest du heim. Der Junge ist unschuldig, und im Grunde weißt du das sogar.“
„Er bekommt einen fairen Prozess, und die Wahrheit stellt sich heraus. Dann ist er frei. So aber hängt es ihm immer an. Er bleibt ein Verfolgter.“
„Das ist richtig, wenn das Opfer irgendein Mann wäre, einer wie du und ich. Es ist aber der Colonel. Und der wahre Täter ist ein Mann, der sein Ansehen um keinen Preis bloßstellen will: Webster. Deshalb, Billy, gibt es keinen fairen Prozess und keine Gerechtigkeit. Es gibt nur eines: sie stürzen Tom ins Unglück. Das aber will ich nicht.“
„Du würdest mir nicht zufällig sagen, wer ihn befreit hat?“
Wild John grinste. „Erwartest du das im Ernst?“
Dutch-Billy lächelte. „Natürlich nicht. Schenk mir noch einen ein, das Zeug ist wunderbar!“
„Soviel du willst, Hauptsache, du fällst nicht aus dem Sattel morgen.“
„Ich glaube kaum, und das Pferd findet allein nach Hause.“
„Also reitest du zurück?“
Dutch-Billy lachte. „Bist du nun zufrieden, du verdammter Waldschrat?“ Er wurde ernst: „Deinem Jungen aber würde ich nicht raten, im Umkreis von fünfzig Meilen von Musselshell City aufzutauchen. Am besten wäre, er ritte weit, weit weg!“
*
Die Augusthitze brütete über der Waldlichtung. Über den Feuern zitterte die Luft. Und um die Zelte hockten, lagen und kauerten bronzehäutige Männer und Frauen, spielten nackte Kinder im aufgewühlten Sand.
Eine Gruppe junger Burschen, von denen keiner mehr als einen Lendenschurz trug, hatte sich im Schatten einer mächtigen Douglastanne gesammelt. Es waren muskulöse, sehnige Kerle, und bis auf einen hatten sie alle diese tiefgebräunte, bronzefarbene Haut. Einer aber war heller. Hatte helles Haar, hatte blaue Augen. Aber sonst glich er ihnen.
Sie hatten sich im Kreis zusammengehockt, acht Burschen zwischen sechzehn und zwanzig Jahren waren es. Einer von ihnen wurde „Guipaego“ genannt. Das heißt: Wolf, der alleine ist. Das war der mit der helleren Haut, das war Tom Cadburn, der jetzt nicht mehr daran dachte, dass er sich gerne Tom Stafford Cadburn genannt hatte. Für die Leute hier war er Guipaego. Anfangs hatten sie ihn „Mann mit dem Haar wie reifes Gras“ genannt. Das war auf indianisch ein so langer Name, dass ihn sich Tom nie merken konnte.
Einige nannten ihn dann auch Tom, weil er es so wollte. Das waren die, denen das notwendigste Englisch geläufig war. Aber eines Tages war ein Wettkampf, und er musste daran teilnehmen. Erst wollte er nicht, doch dann machte es ihm Spaß, und weil er wie ein Wolf kämpfte, um gegen die weit überlegeneren und durchtrainierten Gegner zu gewinnen, gaben sie ihm diesen Ehrennamen, obgleich er nicht der Sieger wurde. Doch sein Kampfgeist nötigte ihnen Respekt ab.
Er war jetzt zwei Monate bei ihnen, und jeden Tag lernte er mehr. Denn eines hatte er längst erkannt und begriffen: Die Indianer waren nicht die primitiven Wilden, als die sie von den meisten Weißen in Musselshell City hingestellt wurden. Vor allem kannten sie sich in der Natur weit besser aus als viele Weiße, und es gab einfache Dinge, die sie beherrschten und die Tom von ihnen erst lernen musste. Auch in der Jagd und der Kriegslist waren sie erfinderisch, um mit einfachen Waffen einen überlegenen Gegner zu bezwingen.
Tom verstand sich mit den Gleichaltrigen des Stammes, und seit dem Wettkampf kam er mit ihnen gut zurecht. Er begann schon ihre Sprache zu verstehen und ein wenig auch zu sprechen, wenn auch mancher Schwarzfuß nachsichtig lächelte, wenn Tom sich redlich mühte, indianisch zu reden. Eine ganze Reihe von Männern sprach jedoch mehr oder weniger verständliches Englisch, so dass Tom in der Not darauf zurückkommen konnte. Er aber hatte den Ehrgeiz, Indianisch zu lernen, und sie halfen ihm dabei.
An diesem Tage, jenem Sonntag Mitte August, lernte Tom den Hengst Thunder kennen. Es sollte eine bedeutsame Begegnung werden, wenngleich Tom davon so wenig ahnte wie der Blauschimmel, den die Indianer in einen Einzelpferch aus Rohlederriemen gesperrt hatten. Das war gar nicht ihre Art, und so wandte sich Tom an Little Crow, einen zwanzigjährigen Burschen, der meist mit ihm zusammen war und von dem Tom lernen sollte.
Little Crow sprach besser Englisch als die anderen in der Gruppe. Mit ihm unterhielt sich Tom nur in seiner eigenen Sprache.
„Warum habt ihr diesen Dreijährigen eingesperrt?“
Little Crow blickte wehmütig auf den herrlich gewachsenen Blauschimmelhengst. „Er hat geschlagen und gebissen Tochter von Häuptling. In ihm ist böser Geist. Wir müssen austreiben böse Geist. Medizinmann wird morgen kommen und austreiben. Vielleicht wir verkaufen Pferd an Langmesser.“
„An die Soldaten? Aber das ist doch kein Grund, einen so herrlichen Hengst zu verkaufen. Man kann ihm das Schlagen und Beißen doch abgewöhnen!“
Little Crow lächelte sanft. „Man kann, wenn Pferd mich beißen oder Häuptling beißen oder dich beißen. Aber es hat Namrami gebissen.“
„Weil sie eine Frau, ist?“
„Weil sie eine Frau und Tochter vom Häuptling ist.“
„Little Crow, kann ich dieses Pferd nicht kaufen?“
Little Crow sah Tom grinsend an. „Hast du Geld?“
„Ich könnte dafür arbeiten.“
Little Crow lachte. „Wenn du zu unsere Stamm gehörst, kannst du nicht kaufen und nicht bekommen. Bist du Gast, kannst du nicht kaufen, aber wir können schenken. Bist du fremd, kannst du kaufen. Häuptling will nicht schenken. Braucht Geld. Geld notwendig für Munition und Gewehre. Notwendig für Messer, für Nadeln. Aber ich werde fragen.“
Und Little Crow fragte. Dann kam Little Crow vom Zelt seines Vaters zurück, und der wiederum ging zum Häuptling. Denn Little Crow durfte nicht selbst zum Häuptling gehen.
Tom erwartete eine rasche Antwort, doch Little Crow sagte ihm, dass er damit nicht vor dem morgigen Vormittag rechnen könne.
Indessen trat Tom an den Seilkorral, um sich den Hengst aus der Nähe anzusehen. Ein herrliches Tier, kräftig, groß, mit einem gewaltigen Brustkasten, der eine leistungsfähige Lunge ahnen ließ. Die Fesseln schlank, die Sprunggelenke sehnig und muskulös, ein wunderbarer Mustang, der zudem schon von seiner Fohlenzeit an, wie es bei Indianern üblich war, neben großen erfahrenen Pferden mitgelaufen war. Die Häuptlingstochter war mit ihm nicht fertig geworden.
Tom sprach auf den Hengst ein, erzählte ihm irgend etwas in monotonem, einschläferndem Tonfall. Und der Hengst kam näher, reckte Tom den Kopf entgegen, ließ es geschehen, dass Tom ihn kraulte und streichelte. Es war etwas in Toms Stimme, was alle Wildheit in dem Hengst wie weggeblasen machte. So ähnlich wie bei Sam. Und auch die Art, wie Tom das Pferd liebkoste, schien seine besondere Wirkung zu haben. Tom selbst wusste da noch nicht, dass er eine ganz besondere Gabe besaß: er konnte mit wilden und halbwilden Tieren umgehen wie kaum ein anderer. Etwas war in seinem Fluidum, das diese Tiere deutlich spüren ließ, dass er sie mochte.
Auch der Hengst spürte das, und er, der sonst biss und auskeilte, sobald einer an die Seile des Korrals trat, war wie ein Lamm.
Zuzureiten brauchte man ansonsten einen Mustang nicht, das wusste Tom. Denn die Mustangs wurden schon sehr früh daran gewöhnt, dass sie einmal einen Reiter zu tragen hatten. Anfangs legten ihnen die Indianer Säcke auf, später saßen Kinder auf den Rücken der noch nicht erwachsenen Jungpferde, und Zug um Zug lernten Mustangs, einen erwachsenen Reiter mit einem indianischen Sattel oder auch ohne Sattel - bei Jagd und im Krieg zu tragen.
Dieser Blauschimmel aber musste einmal missbraucht worden sein, wer weiß? Und seitdem, das ging schon über ein Jahr, ließ er kaum einen an sich heran. Nur Little Crow durfte ihn anfassen, aber reiten ließ er sich auch von ihm nicht.
Tom hatte in seiner Burschenzeit zwei Dinge bis zur Perfektion gelernt: Reiten und Schießen. Nur deshalb war er von Webster als Express- und Botenreiter und auch als Wagenbegleiter angestellt worden. Und dieses Können verdankte Tom Old Cliff. Bei dem Alten war er in eine harte Schule gegangen.
Ich würde dich reiten!, dachte Tom, als er den Hengst betrachtete, und er murmelte monoton: „Wir beide könnten Freunde werden, prächtige Freunde. So wie mit Sam, an den ich verdammt oft denke. Und wenn wir drei richtig zusammenhalten, dann wären wir imstande, den Teufel aus der Hölle zu fischen. Was meinst du, Großer Ja, einen Namen haben sie dir auch noch nicht gegeben. Einen Namen geben dir die Schwarzfüße erst, wenn du einem gehörst. Also ich glaube, dass du irgendwann mir gehören wärst. Ich werde dich Thunder nennen. Gefällt dir der Name Thunder?“
Der Hengst rieb seine Nüstern an Toms Schultern, und es gab ein Bild ab, als wären die beiden seit Jahr und Tag die dicksten Freunde. Dabei kannten sie sich noch keine zehn Minuten näher.
Aber aus dieser Bekanntschaft wurde aus völlig unerklärlichen Gründen eine richtige tiefe Zuneigung. Sie hatten sich gesehen und mochten sich. Und Thunder, wie ihn Tom nur noch nannte, wieherte sehnsüchtig, als Tom sich einmal entfernte.
Als Tom zu den anderen jungen Burschen zurückging, die ihm und dem Hengst verblüfft zugesehen hatten, sagte Little Crow, der auch gerade zu ihnen stiess: „Es ist toll, es ist einfach toll, aber du bist Wundermann! Da drüben, Häuptling hat zugesehen. Hat alles beobachtet.“
Der Häuptling winkte Little Crow. Der trabte zu dem bulligen Indianer, beide sprachen, dann trabte Little Crow wieder über den Platz zu den jungen Burschen.
„Guipaego, du kannst bekommen Hengst. Du musst nehmen und reiten. Wenn Hengst dich tragen, du kannst behalten Hengst. Häuptling ihn dir schenken.“
*
Sie kamen aus allen Zelten, und sie bildeten einen riesigen Kreis. Der älteste Greis humpelte herbei, um es zu sehen. Und sie alle hatten noch gut in Erinnerung, wie dieser Blauschimmel gebissen und geschlagen hatte. Denn nur bei der Tochter des Häuptlings, die übrigens mit einem Häuptlingssohn verheiratet worden war und seit ein paar Wochen nicht mehr im Camp lebte, hatte man die Tücken dieses Hengstes beklagt. Der Hengst' war aber schon vorher zum Schrecken vieler mutiger Männer geworden, die er abgeworfen und dann mit wirbelnden Hufen fast umgebracht hatte.
Jetzt wollten sie sehen, wie dieses gelbhaarige Bleichgesicht sein Leben aufs Spiel setzte. Doch zuvor ließ der Häuptling etwas verkünden, und Little Crow übersetzte es Tom, weil der nicht alles verstanden hatte.
„Hengst gehören meine Familie. Häuptling sagt, dass ich versuche auf Hengst reiten. Wenn ich oben bleiben, dann Hengst mir gehören. Wenn nicht, du musst versuchen. Wenn du auch nicht kannst reiten, Hengst kommt zu Langmesser.“
„Also praktisch eine Art Zweikampf“, sagte Tom. „Zwischen uns beiden.“
„Zwischen Hengst und uns beiden“, erwiderte Little Crow.
Little Crow ging zum Seilkorral, wo der Hengst nicht nur eingepfercht war, sondern auch zusammengebundene Vorderbeine hatte, um ihm die Flucht unmöglich zu machen.
Der Hengst kannte Little Crow, und von ihm ließ er sich anfassen, ließ sich die Fesseln lösen, ließ sich aus dem Korral führen. Er trug jetzt nur die Hackamore, jenen Zaum, den die Indianer zum Leiten des Pferdes nötig haben. Ein Nasengurt statt eines Gebissstückes und ein einfaches Seil sind alles, womit Indianer ein Pferd leiten.
Auf die Mitte des von den Zuschauern gebildeten Kreises brachte Little Crow den Hengst. Er winkte auch Tom, weit genug zur Seite zu gehen, dann sprang Little Crow nach Indianerart mit einem Schrei auf den Rücken des Hengstes. Trieb den Hengst damit zugleich an, um ihn am Bocken zu hindern oder davon abzulenken.
Thunder, der Blauschimmel, machte einen Satz nach vorn, stemmte sich sofort mit beiden Vorderbeinen ein, aber damit bekam er Little Crow nicht von seinem Rücken. Der junge Indianer saß wie angewurzelt auf dem Pferd, und als es abermals bockte und dabei mit der Hinterhand auskeilte, klebte Little Crow nach wie vor auf dem Pferdrücken.
Doch nun versuchte es Thunder anders. Er warf sich überraschend seitlich auf den Boden. Little Crow begriff es gerade noch rechtzeitig und sprang ab.
Der Hengst wirbelte herum, und schon rotierten die Vorderhufe in rasendem Tempo wie Quirle. Little Crow sprang auf und hatte nur noch die Chance, diesen mörderischen Vorderhufen durch die Flucht zu entkommen. Das hatte mit Feigheit nichts zu tun. Es war die einzige Lösung. Und Little Crow rannte los. Der Hengst kam wieder auf alle Viere, aber da war Tom da. Tom, der mit zwei langen Sprüngen gestartet war, als sich sein Freund Little Crow in Gefahr befand. Und mit einem dritten Satz hatte Tom den Hengst an der Hackamore.
Er sprach auf ihn ein, streichelte ihn, und der eben noch wie irr tobende Hengst wurde schlagartig ruhig. Es war wie Magie, und die umstehenden Indianer starrten auf Tom wie auf einen Medizinmann, wie auf einen, der Wunder vollbringen kann.
Und dann kam es. Tom legte dem Hengst die Hand auf den Widerrist, streichelte ihn dort, um sich dann mit einem Sprung auf den Rücken des Tieres zu setzen.
Tom rechnete mit allem, aber dennoch redete er immer wieder auf das unter nervösem Druck stehende Tier ein. Und es blieb stehen, hielt die Ohren nach hinten gedreht. Die Nüstern, vorhin noch weit gebläht, nahmen wieder normale Größe an. Ein leichtes Zucken lief übers Fell vom Hals her. Doch als Tom seine Hand sanft auf das wie Samt glänzende Fell am Hals legte und weich darüber strich, hörte auch dieses Zucken auf. Der Hengst wurde ruhiger, immer ruhiger, und Tom sprach. Er redete sinnloses Zeug, und das war auch gar nicht wichtig. Nur am Tonfall erkannte der Hengst, dass dieser Mensch auf seinem Rücken der Freund war. Das Magische lag im Ton, in Toms Stimme. Der Hengst wurde ganz ruhig und dann trieb ihn Tom ganz vorsichtig und behutsam an. Der Hengst blieb stehen.
Tom fragte sich, ob jetzt alle Beruhigung wieder vorbei sein würde, ob nicht die Panik wieder Herr über den Hengst werden könnte.
Doch dann, während noch alle im Kreis die Luft anhielten und Tom schon mit einem Zornausbruch des Tieres rechnete, machte Thunder einen Schritt, dann noch einen, und unter weiterem Zureden ging er im Kreis wie ein uralter Gaul, der nie ein Wässerchen getrübt hatte.
Jetzt setzte Tom alles auf eine Karte. Er trieb ihn schneller an, schnalzte mit der Zunge, und gleichzeitig gab er den Indianern das Zeichen, ihm eine Gasse zu öffnen im Kreis der Zuschauer. Sie öffneten diesen Kreis, und da preschte Thunder los. Aber auch das war kein Ausbruch, keine Flucht, keine Form der Panik. Der Hengst lief gutwillig dahin, galoppierte so gleichmäßig, dass sich Tom fragte, ob es je ein Pferd gegeben hatte, das einen so herrlichen Sprung besessen hatte wie Thunder.
Der Hengst flog wie eine Feder. Und am Tempo, das dieser herrliche Blauschimmel nahezu mühelos noch steigerte, erkannte Tom, dass er einen Schatz besitzen würde, sollte der Häuptling ihm dieses Pferd wirklich schenken.
Als Tom nach einer halben Stunde zur Umkehr ansetzte, sah er den Pulk der Indianer in der Ferne, die näher kamen. Und als sie bei ihm waren, schrie Little Crow, der weit vor den anderen ritt: „Wir denken, du von Pferd gefallen. Wir kommen suchen."
Aber Tom ritt noch auf Thunder, als sie wieder ins Lager kamen. Und er ritt, als hätte er nie ein anderes Pferd besessen und als wäre Thunder niemals ein Schläger und Beißer und ein tollwütiger „Sunfisher“ gewesen. Und „Sunfisher“ oder Sonnenfischer nennt man die Pferde, die sich hinwerfen und die Beine in die Höhe stoßen, um ihren Reiter nicht nur loszuwerden, sondern um ihn bei der Gelegenheit auch noch umzubringen.
Der Häuptling verzog keine Miene, sah Tom an, sah den Hengst an, dann sagte er etwas zu Little Crow, und der übersetzte: „Der Hengst gehört dir. Dir und keinem anderen. Ich freuen für dich, Guipaego ...“
Der Blauschimmel wieherte, als hätte er das verstanden. Und es klang freudig, dieses Wiehern …
*
Dutch-Billy hatte Zeit, wahnsinnig viel Zeit. Er kam aus dem Barber Shop, wo er sich rasieren ließ, und nun marschierte er geradewegs auf den Central Saloon zu, sein Stammlokal. Es war Vormittag, und es war ein frischer, wenn auch wolkenloser Märztag.
Der große Mann trug keinen Stern mehr auf der Weste, wenn man auch noch die Nadellöcher im Leder sehen konnte. Nur sein Revolver erinnerte noch an die Zeit vor einem halben Jahr, als Klein noch Sheriff gewesen war.
Drüben im Office saß ein jüngerer Mann, einer, der erst seit knapp sieben Monaten in der Stadt lebte. Webster hatte ihn knapp vier Wochen als Wagenbegleiter beschäftigt gehabt, als er ihn auch schon fürs Amt des Sheriffs vorschlug. Denn für Dutch-Billy Klein war wiederum eine Amtsperiode abgelaufen. Vier Jahre, in denen er nicht jünger geworden war. Vier Jahre, in denen er mehrfach Webster und seine Geschäftsmethoden angekreidet hatte. Webster revanchierte sich. Er hatte die Macht. Zu viele Leute schuldeten ihm Geld. Ihre Abhängigkeit machte er sich zunutze. So lancierte er einen Fremden auf den Sheriffposten.
Dutch-Billy wäre darüber nicht böse gewesen, hätte der Mann seine Pflicht getan. Aber dieser Kenworthy war ein Mann Websters, und er half mehr, Websters Schulden einzutreiben, Leute von ihrem Besitz zu verjagen und zweifelhafte Grundschulden zu sichern, als für Ruhe und Ordnung zu sorgen.
Wolters war seit einem Jahr tot, ganz undramatisch an Hitzschlag gestorben. Irgendwie musste er es mit dem Herzen gehabt haben. Der neue Sheriff hatte zwei Deputies, auch Fremde mit Gesichtern, die nicht gerade vertrauenerweckend wirkten.
Dutch-Billy lebte von drei Dingen: er spielte sonntags das Harmonium in der Methodistenkirche, unterrichtete die Kinder der Stadt im Schreiben, Rechnen und Lesen, und da dies auch nur in der Sonntagsschule der Fall war, konnte er in der Woche die Vormittage im Müßiggang verbringen. Nachmittags aber schrieb er Briefe oder Rechnungen für alle möglichen Leute, die zwar gutgehende Geschäfte besaßen, selbst aber nicht schreiben oder lesen konnten. Einigen machte er auch so etwas wie Buchführung, und alles zusammen brachte so viel ein, dass er und seine Frau Eliza leben konnten. Für ein paar Whisky blieb auch etwas übrig, aber meist „vergaß“ der Wirt vom „Central“ sie ihm anzurechnen.
Als er heute wie immer um diese Zeit die Schwingtür aufstieß und den eigenartigen Mischduft von Schnaps, Sägespänen, ranzigem Bratfett und Lampenöl roch, lächelte er erwartungsvoll, denn er freute sich auf seinen Drink.
Das Lächeln gefror ihm, als er Webster an der Theke sah. Der Storebesitzer und Geldverleiher war noch um einiges fetter geworden. Sein hämisches Grinsen im breiten Mondgesicht wirkte auf Dutch-Billy wie ein Brechmittel. Dennoch ging er weiter auf seinen gewohnten Platz am Tresenende zu, stellte sich hin und nickte dem Wirt zu, der das mit einer ebensolchen Kopfbewegung quittierte.
Webster, der sich übergangen fühlte, schnarrte gehässig: „Jetzt, wo Sie keine Steuern mehr eintreiben können, haben Sie wohl einen Gruß nicht nötig, Klein?“
Dutch-Billy tat, als hätte Webster keinen Ton von sich gegeben. Er sah den Wirt an und fragte ihn: „Hansold schon hiergewesen?“
„Noch nicht, aber ich denke, er wird bald kommen. Er und sein Junge bauen noch am Stall...“ Der Keeper kam zu Dutch-Billy, warf einen grimmigen Seitenblick auf Webster und sagte: „Er hat sich was Tolles einfallen lassen. Frag ihn mal, was es ist!“
Bevor Dutch-Billy dazu eine Frage stellen konnte, schnauzte Webster: „Ich habe Ihnen verboten, darüber zu sprechen! Wenn Sie noch einen Ton zu Klein sagen, Limp, fordere ich meinen Kredit zurück.“
Der Wirt drehte sich um und sah Webster voll an. „Tun Sie es! Fordern Sie Ihren Kredit zurück, Sie Aasgeier! Aber dass Sie Libbie Johnson heiraten, daran glauben Sie selber nicht! Sie könnten gut ihr Vater sein, Sie Wüstling!“
„Was will er?“, rief Dutch-Billy.
Der Wirt fuhr herum und sah Dutch Billy voller Empörung an.
„Dieser Profitgeier will Libbie Johnson heiraten. Und damit er das auch einfach so durchsetzen kann, hat er sie unter Druck gesetzt. Du weißt doch, Billy, dass sie die beiden Kinder von McLean aufgenommen hat, weil McLeans Frau an Brustkrebs gestorben ist. Und McLean möchte Libbie heiraten. Inzwischen hat sie Tom Cadburn sicher vergessen. Sie hätte ja die prächtigsten Burschen haben können, wenn sie nicht diesem Tom Cadburn nachgetrauert haben würde.“
„Und Webster will...“ Dutch-Billy sah den dicken Storebesitzer an. „Das ist doch nicht möglich! Dazu gehören doch zwei!“
Webster kochte vor Zorn. Sein Kopf wurde dunkel. „Dafür kündige ich Ihnen den Kredit, Limp! Und wenn Sie morgen Mittag nicht zahlen, übernehme ich diesen Saloon!“
Dutch-Billy tippte Webster auf die Schulter, als er gehen wollte. „Moment, Sir! Wie war das denn eigentlich mit dem Colonel vor viereinhalb Jahren? Wie ist das denn wirklich gewesen?“
Websters Zorn wuchs. Es war dem Mann anzusehen, dass er sich kaum noch beherrschen konnte. Er, der Mächtige in Musselshell City, war hier auf einmal in eine Klemme geraten. Das zwickte ihn.
„Was quatschen Sie da? Mein Gott, nur der Tod des Colonels hat Sie davor bewahrt, schon damals abgewählt zu werden. Dann waren Sie doch wohl der einzige Nutznießer. Haben Sie vielleicht den Jungen angestiftet, den Colonel zu erschießen? Deshalb haben Sie ihn wohl auch nirgendwo finden können, was? Deshalb sind Sie ihm wohl auch allein nach, während Wolters den alten Johnson ins Jail schaffen musste. Und ausgerechnet Sie wollen mir was anhängen? Sie gottverdammter Heuchler!“
Dutch-Billys Rechte kam wie in alten Zeiten, und sie landete mit der Wucht einer Dampframme in Websters hämisch blickendem Mondgesicht.
Webster schrie gurgelnd, während ihn dieser Stoß gut sechs Schritte weit neben der Theke her durch den Saloon trieb. E r nahm noch einige Hocker mit, die polternd umfielen, dann aber verlor er selbst das Gleichgewicht und landete wie ein vom Aufzug gefallener Sack Mehl in den Sägespänen. Noch einmal gurgelte er, dann sank er mit verklärtem Lächeln auch mit dem Kopf zu Boden und streckte sich aus, als verließe ihn jegliches Leben.
Dutch-Billy wischte sich den Handrücken an der Hose ab, als hätte er sich beschmutzt. „Das war nötig, und wie“, meinte er.
Der Keeper grinste. „Mann, es hat in deiner Zeit als Sheriff eine Menge gegeben, womit ich nicht einverstanden war, Billy, aber das, Junge, das war etwas, womit du alle deine Fehler in deinem Leben ausgewischt hast. Mann o Mann, mir ist, als hätte ich frisch gebadet. Wollen wir dieses Mastschwein auf den Misthaufen hinterm Haus schmeißen, oder glaubst du, es wäre noch schöner, ihn mitten auf der Straße zu plazieren?“
„Greifst du gerne eine fette Made an?“, fragte Dutch-Billy.
Der Keeper grinste. „Na ja, wie du meinst. Auf alle Fälle wird er alles tun, um es uns heimzuzahlen.“
„Dazu gehören aber zwei, Limp, und die Sache mit Libbie Johnson regt nicht nur dich und mich auf. Darüber werden sogar Leute wild, die dick in Websters Kreide stehen ...“
*
Webster schob die Lampe auf die Tischmitte und blickte auf die drei Männer, die ihm gegenübersaßen. Er selbst lehnte sich zurück, legte wieder das Tuch ins Wasser, wrang es aus und packte es sich erneut auf seine verquollene Nase.
„Ich habe euch nicht zu Sheriffs gemacht, damit ihr außer den Lohn zu kassieren nichts mehr tut. Ihr sollt euer Geld auch verdienen“, sagte Webster schnaufend. „Das gilt für dich mehr als für die anderen, Kenworthy!“
Kenworthy war jung, so um die fünfundzwanzig, aber eine Reihe von Jahren lag in absolutem Dunkel. Davon wusste in dieser Stadt außer Kenworthy selbst nur Webster etwas. Mit den beiden anderen, Cook und Woolsley, war es nicht viel anders. Die beiden waren auch etwa in Kenworthys Alter.
„Und was denken Sie, soll ich tun, Boss?“, fragte Kenworthy.
„Nenn mich nicht immerzu Boss! Irgendwann sagst du das auch vor den anderen. Was du tun sollst? Du sollst mir mit Cook und Woolsley zusammen die Leute aus dem Weg schaffen, die hier stänkern. Dieser verdammte Schweinehund Klein hat den ganzen Tag herumerzählt, dass ich die kleine Johnson heiraten will. Und ich habe erzählen lassen, dass es eine verdammte Lüge ist. Ich will nicht, dass dieser Stinker morgen früh wieder anfängt, seine Quatscherei loszulassen. Ich will ihn nicht mehr sehen. Nie mehr. Und kein anderer soll ihn sehen. Verstanden?“
Kenworthy nickte. „Klar. Also ein Stück Blei!“
„Du wirst ihn verhaften wollen. Er wird Schwierigkeiten machen. Dann schießt du. Einfacher geht es nicht. Und ihr beide seid dabei. Als Zeugen. Ich gehe in den Saloon, in den Empire Saloon. Dort lasst ihr euch nicht sehen.“
„Und der Grund der Verhaftung?“
„Körperverletzung, versuchter Totschlag, Morddrohung! An mir. Und jetzt ab! Halt! Noch etwas: Dass keiner danach zu mir kommt. Ich erfahre auch so, was passiert!“
Und er erfuhr es wirklich zwei Stunden später, während er im Empire Saloon mit ein paar Leuten Karten spielte, was ihm gar nicht so leicht fiel. Er erfuhr, dass Dutch-Billy Klein Widerstand gegen die Sheriffs dieser Stadt geleistet hatte, als er wegen einer Anzeige festgenommen werden sollte. Im Verlaufe dieser Verhaftung war es zu einer Schießerei gekommen. Dabei hatte Deputy Sheriff Cook den einstigen Sheriff Klein tödlich verwundet. Klein starb wenige Minuten später in den Armen seiner Frau Eliza.
Am nächsten Tag stürzte der Jäger Tracy Johnson aus vierhundert Fuß Höhe auf den Grund einer Schlucht. Bald darauf wurde er von dem zufällig daherkommenden Deputy Sheriff Woolsley gefunden und zu seiner Hütte gebracht, wo Libbie Johnson vor Schreck ohnmächtig wurde. Immerhin begrub Woolsley, mitfühlend und hilfsbereit, den Toten und sprach der Tochter sein Beileid aus. Die beiden Kinder des Farmers McLean wollte er zu einer anderen Familie bringen, aber da wurde Libbie fanatisch und schlang ihre Arme um die Kleinen.
„Die bleiben hier!“, rief sie entschlossen. Woolsley ritt ab, weil er mehr nicht noch riskieren wollte. Immerhin kam er bald wieder und beobachtete Libbie, die ihm sehr gefiel und bei deren Anblick er beschloss, sie einmal in aller Ruhe näher kennenzulernen.
*
Aber schon drei Tage später passierte wieder etwas. Und abermals war rein zufällig ein Sheriff gar nicht weit. Doch zu weit, wie es schien, um rechtzeitig eingreifen zu können. Denn da ging ein Pferd durch, und der Mann, der am Steigbügel mitgeschleift wurde, war der Besitzer des Central Saloon. Das erregte Pferd schleifte den Mann zu Tode. Der erste, der das Pferd aufhalten und den Tod des Geschleiften feststellen konnte, war Sheriff Kenworthy. Niemand bemerkte, wie er dem erregten Braunen einen Dorn aus der Kruppe zog, der bestimmt nicht von allein dahin geraten war.
Ein neuer Zwischenfall verlief etwas anders, als offenbar beabsichtigt. Als geheimnisvolle Banditen den einsam hausenden Farmer McLean überfallen wollten, um ihn zu berauben, ging etwas schief. Abgesehen davon, dass ein Bandit total übergeschnappt sein musste, der bei McLean nur einen einzigen roten Cent vermutete, war die Sache so plump eingefädelt, dass McLean die „Banditen“ bemerkte, als die noch gar nicht richtig auf Schussweite heran waren. Es war natürlich nachts, aber der Farmer musste früh aufstehen, da es die Zeit zum Pflügen der Felder war. Vorher aber waren die drei Kühe zu melken, und McLean hatte keine Hilfe mehr seit dem Tode seiner Frau. Die Banditen aber wähnten gerade diese frühe Stunde für günstig.
McLean empfing sie mit einer Schrotflinte, und dabei wurde Cook verwundet. McLean bekam einen leichten Streifschuss am Bein ab, so dass er nicht herausfinden konnte, wer da überhastet floh.
Immerhin hatten die Banditen auch McLeans Zugochsen erschossen, und das machte ihm mehr aus als der Streifschuss. Und weil McLean ein beharrlicher Mensch war, ein Mann, der ein Ziel nie aus dem Auge liess, reimte er sich auch drei und drei zusammen. Für ihn war die Sache mit Johnson auf einmal kein Unfall mehr. Er begann die Motive zu begreifen. Webster steckt dahinter, sagte er sich.
McLean konnte sein weggelaufenes Pferd, wieder einfangen und ritt nach Fort Hawley. Denn was in Musselshell City gespielt wurde, meinte er erraten zu haben. In Fort Hawley aber gab es einen Militärrichter. Vielleicht konnte der die Armee zum Eingreifen veranlassen.
Aber er kam nicht weit. Keine zwei Meilen von seiner kleinen Farm entfernt hörte er etwas zischen, fuhr im Sattel herum, während sich sein Pferd aufbäumte. Etwas schlang sich blitzschnell um McLeans Oberkörper und riss ihn vollends aus dem Sattel, während sein Pferd davonjagte. Beim Sturz verlor McLean infolge harten Aufschlags das Bewusstsein. Sein Pferd aber trabte zur Farm zurück.
McLean spürte nicht, wie er gefesselt und auf ein Pferd gehoben wurde. Er merkte zunächst auch nichts von seinem Abtransport. Als er dann aber in einer dreckigen, feuchten Erdhöhle aufwachte, war er an einen Pfahl gebunden. Von seinen Entführern sah er keinen.
Jetzt wähnte McLean alles verloren und fragte sich, ob ihm Webster, den er für den Kopf seiner Entführer hielt, überhaupt eine Chance lassen würde.
Aber nichts war verloren. Es gab eine Chance, wenn sie auch winzig war. Und er verdankte sie Eliza Klein, Hennie Cadburn und Old Cliff, den vor allen anderen.
*
Oben in den Bergen war über Nacht noch einmal Winter geworden. Ein leichter Hauch von Neuschnee lag auf den Spitzen der Tannen, als Old Cliff auf seinem Pferd den Berg herauf ritt. Er atmete auf, als er Wild Johns Hütte dort sah, wo sie immer gestanden hatte.
Irgendwie war seine große Sorge gewesen, Wild John würde womöglich nicht mehr hier sein.
Aber nicht nur die Hütte war da, auch Wild John selbst. Er empfing den alten Freund poltrig und lautstark wie immer, doch Old Cliff spürte, dass der Waldläufer ein gutes Stück älter geworden war seit der Zeit vor zwei Jahren, da sie sich zum letzten Mal gesehen hatten. Und das machte Old Cliff Sorgen. Ein alter Mann war nicht das, was sie jetzt in Musselshell City brauchten.
„Was bringt dich hier in die Wildnis?“, fragte Wild John und nahm seinen Krug mit dem Selbstgebrannten unter der Bank vor der Hütte hervor. „Hol dir drinnen einen Becher!“
Old Cliff trank, dann erzählte er, was in Musselshell City los war. Und er schloss: „Wir sind wenige, alte Leute zudem, die sich gegen Webster stellen. Er hat die drei Sheriffs, und das sind drei Banditen. Einer von ihnen ist gestern irgendwo verletzt worden, ich weiß nur noch nicht, wo das war. Immerhin haben wir Libbie Johnson mit den Kindern von McLean in die Stadt geholt, weil sich da diese Schweinebande ja doch nicht so offen als Banditen zeigen können. Allerdings wurde Dutch-Billy auf eine so freche Art umgebracht. Also, kurzum, Wild John, du hast früher so manche Stadt gezähmt. Wir brauchen dich.“
Wild Johns Augen waren noch jung und scharf wie ehedem. Um diese Augen spielten unzählige Falten, als er schmunzelte, und nun zog er sein rechtes Hosenbein hoch.
Old Cliff begriff erst nicht, was das heißen sollte, doch dann erschrak er. Wild Johns Fuß hatte von der Mitte des Unterschenkels an eine Prothese aus Holz. Der Stiefel war geschickt über diesen geschnitzten Fuß gezogen.
„Was ist das?“, entfuhr es Old Cliff.
Wild John grinste belustigt. „Ein Holzbein. Sagen wir ein Holzfuß, und ich habe ihn doch gut gemacht, was? Alles selbst geschnitzt. Ist meine Idee. Ich wollte nicht wie die Krüppel aus dem Bürgerkrieg mit einem Stock und einem Gummibolzen daran herumhumpeln. Das Ding ist fest angeschnallt, und man sieht es erst, wenn ich die Hose hochziehe. Nur, mit dem Marschieren, Cliff, ist es vorbei. Ich kann gehen, aber langsam und nicht sehr lange“, fügte er gar nicht mehr so heiter hinzu.
Old Cliff dachte an das, weshalb er hergekommen war. Das konnte er nun aufstecken.
„Du warst meine und meiner Freunde letzte Rettung“, sagte Old Cliff. „Aber lassen wir das. Wie konnte das mit deinem Fuß passieren? Wann war das?“
„Letzten Winter. Ein Baum, der mir auf den Fuß gefallen ist. Tom hat mir den Fuß amputiert. Es lag hoher Schnee, wir konnten nicht einmal die Schwarzfüße und ihren Medizinmann holen. Tom hat es wunderbar gemacht."
Old Cliff kroch ein Schauder den Rücken herauf. „Ohne Betäubung?“
Wild John lächelte. „Er hat mir einen Kinnhaken gegeben. Als ich aufwachte, war er mit allem fertig. Das ist ein lieber Sohn, was?“
Da fiel Old Cliff ein, dass von Tom Cadburn die Rede gewesen war. „Hör mal, du Schlachtross, ist der Junge etwa bei dir?“
„Im Moment nicht, Cliff, aber er kommt bald wieder. Und somit war ich nicht nur deine letzte Rettung, ich bin es noch. Cliff, erzähle mir jetzt Einzelheiten. Wenn du damit fertig bist, ruh dich aus und reite danach wieder heim. Tom ist mit den Schwarzfüßen auf Jagd. Sobald er zurück ist, wird er euch helfen.“
Old Cliff sah seinen alten Freund skeptisch an. „Hör mal, ich weiß, dass dein Junge kein Schlappschwanz ist. Ich habe ihn auch vier Jahre nicht gesehen. Nur, glaubst du, dass er mit Webster und dessen Revolverbande fertig wird?“
Wild John lächelte. „Du wirst dich wundern, Cliff, und nicht nur du. Auch Webster wird sich wundern. Tom brennt darauf, seine Geschichte von damals ins Reine zu bringen. Ich hatte es ihm nur bis heute verboten. Aber einmal muss ich Tom ziehen lassen. Ich werde dann zu meinen Freunden, den Schwarzfüßen, gehen. Man wird alt, Cliff, und man glaubt, man könnte alles festhalten. Nichts möchte man weitergehen lassen. Aber das Leben ist eine riesige Uhr, Cliff. Der Zeiger geht immer weiter und weiter ...“
*
Libbie Johnson hatte Sue gewaschen und ins Bett gebracht, als es draußen klopfte. Sie gab dem Kind einen Kuss und sagte: „Schlaf schön, Sue! Ich muss sehen, wer da gekommen ist.“ Sie sah Daniel, den Jungen, an. „Dan, lies ihr das vor, was wir beide heute gelernt haben. Lies es Sue vor! Ich bin gleich wieder bei euch.“
Das fünfjährige Mädchen nickte nur, und der neunjährige Daniel nahm nicht sehr begeistert das abgegriffene Märchenbuch, klappte es auf und begann seiner kleinen Schwester im Schein der Kerze vorzulesen.
Libbie ging aus dem Zimmer, schloss leise die Tür und rief zur Haustür hin: „Wer ist draußen?“
„Ich bin es, Hennie Cadburn..
Libbie öffnete und ließ die Frau in die Wohnküche des kleinen Hauses treten. Hennie Cadburn hatte sich eine Wollstola über Kopf und Schultern gelegt, auf der Schneeflocken im Lampenlicht schimmerten.
„Es ist noch mal Winter geworden, was?“, fragte Libbie.
Die viel ältere Frau sah Libbie forschend an. „Weißt du es schon?“, fragte sie.
„Nein, Mrs. Cadburn, wovon sollte ich wissen?“ Und dabei dachte Libbie: Sie sieht aus wie Tom. Mein Gott, fängt alles wieder von vorn an?
„Libbie, sie haben McLean. Webster war selbst bei mir. Er sagt, dass sie McLean eine ganze Reihe von Verbrechen beweisen würden ... falls du uneinsichtig wärst. Er meint damit, dass du ihn heiraten sollst.“
„Mrs. Cadburn, das ist entsetzlich!“, rief Libbie. „Es ist eine Erpressung! Kann man denn nicht den Militärrichter …?“
„Kind, der ist doch nicht zuständig. Nicht mehr. Wir müssten den Zivilrichter alarmieren. Der sitzt in Helena. Nein, das hat keinen Zweck.“
„Aber Sie haben mir doch gesagt, dass Old Cliff weggeritten sei, um Hilfe zu holen.“
„Ja, Toms Vater ... Wild John.“
„Und Tom?“
Hennie Cadburn lächelte müde. „Tom? Der würde sofort verhaftet, wenn er hier auftauchte. Und außerdem, Kind, er ist noch jung ...“
„Mrs. Cadburn, er müsste jetzt einundzwanzig sein, vielleicht schon zweiundzwanzig. Er ist...“
„Er hat gejagt oder gefischt, oben im Norden bei den Indianern. Aber er ist kein Mann, der gegen drei Revolvermänner antreten könnte. Und weiter sind nun einmal Websters Sheriffs nichts. Zudem sieht es so aus, als hätten sie das Gesetz im Rücken. Libbie, du musst fliehen. Wir können auch nicht warten, bis Wild John kommt. Du musst bald weg, am besten noch diese Nacht.“
„Und die Kinder?“
„Ich kann mich um sie kümmern."
„Ich weiss nicht, ob ...“
Da bemerkte Libbie, dass sich die Tür zum Schlafzimmer geöffnet hatte. Und sie sah den Jungen, der sie aus großen Augen anblickte.
„Dan, warum liest du Sue nicht vor?“, rief sie.
Der Junge schüttelte den Kopf. „Wir wollen nicht von dir weg, Libbie! Wir wollen bei dir sein. Immer, Libbie! Lass uns nicht allein. Wir wollen nicht zu Mrs. Cadburn. Sie ist schon alt. Wir wollen bei dir sein, Libbie!“
Er sagte es so bestimmt, so fest.
„O Gott, was soll nur werden?", stöhnte Libbie verstört.
„Wenn du hier bleibst“, erwiderte Hennie Cadburn, „wird dir kein anderer Weg bleiben, als Webster nachzugeben. Schon McLean zuliebe. Sie vernichten ihn, und am Ende ist er schon so gut wie ... Na, ich möchte es nicht aussprechen. Libbie, bring den Jungen ins Bett! Er muss nicht alles hören!“
„Ich bleibe. Ich muss bleiben. Die Kinder und McLean, nein, ich muss bleiben. Dann habe ich eben keine Wahl.“
Hennie Cadburn nickte. „Ich werde noch etwas versuchen. Ich werde noch einmal mit ihm reden. Jetzt sofort!“ Sie nickte Libbie und dem Jungen zu und war wieder draußen, bevor Libbie etwas sagen konnte.
*
Das Licht, das vom vielkerzigen Kronleuchter den ganzen Raum erhellte, fiel durch das Fenster bis auf die Straße. Hennie Cadburn sah Webster durch die Scheiben an seinem Schreibtisch sitzen. Neben ihm stand Kenworthy, der Sheriff.
Hennie Cadburn zögerte erst, dann fasste sie sich ein Herz, ging die Stufen zur Haustür empor und klopfte. Sofort bellte drinnen die große Dogge, die sich Webster angeschafft hatte und die ihm auf Schritt und Tritt folgte.
Es war Kenworthy, der die Tür öffnete, den Revolver in der freien Hand. Als er Hennie Cadburn erkannte, grinste er schief, winkte mit dem Revolverlauf und meinte hämisch: „Mit dir alten Schachtel hat er schon gerechnet. Komm herein!“
„Was fällt dir ein, du Rotzlümmel?“, fauchte ihn Hennie an.
„Geschenkt, Muttchen! Komm, geh zu ihm. Er wartet auf deinen Bericht!“
Vom Vorraum aus ging es in Websters Büro. Feudal eingerichtet, mit mexikanischen Teppichen belegt, denen man indianische Handarbeit ansah, mit Möbeln, die ein Heidengeld gekostet haben mussten.
Webster saß am Schreibtisch wie ein Regent. Neben ihm die Dogge, die böse knurrte, als Hennie Cadburn näher trat.
Die Dogge war groß, hatte gelbbraunes, kurzhaariges Fell und rotunterlaufene Augen. So ein richtiger Killerhund ist das, sagte sich Hennie Cadburn.
„Na, du warst bei ihr? Kenworthy, machen Sie, dass Sie hinauskommen. Ich brauche Sie jetzt nicht mehr!“, rief er nach seiner Frage Kenworthy zu. Der grinste wieder und ging. Daraufhin fragte Webster erneut: „Na, ist sie willig?“
Hennie Cadburn sah ihn an, diesen fetten, selbstgefälligen Pascha. „Du bist früher einmal wie wild auf mich gewesen“, sagte sie.
Er lachte schallend. „Willst du mir etwa einen Antrag machen? Du bist alt geworden, Hennie. Zu alt für einen Mann von Welt wie mich.“
„Du bist auch alt. Alt und fett. Zu alt und zu fett für ein so junges Mädchen wie Libbie. Sie ist erst zwanzig.“
„Na und? Ich bin im besten Alter. Je jünger desto besser.“ Er lachte wieder. „Hast du sonst nichts zu äußern als dieses Gewimmere?“
„Du bist ein Schwein, Webster, ein dreckiges Schwein!“, keuchte sie zornig.
Er lachte. „Du kannst mich nicht beleidigen, Indianer-Hennie!“
Dieser Name versetzte sie augenblicklich in feurigen Hass. „Du Schuft, du erbärmlicher Schuft!“, schrie sie und hob drohend den Arm.
Die Dogge schien auf so eine Bewegung nur gewartet zu haben. Sie flog wie von der Sehne geschnellt auf Hennie Cadburn zu, die damit überhaupt nicht gerechnet hatte. Bevor sie begriff, was geschah, sprang sie der riesige Hund an, riss sie um, und dann schlug Hennie Cadburn mit dem Hinterkopf auf die scharfe Kante der Kommode. Der jähe Schmerz, der sie durchzuckte, war ihre letzte Wahrnehmung.
„Toy!“, schrie Webster.
Die Dogge kam auf alle Viere und blickte auf die reglos am Boden liegende Frau.
Webster erhob sich, als Kenworthy hereinkam. Der Sheriff sah verblüfft auf Hennie Cadburn. „Was ist mit ihr?“
„Sie ist gegen den Schrank gefallen. Sieh nach, was sie hat!“
Kenworthy beugte sich über die Frau, hob ihren Kopf an und fühlte etwas Klebriges, Feuchtes an seinen Fingern. Als er daraufhin ihren Kopf etwas zur Seite drehte, entdeckte er die Wunde.
Er machte ein betroffenes Gesicht, presste das linke Ohr auf Hennie Cadburns Brust und lauschte. Dann fühlte er nach ihrem Puls, schüttelte den Kopf und sagte fassungslos:
„Boss, sie ist tot. Da rührt sich nichts mehr!“
Webster machte große Augen. „Tot? Verdammt, das darf nicht sein! Du Narr, nimm einen Spiegel und halte ihn ihr vor den Mund! Los!“
Aber auch der Spiegel beschlug nicht.
„Der hat sie nur angesprungen“, meinte Webster verstört. „Es ist ein Unfall, nichts als ein Unfall. Sie hat mir gedroht, verstehst du?“
„Ich verstehe schon, Boss, aber ob das die anderen in der Stadt verstehen, das weiß ich nicht, Boss“, meinte Kenworthy. „Die Sache mit Libbie Johnson wird schlimm genug werden, aber das hier, das gibt mehr als Ärger, Boss. Am besten, es erfährt niemand von ihr. Wenn man nur wüsste, ob jemand sie zu uns kommen sah ...“
„Die Vorhänge zu!“, keifte Webster. „Hier sieht ja zu, wer will!“
Kenworthy ging, die Vorhänge zuzuziehen. Dann drehte er sich um, sah Webster an und meinte eisig: „Ich meine, Webster, dass sie recht hatte, als sie schrie, du wärst ein Schwein. Du bist eines. Ein richtiges, ein fettes, ein dreckiges und mieses Schwein. Webster, steh ganz ruhig und greif mit zwei Fingern in deine Westentasche, zieh den Safeschlüssel heraus und rühr dich nicht mehr!“
Webster stand wie gelähmt. Sein Gesicht verlor jede Farbe. Aus großen, erschrockenen Augen sah er den Mann an, den er zum Sheriff machen ließ - den Mann seines Vertrauens. Er war nicht imstande, nur ein Wort zu sagen.
„Den Schlüssel, Webster, hörst du nicht?“, sagte Kenworthy mit eisigem Lächeln.
Der Hund stand noch neben der Frau, aber er hatte wohl die Situation noch nicht erfasst. Denn Kenworthy schrie nicht, drohte nicht offen, er sprach ganz ruhig, scheinbar harmlos. Die Dogge schien nicht zu ahnen, worum es ging.
Da aber hatte Webster sich gefasst und keuchte fassungslos: „Kenworthy, du kannst doch nicht... nicht auf mich ...“
„Du interessierst mich einen feuchten Dreck, Webster. Dein Geld, Webster, nur dein Geld. Der Köter ist fällig, wenn du nur einen Ton zu ihm sagst.“
Aber Webster kannte die Dogge besser. Sie war dazu erzogen, einen Mann sofort anzugreifen, wenn derjenige seinen Revolver zog und auf Webster richtete.
Aber dann geschah plötzlich etwas, das weder Webster noch Kenworthy berechnet hatten. Während Webster noch darauf wartete, dass Kenworthy den Revolver zog, was den automatischen Angriff der Dogge auf Kenworthy zur Folge haben würde, drehte die Dogge sich um und sah zur Tür.
Sie bellte nicht. Sie stand wie eine Statue. Aber ihre Ohren waren auf die Tür gerichtet, die Nasenflügel wirkten gespannt.
Plötzlich polterte etwas im Nebenraum, dann klirrte Glas.
Webster zuckte zusammen, Kenworthy riss den Revolver heraus, doch nicht in Richtung auf Webster. Beide Männer sahen zur Tür. Die Dogge sprang vor, und Webster zischte: „Lass sie hinaus!“
Kenworthy war mit einem Sprung bei der Tür, öffnete sie so, dass man ihn von außen nicht sehen konnte. Sofort schoss die Dogge in den Vorraum. Aber wieder bellte sie nicht. Kenworthy sah dann, dass sie durch die offene Tür zum Nebenraum verschwand, und das war Websters Salonzimmer. Er steckte den Revolver wieder ein.
Wieso steht diese Tür offen?, dachte Kenworthy noch, da spürte er auf einmal eiskalten Luftzug im Genick.
Überrascht drehte er sich um. Und was er da sah, gab ihm das Gefühl, als sei ihm kochendes Blei in die Adern gefahren.
*
Er stand breitbeinig vor dem Fenster, das noch leicht hin und herschwang. Alles an ihm war schwarz, sein Hut, sein Wetterumhang, seine Hosen aus weichem Wildleder, die Stiefel, die so aussahen wie die Wintermokassins der Schwarzfußindianer. Und in seiner rechten Hand hielt der Mann einen Revolver, der auf Webster gerichtet war.
Als Kenworthy ins Gesicht des Fremden blickte, sah er nur ein grimmig dreinblickendes Augenpaar. Alles darunter war durch ein schwarzes Tuch verdeckt. Der Mann war groß, breitschultrig und wirkte unheimlich.
Mit einer rauen, ziemlich tiefen Stimme sagte er zu Kenworthy: „Leg die Hände flach an die Wand oder zieh!“ Dabei steckte er seinen Revolver ins Holster.
Kenworthy sah Webster an, der zur Salzsäule erstarrt zu sein schien. Nein, dachte er, von Webster kommt alles andere als Hilfe.
So versuchte es Kenworthy mit einem Trick. Er nickte, ging auf die Wand zu, als wollte er aufgeben, doch dort angekommen, wirbelte er plötzlich herum, und seine Hand zuckte zum Revolver, und es geschah rasend schnell.
Als er ihn halb heraus hatte, hielt der Fremde seine Hände noch ruhig.
Ich schaffe es! Er ist verloren. Ich knalle ihn übern Haufen!, dachte Kenworthy, und nun hatte er seinen Revolver heraus, hob ihn an ...
Bis dahin wartete der maskierte Fremde noch. Doch dann zuckte seine Hand so schnell nach unten, dass es mit bloßem Auge gar nicht zu verfolgen war. Und auf einmal blühte dort eine Feuerblume auf.
Kenworthy sah diese Feuerblume und fragte sich, wieso das sein konnte. Der Fremde hatte doch gar nicht gezogen ...
Es war der letzte seiner Gedanken im Leben.
Kenworthy spürte noch einen Stich in der Herzgegend, wollte etwas schreien, wollte etwas tun, wollte noch abdrücken, aber er tat gar nichts mehr, außer zu Boden zu stürzen. Und als er dumpf aufschlug, lebte er schon nicht mehr.
Der Knall des Schusses dröhnte von den Wänden wider. Webster stand wie gelähmt, und fassungslos starrte er auf Kenworthy, der über die Beine der toten Mrs. Cadburn gefallen war.
Plötzlich wurde es nebenan laut. Überschnappendes Gebell und wildes Knurren, polternde Geräusche, wieder schrilles Klirren drangen über den Flur in den Raum.
Ganz unvermittelt wurde es still. Totenstill ...
Die Dogge Toy war ein Jahr lang von einem erstklassigen Hundeausbilder zum Killerhund ausgebildet worden, ein Hund, der seinen Herrn nicht nur verteidigt, sondern alles, was ihn ernsthaft angreift, auf Kommando tötet, auch andere Hunde. Dazu musste man Toy erst erziehen, denn von sich aus bringt kein Hund den anderen wirklich um. Toy aber hatte es gelernt.
Als er vorhin aus dem Raum wollte, hatte er etwas gewittert, das viel stärker war für ihn als Menschengeruch. Das war der Geruch eines Wolfes.
Toy fragte sich nicht, wieso ein Wolf ins Haus seines Herrn kommen konnte. Toy spürte andere Dinge. Es war nicht nur der Geruch eines Wolfes, es war dazu der Geruch eines Rüden.
Für Toy verlief von da an alles instinktmäßig. Ein Rüde in seinem Revier, der er selbst ein Rüde war, musste bekämpft werden.
Als Kenworthy Toy aus dem Zimmer ließ, brauchte Toy nur dem Geruch nachzulaufen. Und der war stark, viel stärker noch als eben. Er kam direkt aus der offenen Tür zum Salon, dieser Geruch.
Den Salon durfte Toy sonst nie betreten. Jetzt störte ihn das nicht. Dieser Wolfsgeruch war so enorm, dass Toy nicht einmal mehr einem Befehl Websters gehorcht haben würde.
Toy schoss in den Salon hinein, und da sah er im Dämmerlicht ein riesiges schwarzes Etwas, das da mitten im Raum stand, während es eisigkalt durchs zertrümmerte Fenster hereinwehte. Sogar Schneeflocken tanzten ins Zimmer. Dinge, die Toy gar nicht mehr wahrnahm.
Da stand der Wolf, ein gewaltiger Timber, viel größer als alle Wölfe, die Toy je sah und je getötet hatte. Denn auch auf Wölfe hatte man ihn abgerichtet.
Der dort, der knurrte nicht, der fauchte nicht, der stand einfach da. Aber sein Geruch überwältigte Toy fast.
Der Geruch eines starken, eines geschlechtsstarken Tieres.
In Toy kochte es. Nun brauchte ihn niemand mehr auf diesen Feind zu hetzen. Das war ein Feind, auf den Toy nicht abgerichtet zu werden brauchte.
Toy sprang vor, schoss auf diesen Gegner zu, und immer noch war der andere still. Doch dann explodierte dieser schwarze Timber.
Er wirbelte blitzschnell zur Seite, und Toy fuhr, vom eigenen Schwung getrieben, an ihm vorbei, stemmte sich mit allen Vieren ein, um diesen Schwung abzustoppen, doch da biss der schwarze Timber zu, ganz plötzlich, blitzartig, und scharf.
Toy heulte auf, als er den durchs Mark gehenden Schmerz im Nacken spürte. Dann war er am Zuge. Er biss nach dem Bein des schwarzen Timbers, erwischte es, doch da packte ihn selbst etwas mit fünfzig Messern von oben und unten an der Kehle. Toy wiederum konnte endlich seinen Fang in den dick behaarten Rücken des Timbers schlagen, und er spürte, wie es ihm warm über die Lefzen rann, als seine Reißzähne ins Fleisch des Schwarzen schlugen.
Dann aber wiederholte sich der Biss in Toys Hals. Toy bellte, wich aus, bellte wieder, und als Antwort kam das Knurren, das gefährliche Knurren des Timbers aus dem Dunkel, kam näher, immer näher, und Toy, der schon floh, der jetzt bellte und knurrte, kniff, suchte die Flucht, aber da war der Timber vor der Tür.
Toy griff verzweifelt noch einmal an, obgleich er spürte, wie ihm das Blut aus der Halswunde schoss.
Da auf einmal war der schwarze Timber wieder da, diesmal an der Flanke, und jetzt riss er die große Dogge um, biss noch einmal zu und erwartete, dass Toy sich durch Zeigen des unbedeckten Halses ergeben würde.
Toy war abgerichtet worden, nie aufzugeben. Und er tat es nicht, auch jetzt nicht. Er war mutig, verzweifelt mutig. Er wollte wieder angreifen, doch seine Halsschlagader war verletzt. Blut spritzte aus der Arterie. Und damit verlor er mit jeder Sekunde mehr Kraft. Sein Angriff auf den Schwarzen brach auf halbem Wege zusammen. Der Schwarze knurrte nur noch, tat aber nichts, als wüsste er, dass er nur noch abzuwarten brauchte.
Toy wollte nun doch fliehen, aber ihm tanzten schon rote Punkte vor den Augen. Er war nicht mehr imstande, die Hinterbeine zu heben, sackte in den Sprunggelenken ein, taumelte, um schließlich hinzustürzen und japsend liegenzubleiben. Aus seinem Hals quoll unaufhaltsam Blut... quoll Toys Leben.
Der Schwarze aber wandte sich um, trabte auf den Flur hinaus, wo Lichtschein aus einem Raum fiel, dessen Tür nur angelehnt war.
Ein Mann lag am Boden, daneben eine Frau. Ein dicker Mann mit Glatze stand hinter seinem Schreibtisch, das Gesicht fahl, die Augen schreckgeweitet. Und dann war noch der, dessen Aussehen auf den Timber eng vertraut wirkte.
„Seite, Sam!", sagte dieser Mann mit dem maskierten Gesicht.
Der Timber war mit einem Sprung neben seinem Herrn. Jetzt riss sich der Schwarzgekleidete das Tuch vom Gesicht.
„Erkennst du mich, Webster?“, fragte er.
Webster starrte ihn konsterniert an. „Cadburn!“
„Ich bin zu spät gekommen, Webster. Nur wenig zu spät. Warum habt ihr sie umgebracht?“
Webster lief der kalte Schweiß von der Stirn. Entsetzt spürte er die Gefahr, die tödliche Gefahr. Und er, der immer das große Wort geführt hatte, erlitt in seiner Angst fast einen Herzschlag.
„Ich ... ich habe sie nicht... nicht getötet. Es war ein Unfall, ja, ein Unfall! Sie ist gegen den Schrank gestürzt, ehrlich, gegen den Schrank“, schnatterte er. „Sehen Sie selbst nach, Mr. Cadburn, sehen Sie doch bitte selbst nach! Es war wirklich ein Unfall. Sie hat die Hand drohend erhoben, und Toy hat sie angesprungen. Sie ist gegen den Schrank gefallen. Ich hätte ihr nie etwas getan. Ich schwöre es!“
„Wie war das mit Johnson? He, wer hat Johnson in die Schlucht gestürzt? Er?“, fragte Tom Cadburn. Indessen ließ sich der Timiber neben der Tür nieder.
„Mr. Cadburn, ich hatte das nicht befohlen. Vorhin, da hat der mich auch bedroht. Ich schwöre es, er hat mich bedroht. Er hat...“
„Sie brauchen nicht zu schwören!“, rief eine Stimme von der Tür her.
Tom Cadburn sah zur Seite und gewahrte einen Fremden, der einen Verband um den Kopf trug, ein Nachthemd anhatte und in den Händen eine Greenerflinte hielt, die genau auf Tom gerichtet war.
„Lass den Revolver fallen, Mann!“, bellte der Unbekannte.
Webster sah etwas, das der mit der Flinte übersehen zu haben schien. Und er rief ihm zu: „Cook, ein Wolf!“
Cook hatte den Timber nicht gesehen, diesen riesigen schwarzen Burschen, der sich eben noch neben die Tür gesetzt hatte. Doch gerade, als Webster seine Warnung gerufen hatte, stieß Tom Cadburn ein leises Zischen aus.
Da flog Sam wie ein Geschoss von der Seite her gegen den völlig überraschten Cook. Der wurde umgerissen, verlor die Flinte und kam wie ein Wiesel wieder auf die Beine, jagte auf die Haustür zu, aber da war der Timber schon wieder über ihn und. packte ihn am Hemdkragen, riss ihn auf den Rücken und zeigte ihm dann die Zähne. Cook hatte Gelegenheit, aus allernächster Nähe in den Rachen eines Wolfsblutes zu sehen. Und der heiße Atem traf sein Gesicht. Cook lag wie ein geprellter Frosch am Boden.
Tom Cadburn hob die Flinte auf, entlud sie und sagte zu Webster: „Wo ist der Dritte im Bunde? Dieser Wollsley?“
„Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht!“, behauptete Webster ängstlich. Und er tat, als zerflösse er vor Sorge um sein Leben. Aber Webster hatte wieder eine Chance entdeckt. Eben schon, als Cadburn abgelenkt worden war. Da hatte er den Derringer in die Rechte genommen, der bislang unter einem Blatt Papier auf dem Schreibtisch gelegen hatte.
Webster war kein Mann, der warten konnte. Er wähnte seine Chance jetzt, als Cadburn zur Seite blickte. Webster fragte sich nicht, warum Cadburn in eine Richtung sah, wo weder er noch Cook sich befanden, sondern nur ein Schrank mit Akten, die hinter einer Glastür lagen.
Webster riss den Derringer hoch, und dabei spürte er jetzt schon allen Triumph. Aber als er abdrücken wollte, da sprang Tom Cadburn plötzlich ein Stück zurück. Der Schuss dröhnte auf, aber er ging genau dahin, wo Cadburn eben noch gestanden hatte. Und als Antwort sah Webster plötzlich eine grelle Stichflamme mit einem Feuerball. Er sah es, und er begriff nicht, wieso das sein konnte.
Zu weiteren Gedanken kam er nicht mehr, würde er nie mehr kommen. Als ihn der Schuss Cadburns traf, machte Webster ein ungläubiges Gesicht. Und er machte es noch, als er am Boden lag. Dass ihn Tom Cadburn in der Scheibe des Aktenschrankes die ganze Zeit wie in einem Spiegel beobachtet hatte, erfuhr Webster nie mehr …
*
Cook sah, dass der Timber von ihm weglief, und sofort war Cook wieder hoch. Verzweifelt riss er die Haustür auf, stürmte hinaus, hinaus in die rettende Nacht. Schnee peitschte ihm entgegen.
Und plötzlich ertönte aus dem Haus ein schriller Pfiff. Cadburns Stimme schrie: „Thunder!“
Cook begriff nicht, was es bedeutete, wollte nur so rasch wie möglich über die Strasse, und da auf einmal war es vor ihm. Ein Pferd. Ein Pferd, das in der Nacht mit den Schneeflocken zu tanzen schien, das sich dicht vor ihm aufbäumte, und da erst erkannte Cook, was es für ihn hieß.
Er wollte den wirbelnden Vorderhufen ausweichen, die da vor ihm rotierten. Er warf sich herum, rannte zur Hauswand, aber dieses unheimliche Pferd setzte ihm nach wie ein Hund ...
Mit einem Sprung war Cook unter dem Vordach. Nein, dachte er, hierher kommst du nicht.
Da hörte er das Knurren, und sein Kopf zuckte nach rechts. Der Timber!, dachte Cook entsetzt.
Dieses schwarze Untier! durchzuckte es ihn. Er stand wie gelähmt. Und der Timber brauchte ihn nur anzusehen. Das Pferd aber, als hätte es nie anders dort gestanden, hielt den Kopf gesenkt, als wäre es müde, blickte scheinbar harmlos zu ihm herüber, nicht anders als irgendein Pferd, das der Reiter vor einem Haus hatte stehenlassen.
Dann tauchte auch der Mann auf, der so ein Pferd und so einen Timber besaß. Dieser Mann Tom Cadburn, den Cook nur vom Hörensagen kannte.
Cook zitterte vor Kälte am ganzen Leibe. Nur im Nachthemd fror er entsetzlich.
„Wo ist der andere?“, fragte Tom Cadburn, während er einen prüfenden Blick in die Runde warf. Doch die Stadt war ruhig, obgleich Tom sicher war, Zuschauer zu haben, die durch die Ritzen der Läden spähten.
„Ich weiß nicht“, keuchte Cook zitternd und mit klappernden Zähnen. „Ich weiß wirklich nicht.“
„Gut, dann warte ich noch. Vielleicht fällt es dir noch ein.“ Tom sah Sam an. „Pass auf, Sam, pass gut auf!“
Sam ließ Cook nicht aus den Augen. Und Cook fror jämmerlich. Da entschloss er sich, etwas zu sagen. „Wirst du mich gehen lassen?“, fragte er erst.
„Nein. Aber lass dir nur Zeit, ich kann warten!"
Cook hatte keine Zeit. Es war noch einmal so winterlich kalt geworden, dass er meinte, erfrieren zu müssen. „Woolsley ist... ist bei McLean. Er bewacht ihn in einer Höhle.“
„Wo?“
„Zwei Meilen von hier“, erwiderte Cook.
„Gut, beschreibe es genau!“
Cook beschrieb die Stelle. „Und was wird aus mir?“, wollte er wissen.
„Dich sperre ich ins Jail. Du kennst dich dort ja aus. Bete, dass ihr geheizt habt.“ Tom Cadburn lachte grimmig.
*
Mit Sams Hilfe hatte Tom die Erdhöhle sehr rasch gefunden. Es schneite auch nicht mehr. Zu Toms Erstaunen war die Höhle nicht bewacht. So fand er McLean ohne Zwischenfälle. Der Farmer war an Händen und Beinen gefesselt und dazu noch geknebelt.
Tom befreite McLean, der ihn zunächst gär nicht erkannte. Als er dann seine erstarrten Glieder rieb, fragte er: „Danke, Fremder, danke dir!“
„Fremder? Du musst mich kennen. Ich habe dir oft genug Dinge aus Websters Store auf die Farm gebracht. Ich bin Tom Cadburn ...“
McLean machte groe Augen. „Tom? Mensch, Tom!“ Er betrachtete ihn von oben bis unten im Licht des Feuers, das Tom Cadburn angezündet hatte. „Mann, bist du ein Kerl geworden! Nur das Gesicht, ja, das Gesicht ist dir noch ähnlich. Aber sonst! Mensch, wo hast du all die Zeit gesteckt?“
„Darüber reden wir später. Wo ist Woolsley?"
McLean sah ihn erschrocken an. „Mann, dass ich das vergessen konnte. Wollsley, dieser Hundesohn, wollte zu Libbie. Er hat es auf sie abgesehen. Webster wollte Libbie, und Woolsley hat mir ins Gesicht gelacht und gesagt, er werde sie noch vor Webster bekommen. Er werde sie mitnehmen ... Tom, er will sie nach Mexiko bringen. Und Kenworthy wollte ihm helfen. Sie hatten vor, Webster auszunehmen. Tom, Libbie und ich, wir beide hatten vor, uns zu heiraten. Schon wegen der Kinder Und ... Tom, es geht jetzt um Libbie, obgleich ich fürchte, jetzt, wo du wieder da bist, da wird sie nur dich wollen.“
„Glaubst du?“, fragte Tom.
„Ja, Tom. Sie hat dich wahnsinnig geliebt. Ich bin nur eine Art Ersatz gewesen. Mehr nicht.“
„Vielleicht ist es gar nicht so, McLean. Komm, wir müssen weg. Du kannst dich zu mir mit aufs Pferd setzen!“
*
Libbie Johnson hatte sich entschlossen, dem Rat Hennie Cadburns zu folgen. Sie wollte fliehen, doch die Kinder würde sie mitnehmen. Sie weckte beide, so schwer es ihr fiel, und sie packte ihr Bündel.
Plötzlich hörte sie draußen eine Stimme rufen: „Libbie, mach auf! Ich bin es, McLean!“
Libbie sah die Kinder an. „O herrlich, euer Vater!“ Sie ging zur Tür, und die beiden Kleinen folgten ihr. Als sie den Riegel zurückstieß, rief es draussen wieder, und sie hätte einen Eid abgelegt, dass es McLeans Stimme sein musste. Sie machte die Tür auf, und aus dem Raum fiel das Licht auf den Mann. Es war Woolsley.
Entsetzt wollte sie wieder zurück aber Woolsley hielt ein Gewehr in der Hand. Und die Mündung zeigte auf Daniel.
„Ich würde den Kleinen erwischen, in jedem Fall. Steh ganz ruhig, Libbie! Du gehörst mir und keinem anderen. Komm her! Und bring die Kinder mit!“
Da sah Libbie plötzlich etwas Schwarzes durch die Luft fliegen. Ein riesiger Timber packte den völlig überraschten Woolsley am Kragen, riss ihn rücklings zu Boden.
Doch Woolsley war schnell, viel flinker, als man es ihm zugetraut hätte. Als er am Boden lag und der Timber ihm den Fang zeigte, gelang es Woolsley, seinen Revolver zu ziehen Er wollte gerade die Waffe auf den Bauch des Timbers richten, als Woolsley plötzlich einen stahlharten Schlag an der Brust spürte, ein Schmerz, der sich explosionsartig in seinem Leib ausbreitete. Dann erst hörte er einen weit entfernten Knall.
Woolsleys Kraft erlahmte und der Schmerz wurde stärker und stärker, und schließlich befreite eine Ohnmacht den Mann von jeder Pein.
Libbie aber stand entsetzt in der Tür und blickte dem Mann entgegen, der auf einem herrlichen Blauschimmel in den Lichtkreis ritt, der aus dem Haus auf den Vorplatz fiel, wo der Timber noch immer den Reglosen bewachte.
Der Reiter aber hielt ein Gewehr mit silbernem Lauf in den Händen. Eine Silver Sharps, eine Büchse, die von der Gewehrfabrik Sharps speziell für Wild John Stafford gefertigt worden war.
Und hinter dem Reiter tauchte jetzt McLean auf, zu Fuß. Die Kinder sahen ihren Vater, liefen die Stufen herab an dem Toten und dem Timber vorbei auf den Vater zu.
Libbie aber stand wie gelähmt. Da hörte sie Tom sagen: „Hallo, Libbie! Alles in Ordnung?“
Sie nickte mechanisch, sah auf McLean, der sie fragend ansah, blickte auf Tom, der ihr zulächelte, sah auf den Toten, dann wieder auf McLean und die Kinder.
Und dann kam sie zu Tom herab, der inzwischen abgesessen war, reichte ihm die Hand und sagte: „Danke, Tom, vielen Dank. Du hast keine Zeit verloren ..
„Ich bin zu spät gekommen. Meine Mutter ist tot, Libbie. Aber du lebst. Ich glaube, dass McLean und die Kinder dich sehr brauchen, Libbie ...“
„Und ... und du, Tom?“, fragte sie leise.
„Ich? Ich weiß nicht, Libbie, ob ich dich brauche. McLean aber hat dich sehr nötig, Libbie, die Kinder auch. Und alle drei lieben dich.“
„Ich sie auch“, sagte Libbie mit gesenktem Kopf, „Tom, ich danke dir sehr.“ .
Er, der jetzt viel größer war als sie, gab ihr einen brüderlichen Kuss auf die Wange und murmelte: „Werde glücklich, Libbie! Er ist bestimmt ein guter Mann!“
Sie nickte, schluckte, und er meinte, zwei Tränen in ihrem Gesicht zu sehen. Doch da kam schon McLean mit den Kindern, und er rief befreit: „Ich bin so froh, dass euch nichts passiert ist!“
Als er Libbie in die Arme schloss, saß Tom Cadburn rasch auf, winkte Sam zu, und alle drei verschwanden fast lautlos. Tom hatte noch etwas zu tun. Er musste seine Mutter begraben. Dann aber würde er weiterreiten. Weiter ... immer weiter.
An Musselshell City durfte er am besten nicht einmal mehr denken...
ENDE