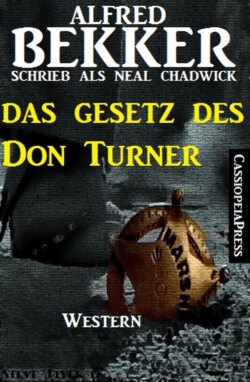Читать книгу Das Gesetz des Don Turner - Alfred Bekker, Frank Rehfeld, Karl Plepelits - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 1
ОглавлениеAlfred Bekker
schrieb als
Neal Chadwick
Das Gesetz des Don Turner
Western-Roman
Der Romantext wurde in alter Rechtschreibung belassen.
© 1989 by Alfred Bekker
www.AlfredBekker.de
www.Postmaster@AlfredBekker.de
All rights reserved
Ein CassiopeiaPress Ebook
Ausgabejahr dieser Edition: 2013
Don Turner war ein Mann, der einen langen Schatten warf und einen noch längeren Arm hatte. Er betrachtete das ganze County als sein Eigentum. Und er hatte sich längst zum Herrn über Leben und Tod aufgeschwungen. Wer sich gegen den Terror aufbäumte, lebte nicht mehr lange. Deshalb duckten sich alle. Niemand wollte unversehens von einer tödlichen Kugel erwischt werden. Bis dann dieser Satteltramp namens Finley kam und sich überraschend zum Sheriff ernennen ließ. Das war gleichbedeutend mit einem todeswürdigen Verbrechen …
*
Als die drei finsteren Gestalten seinen Laden betreten hatten, wusste Tom Asher sofort, dass sie nicht gekommen waren, um ihm etwas abzukaufen.
Ashers Puls beschleunigte sich, er rang nach Luft.
Es würde Ärger geben, so viel stand fest.
Die Gesichter der drei Männer waren hart. Ihre kalten Augen blickten mitleidslos auf Asher herab, der einen guten Kopf kleiner war als sie.
Ein kalter Schauer lief über Ashers Rücken, die Hände hatte er in ohnmächtiger Wut zu Fäusten geballt.
„Na, kennen wir uns noch, Mr. Asher?“, fragte einer der drei, der offensichtlich ihr Anführer war.
Sein schwarzer Bart unterstützte die Hagerkeit seines Gesichts und gab ihm ein düsteres Aussehen. Seine Haut war von auffallender Blässe. Er trug den dunklen Hut tief ins Gesicht gezogen. Mit der Linken nahm er seine schlanke Zigarre aus dem Mund und stieß Rauch aus, während die Rechte die ganze Zeit über in der Nähe des Revolvers blieb, den er in seinem Holster stecken hatte.
„Ist schon ´ne ganze Weile her, seit Zahltag war, nicht wahr, Mr. Asher?“, meinte der Schwarzbart. Seine Züge blieben eiskalt, nicht ein Gesichtsmuskel bewegte sich.
„Hören Sie!“, rief Asher. „Sagen Sie Ihrem Boss, dass es nicht anders geht! Ich brauche noch ein paar Tage! Ich habe das Geld einfach nicht!“
Der Schwarzbart verzog zynisch das Gesicht, blieb aber letztlich völlig ungerührt.
„Ich persönlich hätte nichts dagegen, Ihnen noch eine gewisse Frist einzuräumen, Mr. Asher“, brummte er. „Aber der Boss ist verdammt ungeduldig!“ Der Schwarzbart blickte auf Asher herab, wobei ein dünnes Lächeln um seine blutleeren Lippen spielte. Er sah die Angst in den Augen seines Gegenübers, und in diesem Augenblick machte es fast den Anschein, als würde er diesen Anblick genießen.
„Die Geschäfte waren in letzter Zeit nicht so gut!“, rief Asher. „Aber das wird sich bestimmt wieder ändern! Ich schwöre es Ihnen! Aber im Moment ist einfach nicht genug da!“
Der Schwarzbart zuckte mit den Schultern.
„Kann schon sein, dass Sie Recht haben, Asher. Wie ich bereits sagte: Es ist nichts Persönliches.“
Einer der Männer nahm das Schild mit der Aufschrift „vorübergehend geschlossen“, das Asher in der Mittagspause vor die Tür zu hängen pflegte, vom Wandhaken, hängte es von außen an die Tür und schloss diese anschließend.
„So, jetzt sind wir ungestört bei dem, was wir zu erledigen haben“, meinte der Mann, ein Blondschopf, noch keine dreißig, an dessen Revolvergurt zwei Colts hingen. Als er sah, wie Ashers Mund vor Entsetzen offen blieb, grinste er, wobei er zwei Reihen gelber Zähne entblößte.
„Was …“, hauchte Asher, obwohl er es sich denken konnte. Sein Blick war erstarrt; er stand vor dem Schwarzbart und seinen zwei Komplizen wie das Kaninchen vor der Schlange.
Sie traten auf Asher zu.
„Was haben Sie vor?“, murmelte dieser kaum hörbar. Kalter Angstschweiß war mittlerweile auf seine Stirn getreten.
„Tja, Mr. Asher, unser Boss hat uns leider ziemlich unmissverständliche Anweisungen gegeben“, zischte der Schwarzbart. „Wir haben eine traurige Pflicht zu erfüllen, und ich hoffe, Sie machen uns dabei nicht allzu viele Schwierigkeiten!“
Asher wich vor den Eindringlingen zurück. Der Blondschopf riss beim Vorübergehen mit der Rechten den Inhalt eines Regals zu Boden.
„Nicht meinen Laden!“, kreischte Asher. „Das ist doch meine Existenz!“
Der Schwarzbart schüttelte den Kopf.
„Ich bedaure, Sir. Aber so billig kommen Sie diesmal nicht davon!“
„Was …“
„Wir haben uns Ihren Laden – wie Sie sich vielleicht erinnern werden – bereits mehrmals gründlich vorgenommen.“ Der Schwarzbart kniff die Augen zusammen. Sein Blick hatte jetzt etwas Raubtierhaftes. Die blutleeren Lippen waren fest aufeinander gepresst.
„Leider hat das Ihre miserable Zahlungsmoral nicht merklich verbessert!“, ergänzte der Blondschopf. „Jedenfalls ist unser Boss dieser Meinung.“
Asher war unfähig, irgendetwas zu erwidern, und so fügte der Schwarzbart hinzu: „Sie geben ein schlechtes Beispiel für die anderen ab, Mr. Asher. Wo kämen wir hin, wenn alle so wären wie Sie!“
Asher schluckte und schnappte nach Luft.
Sein Verstand begann fieberhaft zu arbeiten. Es musste doch noch eine Möglichkeit geben …
„Was soll ich tun?“, fragte er verzweifelt, obwohl er insgeheim wusste, dass seine Frage überflüssig war.
„Nichts“, versetzte der Schwarzbart. „Sie werden nie mehr etwas tun!“
„Aber, ich …“
„Wir werden ein Exempel statuieren.“
Asher begriff.
Es gab mit diesen Männern keine Möglichkeit der Übereinkunft mehr. Er konnte sich ihnen noch so sehr unterwerfen, es würde sie jetzt völlig ungerührt lassen.
Er versuchte sich zu konzentrieren, irgendeinen vernünftigen Gedanken zu fassen, aber sein Kopf schien wie leer geblasen.
Er unternahm einen letzten Versuch. „Hören Sie, ich weiß, dass das nicht richtig war, aber …“
„Wenn Sie noch etwas Wichtiges zu sagen haben, dann sollten Sie es schnell tun!“, unterbrach ihn der Schwarzbart kühl.
„Ich habe Ihnen zwar gesagt, dass ich das Geld nicht hätte, aber das stimmt nicht! Ich habe das nur gesagt, weil ich sehen wollte, wie weit Sie gehen …“ Ashers Stimme hatte einen winselnden Ton bekommen. Dem Gesicht des Schwarzbartes war nicht anzusehen, was er davon hielt. „Das Geld ist in der Schublade im Tresen! Ich werde es holen!“
Der Schwarzbart nickte stumm und trat noch einen Schritt näher, während Asher bis zum Tresen zurückwich. Immer wieder sandte er ängstliche Blicke in Richtung seiner Gegenüber. Vorsichtig umrundete er den Tresen. Die Schublade befand sich auf der hinteren Seite.
Asher zögerte etwas.
„Was ist?“, rief der Schwarzbart mit unbewegtem Gesicht.
Asher gab keine Antwort, seine Muskeln und Sehnen waren gespannt. Er zögerte kurz, dann öffnete er mit einer ruckartigen Bewegung die Schublade und riss einen Revolver hervor.
Als der Schwarzbart blitzschnell seine Waffe aus dem Holster zog und schoss, hatte Asher noch nicht einmal den Hahn gespannt. Der Kaufmann sackte in sich zusammen, die Augen weit aufgerissen, so als könnte er noch immer nicht fassen, was geschehen war.
Der Revolver entfiel seiner Hand, ohne einen Schuss abgegeben zu haben. Ashers Körper schlug schwer und leblos auf dem Bretterfußboden des Ladens auf.
*
Jim Finlay hatte seinen Lagerplatz bei einer Baumgruppe gewählt. Die Umgegend bestand zum Großteil aus flachem Weideland, das von hier aus weithin zu übersehen war. Es war gutes Land, wie geschaffen, um große Rinderherden zu ernähren.
Die Nacht war alles andere als warm gewesen. Die Morgenkühle hatte Finlay geweckt. Er hatte Holz gesammelt und das erloschene Lagerfeuer wieder entfacht, so dass er sich Kaffee kochen konnte.
Es waren seine letzten Kaffeebohnen, die jetzt einen angenehmen Geruch verbreiteten – und auch sonst musste er feststellen, dass seine Vorräte ziemlich erschöpft waren.
Wird Zeit, dass ich irgendwo einen Job bekomme!, dachte er, denn auch sein Bargeld hatte sich fast vollständig verflüchtigt.
Finlay war vielseitig. Er hatte schon eine ganze Reihe unterschiedlichster Arbeiten verrichtet, um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Er war Hilfssheriff gewesen, Postreiter, Cowboy und Schienenleger bei der Eisenbahn. Für kurze Zeit hatte er auch in einem Detektivbüro gearbeitet, drüben im Osten.
Aber dort gefiel es ihm nicht. Es war ihm zu eng. Er mochte die großen Städte nicht, die schwarz vom Ruß der Maschinenwaren und in denen jeder sich unterzuordnen hatte. Als eine Ameise in einem riesigen Ameisenhaufen zu leben, das lag Finlay nicht. er wollte sein eigener Herr sein.
Immer weiter hatte es ihn hinaus in den Westen gezogen, aber die Zivilisation folgte ihm. Die Eisenbahn, an der er selbst mitgebaut hatte, würde sie in den hintersten Winkel des Kontinents tragen und irgendwann, das wusste er, würde es überall so aussehen wie in den großen Städten des Ostens.
Finlay war nach Westen gegangen, um sein Glück zu machen, so wie es viele andere auch taten. Manche kamen mit den Taschen voller Gold zurück, von anderen hörte man nie wieder etwas, weil ihre Leichen irgendwo verscharrt lagen.
Finlay führte die Kaffeetasse zum Mund, schlürfte die heiße Flüssigkeit in sich hinein und bemerkte zufrieden, wie sich die Wärme auf seinen Körper übertrug und in ihm ausbreitete.
Das große Glück, der große Erfolg waren ihm bis jetzt nicht beschieden gewesen, und manchmal fragte er sich, ob es das überhaupt war, was er suchte. Vielleicht war es auch nur ein Vorwand, um nirgendwo zu starke Wurzeln zu schlagen. Er war eine Art Glücksritter, der von Gelegenheitsjobs lebte; ein Tramp, der es bislang nirgendwo lange ausgehalten hatte und dem es nach einer Weile überall zu eng wurde. Er wusste nicht, ob er je einen Ort finden würde, an dem er bleiben wollte.
Finlay hörte nun in der Ferne ein Geräusch, wie es galoppierende Pferde verursachen, und horchte auf. Er sah hinaus auf die Ebene und sah drei Reiter herannahen.
Cowboys wahrscheinlich, so überlegte er.
Das fruchtbare Weideland reichte, so weit das Auge sehen konnte. Es gab also vermutlich Rancher, die sich in dieser Gegend niedergelassen hatten.
Finlay wusste nicht mehrgenau, wo er sich befand. Er hatte etwas die Orientierung verloren, und daher kamen ihm die drei Reiter, die mittlerweile so nahe heran waren, dass man ihre Gesichter erkennen konnte, gerade recht.
Er würde sie nach dem Weg fragen.
Als die Reiter ihn erreichten, zügelten sie ihre Pferde und musterten Finlay, der ungerührt seinen Kaffee weitertrank. Allerdings hielt er die Tasse jetzt mit der Linken, während die Rechte stets in der Nähe des Revolvers blieb, den er im Holster trug. Finlay wusste aus eigener Erfahrung, dass man nicht vorsichtig genug sein konnte. wer konnte einem Mann schon an der Nasenspitze ansehen, ob es sich um einen Gentleman odre einen Strauchdieb handelte? In jeden Fall war es besser, auf eine Begegnung mit gesetzlosem Gesindel stets vorbereitet zu sein.
Die Reiter wirkten auf Finlay nicht gerade sympathisch. In ihren Blicken lag unterschwellige Feindschaft, teilweise aber auch offen zur Schau getragene Verachtung.
Einer von ihnen, mit schwarzem Bart und knorrigem Gesicht, den Hut tief hinuntergezogen, wirkte mit seiner fahlen, bleichen Haut und den blutleeren, fest aufeinander gepressten Lippen wie ein leibhaftiger Todesengel. Seine zusammengekniffenen Augen waren blass und kalt. Dieser Mann schien die Luft um sich herum förmlich mit Spannung aufzuladen.
Finlay warf einen flüchtigen Blick auf den Colt, den er an der Seite hängen hatte, und fragte sich, wie schnell der Schwarzbart wohl ziehen konnte.
An der Seite dieser finsteren Gestalt befand sich ein Blondschopf, über dessen Lippen ein unverschämtes Grinsen ging, während er sich den braunen Hut in den Nacken schob. An seinem Gürtel befanden sich zwei Revolver, was Finlay ein unwillkürliches Stirnrunzeln entlockte. Unten, in Mexiko, waren solche Doppelholster ziemlich beliebt, aber hier im Norden waren sie immer ein Kuriosum geblieben.
Der Dritte war ein rothaariger, sommersprossiger Mann, dessen Vorfahren vielleicht irischer Abstammung gewesen sein mochten. Seine Augen blitzten gefährlich, und Finlay wusste, dass er die erste beste Gelegenheit zu einer Provokation nutzen würde.
An den Unterarmen des Rothaarigen befanden sich Tätowierungen, was darauf hindeutete, dass er früher einmal zur See gefahren war. Finlay erwiderte einen Moment lang den Blick des Rothaarigen und dachte: Einen guten Bootsmann hätte er abgegeben! Allein schon seine massige, kräftige Gestalt war dazu geeignet, eine Mannschaft einzuschüchtern!
„Guten Morgen, Mister!“, murmelte der Schwarzbart so leise, dass Finlay Mühe hatte, ihn überhaupt zu verstehen. Ein gefährlicher Unterton schwang in seiner Stimme mit, so dass selbst diese an sich harmlose Begrüßung schon den Charakter einer versteckten Drohung besaß.
„Guten Morgen, Gentlemen“, erwiderte Finlay, nachdem er einen weiteren Schluck von seinem Kaffee genommen hatte. „Ich würde Ihnen ja gerne einen Becher anbieten, aber leider waren dies meine letzten Bohnen.“
Die Reiter reagierten darauf nicht.
Ihre Blicke hingen an Finlay, als wäre er ein exotisches Tier, das es zu erlegen galt.
„Wissen Sie, dass Sie sich auf Don Turners Land befinden?“, fragte der Schwarzbart.
Finlay zuckte mit den Schultern.
„Ich habe diesen Namen nie gehört“, erklärte er.
„Sie sind nicht von hier, was?“
„Nein, ich komme nicht aus dieser Gegend. Aber das Land hier sieht fruchtbar aus. Es wäre verwunderlich gewesen, wenn es niemandem gehört hätte.“
Die blutleeren Lippen des Schwarzbartes verzogen sich etwas. Finlay hatte versucht, einen versöhnlichen Ton in seine Stimme zu legen, denn er war nicht auf Streit aus. Der Schwarzbart hingegen schien genau das im Sinn zu haben.
„Don Turner hat es nicht besonders gerne, wenn Landstreicher auf seinem Grund und Boden herumstreunen!“, murmelte der Schwarzbart dann.
„Ich bin kein Landstreicher“, erwiderte Finlay sachlich. Es war sicher besser, sich nicht provozieren zu lassen, denn das Zahlenverhältnis sprach für seine Gegenüber.
Der Blondschopf mit den zwei Revolvern verzog höhnisch den Mund.
„Als was würden Sie sich denn bezeichnen?“
„Vielleicht ist er ein Viehdieb!“, warf der Rothaarige mit einer wegwerfenden Geste ein.
Der Schwarzbart spuckte aus.
„Also, Mister, was suchen Sie hier auf fremdem Boden?“
„Ich bin auf der Durchreise“, erklärte Finlay so ruhig, wie es ihm in dieser Lage möglich war. „Und ich suche einen Job. Irgendwie habe ich wohl etwas die Orientierung verloren. Vielleicht sind Sie so freundlich und sagen mir, wo hier die nächste Stadt liegt!“
Der Schwarzbart grinste und wandte sich an seine beiden Begleiter.
„So, die Orientierung hat er verloren, unser Freund. So etwas kann gefährlich sein! Schon so manch einen, der nicht wusste, über wessen Land er reitet, hat man später mit einer Kugel im Kopf im Gras gefunden! Es gibt nämlich jede Menge räuberisches Gesindel …“ Sein Gesicht verzog sich zu einer seltsamen Fratze. Er deutete mit der Hand nach Norden. „Wenn Sie in diese Richtung reiten, kommen Sie in etwa eineinhalb Stunden nach Madison City.“
Finlay nickte.
Er hatte diesen Namen noch nie auf irgendeiner Landkarte gesehen, aber das bedeutete nichts. In wenigen Jahren konnten hier im Westen Städte aus dem Nichts wachsen und ebenso schnell wieder von der Landkarte verschwinden und zu Geisterstädten verkommen, in denen nur noch Ratten und herrenlose Hunde hausten. Für die Kartografen war es ein schwieriges Geschäft, da Schritt zu halten.
„Sie sagten, Sie suchen einen Job, Mister …“ Der Schwarzbart erwartete offensichtlich, dass Finlay ihm seinen Namen sagte, aber dieser verzichtete demonstrativ darauf. Er mochte die drei Männer nicht und wollte so wenig wie möglich mit ihnen zu tun haben.
Er sagte daher: „Ja, das ist richtig. Ich suche einen Job.“
„Haben Sie schon einmal auf einer Ranch gearbeitet?“
Finlay bestätigte.
„Ja, schon auf mehreren.“
„Vielleicht sollte ich Sie meinem Boss vorstellen. Don Turner kann immer gute Leute gebrauchen.“
Aber Finlay winkte ab. Bevor er antwortete, nahm er noch einen Schluck Kaffee.
„Nein, danke.“
Die Augenbrauen des Schwarzbartes zogen sich zusammen, und für Finlay hatte er in diesem Augenblick entfernte Ähnlichkeit mit einem Raubtier.
„Was soll das heißen?“
„Das soll heißen, dass ich keine Lust habe, für Ihren Boss zu arbeiten, diesen, wie heißt er noch gleich? – Don Turner, nicht wahr?“
„So ein Angebot schlägt man nicht einfach aus!“, erklärte der Schwarzbart. „Was ist los? Sind Sie sich zu fein dazu, hart zuzupacken? Sie würden gut entlohnt …“
Finlay zuckte mit den Schultern.
Er hatte Bargeld wirklich dringend nötig, aber er war der tiefen Überzeugung, dass es Dinge gab, die noch weitaus wichtiger waren. Man konnte ihn nicht kaufen – und darauf war er stolz.
„Das mag schon sein“, antwortete er also dem Schwarzbart. „Aber ich müsste dann mit Ihnen zusammenarbeiten!“
„Und das würde Sie stören?“
„Ich mag Sie nicht besonders, und es geht mir nicht so schlecht, dass ich Ihr Angebot annehmen müsste!“
Finlay spürte, dass die Luft um sie herum sich in einem Maß mit Spannung aufgeladen hatte, das kritisch war. Er sah es in den Gesichtern der drei Cowboys, und er fühlte es in seiner Magengegend.
Ein winziger Funke nur, dachte er, und es kommt zur Explosion!
Finlay blieb ganz ruhig – zumindest äußerlich.
Man sah ihm die Anspannung nicht an, die jeden Muskel, jede Sehne seines Körpers erfasst hatte. Er war bereit, blitzschnell seinen Colt aus dem Holster zu reißen und zu feuern, wenn es sein musste.
Die Fähigkeiten seiner Gegner waren für ihn schwer einzuschätzen. Sein Blick fiel auf die zwei Revolver des Blondschopfs. Vielleicht war er ein Angeber und konnte gar nicht wirklich mit beiden Händen schießen. Wenn jemand zwei Colts trug, wollte er sich aller Wahrscheinlichkeit nach nur wichtig machen, aber hin und wieder traf man auch auf wirkliche Könner, die mit der Linken so gut wie mit der Rechten schießen konnten.
Das Dumme war nur, dass man es den meisten nicht ansehen konnte, zu welcher Sorte sie gehörten …
Finlay trank den Kaffee aus und stellte die Blechtasse neben das Feuer auf den Boden.
„Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag, Gentlemen!“, erklärte er dann schließlich dreist. „Schätze, Sie werden noch ´ne Menge zu tun haben für Ihren Boss, diesen Turner. Auf einer Ranch gibt’s immer jede Menge Arbeit …“
Der bleiche Schwarzbart schob sich jetzt den Hut in den Nacken, so dass die Sonne auf seine helle, unreine Haut schien.
„Wie ich bereits zu Anfang unserer Unterhaltung erwähnte, durchqueren Sie Don Turners Land. Ich denke, es wäre nicht zu viel verlangt, dafür eine kleine Abgabe zu verlangen, oder?“ Er wandte sich an seine beiden Begleiter, die zustimmendes Gemurmel vernehmen ließen.
„Klar doch!“, rief der Blondschopf angriffslustig. „Eine Art Wegezoll, verstehen Sie?“
Finlay verstand sehr gut, aber er war nicht gewillt, den dreien auch nur das Schwarze unter seinen Nägeln zu geben.
„Was meint ihr?“, fragte der Schwarzbart. „Sind hundert Dollar für eine Durchquerung von Don Turners Land angemessen?“
„Aber das ist nur für eine Tour!“, meinte der Rothaarige zynisch. „Der Rückweg muss extra bezahlt werden!“
Der Schwarzbart wandte sich an Finlay.
„Sie haben es gehört, Mister. Es sind hundert Dollar fällig. Zahlbar jetzt und in guten amerikanischen Banknoten! Wir nehmen aber auch Goldnuggets und silberne Taschenuhren!“
„Scheren Sie sich zum Teufel!“, erwiderte Finlay ärgerlich.
„Habt ihr das gehört?“, rief der Schwarzbart. „Er ist nicht gerade höflich, dieser Fremde hier!“
„Vielleicht will er uns damit sagen, dass er nicht zahlen kann“, meinte der Rothaarige. „Hundert Dollar sind schließlich ´ne Menge Geld für einen Landstreicher!“
„Ja, richtig!“, fiel der Blondschopf ein. „Besonders, wenn man sich zu schade ist Arbeit anzunehmen.“
Finlay spürte, dass es jetzt gefährlich wurde. Diese Männer waren einzig darauf aus, ihn zu schikanieren. Sie schienen es nicht gewöhnt zu sein, in ihre Schranken verwiesen zu werden.
„Also gut“, erklärte der Schwarzbart ironisch, wobei sich seine dünnen, blutleeren Lippen nicht mehr als unbedingt notwendig bewegten. „So werden wir Gnade vor Recht ergehen lassen, wenn Sie nicht zahlen können! Wir geben uns auch mit Ihrem Pferd, dem Sattel und Ihrer Winchester zufrieden, wenn Sie nichts dagegen haben!“
Aber Finlay hatte durchaus etwas dagegen. Dennoch gelang es ihm, verhältnismäßig ruhig zu bleiben.
„Ich gebe Ihnen einen guten Rat“, murmelte er. „Ziehen Sie Ihrer Wege und lassen Sie mich in Frieden!“
„Nimm dir sein Pferd, Bill!“, befahl der Schwarzbart, an den Blondschopf gewandt.
Bill zögerte einen Moment lang, dann veranlasste er sein Pferd dazu, ein paar Schritt in Finlays Richtung zu gehen. Dieser fackelte nicht lange.
Blitzschnell riss er den Revolver aus dem Holster, spannte den Hahn und richtete die Waffe auf den Blondschopf.
„Keine falsche Bewegung, Mister!“ Einige Augenblicke lang hing alles in der Schwebe.
Bill war sich offensichtlich nicht schlüssig darüber, wie er zu reagieren hatte. Er schaute etwas ratlos zu dem Schwarzbart hin.
Er braucht jemanden, der für ihn denkt!, wurde es Finlay klar.
Die Gesichter seiner Gegenüber wirkten wie die von ausgehungerten Wölfen, die ihre Beute gestellt hatten und nun darauf warteten, sich auf sie zu stürzen und sie zu zerfleischen.
Dann zog unvermittelt der Rothaarige, aber Finlay war schneller. Er hatte sich blitzschnell gedreht und seine Waffe abgefeuert. Der Colt des Rothaarigen fiel zu Boden. Er stieß einen Laut aus, der halb Verwünschung, halb Schmerzensschrei war, und hielt sich mit verzerrtem Gesicht den Arm.
„Verdammt …!“, stieß er gepresst hervor. Sein Gesicht hatte sich vor Zorn und Wut der Farbe seiner Haare angepasst. „Verdammt, Bill und Joe, warum tut ihr nichts? Blast diese Ratte doch um!“
„Sie tun nichts, weil sie vernünftig sind“, erklärte Finlay kalt.
Das fahle Gesicht des Schwarzbartes war noch bleicher geworden, als es ohnehin schon war. Sein dünnlippiger Mund war wieder fest zusammengepresst, die Mundwinkel deuteten nach unten.
Auch der blonde Bill wagte es nicht, sich auch nur einen Zentimeter zu bewegen.
„Sie wissen, dass Sie es nicht mit mir aufnehmen können und dass ich dem nächsten, der eine falsche Bewegung macht, nicht nur in den Arm schießen werde!“, fuhr Finlay fort. „Besser, unsere Wege trennen sich jetzt, Gentlemen. Wir scheinen uns nicht besonders miteinander zu verstehen …“
Bills Blick hing noch immer an Joe, dem Schwarzbart, aber der zeigte keine Reaktion. Joe wartete einige Augenblicke, denn es fiel ihm schwer, die Niederlage einzugestehen. Schließlich nickte er seinen Männern zu.
„Okay, Leute. Schätze, es ist besser, wenn wir uns auf die Socken machen!“
*
Die Sonne stand schon hoch, als Jim Finlay Madison City erreichte, eine Stadt aus schnell zusammengehauenen Blockhäusern und namenlosen, staubigen Straßen, die sich bei Regen vermutlich in Sümpfe verwandelten.
Als Finlay die Frauen in den guten Kleidern und einige der Männer in dunklen Anzügen sah, dachte er, dass heute vielleicht Sonntag war und die braven Bürger sich zum Kirchgang so herausgeputzt hatten.
Aber dann sah er den Sarg und begriff, dass es sich um einen Beerdigungszug handelte.
Finlay sah sich den Zug interessiert an, wobei er den Hut in den Nacken schob.
Die feinen Anzüge passten nicht zu dem Staub der Straßen.
Die Kirchglocken wurden geläutet. Finlay sah in zerknirschte Gesichter. Finlay besann sich und nahm den Hut in die Hand. Wer immer auch der Verstorbene gewesen sein mochte, so wollte er ihm im Angesicht des Todes doch einen gewissen Respekt zollen. Selbst beim Anblick der Leiche des gemeinsten Halunken pflegte er so zu verfahren.
In den Zügen der Menschen, die hinter dem Sarg herschritten, lag aber durchaus nicht nur Trauer, sondern mindestens ebenso viel Furcht und Wut.
Natürlich kannte Finlay die Umstände nicht, unter denen hier ein Mensch zu Tode gekommen war, aber es machte ganz den Anschein, als wäre hier jemand nicht an Altersschwäche oder Krankheit gestorben. Irgendein Drama schien sich in den letzten Tagen zwischen den Bretterbuden von Madison City abgespielt zu haben …
Finlay lenkte sein Pferd auf den Saloon zu, der keinen Namen hatte.
Wozu auch ein Name?, dachte Finlay. Vermutlich gab es nur einen Saloon in der Stadt, man konnte ihn also kaum verwechseln.
Er machte sein Pferd neben ein paar anderen fest, die bereits vor dem Saloon standen, und passierte die Schwingtüren.
Die Stimmung, die im Schankraum herrschte, war alles andere als ausgelassen. Ein einsamer Zecher hing an der Theke, und der Barkeeper stand gelangweilt dahinter.
Finlay bestellte sich einen Drink.
„Nicht viel los hier, was?“, fragte er, gleichermaßen an den Barkeeper wie an den Zecher gewandt. Letzterer war allerdings zu einer Antwort wohl ohnehin nicht mehr fähig. Er hatte den Kopf auf den Schanktisch gelegt und ließ jetzt ein vernehmliches Schnarchen hören. Als auch der Barkeeper zunächst nichts sagte, fragte Finlay weiter: „Ist das immer so?“
„Die Leute sind alle auf der Beerdigung von Tom Asher“, erklärte der Barkeeper, während er Finlay nachschüttete. „Ich habe Sie noch nie gesehen. Sie sind nicht von hier, nicht wahr?“
Finlay nickte.
„Richtig.“
Der Barkeeper machte ein nachdenkliches, fast trauriges Gesicht.
„Dann wird Ihnen Tom Ashers Name auch nichts sagen, schätze ich.“
„Nein, tut er nicht.“
„Er war ziemlich beliebt hier in der Gegend.“
„Das sieht man. Es laufen ´ne Menge Leute hinter seinem Sarg her.“
„Weiß Gott, ja!“, bestätigte der Barkeeper. „Er war der Besitzer des Ladens dahinten die Straße runter.“ Er gestikulierte mit den Händen, ohne dass Finlay verstand, wo sich Ashers Laden nun tatsächlich befand. Aber das war im Moment nicht so wichtig. „Tom war wirklich ein guter Kerl!“
Dem Barkeeper traten jetzt Tränen in die Augen, die er hastig wegwischte. Als Barkeeper in einer Stadt wie Madison City musste man allerhand austeilen und einstecken können, und auch jener Mann, der Finlay jetzt gegenüberstand, schien eher von der hart gesottenen Sorte zu ein. Aber diese Sache ging ihm sehr nahe. „Ich wäre auch mitgegangen“, presste er hervor. „Aber … Ich habe es einfach nicht fertig gebracht. Sie sehen ja, wie mich das mitnimmt! Wir waren gute Freunde!“
Er nahm jetzt selbst einen tiefen Schluck aus der Flasche. Das schien ihn etwas zu beruhigen. Er atmete tief durch, wischte sich mit dem Ärmel den Mund ab und schlug dann mit der flachen Hand auf den Schanktisch. „Sie haben ihn einfach abgeknallt! Wie einen tollwütigen Hund!“ Seine Stimme zitterte, und ohnmächtige Wut stand in seinem Gesicht. „Ich hätte ihm das fehlende Geld geliehen, wenn ich eine Ahnung von seiner Lage gehabt hätte! Aber um von selbst zu mir zu kommen, war er zu stolz!“
Finlay runzelte die Stirn.
„Sie wissen, weshalb und von wem dieser Asher umgebracht wurde?“
Die Züge des Barkeepers erstarrten.
Er musterte Finlay zunächst einige Augenblicke lang misstrauisch. Bevor er ihm antwortete, nahm er zunächst noch einen Schluck aus der Flasche.
„Vergessen Sie, was ich gesagt habe!“, murmelte er fast flehentlich. „Vergessen Sie’s, ich bitte Sie! Ich habe schon viel zu viel geredet, aber ich konnte einfach nicht anders. Der Druck war zu stark, es sprudelte einfach so aus mir heraus!“ Er atmete schwer und seufzte. „Das ist eine böse Geschichte …“
„Erzählen Sie sie mir!“
Aber der Barkeeper schüttelte energisch den Kopf.
„Ich sagte doch: Vergessen Sie’s. Ich habe einfach nur so dahergeredet.“ Er schluckte und machte eine hilflose Geste. „Ich gebe Ihnen einen guten Rat: Wenn Sie nichts Dringendes in Madison City zu erledigen haben, dann sollten Sie schleunigst weiterreiten!“
Das stachelte Finlays Neugier noch mehr an.
„Na los, erzählen Sie schon! Worum geht es bei der Sache?“
„Seien Sie froh, dass Sie nichts damit zu tun haben!“
Der Barkeeper sagte das auf eine Art und Weise, die Finlay signalisierte, dass es zwecklos war, weiter zu fragen.
Finlay zuckte mit den Schultern und trank sein Glas leer.
„Noch einen Drink, Mister?“
„Nein, danke. Ach sagen Sie, ich suche kurzfristig einen Job. Wissen Sie, wer hier jemanden braucht?“
Man sah dem Barkeeper die Erleichterung darüber an, dass der Fremde das heiße Terrain, auf dem sich ihr Gespräch befunden hatte, verließ und sich in weniger verfängliche Gefilde bewegte.
„Kommt drauf an, was Sie suchen.“
„Ich bin nicht wählerisch.“
„Spencer, der sucht jemanden für sein Fuhrunternehmen. Fragen Sie den mal. Ein Gespann lenken können Sie doch, oder?“
„Keine Frage. Wo finde ich diesen Spencer?“
*
Allan Spencer war ein gedrungener Mann, der die Sechzig schon überschritten hatte. Sein Haar war ergraut, das sonnenverbrannte Gesicht runzelig geworden.
Mit einem einzigen Wagen hatte er angefangen, jetzt besaß er insgesamt fünf Gespanne, die Fracht zwischen Madison City und Pinewood transportierten – oder wo immer der Kunde seine Sachen sonst in der Umgebung hingebracht haben wollte.
Nur noch sehr selten übernahm Spencer selbst Frachtfahrten. Er saß nicht mehr auf dem Kutschbock, sondern zumeist in seinem Büro und koordinierte die Aufträge. So auch jetzt, als Jim Finlay ihn aufsuchte.
„Sie sind Spencer?“
„Ja. Was wollen Sie transportieren?“
„Nichts. Ich habe gehört, hier gibt’s ´nen Job!“
Spencer bestätigte mit einem Kopfnicken.
„So ist es. Ich nehme an, Sie können ein Gespann führen?“
„Kein Problem.“
Spencer nannte ihm den zu erwartenden Verdienst. Ein reicher Mann konnte man davon nicht werden, aber Finlay nahm an, dass es reichen würde, um den einen oder anderen Dollar zurückzulegen. Wenn er genug beisammen hätte, würde er weiterziehen.
„Kost und Logis sind dabei!“, erklärte Spencer. „Nebenan sind die Unterkünfte für die Fahrer.“ Er grinste. „Sie können sich natürlich auch ein Zimmer in der Stadt nehmen, aber das würde Sie einiges kosten …“
„Ist schon in Ordnung“, erklärte Finlay. „Ich wohne bei Ihnen in der Unterkunft. Der Lohn ist auch okay.“
„Gut, dann sind wir uns ja einig.“
„Wann soll ich anfangen?“
„Morgen. Heute ist keine Fahrt mehr.“
Die ganze Zeit über hatte Spencer kaum von seinen Geschäftsbüchern aufgeschaut, doch jetzt musterte er Finlay eingehend und nickte dann, so als wollte er sich selbst bestätigen, den richtigen Mann eingestellt zu haben.
„Ich denke, wir werden uns gut verstehen …“ Er reichte Finlay die Hand. Dann rief er plötzlich: „Beth! Beth, komm her!“ Ein paar Augenblicke später betrat eine junge, dunkelblonde Frau das Büro.
„Beth, das ist …“ Spencer stockte. „Wie ist eigentlich Ihr Name, Mister?“
„Finlay. Jim Finlay.“
„Du hast es gehört, Beth. Er heißt Finlay und fährt für uns. Sei so nett und zeig ihm, wo er seine Sachen lassen kann. Er wohnt bei den anderen in der Baracke.“
Beth nickte und lächelte freundlich dabei.
Sie ist schön, dachte Finlay, der die Art bewunderte, in der sie ihr Haar hochgesteckt hatte. Ein großartiger Kontrast zu den rohen Brettern, aus denen diese Stadt zusammengenagelt war!
„Kommen Sie mit mir, Mr. Finlay!“, sagte sie. Ihre Stimme hatte einen angenehmen, warmen Klang. Allan Spencer beugte sich wieder über seine Auftragsbücher und würdigte Finlay keines Blickes mehr. Er beugte sich so tief auf die Papiere, dass seine Nasenspitze sie fast berührte. Außerdem benutzte er eine starke Lupe.
Beth führte ihn hinaus.
Neben dem Wohnhaus, in dem sich auch Spencers Büro befand, war ein Pferdestall und daneben die Baracke, in der die Fahrer untergebracht waren.
„Sind Sie Spencers Tochter?“, erkundigte sich Finlay.
Sie nickte.
„Seit meine Mutter tot ist, führe ich den Haushalt. Oft helfe ich ihm auch bei den Eintragungen in die Bücher. Ich weiß nicht, ob Sie es bemerkt haben …?“
„Was?“
„Seine Augen haben in den letzten Jahren ziemlich nachgelassen.“
„Gehen die Geschäfte gut, Miss?“
Sie errötete etwas, und Finlay war nun seinerseits verwirrt, denn er konnte sich nicht denken, was diese Regung in ihr hervorgerufen hatte. Irgendetwas hatte sie für den Bruchteil eines Augenblicks verstört – und offensichtlich hatte es mit der Frage zu tun, die er gestellt hatte.
Dann war alles vorbei, und sie hatte sich wieder gefasst.
„Die Geschäfte gehen einigermaßen“, sagte sie dann, allerdings eine deutliche Nuance weniger fröhlich, als sie zuvor gesprochen hatte. „Wir kommen ganz gut über die Runden“, setzte sie hinzu. Dann versuchte sie, heiter zu wirken, verzog den Mund zu einem verkrampften Lächeln und meinte noch: „Jedenfalls hat noch keiner von uns hungern müssen!“ Das hatte humorvoll sein sollen, aber es war ganz und gar nicht so über ihre Lippen gekommen.
Sie wechselten einen längeren Blick, bei dem Finlay vergeblich in ihren Augen zu lesen suchte.
Er zog die Augenbrauen zusammen.
Er hatte nicht viel Übung im Umgang mit Frauen, aber dennoch spürte er sehr deutlich, dass hier etwas nicht so war, wie es sein sollte. „Was ist los mit Ihnen, Miss? Wenn ich irgendetwas angesprochen haben sollte, das …“
„Es ist schon gut, Mr. Finlay. Ich werde Ihnen jetzt Ihre Unterkunft zeigen.“
Im ersten Moment wollte Finlay nachhaken, aber dann zögerte er einen Augenblick zu lange, und die Gelegenheit war dahin.
Vielleicht auch besser so, dachte er. Welches Recht hatte er schon, in sie zu dringen?“
Beth Spencer führte ihn dann in die Baracke.
Fünf Betten befanden sich darin, an der einen Seite war ein Kohlenofen, auf der anderen ein paar Schränke, eine alte Kommode und ein Spiegel, vor dem eine Waschschüssel stand.
„Alles in bester Ordnung!“, meinte Finlay. „Wissen Sie, Miss, in letzter Zeit habe ich meistens unter freiem Himmel kampiert, da wird mir so ein richtiges Bett sicher gut tun!“
Beth machte eine Handbewegung und deutete auf eines der Betten.
„Sie können dort schlafen. Die anderen sind belegt. Im Augenblick sind die Männer noch unterwegs. Heute Abend werden Sie sie wohl kennen lernen. Es sind nette Kerle, Sie werden sich mit ihnen verstehen!“
Finlay nickte.
„Sicher.“
Dann schwiegen sie.
Draußen rief jemand: „Hey, Spencer, mach auf!“
Es durchzuckte Finlay wie ein Blitz. Augenblicklich war seine Rechte in der Nähe seiner Waffe, sein Gesicht, das eben noch entspannt gewirkt hatte, veränderte sich.
Diese Stimme!, dachte er.
Unvermittelt ging er zur Tür und trat aus der Baracke heraus.
„Hey, Mr. Finlay, was haben Sie?“, rief Beth, während sie hinter ihm herlief. Als Finlay nach einigen Schritten stehen blieb, holte sie ihn ein. „Was ist los?“
Vor der Haustür befand sich ein Mann, und obwohl Finlay ihn nur von hinten sehen konnte, erkannte er ihn sofort! Die Tür wurde geöffnet, und Spencer ließ den Mann eintreten.
„Was ist?“, fragte Beth noch einmal. „Kennen Sie den Mann, der gerade ins Haus gegangen ist?“
Sie schluckte, und als Finlay sie ansah, wusste er sofort, dass sie ihn kannte.
Er wartete ihre Antwort also gar nicht erst ab, sondern stellte sogleich eine weitere Frage.
„Wie heißt er?“
„Kommen Sie, packen Sie erst einmal Ihre Sachen in die Baracke!“
„Ich will verdammt noch mal wissen, wie er heißt!“
Ein scharfer, unmissverständlicher Unterton lag jetzt in seiner Stimme. Beth zögerte einen Moment, bevor sie den Namen murmelte.
„Joe Muller.“
Finlay nickte und atmete tief durch. „Das könnte sein. Der eine hat ihn Joe genannt!“
„Wovon sprechen Sie?“
„Ich habe heute Morgen die unangenehme Bekanntschaft von diesem Muller gemacht!“
„Oh …“
„Er und zwei Komplizen haben versucht, mir meine Sachen wegzunehmen. Was hat Ihr Vater mit diesem Gesindel zu tun?“
„Nichts!“
Finlays Erregung flachte zunächst etwas ab, seine Züge entspannten sich wieder. Dann runzelte er unwillkürlich die Stirn.
„Nichts!“, hatte sie gesagt. Weshalb? Wäre es nicht die natürlichste Sache der Welt gewesen, wenn Joe Mullers Boss Don Turner seine Fracht von Spencer transportieren ließ und Muller gekommen war, um einen entsprechenden Auftrag zu erteilen?
„Dieser Muller ist ein gefährlicher Mann“, meinte Finlay. „Ich werde mal ins Büro hineingehen und ihm einen guten Tag sagen.“ Er grinste sarkastisch. „Schätze, er wird nicht gerade erfreut sein über unser Wiedersehen!“
Finlay wollte gehen, aber Beth hielt ihn verzweifelt am Arm.
„Ich bitte Sie, Finlay, tun Sie das nicht!“
„Warum denn nicht?“
Er blickte in ihr Gesicht und sah, dass es kreidebleich war. Sie hatte Angst, so viel war klar.
„Ich bitte Sie, Sie wollen uns doch nicht in Schwierigkeiten bringen, oder?“
Sie schluckte, ihre Augen waren gerötet. „Sie sind nicht von hier, Sie können nicht wissen, worum es geht!“
„Worum geht es denn?“
In diesem Moment ging die Haustür wieder auf, und der schwarzbärtige Joe Muller trat heraus, den dunklen Hut tief ins Gesicht gezogen, so dass man von der oberen Hälfte seines bleichen Gesichts kaum etwas sah.
Um seine dünnen Lippen spielte ein zynisches Grinsen, das jedoch sofort verschwand, als er Finlay erblickte.
„Versuchen Sie das besser nicht!“, warnte Finlay sein Gegenüber, bevor dessen Hand zum Revolver greifen konnte. „Sie wissen doch, dass ich schneller sein würde, oder etwa nicht?“
Hinter Muller trat jetzt Spencer hervor, der das kurze Wortgefecht mitbekommen hatte und nun nachschauen wollte, was los war. Sein Gesicht war verkrampft, seine Körperhaltung seltsam geduckt.
Das scheint nicht gerade ein Kunde zu sein, mit dem er gern verkehrt!, kam es Finlay in den Sinn. Er ließ die Rechte in die Nähe seines Revolvers. Jemandem wie Muller war alles zuzutrauen.
„Was gibt es?“, fragte Spencer.
Muller achtete nicht auf den hinter ihm stehenden Fuhrunternehmer. Er wechselte mit Finlay einen längeren Blick, und für Momente herrschte eine gefährliche, explosive Stille. Dann wandte Muller sich zu seinem Pferd, das er vor dem haus der Spencers festgemacht hatte, stieg in den Sattel und ritt davon, ohne sich noch einmal umzuwenden.
„Na, was für eine Art Fracht wollte Mullers Boss denn befördert haben?“, fragte Finlay jetzt sichtlich entspannter an Allan Spencer gewandt.
„Fracht?“ Spencer lachte heiser und freudlos. „Sie haben ja keine Ahnung, Finlay!“
Er wirkte traurig und müde.
In den wenigen Minuten, die vergangen waren, seit Finlay den Fuhrunternehmer zum ersten Mal gesehen hatte, schien er um Jahre gealtert zu sein. Spencer wandte sich um und trottete ins Haus zurück. Krachend fiel die Tür hinter ihm ins Schloss.
Finlay wandte sich an Beth.
„Hier ist etwas faul, Miss, das spüre ich! Die Sache stinkt meilenweit gegen den Wind.“
Sie versuchte seinen Blicken auszuweichen.
„Hören Sie, Miss. Ich lebe jetzt hier. Sie sollten mir sagen, worum es geht!“
Sie hob den Kopf und musterte ihn prüfend.
„Kann ich Ihnen vertrauen?“
„Mein Wort drauf.“
Sie nickte.
„Vielleicht haben Sie Recht.“
„Gut, dann schießen Sie los!“
„Nicht hier. Gehen wir zurück in die Baracke.“
*