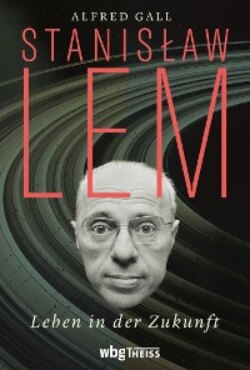Читать книгу Stanislaw Lem - Alfred Gall - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Lemberg und Galizien – die Vorgeschichte
ОглавлениеStanisław Lem wurde am 13. September 1921 in Lemberg (polnisch Lwów, ukrainisch Lwiw) geboren. In der Geburtsurkunde wurde jedoch der 12. September eingetragen – aus dem Aberglauben, damit künftiges Unglück zu vermeiden. Als einziges Kind in einer polnisch-jüdischen Familie bürgerlicher Provenienz wuchs der künftige Technikvisionär behütet von seinen beiden Eltern Samuel (1879–1954) und Sabina Lem (1892–1979) auf und erlebte eine verwöhnte Kindheit, über die er in seinen Memoiren Das Hohe Schloß sagen wird, er habe sie als „Monster“ zugebracht (er nahm z. B. sein Essen nur zu sich, wenn der Vater zuerst mit einem Regenschirm auf den Tisch stieg). Die Familie umgab in Lemberg ein weitverzweigtes Netz von Verwandten, die sehr unterschiedlich mit ihrer jüdischen Herkunft umgingen. Während einige bei ihrer Jüdischkeit blieben und den Familiennamen daher bei „Lehm“ beließen, polonisierte Samuel Lehm seit 1904 den deutschen Familiennamen zu Lem. Es ist auch als Bekenntnis zur polnischen Nation zu sehen, dass Samuel und Sabina Lem ihrem Sohn den nichtjüdischen, aber in der polnischen Kultur populären, altslawischen Hintergrund aufweisenden Namen Stanisław gaben, der „werde berühmt“ bedeutet. Und Berühmtheit wird man Stanisław Lem gewiss nicht absprechen können, wenn auch die spätere Entwicklung im Jahr 1921 noch gar nicht abzusehen, bestenfalls zu wünschen war. Um diese Entscheidungen zu verstehen, ist ein Blick auf die damaligen sozialen Bedingungen und ihre geschichtliche Entwicklung erforderlich.
Abb. 1: Stanisław Lem als Kind mit Teddybär, Lemberg 1920er Jahre
Lemberg gehörte seit den Teilungen Polens am Ende des 18. Jahrhunderts zur Habsburger Monarchie, die das ihr zugefallene Territorium unter der Bezeichnung „Königreich Galizien und Lodomerien“ in das eigene Reich integrierte. Die Eingliederungsmaßnahmen fußten auf einer flächendeckenden Einführung des österreichischen Verwaltungs- und Steuersystems und der Hinzuziehung österreichischer Beamter. Die altpolnischen Strukturen sollten aufgelöst und jedwede Möglichkeit der Obstruktion unterbunden werden. Nicht nur in Galizien, auch im preußischen (ab 1871 im reichsdeutschen) und im russischen Teilungsgebiet sahen sich die Polen vor die Herausforderung gestellt, ihre Existenz als Nation zu bewahren. Aufstände und Erhebungen, Protest und Widerstand, wie überhaupt vielfältige Aktivitäten, in der Öffentlichkeit und im Untergrund, bezeugen das polnische Beharren auf nationaler Selbstbehauptung, das sich freilich mannigfaltigen Repressionen ausgesetzt sah.
Ein wichtiges Instrument im Kampf um den nationalen Zusammenhalt stellte in der Zeit der Teilungen die Literatur dar. Sie und allgemein polnische Kulturaktivitäten kompensierten die fehlende Existenz eines unabhängigen polnischen Staats.
Gerade in Lwów und Umgebung erfolgte dies unter besonderen Bedingungen, denn die Bevölkerungsstruktur dieser neuen Reichsgebiete, oft einfach auch nur als Galizien bezeichnet, war sehr heterogen. In den Städten dominierten Polen und Juden, daneben auch eine deutsche Minderheit, auf dem Land im Osten die Ruthenen – hauptsächlich Ukrainer – und im Westen die Polen. Der jüdische Anteil an der Bevölkerung Galiziens stieg bis zum Ende des 19. Jahrhunderts auf 11,5 %. Galizien blieb innerhalb des Habsburgerreichs eine stiefmütterlich behandelte Peripherie, deren demographische Entwicklung nicht durch eine entsprechende Dynamik der Wirtschaft aufgefangen wurde. Industrialisierung sowie Urbanisierung setzten spät und zaghaft ein. Die Folge war, dass das Gebiet in seiner Gesamtentwicklung stagnierte – es wurde auch als Armenhaus Europas bezeichnet – und eine starke Auswanderungsbewegung einsetzte. Die Bevölkerung wuchs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts trotzdem auf über 8 Millionen (1910) an. Der demographische Druck verursachte angesichts der wirtschaftlich teils verheerenden Zustände nach 1900 eine konstant hohe Emigrationsrate von über 50 000 Menschen, die pro Jahr Galizien verließen. Dies führte für den Zeitraum von 1880 bis 1910 zu einer Auswanderung von insgesamt 850 000 Personen, darunter allein 236 000 Juden, die so ca. 28 % der Emigranten ausmachten, also einen überproportional hohen Anteil an der Migrationsbewegung stellten. In seinem 1888 erschienen Buch Die galizische Armut kam Stanisław Szczepański zum erschütternden Ergebnis, das in Galizien jährlich an die 50 000 Menschen an den Folgen von Mangelernährung starben. Im polnischen Volksmund wurde daher die Bezeichnung des Königreichs verballhornt zu Gołycja i Głódomerja (deutsch etwa Nacktizien und Hungermerien).
Die Geschichte Galiziens kann grob in zwei Perioden unterteilt werden. In einer ersten Phase, die bis in die 1860er Jahre hineinreichte, dominierte die österreichische Macht. Sie kontrollierte die Verwaltung und auch das Bildungssystem. Unterrichtssprache war in den Schulen deutsch, auch an der Universität Lemberg wurde in deutscher Sprache gelehrt und geforscht. Juden waren gezwungen, deutsche Familiennamen zu führen, so auch die Familie Lehm. Sie waren, insbesondere wenn sie sich der Assimilation verweigerten, gesellschaftlich diskriminiert sowie antijüdischer Gewalt und Pogromen ausgesetzt. In den 1860er Jahren sah sich die Habsburger Monarchie gezwungen, eine Reihe tiefgreifender Reformen anzugehen. Damit begann für Galizien die zweite Periode. Denn neben dem Ausgleich mit Ungarn im Jahr 1867, der zur Schaffung zweier Reichshälften führte, gehörte auch die 1867/68 zugestandene Galizische Autonomie zu diesem Reformprozess. Als Ergebnis einer ganzen Reihe von Maßnahmen erfolgte seit diesem Zeitpunkt in Galizien der Übergang zur kulturellen Hegemonie der Polen. Der Verwaltungsapparat und das Bildungswesen wurden weitgehend polonisiert. Die galizische Autonomie ist also im Wesentlichen eine polnische Veranstaltung, die insbesondere die Ruthenen dem Diktat der Polen unterwarf und einen entsprechenden Widerwillen hervorrief, der sich in der Entfaltung eines ukrainischen Nationalgefühls mit deutlich antipolnischer Spitze manifestierte. Die Wiener Zentrale erhoffte sich von der Galizischen Autonomie eine Stärkung der Gesamtmonarchie, hat mit ihr allerdings auch die Spannungen zwischen Polen und Ruthenen verstärkt. Für die jüdische Bevölkerung hatte diese folgenreiche Umstellung in der habsburgischen Reichspolitik die Konsequenz, dass Assimilation zumeist mit Polonisierung verbunden war. Als Alternative und Ausweg aus der polnischen Kulturhegemonie sowie als Flucht vor auch mit der Galizischen Autonomie keineswegs beseitigten Formen der Diskriminierung und antijüdischer Gewalt blieb die Emigration unter Juden weiterhin verbreitet.
Die gewährte Autonomie nutzten die Polen, um in Galizien polnische Kultur und Wissenschaft zu einer weit ausstrahlenden Blüte zu entwickeln. Literatur, Theater, Wissenschaft und öffentliche Debatten, von Polen bestimmt und in polnischer Sprache betrieben, dazu die einflussreiche Stellung der mit Polen verbundenen katholischen Kirche – all dies kam einer für die anderen Teilungsgebiete unerreichbaren Konzentration von kultureller Aktivität gleich. Das ging allerdings auf Kosten der Ruthenen und ließ für die jüdische Bevölkerung den Weg zu staatlich anerkannter höherer Bildung mit Polonisierung zusammenfallen. Die Anziehungs- und Durchsetzungskraft der polnischen Kultur in Galizien ist etwa daran ablesbar, dass die Vorfahren von Zbigniew Herbert (1924 in Lemberg geboren und einer der wichtigsten polnischen Lyriker des 20. Jahrhunderts) aus Wien nach Galizien kamen – und sich polonisierten.
Krakau und Lemberg wurden zu zwei Zentren polnischer Vitalität, wobei Lemberg jedoch zugleich eine zunehmend wichtige Rolle in der Verfestigung des gegen die kulturelle Hegemonie der Polen gerichteten Nationalbewusstseins der Ruthenen zu spielen begann. Deren Ansprüche auf autonome Bildung und Kultur wurden zwar nicht vollständig zurückgewiesen, konnten sich aber unter dem Druck der Polen nicht im angestrebten Ausmaß entfalten. In Lemberg wirkten mit dem Historiker Mychajlo Hruschewskyj oder dem Schriftsteller und Publizisten Ivan Franko zwei für die Genese des modernen ukrainischen Nationalbewusstseins zentrale Persönlichkeiten.
Das Ende des Ersten Weltkriegs eröffnete den Polen die Chance auf Wiederherstellung der staatlichen Unabhängigkeit und Zusammenführung der über hundert Jahre getrennten und unter Fremdherrschaft stehenden Teilungsgebiete. Umstritten und heiß umkämpft waren die Grenzen des polnischen Staats, der auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der Völker 1918 wiedererrichtet werden sollte. Auch Lemberg geriet in den Strudel kriegerischer Ereignisse. Gerade im Osten Polens standen sich antagonistische Nationalbewegungen gegenüber, deren territoriale Besitzansprüche unvereinbar waren. Mit der Oktoberrevolution und der revolutionären Entwicklung in Russland trat ein weiterer Faktor in Erscheinung, der die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Aufruhr versetzte. In Wilna wurde 1918 ein litauischer Staat mit einer entsprechenden Nationalregierung ausgerufen, wobei die Unabhängigkeit dieser Republik erst nach Kämpfen gegen Polen und die Rote Armee behauptet werden konnte. Allerdings wurde Wilna schon 1920 von den Polen besetzt. Auch in der Ukraine wurde der Versuch unternommen, einen eigenen Nationalstaat zu gründen, wobei neben der Ukrainischen Nationalrepublik mit der Hauptstadt Kiew in Lemberg auch eine Westukrainische Volksrepublik ausgerufen wurde. Die polnische Regierung unter Józef Piłsudski widersetzte sich zumindest den territorialen Ansprüchen der litauischen und ukrainischen Nationalregierungen. Lemberg wurde nach einer militärischen Auseinandersetzung mit der Ukraine erobert und in den polnischen Staat integriert. Zwar war Piłsudski, eingedenk der polnisch-litauischen Adelsrepublik, durchaus an einer Föderation mit der Ukraine interessiert, verstand letztere aber als Zusammenschluss unter polnischer Führung. Nach einem erfolgreichen polnischen Vorstoß bis nach Kiew erfolgte unter dem Druck der Roten Armee der Rückzug. Erst kurz vor Warschau, mit dem „Wunder an der Weichsel“ im August 1920, konnte der Vormarsch der Roten Armee aufgehalten werden. Die Grenzen im Osten – und auch Westen – waren zwar gesichert und so die Existenz des polnischen Staats nach außen behauptet. Allerdings belasteten die zahlreichen militärischen Konflikte die Beziehungen zu den Nachbarstaaten, von denen etwa die Weimarer Republik nicht bereit war, die Westgrenze Polens anzuerkennen.
Lemberg wurde Ende November 1918 nach heftigen Kämpfen mit Verbänden der Westukrainischen Volksrepublik von polnischen Truppen besetzt. Während der kriegerischen Auseinandersetzungen, die in dieser Zeit tobten – neben dem Russischen Bürgerkrieg ist vor allem an den Polnisch-Ukrainischen und Polnisch-Russischen Krieg zu denken –, kam es in der ganzen Region wiederholt zu Pogromen, verübt von Ukrainern – vor allem den Milizen von Symon Petljura –, Rotarmisten und Polen. In Lemberg selbst ereigneten sich im November 1918 nach Beendigung der Kämpfe mit den Ukrainern Ausschreitungen. Mehrheitlich polnische Soldaten verübten ein Massaker an der Zivilbevölkerung, das insgesamt 340 Menschenleben kostete, der Großteil der Getöteten waren Ukrainer. Das Massaker ging nahtlos in einen Pogrom über, dem über siebzig Juden zum Opfer fielen. Immerhin nahmen die Kampfhandlungen 1920 ein Ende.
Nach den kriegerischen Auseinandersetzungen ging es in Polen darum, die über hundert Jahre voneinander getrennten Teilungsgebiete zu einem Staat zusammenzufügen. Dies war bei den teilweise beträchtlichen Entwicklungsunterschieden kein einfaches Unterfangen. Erschwerend wirkte sich auch die angespannte internationale Lage aus. Dazu kam, dass dieser Staat keineswegs über eine ethnisch homogene Bevölkerung verfügte, sondern zahlreiche Minderheiten aufwies, die es ebenfalls in die neu entstehende Ordnung zu integrieren galt. Lemberg wurde Hauptstadt der gleichnamigen Wojewodschaft. Das galizische Erbe machte sich jedoch nach wie vor bemerkbar. Im Unterschied zu den modernen, industrialisierten Gebieten in Zentralpolen und Oberschlesien oder den insgesamt wirtschaftlich besser kapitalisierten Regionen in den westlichen und zentralen Gebieten blieben die stark agrarisch geprägten östlichen und südöstlichen Landstriche, also auch die Wojewodschaft Lemberg, geprägt von wenig effizient bewirtschaftetem Großgrundbesitz, Kleingewerbe und kaum entwicklungsfähiger bäuerlicher Kleinwirtschaft. Die ökonomischen und sozialen Zustände im Südosten Polens bilden den Hintergrund für die phantasmagorischen Sujets in den literarischen Werken von Bruno Schulz, der 1892 in Drohobytsch das Licht der Welt erblickte.
In freien Berufen war es aber auch in den südöstlichen Regionen Polens möglich, einen sicheren Lebensunterhalt zu verdienen. Samuel Lem war als Arzt jedenfalls ein angesehener und wohlhabender Bürger Lembergs, der für seinen Sohn auch eine Gouvernante beschäftigen konnte. Lemberg als die damals nach der Hauptstadt Warschau und dem Industriezentrum Łódź noch vor Krakau drittgrößte polnische Stadt bot einen perspektivenreichen Rahmen. Zählte die Stadt 1921 noch 220 000 Bewohner – davon knapp 50 % Polen, 34 % Juden und 13 % Ukrainer sowie weitere ethnische Minderheiten, darunter auch Deutsche – lebten 1931, auch dank administrativer Maßnahmen, bereits über 300 000 Menschen in Lwów. Die ethnische Struktur blieb gemischt. Für das Jahr 1931 ist nachgewiesen, dass die Stadtbevölkerung aus 63,5 % Polen, 24,1 % Juden, knapp 8 % Ukrainern sowie 3,5 % Ruthenen bzw. Ostslawen, knapp 1 % Deutschen und auch polnischen Armeniern, einer der ältesten Minoritäten in Polen, bestand.
Ethnische Vielfalt charakterisierte ganz Polen nach 1918. 1921 zählte Polen knapp 27 Millionen Einwohner, davon 18 Mio. Polen (69 %), 3,7 Mio. Ukrainer (14,3 %), 2,7 Mio. Juden (7,8 %), 1,06 Mio. Weißrussen (3,9 %), 1,06 Mio. Deutsche (3,9 %), wobei insbesondere die Ukrainer und Juden ihren Siedlungsschwerpunkt im östlichen Polen hatten. Schon bald belief sich die Bevölkerungszahl auf über 30 Millionen und bildeten die Juden bis zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs knapp 10 % der Gesamtbevölkerung. Lwów wurde neben Städten wie etwa Warschau, Krakau und Wilna zu einem wichtigen Zentrum der polnischen Wissenschaft und Kultur.
Die Verhältnisse gestalteten sich in Lemberg aber keineswegs spannungsfrei. Die Ukrainer entfalteten rege politische Aktivitäten und wurden deshalb vom polnischen Staat zunehmend mit Misstrauen beachtet, ja an der Wahrnehmung der ihnen eigentlich insbesondere im Bildungs- und Kulturbereich zustehenden Minderheitenrechte gehindert. Und auch die jüdische Minderheit sah sich vor allem seit Beginn der 1930 Jahre im Gefolge der Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise und des damit einhergehenden Anstiegs von Nationalismus und Antisemitismus auch in Lemberg vermehrt Anfeindungen ausgesetzt, selbst wenn sie formalrechtlich durch die entsprechenden Verfassungsgrundlagen mit der polnischen Mehrheitsbevölkerung gleichgestellt war. 1932 kam es zu überaus gewalttätigen antijüdischen Ausschreitungen mit mehreren hundert Verletzten. Das Lemberger Polytechnikum war die erste Hochschule im Land, die 1935 in einigen ihrer Fachbereiche die sogenannten Ghettobänke einführte, also eigens im Sinne einer akademischen Apartheitsregelung für jüdische Studenten abgetrennte Sitzplätze in den Hörsälen und Unterrichtsräumen einrichtete. Bei Stanisław Lems Geburt war diese Entwicklung freilich noch nicht abzusehen.