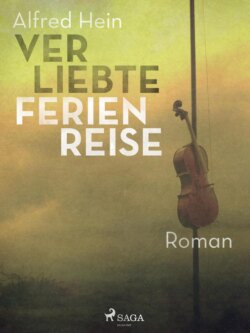Читать книгу Verliebte Ferienreise - Alfred Hein - Страница 5
III
ОглавлениеIch, der Einsamkeitsfanatiker, sitze tatsächlich im Speisesaal des »Tannhäusels« am Gemeinschaftstisch, zum erstenmal in meinem Leben. Wenn ich mit Paulamarie, meiner Frau, wanderte, dann hielten wir uns stets von diesen Schwatzrunden fern. Es war eine Art geistiger Hochmut, ich gestehe es offen. Zu Hause in Berlin konnte mir Paulamarie noch so gut zureden, es gab Tage, da hielt ich jeden Menschen, der mir über den Weg lief, für einen heimlichen Gegner meiner Pläne und Wünsche. Doch dies hat nur den Grund: jeder möchte in seiner Arbeit auf unbegrenztem Feld möglichst schnell vorankommen. So gibt es meist ganz unbewußte Ellenbogenpüffe, bis den Gemütlichsten ein Verdrießen packt, und schließlich ist er verdrießlich über seine eigene Verdrießlichkeit. Nun, da alles dies in der von der Junisonne verklärten Berglandschaft wie eine letzte Wolke verflogen ist, begreift man sich kaum. Man ist doch im Grunde ein so netter, lieber Mensch. Und auch die andern, die man in einem Berliner Restaurant mißtrauisch anstarren würde mit dem Gedanken: setzen Sie sich bloß nicht an meinen Tisch! – plötzlich sind es doch ganz zugängliche, ja reizende Wesen. Man muß eben im Menschen ein Stück Natur sehen.
Und so war es auch. Schon nach wenigen Tagen ihres von Alltagsplagen befreiten Aufenthalts benahmen sich die Tischgenossen wie die Kinder. Ich führte bald die harmlosesten und, zugegeben, auch die unwesentlichsten Gespräche über Wetter, Nachtschlaf, Liegekur, das zahme Reh und nicht zuletzt über das Essen mit ihnen. Dies alles war plötzlich so wichtig, als gäbe es keine anderen Nöte in der Welt.
Und was wurde gelacht! Über jede Kleinigkeit, minutenlang. Wenn Herr Gänsly, der nicht der Kur halber, sondern der Jagd wegen Gast des Jägerwirts war, eine Zitrone bestellte, und die Anni brachte eine Limonade, er aber brauchte Zitronenscheiben für das Schnitzel, was gab das für ein Gepruste und Gejohle! Wie die Kinder!
Natürlich beachtete man scharf auch jedes Wort, das ich an die Damen, besonders die jungen, richtete. Jetzt denken sie schon: zweifellos hat er etwas für Frau von Lähn übrig. Nein, die Nöhl ließ er ziemlich abfallen. Aber was sagen Sie zu dem plötzlich so lebhaft gewordenen Fräulein Isa Hommel, seit Herr Kreusler ihr Tischnachbar ist? Ein Künstler ist er? Geiger? Habe noch nie in Berlin etwas von ihm gehört. Wird nicht viel los sein. Ein Künstler sieht auch anders aus. (Weil ich meine braunen Haare schlicht gescheitelt trug und mich gab, wie ich war, vor allem aber nie von der Kunst sprach.) Herr Kurd Recke, der »nicht mehr ganz unbekannte« Dichter, ja, dessen Auge hat so etwas Gewisses. Und auch die Haarmähne ist des Dichters würdig. Er ist zwar ein winziger Recke und seine Sprache ist piepsig, doch sein Wesen atmet Würde aus. Aber ich?
Mir taten diese Klätschlein nicht weh. Ich stimmte in den Tischchor ein, erzählte fast gewagte Witze, über die sogar gelacht wurde, schon um die anderen, die auf der Veranda saßen, zu ärgern: seht, bei uns geht es am vergnügtesten zu! Wir genießen unsere Ferien aus dem Effeff! Auf der Veranda saßen nämlich jene »älteren Herrschaften«, die ihre Würde noch nicht ablegen konnten; sie hatten offenbar die Absicht, ihre Ferien mit vornehmer Ruhe zu »absolvieren«.
Beim dritten Mittagbrot gab es Braten von jenem Hirsch, den der Jägerwirt vor vierzehn Tagen, wie man lang und breit erzählte, auf recht abenteuerliche Weise nächtens geschossen hatte. Als es allen so ganz besonders gut schmeckte – die Bergluft bereitete ja solch lustig machenden Hunger, wie man ihn seit der Kindheit nicht mehr kannte –, »gewann ich mir«, ein richtiger Gesellschaftslöwe schon, »die Herzen im Fluge« mit dem Bericht von meiner verunglückten Reißausfahrt als »jugendlicher Held« einer Wanderbühne. Ach, waren das Zeiten! Das Stichwort für meine Bravourleistung als Held der Gesellschaft — meine Frau würde staunen, wenn sie mich sähe — gab mir diese von den Tannhäuselgästen vielbesprochene Tatsache:
Ein ziemlich berühmter Filmschauspieler war im Kurhaus abgestiegen, nur für ein paar Tage auf der Fahrt von Berlin nach Pistyan rastend. Das Ziel seiner Reise verriet, daß er an Rheuma oder Gicht leiden mußte, offensichtlich trug er auch eine Perükke, aber die Damen sahen alle in ihm nur den bezaubernden, scharmanten, fabelhaften, großartigen, entzückenden Heldenspieler. Man sprach »demzufolge« nur vom Film und immer wieder von »ihm«.
»Auch ich«, so unterbrach ich bei der Nachspeise, die sich »Frühlingscreme à la reine» nannte und auch so undefinierbar schmeckte, die Verzückungen Fräulein Nöhls; denn sie fand des Rühmens kein Ende. Hatte »er« ihr doch neulich »sein« Bild mit Autogramm gegeben. »Was wollten Sie sagen?« fragte das allzeit ein wenig neugierige Fräulein Vogel.
Wie mir das nur einfiel? Jahrelang hatte ich an meinen drolligsten Jugendstreich nicht gedacht; jetzt aber trat das Erlebte aus dem Dunkel versunkener Erinnerung wieder deutlich hervor wie ein Film, der, merkwürdig meinem heutigen Ich entrückt, abrollte. Und doch, je länger ich erzählte, desto mehr verwandelte ich mich wieder in den Lausbuben von ehedem. Warscheinlich fiel mir überhaupt wegen dieser Verwandlung die Geschichte ein. Das Schicksal spielt ja oft solchen Hokuspokus mit uns. Erst viel später merken wir‘s. Ich brauchte bloß den plötzlich erwachenden Erlebnisbildern zu folgen, da erzählte ich auch schon, mir selbst rätselhaft gesprächig:
»Ja, auch ich. Gewiß hat Sie‘s alle, meine Herren, in der Jugend holden Maientagen gelockt, es einem Karl Moor oder Prinzen von Homburg gleichzutun, ha! auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Bedoiten! Bedoi - i - tten!« höhnte ich und sah Fräulein Nöhl mit ihrem Schwarm für den »Dingsda«-Filmschauspieler spöttisch an. »Ja, auch ich bin einstens unter die Schauspieler gegangen. 1913 war‘s, einen Sommermond lang, mit neunzehn Jahren. Heimlich von Hause fort. Fast zu langweilig entfaltete sich damals das Menschenleben, ohne abenteuerliches Napoleonentum. Ein jeder kam ungefähr zu seinem täglichen Brot ohne viel Mühe, aber auch ohne viel Preis. Diese Langeweile galt es zu bannen. Man wurde leichtfertig. Man sann auf Flucht aus dem Elternhaus.«
Fräulein Vogel lächelte: »Damals war ich ganz, ganz klein, ein Baby.« Herr und Frau Pfundtner, liebe, stille Leute, schmunzelten; sie dachten wie ich: ein Baby von zehn oder zwölf Jahren? Aber dann fuhr ich, die Aufmerksamkeit »bannend«, fort:
»Schon hatte ich mir etwas Geld gespart. 35 Mark und 49 Pfennige, ich weiß es noch ganz genau. Mit Stundengeben wurde dieser Überschuß zum täglichen Geldbedarf herausgeschanzt. Denn mein Vater gab mir, dem Studenten der Philosophie — Oberlehrer sollte ich werden – die freie Station, wie man so sagte. Heimlich hatte ich jedoch längst mehr Rollen als literarische und geschichtliche Vertracktheiten studiert. Gewiß war ich schon damals musikalisch, aber diese Begabung hielt ich nur für eine angenehme Beigabe zu meinem Tragödentalent. Junghilde Kühnlieb hieß meine Lehrerin, zu der ich in den Abendstunden schlich. Ihr etwas wunderlicher Vater hatte sich als herzoglicher Hoftheaterlogenschließer den Vornamen seiner einzigen Tochter so und nicht anders erdacht. Junghilde zählte bestimmt schon an die vierzig bis fünfzig Lenze. Damals rechnete man ja noch nach Lenzen, meine Damen, nicht wie heute nach Doppeljahren.« Ein entrüstetes »Oh!« der Damen, ein beipflichtendes »Soso!« der Herren war der Lohn für dieses »Bonmot«.
»Kühnlieb! Ein entzückender Name!« sagte sehr belustigt Kurd Recke. Und reckte sich wieder, um einem Recken ähnlich zu werden; er blieb aber eine Spitzmaus mit Löwenmähne. Als ich ihn vielleicht zu prüfend betrachtete, wurde er unruhig, griff in die Westentasche und klemmte sich ein Monokel ins linke Auge. Er fixierte mich, wie man so sagt. Ich fuhr seelenruhig fort:
»Aber Kühnlieb, ja, es wäre kühn gewesen, sie noch zu lieben, an ihrem Busen zu ruhen, schweigen wir in seinem mächtigen Schatten. (Lachen erschallt. Die Verandagäste drehen sich ärgerlich nach uns um.) Junghilde Kühnlieb engagierte mich kurzerhand für ihr Ensemble, als ich ihr meine Absichten enthüllte, dem trockenen Studium um der heiteren Kunst willen zu entsagen. Es wurde heiter, sehr heiter. Ich war also engagiert, nebenbei auch als Billettverkäufer. Ich entschwand eines Tages in aller Herrgottsfrühe meinen nichtsahnenden Eltern. Wir fuhren los. Galatournee der ehemaligen Hofschauspielerin Junghilde Kühnlieb mit eigenem Ensemble. Auf dem Repertoire: »Medea« von Grillparzer. Denn Junghilde Kühnlieb war die Medea des Jahrhunderts, nach ihrer Meinung. Nur leider geneidet, verkannt, zu Unrecht beiseite geschoben. Aber vielleicht würde es diese Tournee an den Tag bringen, welch ein Genius über Junghilde Kühnlieb und ihren Getreuen schwebte, so hofften wir alle. Wir waren gebeten worden, in ..... aber nein, den Ort verschweige ich doch lieber. Sie bekommen es fertig, verehrte Zuhörer, und erkundigen sich.«
Keiner merkte, wie ich mich selbst verhöhnte. Ich beobachtete, wie sich mein Ansehen bei allen im Nu hob. Man muß eben etwas angestellt haben im Leben, man muß »angeben« können.
»Ich saß zunächst an der Kasse«, fuhr ich fort, »und zählte die, die nicht kamen und trotz unseres herrlich schönen Plakates, einer sehr realistisch ihre Kinder ermordenden Medea, vorübergingen. Aber manchmal kam doch einer und kaufte, meist Töchterschülerinnen, Dienstmädchen, vielleicht auch daraufhin deren Kavaliere: Soldaten und ein Apothekerlehrling. Das erfuhr man ja alles sofort. Und dann kam der Herr Professor Niespurzel vom Stadtgymnasium. Niespurzel sagte mir sogleich, daß, wenn ihm die Aufführung gefiele, er nicht davon abstehen werde, seinen Schülern den Besuch zu empfehlen. Er nuschelte ein paar griechische Verse aus der »Medea« des Euripides in den Bart. Ich zitierte weiter, als er stockte. Er erstaunte: »Sie sind – akademisch gebildet?« Ich nickte und wurde rot.« Empörtes Räuspern eines Studienrates auf der Veranda. Dabei meinte ich es gar nicht so, wie er meinen Bericht auffaßte. Ich blieb sachlich und fuhr fort:
»So sagte ich nur: ›Nein, nein, hab‘s nur aufgeschnappt.‹ Denn meine Eltern hatten schon die Polizei hinter mir her gehetzt, wie mein Studienfreund mir aus der Vaterstadt schrieb. Kopfschüttelnd ging Niespurzel durch die Mitte ab. Zwei Uhr mittags schloß ich die Kasse. Ich hatte Hunger, das eingenommene Geld nahm Junghilde Kühnlieb in Empfang, um – nein, nein, kein Essen! – um die Saalmiete im voraus zu begleichen. ›Fehlen noch 5 Mark sechzig‹, sagte der Wirt. Die Lisa Tuchmaier fing an zu heulen und wollte zur Mutter zurück. Herr Siegmund Kobenzl machte dauernd Organstudien: ›Babylonische Turmbauspitzengesellschaft — babylonische Turmbauspitzengesellschaft.‹ Indessen rüstete Junghilde alles für die Aufführung. Das goldene Vlies war ein Bettvorleger. Die Zaubertruhe wurde durch eine Seifenkiste dargestellt. Der Opferbecher gehörte einem Ruderklub.«
Ich nahm einen langen Schluck aus meinem Glas voll Buttermilch.
»Weiter!« flüsterte Fräulein Nöhl. »Jetzt kommt‘s sicher.«
»Was?« fragte ich spitzbübisch. »Ach, es ist so harmlos, beileibe keine Liebestragödie. Für die große Szene des Jasons brauchten wir einige Kinder. Diese Kinder! Fluch und Dank ihnen zugleich! Vor allem Ännchen Sebald, dieser – na ja. Der Abend kam, fünfundsechzig Zuschauer saßen im Saal, denn draußen lachte noch die Junisonne. Die Sache ging los. Ich spielte den Jason. Ich, Christoph von Stolzenhagen, wie mein Künstlername lautete. Alles verlief ganz gut, bis die Kinder auf die Bühne kamen, die mich umringen sollten. Natürlich war jedes Wort, das der Dichter den Kinderrollen vorschrieb, gestrichen. Sie hatten jedes einen Bonbon im Mund, damit sie stille wären. Manche trugen nichtsdestotrotz sittsam den Finger in der Nase. Nun, schließlich werden die kleinen Griechen zu ihrer Zeit diesen Brauch auch gekannt haben. Im Faltenwurf ihrer hellenischen Gewänder popelten und lutschten sie also um die Wette, während aus meinem Munde rollende, grollende Verse erschollen.«
»Das hätte ich Ihnen nie und nimmer zugetraut«, sagte Fräulein Hommel. Selbst die immer so merkwürdig melancholische Frau von Lähn schmunzelte vor sich hin.
»Als ich mich gerade zur höchsten Höhe meiner mehr hohl als wohltönenden Rhetorik emporschwang, da geschah‘s. Das Ännchen, ja, das Ännchen Sebald! Sieben Jahre war es alt und vermasselte mir die ganze Tour. Das Ännchen nahm den Finger aus der Nase, den Bonbon aus dem Mund, trat hervor aus dem Chor der Griechenkinder und sprach mit laut meine Stimme übertönender Offenherzigkeit, mich an meinem Purpur zupfend: ›Du Onkel, ich muß mal!‹ «
Für fünf Minuten stellte ich mit dieser Pointe den kurhäuslichen Filmschauspieler bei allen Tannhäusel-Insassen in den Schatten. Die Wirtsleute standen lauschend in der Tür zum Speisezimmer, auch sie hatte das Gelächter angelockt.
»Und weiter!« prustete Herr Kretschmer.
»Diese Medea-Aufführung ward keine Tragödie, wenigstens nicht für die Zuschauer, die nun das Lachen nicht mehr ließen, so wie Sie jetzt. Für mich damals wurde es eine Tragödie, ach ja. Ich begrub meiner Jugend schönsten Traum. Das Ännchen wurde zwar sofort nach seinem peinlichen Ausruf von einer im Chor mitwirkenden Buchbindersfrau hinter die Kulissen geführt. Doch ich mußte immer wieder daran denken, ich sprach meine Verse schlechter und schlechter und war alles andere als Jason, der Held. Das Publikum schrie von jetzt an jedesmal, wenn ich die Szene betrat: Wo ist das Ännchen? Ännchen Sebald! Ännchen, sag doch wieder: Du Onkel, ich muß mal!«
Die Tafelrunde lachte aus vollem Halse, genau wie damals die höhnenden Zuschauer. Aber diesmal lachte ich selbst mit.