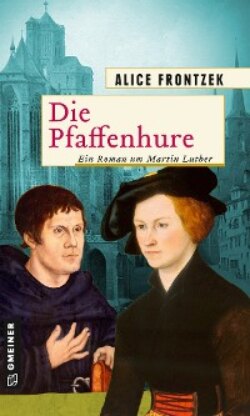Читать книгу Die Pfaffenhure - Alice Frontzek - Страница 7
Kapitel 3
Оглавление1501
Es war gerade hell geworden, und die Vögel zwitscherten um die Wette, als Hans und Martin Ludher nach einem kräftigen Frühstück mit Ei und Speck abreisefertig die kleine Kutsche bestiegen und die Pferde auf die Via Regia über Gotha nach Erfurt lenkten. Der anfänglich bewölkte Himmel wurde klar und die ersten Sonnenstrahlen wärmten die beiden Reisenden. In Gotha hielten sie unterhalb der Burg Grimmenstein, um im Ostergottesdienst in der Margarethenkirche auf dem Neumarkt zu beten, dann fuhren sie weiter nach Erfordia turrita, die türmereiche Stadt. Ihr Weg führte sie durch Wälder, vorbei an Feldern und Wiesen, durch kleinere Dörfer und entlang schmaler Flüsse und Bäche. Sie machten nur kurze Pausen, um die Pferde zu tränken und selbst einen kleinen Schluck aus ihrer ledernen Flasche oder einen Bissen ihres Brotes und Käses zu nehmen. Einmal hielten sie noch in Kirchheim, als die Wegkirche St. Laurentius zum Abendgottesdienst rief. Sie hatten von der Hohen Straße auf die Nürnberger Geleitstraße gewechselt, die sie über Rockhausen durch den Steigerwald auf die südlichen Stadttore zuführte. Es war fast acht Uhr, es dämmerte bereits, der Tag neigte sich.
Noch einen kleinen Hügel bergan. Martin konnte die Stadt noch nicht sehen, aber er konnte sie riechen. Der stechende Uringestank, der von Ferne etwas milder roch, war ihm vertraut. In Magdeburg und auch in Eisenach gab es viele Waidjunker, die aus der gelb blühenden Färberpflanze »Waid«, genauer gesagt aus ihren Blättern, mithilfe von Urin ein wertvolles, blaues Farbpulver herstellten. Erfurt war neben Toulouse in Frankreich und Urbino in Italien bekannt für den großen Waidmarkt und die einzigartige Qualität des blauen Goldes.
»Man riecht es nicht mehr, wenn man einige Zeit in der Stadt verbracht hat«, sagte der Vater, der sah, wie Martin seine Nase rümpfte.
Nun, auf der Höhe, lag sie vor ihnen. Ein Meer von Türmen. Die hohen und schlanken Spitzen der auf dem Marienhügel und dem Petersberg gelegenen Kirchen grüßten zu ihnen herüber, und das Abendgeläut stimmte sie andächtig. Die letzten Sonnenstrahlen reflektierten auf den blanken Metallplatten, mit denen die Türme von St. Peter gedeckt waren. Beim Anblick des Sibyllentürmchens – eine Art Betsäule, die fromme Bürger dort an der Straße errichtet hatten – dankten Hans und Martin Gott für den gnädigen Reiseschutz. Rauch stieg aus den Schornsteinen empor. Vor der Stadtmauer sah man noch vereinzelt Fuhrwerke ein- und ausfahren.
»Das Tor dort vorne rechts scheint noch geöffnet. Auch hier ist um sechs Uhr Toresschluss an den Nebentoren. Das muss ein Haupttor sein. Auf geht’s!«
Ihr Wagen setzte sich wieder in Bewegung und kam beim Acht-Uhr-Glockenschlag vor dem westlichen Tor zum Stehen. Der Torwächter machte sich schon von innen an den Riegeln zu schaffen.
»Wächter, lass uns noch passieren! Es ist Ostern – die Messe hat uns aufgehalten!«, rief Hans.
»Ist in Ordnung. Ab sechs ist die Gebühr fällig: zwei Kreuzer. Macht vier für Euch! Wo müsst Ihr hin?«
»Uns wurde die Ausspanne zum Rebstock in der Futterstraße empfohlen.«
»Ja, Futterstraße ist auf jeden Fall gut. Ihr kennt den Weg? Frohe Ostern!«
Hans hatte genickt, gab dem Mann ein paar Münzen, wünschte einen guten Abend sowie ein gesegnetes Osterfest, und dann kamen sie auf einer gut gepflasterten Straße in die Stadt, fuhren an der Reglerkirche der Augustinerchorherren vorbei, über den Waidanger nach rechts Richtung Kaufmannskirche mit ihren zwei Türmen, dann ein Stück durch die Johannesstraße, die von großen Waidhändler- und Brauhöfen gesäumt war, und schließlich links in die Futterstraße.
Sie kehrten im Haus zum Großen und Kleinen Rebstock der Familie des Otto Ziegler ein. Es war ein stattliches Haus, das die Zieglers vor fünfzig Jahren gebaut hatten. Otto war alt, aber sein Sohn führte die Geschäfte der Brauerei, des Getreidehandels, der Ausspanne und des Gasthauses fort. Martin und Hans waren gleichermaßen beeindruckt, obwohl das Anwesen ihnen von einem Freund aus Mansfeld empfohlen und bereits ausführlich beschrieben worden war. Da waren die achtzehn Zinnen, die in den Farben der achtzehn Königreiche angemalt waren, die Otto während seiner ausgedehnten Reisen besucht hatte. Es waren dies das Römische Königreich, Kroatien, Sizilien, Frankreich, das Reich des Priesters Johannis, Dänemark, Böhmen, Dalmatien, Cypern, Portugal, England, Schweden, Ungarn, Neapel, Armenien, Mavarra, Schottland und Polen. Rechts, in Höhe des ersten Geschosses, prangte das Familienwappen: ein roter Hirschkopf im roten Felde.
Den Hausnamen hatte der frühere Ratsherr Otto gewählt, nachdem er aus dem Heiligen Land einen Rebstock mitgebracht und bei sich eingepflanzt hatte. Angeblich ein Abkömmling der wunderbaren Reben des Landes Kanaan. Er stand noch immer im Innenhof und trug jeden Herbst reichlich Trauben.
Hans klopfte an der großen Tür des Hauses. Otto der Jüngere öffnete und sagte, er werde das Tor öffnen lassen und bitte sie, zunächst Wagen und Pferde hineinzuführen, dann könnten sie vom Hof aus ins Haus kommen.
Das weite, hohe Tor wurde von einem Stallknecht nach innen aufgezogen. Er übernahm auch gleich die Zügel und wies einen Stallburschen an, die Pferde von der Kutsche loszumachen und in den Stall zu führen.
Von der Straße aus war die Größe des Innenhofes nicht zu erahnen gewesen. Es gab dort auf einer Seite fünf Stalltore, die zu den Pferdeständen führten, auf der anderen Seite befand sich die Remise. Der vordere Hofteil bot Platz für den Ausschank in der Zeit, in der der Brauer jeweils für vierzehn Tage sein Bier verkaufen konnte, und ganz hinten gab es weitere Anbauten, vermutlich ein Brauhaus und eine Werkstatt.
Der Stallknecht zeigte ihnen den Eingang in das Gasthaus.
»Nochmals – guten Abend und frohe Ostern! Der Sohn soll wohl in Erfurt studieren?«, riet Ziegler richtig. Er wusste, wann die Väter ihre Söhne zur Intitulation brachten.
»Frohe Ostern. Ja, nach der Lateinschule das Studium! Kommen viele angehende Studenten zu Euch?«, fragte Hans.
»Lasst uns an die neunzehntausend Erfurter sein, davon gibt es fast achthundert Geistliche und immerhin fünfhundert Studenten«, berichtete der Wirt stolz, der er sich als Mitglied des Rates natürlich bestens auskannte. »Jedes Jahr werden es mehr. Hat einen guten Ruf, unsere Universität. Gratuliere! Mach was draus, Junge!«, wandte er sich an Martin. »Wie lange bleibt Ihr?«
»Ich werde übermorgen abreisen, und Martin zieht bereits morgen in eine der Bursen.«
»Ihr seid woher?«
»Aus Mansfeld.«
»Dann müsste er eigentlich in die Georgenburse für sächsische und thüringische Studenten. Augustinerstraße zwischen Georgskirche und Nikolaikirche, gleich bei der Lehmannsbrücke. Der Fluss fließt direkt am Hof vorbei. Die Lehmannsbrücke ist eine Marktbrücke. Da ist immer was los. Viel zu sehen. Ein Stückchen weiter ist das Augustinerkloster. Wird sicher eine schöne Zeit. Auch ich habe an der Universität studiert, ohne das Bakkalaureats-Examen. Die Arbeit hier musste gemacht werden.« Er lachte etwas wehmütig. Dann gab er ihnen einen großen eisernen Schlüssel für die Kammer mit den zwei Betten. »In der Gaststube bekommt Ihr noch bis neun Uhr eine warme Suppe und Bier.«
Hans und Martin bedankten sich, nahmen ihr Gepäck und gingen in die Kammer. Sie lag im ersten Stock. Die Decke des Raumes hatte bemalte Balken, zwischen den beiden Betten stand ein Tisch mit zwei Stühlen, und die Betten selbst hatten blaue Vorhänge, die an den Ecken zurückgebunden waren. Die Kissen und Zudecken – ebenfalls blau mit weißen Blaudruckmustern – waren dick mit Daunen befüllt. Ein kleiner Ofen stand neben der Tür. Ziegler hatte gesagt, er würde gleich nach der Magd schicken, die den Ofen anfeuern und heiße Bettpfannen bringen würde. Die Aprilnächte wären noch recht kalt. Zufrieden, heile angelangt und so gut untergekommen zu sein, wollten Martin und sein Vater nur noch kurz in der Gaststube sitzen und etwas zu sich nehmen.
In der Stube gab es fünf große Holztische, die bis auf einen auch alle besetzt waren. Als sie saßen und sich umblickten, sahen sie zur Rechten zwei dunkelhäutige Männer mit schwarzen Schnurrbärten und roten Gewändern. Ganz in der Ecke saß ein Afrikaner mit einem Juden am Tisch.
»Ich hatte gehört, Erfurt hätte keine jüdischen Bürger mehr«, wunderte sich Hans. Er wusste, dass die Juden aus Mansfeld einst gekommen waren, weil sie aus Erfurt vor nunmehr siebenundvierzig Jahren vertrieben worden waren. Er hatte schon überlegt, ob er bei einem von ihnen einen Kredit für seine erste eigene Hütte aufnehmen sollte.
»Bürger, Vater, Bürger. Das heißt doch nicht, dass sie als durchreisende Händler nicht in Erfurt sind.«
»Hier geht’s ja bunt zu. Na ja, ist halt ein Handelsort mit Stapelrecht. Hier kommen alle durch, die von West nach Ost, von Nord nach Süd wollen. Dann packen sie drei Tage hier aus, bevor sie weiterfahren können. Vielleicht musst du mir irgendwann einmal etwas besorgen, das es nur hier gibt. Dienstagfrüh sehen wir uns zusammen noch mal um. So viel Zeit habe ich, bevor ich fahre.«
Die Suppe war kräftig, das Bier süffig. Beim Neun-Uhr-Glockenschlag wurden ihre Krüge eingesammelt, und sie gingen in ihre Kammer, die nun behaglich warm war. Endlich am Ziel, fielen sie schnell in einen tiefen Schlaf und hörten noch nicht einmal mehr den Nachtwächter, der um zehn seine Runden drehte.
Am Ostermontag, so stand es in dem Brief, den Hans vor einigen Wochen von der Universität erhalten hatte, war für alle neuen Studenten die Ostermontagsmesse bereits Teil ihrer Einschreibung. Sie machten sich nach dem Frühstück zu Fuß auf den Weg zur Michaeliskirche. Martin blickte immer wieder staunend umher, so sehr beeindruckten ihn das bunte Treiben und die vielen Menschen auf den Straßen. Sie hatten es nicht weit. Nur die Futterstraße entlang bis auf den Wenigemarkt, dann durch einen Durchgang im Turm der Ägidienkirche über die Krämerbrücke mit ihren vielen Läden, am anderen Ende durch das Tor im Kirchenschiff der Benediktskirche wieder herunter und gleich die zweite rechts in die Michaelisstraße. Dort an stattlichen Häusern und der Großen Waage vorbei, dann rechts hinter der Dreifaltigkeitskapelle mit dem Erker zur Michaeliskirche. Sie wussten, dass sie richtig waren, denn gegenüber befand sich, nicht zu übersehen, das Collegium Maius, das große Hauptgebäude der ehrwürdigen Universität zu Erfurt. Studenten und Professoren in ihren Talaren gingen zwischen den beiden Gebäuden hin und her.
»Komm, wir fragen jemanden, ob wir dich irgendwo anmelden müssen«, sagte Hans.
Sie gingen auf einen etwas älteren Mann mit rot-weißem Talar zu, der dem Lehrkörper angehören musste.
»Verzeiht. Dies ist mein Sohn Martin, der sich heute zum Studium einschreiben möchte. Wo soll er sich melden?«
»Oh, seid willkommen!« Der Mann reichte beiden die Hand. »Sucht Euch einen Platz in der Kirche, alles Weitere wird dort angesagt, die Studenten, die wir erwarten, werden aufgerufen und dann auf spezielle Plätze verwiesen. Schön, es freut mich, Martin, dass Ihr zu uns kommen wollt.« Er nickte höflich und verschwand eiligen Schrittes in der Kirche. Hans und Martin folgten ihm.
Drinnen herrschte ein aufgeregtes Hin und Her, jeder hatte wohl noch Verschiedenes zu erledigen. Als Gast konnte Martin dem Treiben noch recht entspannt zusehen. Das würde im nächsten Jahr sicher schon anders sein. Es stellten sich noch andere Vater-Sohn-Gespanne neben sie, bei manchen war auch die Mutter dabei. Martin schaute sich um.
Die Kirche war nicht groß. Es gab eine Empore. Dort oben standen die älteren Studenten und blickten hinab auf die Neuankömmlinge. Über ihnen befand sich die Orgel, Grabplatten bedeckten den gesamten Boden. Auf der gegenüberliegenden Seite des Eingangs gab es eine große Tür, die noch offen stand und den Blick in einen Kirchhof freigab. Martin konnte etwas Gras und einige Grabkreuze erkennen. Es gab Bänke an den Seiten, auf denen nun einige Magister und Professoren Platz nahmen. Die Reihen mit den Kniebänken um sie herum füllten sich, und die Glocken begannen zu läuten. Der Chorbereich lag eine Stufe erhöht. Darauf stand der Altartisch mit dem Flügelaltarbild, das in der Mitte den Heiligen Levi zeigte. Licht fiel durch die Fenster auf die mittleren Reihen.
Die Letzten hatten sich nach dem stillen Gebet von ihren Knien erhoben. Jeder versuchte nun, ruhig zu stehen. Der Priester der Kirche trat nach vorne, begrüßte den Rektor, die Professoren und Doktoren, die Magister, die Bakkalare, Studenten, Neuankömmlinge und schließlich die Gäste und Erfurter. Er wünschte allen gesegnete Ostern und begann dann seinen Gottesdienst mit den Worten: »Der Herr der Kirche spricht: Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.« Es folgten die Ostergeschichte, Gebete, die Predigt. Martin hörte nur mit halbem Ohr zu. Er war damit beschäftigt, sich der Reihe nach alle Anwesenden in seinem Blickfeld anzusehen.
Am Ende übergab der Geistliche dem Rektor und Priester, der bis vor Kurzem noch das Pfarramt an der St. Andreaskirche innehatte, das Wort. Er hieß Jodokus Trutvetter. Martin hatte bereits gewusst, dass er ihn hier wiedersehen würde. Er war sein Lateinlehrer in Eisenach gewesen und hatte ihm die Universität von Erfurt ans Herz gelegt. Trutvetters Blick schweifte über die neue Studentenschar. Er erkannte Martin, nickte ihm ganz leicht mit einem anerkennenden Lächeln zu und richtete seine Augen dann zurück in die Menge. Martin schätzte ihn auf etwa vierzig Jahre, ungefähr so alt wie sein Vater, wenngleich bei ihm nicht die äußerlichen Spuren harter Arbeit zu sehen waren. Er trug einen Talar, eine goldene Amtskette und übergab jetzt das Universitätszepter einem älteren Studenten, der unauffällig hinter ihm stand und assistierte.
Trutvetter stellte sich vor. »Ich komme aus Eisenach.«
Hier stupste Hans seinen Sohn mit dem Ellbogen und schaute ihn bedeutsam an.
»Fünfundzwanzig Jahre bin ich nun schon mit Unterbrechung hier, zunächst als Student, nun als Rektor. Ich bin sowohl in der Theologie zu Hause als auch in der Philosophie, und künftig ebenso in den Rechtswissenschaften. Damit will ich sagen, dass ich heute Eure Fragen beantworten und Sorgen und Zweifel ausräumen kann. Ihr alle wisst, es ist nicht nur Ostern, sondern es sind auch die neuen Studenten unter uns, die am 23. April ihr Studium beginnen werden und damit ihren neuen Lebensabschnitt, dazu Eure Väter, Mütter oder gar Geschwister. Ein ganz besonderer Tag also. Alle Neuankömmlinge werden nun von mir aufgerufen. Ich bitte die Anwesenden, kurz die Hand zu heben. Wir gehen anschließend hinüber ins Auditorium, wo Ihr die ersten Einweisungen bekommt und Eure Namen aufgeschrieben werden. Die Zeugnisse der Lateinschule sind vorzuweisen. Wer angemeldet ist, begibt sich zum Kassenbüro, um die Gebühr zu entrichten.« Nun studierte Trutvetter die Liste, die ihm der Student gerade gereicht hatte. »So, schauen wir mal: Eustachius Koler aus Kaufbeuren … Henricus Stupher aus Würzburg … Johannes Tendalen aus Hamburg … Georgius Setznaghel aus Salzburg … Andreas Schöneberg aus Elbingh … Martinus Ludher aus Mansfeld … Henricus Gran aus Brunswick … Johannes Botz aus Frankfurt … Alexis Schmied aus Mansfeld …«
Martin und sein Vater staunten über den Wohlklang der lateinisierten Namen und über die weiten Wege, die einige auf sich genommen hatten, um an der Erfurter Universität zu studieren. Dann schauten sie sich überrascht an. Alexis aus Mansfeld? Den kannten sie gar nicht.
»Ich bitte Euch nun, nach vorne zu kommen«, sagte Trutvetter.
Martin tat, wie ihm und den anderen Neulingen geheißen, und überlegte dabei, wer von den Übrigen nun wohl dieser Alexis war.
Im Chor mit dem Priester beendete Jodokus Trutvetter den Gottesdienst mit den Worten: »Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns gesegnet hat mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern durch Christus. Herrgott, himmlischer Vater, wir danken Dir, dass Du Dich uns gegeben hast in Deinem Wort und Sakrament, und dass auch wir mit Dir reden durften in Gebet und Lobgesang. Amen.«
Dann verließen die neuen Studenten, angeführt durch den Rektor, die Kirche. Als Martin an seinem Vater vorbeilief, schauten sie sich an. Martin war stolz – sein Vater schenkte ihm einen ernsten Blick, der dem Sohn Respekt zollte, und nickte ihm anerkennend zu.
Vor dem Collegium Maius übergab Trutvetter sie einem älteren Studenten, der sich als Johannes Lang vorstellte und sie durch das große Eingangstor hinein in den riesigen, roségetünchten Steinbau führte. Über eine breite Treppe gelangten sie in die Eingangshalle, von der zwei Flure nach rechts und links abgingen und weitere Treppen nach unten und in die oberen Etagen führten. Johannes Lang schritt voran zum rechten Flur, und dort klopfte er wiederum rechts an eine Tür, die bereits leicht geöffnet war.
»Immer herein mit den neuen Scholaren!« Ein freundlich dreinblickender Mann stand auf und stellte sich in den Türrahmen. »Willkommen an unserer Universität! Ich heiße Walter Schreiber und bin hier für fast alle Verwaltungsaufgaben zuständig. Die Intitulationsfeier und der Eintrag in die Universitätsmatrikel finden am Sonntag, 2. Mai, statt, einen Tag nach der offiziellen Ernennung des neuen Rektors. Heute nehme ich Euch auf, dann erkläre ich Euch, wo Ihr was findet und wo Ihr schlafen werdet. Kommt näher, nicht so schüchtern. Ihr werdet in alphabetischer Reihenfolge aufgerufen.«
Während Walter der Reihe nach Namen und die Herkunft der Neuankömmlinge aufschrieb und einen Zettel für das Kassenbüro und einen mit Zimmer-, Bett- und Schreibtischnummer ausgab, kam Martin mit den anderen ein wenig ins Gespräch. Er tauschte sich mit ihnen darüber aus, seit wann sie in Erfurt wären, mit wem sie gekommen seien, wo sie übernachtet hätten. Dann musste er ins Kassenbüro und die Intitulationsgebühr von dreißig alten Groschen in voller Höhe zahlen. Der für ihn zuständige Taxator, Hermann Serges von Dorsten, hatte ihn als wohlhabend eingeschätzt. Er nannte Martin auch die Burse, in die er bald ziehen würde. Es war die Georgenburse, die schon ihr Wirt ihnen vorhergesagt hatte. Nachdem die Formalitäten erledigt waren, wurden alle neuen Scholaren wieder von Johannes Lang empfangen, der sie durch das Gebäude und zu ihren Schlafplätzen führen sollte.
»Hier, im Großen Kolleg – im Collegium Maius –, befinden sich die Hörsäle der philosophischen Fakultät. Das Gelände ist riesig. Es gibt hier zehn Häuser, zwölf Kammern, das Pädagogium. Im Pädagogium werdet Ihr auf das Universitätsstudium vorbereitet. Es liegt im Hof. Daneben fließt der Fluss. Die Häuser zur Arche Noä und zum Kleinen Drachen sind Gästehäuser. Der städtische Rat ernennt aus der Reihe der Magister acht Kollegiaten, die hier frei wohnen. Es handelt sich um ein Ehrenamt auf Lebenszeit. Sie führen die Aufsicht über die Mitbewohner, die Scholaren und Bakkalare. Die Oberaufsicht führt der auf ein Jahr gewählte Probst. Wir nennen ihn ›praepositus‹. Dann gibt es noch eine Bibliothek, ihr steht der ›librarius‹ vor. Ihr steht unter direkter Aufsicht der ›rectores bursae‹. Für das leibliche Wohl sorgt der Bierprobst, der ›praepositus cervisiae‹, der den Kellermeister beaufsichtigt und die Bierkasse führt. Den ›coquus‹, den Koch, findet man in der Küche. Ihr merkt schon, hier wird Latein gesprochen! Ich muss sicher nicht erwähnen, dass nicht gerauft werden darf, dass Unzucht mit Aus- und Einsteigern zu vermeiden ist, ihr zu Hause schlaft und keine unzüchtigen Frauen einführt. Im Sommer werden die Türen und Fenster der Bursen um halb neun, im Winter um acht Uhr abends verschlossen. Ordentliche Kleidung wird erwartet, genauso Gehorsam gegenüber Älteren, gutes Benehmen, Ruhe und pflegliche Behandlung und Nutzung der Universitätsräume, Möbel und Gegenstände.«
Dann führte Johannes sie zu den Kammern. »Kammer drei: Martin Ludher und Alexander Schmied!«
Die beiden Scholaren betraten ihre kleine Stube in der Burse zur Himmelspforte, nur wenige Schritte vom Hauptgebäude entfernt. Hier sollten sie erst einmal ablegen. Danach waren sie frei, sich alles anzuschauen, ihre Reisebegleitung zu verabschieden und zu tun, was sie mochten. Nach der Sechs-Uhr-Andacht in der Michaeliskirche war eine kleine Runde durch die Stadt für die Neuankömmlinge zum Kennenlernen vorgesehen.
Martin schaute auf die zwei Betten, dann auf seinen Zettel, woraufhin er die dort angegebene Nummer auf den Möbeln suchte. »III.II« – er fand die römische Zahl auf einer kleinen Schiefertafel, die an einer Hakenleiste über dem linken Bett hing. Unter den winzigen Fenstern zwischen den zwei Betten stand ein Tisch. Zwischen Bett und Tisch jeweils ein Stuhl. Den Tisch mussten sie sich also teilen. Neben der Tür befand sich ein größerer Schrank, dessen rechte Hälfte Martin für seine Sachen beanspruchte. Die Betten hatten an ihrer vorderen Längsseite einen Vorhang. Auch die lange Seite des Bettes konnte zugezogen werden. Die Stoffe waren blau. Hätte Martin nicht gewusst, dass das Stadtwappen rot war mit einem silbernen Rad, er hätte geglaubt, Blau wäre die offizielle Farbe der Stadt.
»Na ja, ist doch ganz ordentlich«, fing er das Gespräch an. »Was denkst du?«
Alexander nickte. »Packen wir aus, oder was hast du vor?«
»Mein Vater wartet sicher irgendwo draußen auf mich. Ich will ihn noch verabschieden. Später richte ich mich ein. Dann sehen wir uns zur Erfurt-Runde, ja? Freut mich, dich als Zimmerkameraden zu haben.« Martin reichte Alexander die Hand.
Der lächelte, erwiderte seinen Händedruck und sagte: »Nenn mich Alexis. Meine Freunde sagen Alex zu mir, und da wir uns hier ja künftig in den alten Sprachen verständigen …« Er zog die Augenbrauen hoch.
»Martinus, angenehm«, nickte Martin. Sie mussten lachen.
Sein Vater wartete draußen vor dem Eingang der Michaeliskirche.
»Ah, da bist du ja«, freute er sich, seinen Sohn wiederzusehen. »Und? Was habt ihr bisher gemacht?«
Martin stillte Hans’ Neugier und berichtete von seinen ersten Eindrücken. Dabei liefen die Männer in Richtung Fischmarkt, wo Trauben von Leuten zusammenstanden. Um den Brunnen tanzten ein paar kleine Kinder im Kreis, deren Mütter sich mit Wasser gefüllten Holzbottichen in der Hand unterhielten. Die Häuser ringsum waren österlich geschmückt. An den Türen waren Kränze aus Weidenzweigen und bemalten Eiern befestigt. Kätzchensträuße schmückten Fenster, Tore und Zäune. Kruzifixe wurden in den verschiedensten Größen und Ausführungen aufgestellt. Am Platz gab es auch ein großes Gasthaus. »Ratskeller« hieß es. Zwei Männer in dunkler Amtskleidung betraten es, wobei sie sich angeregt unterhielten und der eine dem anderen die Tür aufhielt und ihm höflich den Vortritt ließ. Ein alter Mann mit Handwagen transportierte ein kleines Bierfass, das er sich bei einem Brauhof hatte abfüllen lassen. Hühner liefen gackernd vor einer Kutsche mit zwei schweren Arbeitsgäulen davon. Sie blieben aber in der Nähe und flatterten erneut auf den Platz, als die Kutsche vorübergefahren war. Eins der Tiere hatte einen Berg Pferdeäpfel hinterlassen, an dem sie nun pickten. Neben dem Brunnen entrollte eine ältere Frau ein rechteckiges dünnes Leder, in welches getrocknete Kräutersträuße eingewickelt waren, die sie jetzt darauf arrangierte. Hans Ludher trat näher. Er wollte Grete etwas aus Erfurt mitbringen. Vielleicht ein besonderes Kraut als Zutat zum Kochen.
»Was könnt Ihr empfehlen?«, sprach er die Frau an.
»Das kommt darauf an. Als Heilkraut oder Gewürz? Zum Kochen oder Brauen?«
»Einfach etwas, das meine Frau in Mansfeld nicht bekommt. Gibt es etwas Besonderes?«
»Vielleicht habt Ihr schon davon gehört, dass es hier in Erfurt den besten Waid gibt. Er ist nicht nur zum Färben gut. Er beruhigt auch den Magen.« Sie überreichte ihm einen Strauß getrockneter Waidblätter. »Gießt einfach heißes Wasser darüber und trinkt täglich von dem Aufguss!«
Martins Vater war einverstanden und bezahlte. Waid zum Trinken, das war ihm neu, und der Strauß sah gut aus. So große Blätter hatte er zuvor noch nirgends gesehen.
Sie liefen durch die Schlössergasse, beobachteten von der Brücke aus, wie das Mühlrad gleichmäßig ins Wasser stach, und drehten eine kleine Runde vorbei an der Barfüßerkirche, gingen weiter vorne links in Richtung Wigbertikirche, bogen am Haus zum Stolzen Knecht rechts ab und liefen bis zur Vitikirche geradeaus. Dann gingen sie über die lange Brücke und orientierten sich an den Türmen des Domes, der die Dächer der kleinen Häuschen überragte. Am Platz vor dem Dom angekommen, sahen sie sich erneut in Ruhe um. Hier gab es eine Apotheke, mehrere Gasthäuser und den großen Markt.
»Vater, gehen wir zurück. Wir machen gleich nach der Andacht noch einen Stadtrundgang mit den Studenten. Um drei muss ich wieder an der Michaeliskirche sein.«
»Geh nur schon vor, Martin. Ich finde den Weg zurück. Bin ja nicht zum ersten Mal hier. Ich wünsche dir eine erste gute Nacht alleine.«
Martin winkte seinem Vater zu und lief zügig die Breite Gasse bis zur Allerheiligenkirche hinunter, wo er dann zur Universität abbog. Die Erfurter Glocken schlugen gerade drei.
Nach der Andacht in der Michaelisstraße trafen sich die neuen Scholaren an der Ecke zur Studentengasse erneut. Ein älterer Mann stellte sich ihnen als Nikolaus Marschalk vor. Magister der artistischen Fakultät und Bakkalar der Jurisprudenz. Besitzer einer Druckerei seit diesem Jahr.
»Ich zeige Euch heute, wo sich hier im lateinischen Viertel alles Wichtige befindet. Ich verdinge mich auch als Stadtschreiber in Erfurt und freue mich jedes Mal, die Neuen in Erstaunen zu versetzen.«
Martin hatte sich schon gewundert, weil Nikolaus ihm für einen Studenten recht alt erschienen war, aber das erklärte es natürlich.
»Die Kirche habt Ihr bereits kennengelernt. Sie dient uns als Auditorium Maximum und Aula. Wenn Ihr nun dorthin schaut, dem großen Kolleg gegenüber, dann seht Ihr die Burse zum weißen Rad, Bursa Albae Rotae. An das Collegium Maius angrenzend hier um die Ecke in der Studentengasse befindet sich das sogenannte Domus nova, ein Kolleg für schlesische Studenten.«
Nikolaus Marschalk gab einen schnellen Schritt vor und kümmerte sich nicht sonderlich darum, ob ihm alle folgen konnten. Er zeigte im Vorbeigehen am Fluss auf kleine Fachwerkhäuser auf der linken Seite.
»Hier ist die Bursa pauperum, die Armenburse, für Studenten, deren Eltern sich das Studium für ihre Söhne nicht leisten können. Dort kommt die Horngasse.« Sie bogen links ab und überquerten eine kleine Brücke über einen der beiden Flussarme.
»Dies hier rechts ist das Universitätshospital. Alles am Fluss. Dort hinten die Krämerbrücke. Aber gehen wir wieder zurück.«
Martin gefiel, was er sah, wenngleich dieser Nikolaus Marschalk alle Sehenswürdigkeiten sehr schnell passiert hatte. Ihr kleiner Tross machte eine Kehrtwende und ging zurück in Richtung Hauptgebäude. Sie liefen nun an der Michaeliskirche vorbei in die gegenüberliegende Allerheiligenstraße.
»Dies ist eine unserer Druckereien. Das Haus zum Goldenen Stern. Hier wird mit beweglichen Lettern gedruckt. Ein ehemaliger Student unserer Alma Mater, Johannes Gensfleisch – auch Johannes Gutenberg genannt –, hat diese neuartige Druckmethode erfunden. Genial! Die Buchstaben werden einmal gesetzt, das Ganze mit Farbe bestrichen, und so lassen sich Schriftstücke beliebig vervielfältigen. Hier, daneben, die Burse der niedersächsischen Studenten.«
Martin las die lateinische Inschrift für Niedersachsen, während er von ihrem Pulk weitergedrängt wurde.
»Hier links geht es in die Waagegasse, das Speicherviertel für die durchreisenden Händler«, zeigte Nikolaus in eine schmale Gasse, die von hohen Speicherhäusern gesäumt war. Eins davon sah aus, als hätte es kein Dach, denn ebendieses war schmal, hoch und spitz an der Straßenflucht ausgerichtet, während die Hausfront und die Toreinfahrt so schräg gebaut waren, dass ein Fuhrwerk bequem frontal einfahren konnte. Vor der städtischen Waage standen Pferdefuhrwerke mit ihren Händlern, die ihre Waren wiegen lassen und die entsprechenden Steuern zahlen mussten.
»Und dort rechts, das Haus zur Windmühle, gehört dem Waidhändler Gerstenberg«, lenkte er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer auf die andere Seite. »Gegenüber das Haus zur Engelsburg mit seinen Nebengebäuden. Die Engelsburg beherbergte einst das kleine Hospital zur Elendenburg, zu dem die angrenzende Hospitalskirche Allerheiligen gehörte. Daneben einige Wohnhäuser. Der Turm der Allerheiligenkirche dient als einer von vier Wachtürmen, von denen aus die Stadt überblickt wird und die Türmer ins Horn blasen, sollte es irgendwo brennen oder Ähnliches.« Hier änderte er wieder die Richtung.
»Gehen wir durch die Waagegasse zurück und schließen die Runde. Am Kratzstein vorbei, hier rechts, befindet sich ein großer Speicher, der ein wenig an eine Kirche erinnert. Das war die jüdische Synagoge, die beschädigt wurde, als die Bürger sich an den Juden für die Pest rächten, die vor 150 Jahren über das Land zog. Das war dreizehnhundertneunundvierzig. Die Juden hatten die Brunnen vergiftet.«
Sie traten aus der Gasse hinaus.
»Jetzt sind wir wieder in der Michaelisstraße. Rechts seht Ihr den Platz vor der Benediktskirche und das große steinerne Handelshaus. Wir gehen aber gleich wieder links herum. Dort gegenüber ist die Druckerei von Matthes Maler und Wolfgang Schenk, Freunde von mir. Das Haus zum Schwarzen Horn.«
Dann wandte er sich nach links und fuhr mit der Führung fort.
»Hier das Collegium Amplonianum, Studienort der Mediziner.« Er eilte weiter und stellte sich wieder vor das Hauptgebäude der Universität. »Links neben dem Collegium Maius, das ist das Haus zur Arche Noä mit der Werkstatt von Melchior Sachse. Dahinter befindet sich das Haus zum Kleinen Drachen, das das Große Kolleg zu Wohnzwecken angemietet hat. Das kennt Ihr ja – das Gästehaus.« Dann wies er mit der Hand in die gegenüberliegende Richtung. »Ach so, und dort hinten rechts, in der Pergamentergasse, fertigen die Pergamenter den unentbehrlichen Schreibstoff – sie bekommen ihr Material von den vielen Papiermühlen der Stadt.« Er deutete mit nach oben offener Handfläche die Richtung der Gasse an, wendete sich dann den neuen Studenten zu, öffnete beide Arme in ihre Richtung und schloss seinen Vortrag. »Das ist also das lateinische Viertel. Meinen Lieblingsstadtteil seht ihr ein anderes Mal. Wir Juristen halten uns westlich der Marienkirche auf – im Mainzerhofviertel. Dort befinden sich das Collegium Marianum und die Schola iuristarum, in der die juristischen Vorlesungen stattfinden. Die Theologen findet Ihr im Auditorium coelicum über dem Ostflügel des Kreuzganges der Marienkirche. Vielleicht zeige ich es Euch bei Gelegenheit.«
Die Neuen klatschten und Marschalk deutete mit dem Kopf eine Verbeugung an.
Er lieferte die neuen Studenten wieder am Hauptgebäude ab, wo sie von Jodokus Trutvetter in ihren freien Abend entlassen wurden.
»Um acht Uhr müsst Ihr eure Kammern beziehen, Ende der Woche übersiedelt jeder in seine Burse. In ein paar Tagen werdet Ihr Euch offiziell in die Matrikel eintragen und Euren Eid leisten. Viele werden heute noch von ihren mitgereisten Eltern erwartet, deshalb wünsche ich allen noch einen schönen Ausklang.«
Die Gruppe löste sich auf, und Trutvetter begrüßte seinen ehemaligen Schüler noch einmal persönlich, als zeitgleich Martins Vater die Michaelisstraße hinaufkam, um sich mit seinem Sohn zu treffen.
»Eine gute Wahl, Martin. Ich gratuliere Euch, Herr Ludher. Martin war ein fleißiger Schüler. Wenn er so weitermacht, wird aus ihm ein guter Student.«
Hans deutete mit dem Kopf eine Verbeugung an und bedankte sich für diese positive Einschätzung.
Als der neue Rektor zurück in die Universität ging, die zugleich die philosophische Fakultät war, spazierten Sohn und Vater zum Rathaus und zurück über die Stadtmünze durch die Durchfahrt des Warenhauses am Benediktsplatz, über den Steg entlang der Krämerbrücke in die Futterstraße, wo beide noch ein Bier tranken.
»Dein Pferd bleibt hier stehen. Meins kann den Wagen alleine ziehen, nachdem es nur noch mich und weniger Gepäck fahren muss. Otto Ziegler hat mir einen guten Preis gemacht für Futter und Stalldienst. Du musst den Rappen nur regelmäßig bewegen kommen. Die Weiden liegen vor den Stadttoren, dort wird es den Sommer über stehen. Na ja, mit Pferden kennst du dich ja aus. Morgen gehen wir noch mal über den Markt, ja?«
»Ja, Vater. Danke für alles. Wir sehen uns morgen!«
Martin winkte Hans nach und musste sich anschließend erst einmal auf eine Holzbank auf dem Wenigemarkt setzen, auf dem die Händler längst schon ihre Fleisch- und Brotbänke verschlossen hatten. Eine Wolke schob sich vor die Sonne, die sich allmählich zu senken begann, und er fröstelte. Erschöpfung machte sich nach all der Aufregung und den vielen Eindrücken breit.
Erfurt ist eine Schmalzgrube, dachte er. Wenn sie wegbrennen würde, müsste an selber Stelle sofort wieder eine Stadt entstehen.
Dies war nun sein neues Zuhause. Gegenüber des Platzes lag die Kürschnergasse. Hier roch es beißend nach Gerblösung. Die Ledermacher und Schuster hatten hinter ihren Häusern Stege über dem Fluss, von denen aus sie ihre Felle wuschen, bevor sie sie weiterverarbeiteten. Viele Menschen liefen an Martin vorbei, trugen Kiepen oder Körbe, zogen Handwagen oder Lasttiere hinter sich her oder ritten mit bepackten Satteltaschen vorüber. Fensterläden, auf denen Waren ausgelegt waren, wurden abgeräumt und geschlossen, in Werkstätten verklangen die Geräusche von Hämmern, Sägen und Hobeln. Es roch nach Waid oder Urin, nach Kot und nach Vieh. In den schmalen Wasserklingen, die die Straßen durchzogen, plätscherte leise das Wasser und trug den verschiedensten Unrat mit sich. Ein paar Schweine schnarchten dicht an einer Hauswand, Ziegen wurden in den Stall getrieben, und ein Hund schreckte ein paar Hühner auf, die sich flatternd auf eine Zaunlatte retteten.
Martin lächelte. Er war in Erfurt! Der Taxator hatte ihn als wohlhabend eingestuft und er war Scholar an einer der berühmtesten Universitäten des Kontinents. Vorbei die Zeit, da er sich klein und als Außenseiter fühlen musste. Er hatte ein Pferd, sein Studium war bezahlt, und sein Vater gab ihm ausreichend Geld für alle Tage. Er klopfte sich mit beiden Händen auf die Oberschenkel, um sich zum Aufstehen zu ermuntern, und freute sich darauf, erste Kontakte zu knüpfen.
Er lief zurück zur Universität und in seine Kammer. Alexis war schon dort und hatte begonnen, ein paar Dinge auszupacken und auf seiner Seite des Raumes zu arrangieren. So hatte er sein Schreibzeug genau auf eine Hälfte des Tisches gelegt. Auf seinen Stuhl hatte er Kleidungsstücke gestapelt und an den Haken an seinem Bett hatte er sein leinenes Nachthemd gehängt.
»Alexis, schon zurück? Bist du alleine nach Erfurt gefahren? Ich habe noch meinen Vater zum Gasthaus begleitet. Du kommst auch aus Mansfeld?«
»Ja, ich bin alleine hier. Mein Vater hat in seiner Werkstatt zu tun. Die Tage werden länger, die Leute bestellen mehr. Er ist Schmied. Macht alles, was mit Eisen zu tun hat. Auch Hufe beschlagen. Alle zehn Wochen bekommt jedes Pferd in Mansfeld neue Hufeisen … Klar, es gibt noch andere und wir sind noch nicht lange in der Stadt. Er muss sich seine Kundschaft sichern.«
»Ach, deshalb kennen wir uns nicht. Na ja, ich war die letzten Jahre auch in Eisenach. Wo bist du zur Schule gegangen?«
»In Leipzig. Aber nun, da wir beide in Mansfeld wohnen, können wir unsere Reisen zusammen antreten. Hast du auch ein Pferd hier?«
»Ja, steht bei Ziegler in der Futterstraße.«
»Meins auch, aber im Haus zum Schwarzen Bären.« Sie machten es sich jeder auf seinem Bett bequem, streckten ihre Beine aus und unterhielten sich über Mansfeld, über die Leute dort und gemeinsame Bekannte und schöne Plätze. Sie sprachen über Erfurt, ihre ersten Eindrücke von der Stadt und über Gott und die Welt. Zwischenzeitlich war es dunkel geworden und Martin hatte die Kerze auf dem Tisch angezündet. Beide teilten sie sich den Proviant ihrer Mütter und ließen es sich schmecken. Alexis war in Ordnung. Ein aufrichtiger, offener, netter und humorvoller Kerl, wie Martin fand. Sein erster Freund in Erfurt: ein Mansfelder! Martin musste bei dem Gedanken schmunzeln, kurz bevor ihm die Augen zufielen, als sie weit nach Mitternacht endlich ihre Nachthemden angezogen, die Kerze gelöscht und sich schlafen gelegt hatten.
Am nächsten Morgen wuschen sie sich in einem Waschraum mit mehreren Waschschüsseln, die bereits mit noch lauwarmem Wasser aufgefüllt waren. Alle Neuankömmlinge wünschten sich einen guten Morgen und unterhielten sich durcheinander darüber, was sie am heutigen Tag erwartete, in welche Burse sie endgültig einziehen mussten und was sie am Vortag schon entdeckt oder in Erfahrung gebracht hatten. Martin traf ein letztes Mal seinen Vater vor dessen Rückreise. Hans wollte sich auf den Märkten umsehen und noch das eine oder andere aufladen. Er fand eine schöne Tischdecke mit Blaudruck, einen kleinen türkischen Teppich für den Eingang und getrocknete Früchte aus dem Orient.
»Grüß Mutter und die Geschwister von mir«, sagte Martin, als die Zeit des Abschieds gekommen war.
»Soll ich deiner zukünftigen Frau auch einen Gruß ausrichten?«, fragte Hans seinen Sohn mit vielsagendem Blick.
»Vater, lasst dieses leidige Thema. Ich heirate nicht des Geldes und der Beziehungen wegen.« Martin wunderte sich selber über seinen kühnen Ton, aber anders würde sein Vater es nie verstehen.
Hans schüttelte ärgerlich den Kopf: »Du wirst schon noch zur Vernunft kommen. Mit der Zeit kommt die Liebe, wenn das Leben sorglos ist!«
Martin verdrehte die Augen, lächelte versöhnlich und winkte seinem Vater hinterher, bis der Wagen um eine Ecke verschwunden war.
In den folgenden Tagen reisten noch ein paar Nachzügler an. Auch aus anderen Ländern. Latein war dann ihre einzige Verständigungsmöglichkeit. Wer da war, machte sich mit allem vertraut und wurde eingeteilt, im Brauhaus, in der Küche und in den Gastzimmern zu helfen. Martin ging täglich zu seinem Pferd. Er putzte es, kratzte ihm die Hufe aus und lief mit ihm spazieren. Sonnabend, nach dem Gottesdienst, sattelte er seinen Wallach und ritt mit ihm aus den Mauern der Stadt hinaus in die Natur.
Am Tag des heiligen Georgs, dem 23. April, begann das Semester. Während die Vorlesungen der höheren Semester bereits im alten Halbjahr auf die Dozenten verteilt worden waren, mussten sich die Neuen jetzt in Listen eintragen. Für die meisten Vorlesungen waren Vorlesungsgelder zu entrichten. Martin hatte deshalb aber nicht vor, sich zurückzuhalten, denn sein Vater hatte ihm deutlich zu verstehen gegeben, dass er das Studium nicht in die Länge ziehen sollte. Als er nun im Foyer der artistischen Fakultät stand, kam Johannes Lang auf ihn zu, den Martin bereits von dem kleinen Rundgang durchs Gebäude kannte.
»Und? Schon das Richtige gefunden? Lang, Johannes Lang, ist mein Name. Ich habe im letzten Jahr angefangen. Wenn ich dir helfen kann?«
»Oh ja, danke. Ludher, Martin Ludher. Einige Vorlesungen sind schon voll. Ich bin wohl etwas spät dran.«
»Die Hälfte aller Studenten sind an der artistischen Fakultät. Da erst nach dem Magister dort eins der drei Hauptstudiengänge begonnen werden kann, studieren etwa ein Drittel Theologie, ein Sechstel Jura und nur wenige Medizin. Wofür interessierst du dich?«
»Jura.«
»Wenn du es eilig hast, rate ich dir, dich überall auf die Liste zu setzen. Dann hast du die Möglichkeit nachzurücken. Nett, dich kennengelernt zu haben!«
»Bist du aus Erfurt?«
»Ja.«
»Hättest du Zeit und Lust, mir und meinem Freund Alexis gegen eine Kanne Bier die Stadt zu zeigen?«
»Kein Problem. Um sechs Uhr heute Abend vor der Kirche kann es losgehen!«
Martin und Alexis waren pünktlich da.
»Ich schlage vor, ich zeige euch zuerst die Georgenburse, die ihr beziehen werdet.« Sie bogen ganz in der Nähe der Universität in die zweite Straße rechts ein.
»Hier, zwischen Augustinerkirche und Lehmannsbrücke, wohnt Nikolaus Marschalk im Haus zur Rossbrücke. Es gehört zu jenen Häusern, die unter die Verwaltung des deutschen Ritterordens fallen. Bei Marschalk wohnt auch Georg Spalatin, ebenfalls ein Kommilitone. Aber gehen wir dort der Gera entlang durch die Schildchengasse zur Krämerbrücke. Sie ist die Marktbrücke der reichen Händler: Edle Stoffe, Steine und Gewürze gibt es hier. Wenn ihr auf die Brücke wollt, müsst ihr eine Brückengebühr entrichten. Ich rate euch also, den Steg auf der anderen Seite zwischen Rathaus und Wenigemarkt zu benutzen.«
»Das habe ich schon. Mein Pferd steht in der Futterstraße.«
»Oh«, war Lang erstaunt, »das ist der teuerste Ort, um sein Pferd unterzustellen. Ich empfehle euch einen Stall im Andreasviertel!« Dann fuhr er mit seiner Stadtführung fort. »Hier, neben unserem Hospital, ist ein Badehaus.« Er zwinkerte mit einem Auge und ergänzte: »Wenn ihr Erfahrungen sammeln wollt … Da seht ihr Leute, mit denen ihr nicht gerechnet hättet. Aber da sich niemand dort offiziell aufhält, herrscht eine einvernehmliche Schweigepflicht!«
Martin und Alexis grinsten peinlich berührt.
»Hier, im Gotthardtviertel, wohnen viele arme Leute – wie ihr an den kleinen Holzhäuschen seht. Gehen wir durch die Kürschnergasse zur Schlösserbrücke. Eine weitere Marktbrücke an der Tabaksmühle.« Hier rauschte laut die Gera, das Mühlrad schlug geräuschvoll ins Wasser ein. Von der Brücke konnte man die Stege sehen, von denen aus die Kürschner ihre Felle im Fluss wuschen.
»Hinter der Mühle, das ist das Franziskanerkloster. Gehen wir vorbei.«
Sie sahen zwei in ihren Sandalen barfüßige Mönche, die vor dem Kloster fegten. Dann führte sie Johannes zum Dominikanerkloster und erklärte: »Dies ist das Predigerkloster. Habt ihr schon mal von Meister Eckhardt gehört? Seine Lehre ist verboten. Aber natürlich gibt es sie noch als anonyme Ausgabe im Antiquariat. Ich habe sie mir gekauft. Johannes Tauler bezieht sie auch in seine Lehre ein. Ich sage nur so viel …«, er holte die beiden nahe zu sich und flüsterte fast, »Gott ist im Grund der menschlichen Seele dauerhaft anwesend – wenn auch gewöhnlich auf verborgene Weise – und kann dort erreicht werden. Gott ist in uns, nicht im Außen. Er ist ein Teil von uns, wir sind ein Teil von ihm.« Er wandte sich zum Weitergehen. »Ihr müsst meditieren, wenn ihr eine Gotteserfahrung sucht. Zur Meditation wird schon lange von den Benediktinern geraten, und Nikolas von Kues hat vor genau fünfzig Jahren höchstselbst direkt dazu aufgefordert. Hier in Erfurt. Auf dem Petersberg. Darüber wird dieses Jahr, zum Jubiläum sozusagen, sicher noch gesprochen.«
Für Martin waren dies unglaubliche Dinge, die er da hörte. Gott in seinem Inneren. Wie kühn! Seine Mutter hätte sich bekreuzigt, und von seinem Vater hätte er eine Backpfeife erhalten, wenn so etwas aus seinem Mund gekommen wäre.
Sie liefen an großen Waidspeichern vorbei, hörten den Bierrufer die Brauhäuser, die Ausschank hatten, ausrufen: »Ein wohlfeil Bier gibt’s im Bären zu saufen und ist für ein paar Heller zu kaufen«, und erreichten den Platz vor den Graden. Sie sahen das Trillhäuschen, das auch leer unheimlich war. Martin hatte schon einmal eines mit einer Frau darinnen gesehen, die von den Leuten bespuckt und mit Unrat beworfen wurde. Einige Jungs hatten eine Freude daran gehabt, den Käfig anzuschubsen und wie ein Karussell schneller und schneller in Drehung zu versetzen. Die Frau war kreidebleich gewesen, ihr weißes Hemd gelb getränkt von den Gallensäften, die ihr dabei hochgekommen waren. Dieses hier drehte sich leise quietschend nur ein wenig mal nach links und mal nach rechts. Sie schauten sich den Hebearm mit dem Korb über dem Flusslauf für die Wasserprobe von Hexen an. Auch er bewegte sich leicht knarrend mit jeder Brise auf und ab oder zur Seite. Ganz nah befand sich das Gerichtshaus mit der Justicia als steinerne Figur vor dem Eingang.
»Eine Hinrichtung findet einmal im Monat statt, mindestens. Es ist ein riesiger Volksauflauf. Widerwärtig, wenn ihr mich fragt. Diese Gaffer, die vor Schadenfreude und Hass vergessen, wie schnell auch sie dort landen könnten.«
Martin und Alexis nickten angeekelt, wenngleich auch sie sich zu den ehrfürchtig Schaulustigen zählen würden.
»Na ja, zum Bischofssitz im Dom muss ich nichts sagen. Dort hinten, links neben dem Dom, ist die Frauengasse mit einem recht großen Frauenhaus, wo die Mumen nicht nur weltliche Herren glücklich machen.« Lang schüttelte den Kopf. »Daneben ein Findelhaus – passend, denn es geht nicht immer ohne Nachwuchs aus. Und weit und breit nur Gasthäuser: Die Hohe Lilie neben der Grünen Apotheke, auf der anderen Seite die Rote Flasche – das sind die zwei größten Wirtshäuser hier am Platz.«
Dann zeigte er in Richtung der Andreaskirche, als sie in die Breite Gasse abbogen. »Das Andreasviertel ist das Viertel der Handwerker und Bauern. Sie versorgen auch das große Benediktinerkloster auf dem Petersberg.« Am Fischmarkt blieb er stehen. »Hier seht ihr das Rathaus mit dem Gefängnis, das ›Paradies‹ genannt wird. Da drüben sind die Burse zum Löwenstein und das große Gasthaus Ratskeller, wo es das gute Einbecker und Naumburger gibt. Freitags kann man hier Fisch kaufen. Das soll erst einmal reichen. Meine Kanne Bier fordere ich ein anderes Mal ein. Ich muss noch mal zurück zur Schlösserbrücke, ihr geht dort vorne auf der Via Regia weiter durch die Michaelisstraße.«
Martin und Alexis bedankten sich und gingen, sich angeregt über alles unterhaltend, zu ihrer Unterkunft zurück. Es war inzwischen kurz vor acht.
Nach den ersten Tagen der Orientierung sollten sich alle Studenten in ihren jeweiligen Bursen melden, und Alexis schlug vor, dass Martin und er diesen Gang doch gemeinsam erledigen könnten. Von der Studentengasse führte gleich links hinter dem Universitätsgelände eine schmale Holzbrücke über die Gera an einer Mühle vorbei. Der Fluss war hier künstlich in zwei schmale Arme unterteilt worden, damit das Wasser mit mehr Druck fließen und so mehrere Mühlräder gleichzeitig antreiben konnte. Rechts lag die Armenburse mit ihrem ausladenden Obergeschoss direkt am Fluss und geradeaus ging es über die nächste Brücke an der Schildchensmühle vorbei. Vor sich sahen Martin und Alexis das kleine Haus zum Handschuh und auf der Ecke den stattlichen Kompturhof des deutschen Ritterordens. Sie liefen links den Fluss entlang und gelangten so direkt auf die Lehmannsbrücke, auf der um diese Zeit die Händler ihre Stände aufgebaut hatten. Daneben befand sich ein Nonnenkloster der Zisterzienserinnen und dem gegenüber die Brückenkopfkirche St. Nikolai mit ihrem hohen Kirchturm, der wie der Turm der Allerheiligenkirche als Wachturm fungierte. Die Burse war nicht zu übersehen. Es war ein langer Bau hinter der Brücke, vor dem ein paar ältere Studenten standen. Sie traten näher an das Grüppchen heran.
»Seid gegrüßt, wir sind neu an der Universität und kommen beide aus Mansfeld. Wir möchten uns melden«, sagte Martin.
Einer der Studenten reagierte zuvorkommend: »Folgt mir. Ich bringe euch zum Bursenmeister.«
Auf ihrem Weg ins Gebäude wurden sie von unauffälligen, aber interessierten Blicken begleitet.
Der Bursenleiter hatte eine kleine Amtsstube gleich rechts hinter dem Eingang. Er erwartete die Neuen schon.
»Nur herein. Wen haben wir denn da?«
Alexis übernahm die Antwort: »Die beiden Mansfelder, Martin Ludher und Alexander Schmied.«
Der Bursenleiter schaute sie an, dann auf sein dickes Buch, in dem er seine Bewohner eintrug. »Martinus und Alexius … In der Burse wird für gewöhnlich Latein gesprochen. Das dürfte kein Problem sein, oder? Ja, hier habe ich Euch. Seid willkommen. Ich zeige Euch gleich Eure Betten. Im Sommersemester werdet Ihr um vier Uhr morgens geweckt, im Wintersemester um fünf. Der Tag beginnt mit Gebeten und Lektionen. Um zehn Uhr gibt es die erste Hauptmahlzeit. Dann folgen weitere Lektionen, Übungen und was sonst auf dem Lehrplan steht. Die zweite Hauptmahlzeit ist um vier Uhr nachmittags, danach ist frei. Frei, um zu lernen, zu musizieren oder gar zu arbeiten. Ich rate Euch, tut etwas Sinnvolles! Im Sommer schließe ich die Burse um acht Uhr dreißig, im Winter um acht Uhr ab. Weiblicher Besuch ist nicht gestattet. Während der Mahlzeiten wird geschwiegen. Im Wechsel liest jeweils ein Student aus der Bibel vor.«
»Das ist ja wie im Kloster«, zischte Alexis Martin zu, als der Bursenleiter aufstand, um sie zu ihren Kammern zu führen.
»Genau, fast wie im Kloster.« Der Mann schien ein feines Gehör zu haben. »Ohne Sitte und Ordnung lässt es sich nicht gut studieren. Eure Eltern zahlen einen hohen Obolus, um Euch zu feinen und gebildeten Männern formen zu lassen. Wir bemühen uns, dem Vertrauen, das Eure Eltern in uns haben, gerecht zu werden.«
Im zweiten und dritten Stock befanden sich die Schlafkammern. Wie in den anderen Zimmern auch gab es in ihrem Raum zwei Doppelstockbetten, vor denen jeweils ein Vorhang als Sichtschutz angebracht war. In der Mitte der Kammer stand ein großer Tisch mit vier Stühlen, des Weiteren war an der Wand ein Bücherregal angebracht und hinter einem Vorhang eine lange Kleiderstange, an der schon ein Talar, ein Umhang, ein paar Hemden und Hosen hingen. Ein Zimmergenosse schien schon eingezogen zu sein.
»Crotus Rubeanus aus Dornheim wird noch erwartet. Euer anderer Zimmergenosse ist Hieronymus Buntz aus Windsheim.« Er drehte sich zu ihnen um. »Es ist Sitte, um in den Kreis der älteren Studenten aufgenommen zu werden, sich der Deposition beanii zu unterwerfen. Ihr wisst, was ›beanus‹ heißt?«, er schaute sie fragend an.
»Handwerksgeselle … der nicht freigesprochene Handwerksgeselle«, erwiderte Martin nach kurzem Überlegen eifrig.
»Richtig! Sehr gut! In Eurem Fall der ungetaufte Student. Es ist Brauch an den Universitäten, den Beanen einer Ablegung seines Beanenstandes zu unterziehen. Eine kleine Demutsübung. Ihr müsst erkennen, dass Ihr nichts wisst. Noch nichts. Deshalb studiert Ihr. Diese zugegebenermaßen etwas rohe Prozedur wird am Sonntag stattfinden. Wir wollen den Lehrbetrieb nicht stören.« Er lächelte, wie Martin fand, leicht sarkastisch und überließ die beiden sich selbst.
Alexis schaute Martin verzweifelt an. »Was wird das werden? Und ab sofort nur noch Latein.«
»Übung macht den Meister … Sicher wird das Lateinische durch den täglichen Gebrauch besser und besser, und schließlich werden wir viel Latein lesen. Gerade im ersten Teil der Sieben Freien Künste, dem Trivium: Grammatik, Rhetorik und Dialektik!«
»Mein Latein war nie so gut. Aber natürlich hast du recht. Es kann nur besser werden! Gehen wir unsere Sachen holen.« Alexis klang ernüchtert.
Die ersten Nächte waren gewöhnungsbedürftig. Crotus Rubeanus, der sich ihnen mit bürgerlichem Namen als Johannes Jäger vorgestellt hatte, war ein netter Kerl, aber er schnarchte. Hieronymus kam zwei Tage später.
»Müsst ihr euch auch am Sonntag der Deposition unterziehen?«, fragte Martin.
»Wir sind eine Woche später dran«, gab Johannes zurück. »Schätze, die Anlässe zum Feiern sollen etwas gestreckt werden. Nach der Prozedur müssen wir ein Essen ausgeben.«
»Verstehe. Dann bin ich doch froh, dass wir es bald hinter uns haben«, machte Martin sich und Alexis Mut.
Als der nächste Sonntag kam, wurden Martin und Alexis noch vor dem Frühstück in den Speiseraum geführt. Gleich an der Tür mussten sie stehen bleiben. Der Bursenrektor saß am anderen Ende des Raumes, fast wie auf einem Thron. Alle Magister, Bakkalare und Scholaren des Hauses waren versammelt. Martin schaute sich um. Jeder schien sie zu mustern. Das war es nun also. Martin atmete tief durch und nickte Alexis fast unmerklich aufmunternd zu. Dann kamen zwei Studenten und machten sich daran, ihnen Eselsohren aufzusetzen. Zwei andere brachten Eberzähne, die mit einer dicken Schnur am Kopf festgebunden wurden. Alexis schaute erschrocken. Martin zuckte mit den Schultern und bedeutete ihm damit, dass sie da durchmussten. Er blieb gelassen, als man sie auslachte. Er stand ruhig, als man ihnen Scheuklappen und Hörner aufsetzte. Alexis schien den Tränen nahe, was mit noch mehr Gelächter und Hohn quittiert wurde. In Martin arbeitete es. Wie sollte er diese Situation meistern? Mit Humor – er musste es mit Selbstironie tragen! Ein Magister nahm eine Peitsche und trieb sie im Kreis, wie Pferde an der Longe. Sie sollten traben und galoppieren, sich im Kreis drehen und Männchen machen. Martin spielte mit und führte von sich aus ein kleines Schauspiel vor, in das er Alexis mit einbezog, der erleichtert mitmachte. Sie spielten austretende Esel, vor denen sich die Zuschauer in Sicherheit bringen mussten. Dann wurden ihnen Mohrrüben an einem Stock vor die Nase gehalten, die sie mit dem Mund fassen sollten. Während Alexis mehrere Runden hinter dem Stock hertrabte, ignorierte Martin die Mohrrübe so konsequent, dass der Halter unaufmerksam wurde, die Mohrrübe dicht und tief hielt und Martin ihm den Stock mit einem Biss in die Rübe aus der Hand zog. Die Menge klatschte. Dann wurden zwei Eimer voll mit Bier hereingetragen, aus denen sie um die Wette trinken sollten. Ohne Hände. Sie mussten sich also auf ihre Knie niederlassen und wie die Hunde mit der Zunge saufen. Da sie noch nichts gegessen hatten, stieg ihnen das Bier schnell zu Kopf. Zweimal wurden sie mit dem Kopf in die Eimer getaucht, dass sie den Gerstensaft durch Mund und Nase herausprusteten.
Die Demütigung erfuhr noch eine Steigerung: Mit von Bier verklebten, nassen Haaren, stinkend und in einer Kombination aus Eseln und Ochsen zur Hässlichkeit verunstaltet, wurden sie unter Gelächter und Gegröle hinaus auf die belebte Marktbrücke getrieben. Und wie bestellt, standen dort ausgerechnet zwei hübsche Mädchen, die kichernd auf sie zeigten. Martin spürte, wie ihm die Röte ins Gesicht stieg. Ein Student gab den beiden Eseln ein Löwenzahnblümchen in die Hand und befahl ihnen, sie den Mädchen zu überreichen und einen hübschen Diener zu machen. Martin kam sich mehr als dumm vor. Aber er entschied sich für die Flucht nach vorne und ging geradewegs auf die Hübschere zu, die intelligent genug war, das Spiel mitzuspielen. Alexis und die andere taten es ihnen nach. Eine Menschenmenge hatte sich versammelt, pfiff und applaudierte. Martin bedankte sich bei seiner Mitspielerin, indem er sich verneigte. Sie gab ihm zu verstehen, dass sie mitfühlte, und lächelte ihn mitleidig an.
Nun kamen zwei andere Studenten mit großen Scheren, einer Axt und einer Säge auf sie zu. »Leute, hört, hört!«, sagte der, der mit den Löwenzahnblumen die Moderation hier draußen übernommen hatte. »Dies sind die Neuen, die meinten, sie wären etwas Besonderes, weil sie sich an der Universität zu Erfurt eingeschrieben haben. Dummheit, Engstirnigkeit, Einfalt, tierische Rohheit und Unmäßigkeit haben bei uns nichts verloren. Deshalb erfolgt nun die Fuchsentaufe!« Den beiden Studenten mit den Werkzeugen befahl er: »Nun befreit die Täuflinge von ihrem Beanium!«
Jetzt wurden ihnen die Eselsohren abgeschnitten. Die Scheren waren sehr groß, und Martin trug eine leichte Verletzung am Ohr davon. Dann kamen andere, die ihnen nicht zimperlich die Scheuklappen abrissen. Es ziepte an der Kopfhaut. Die Ochsenhörner und die Schweinszähne wurden mit Sägen gekürzt, und schließlich wurde ihnen mit einem Striegel aus Eichenholz der Bart geschoren. Die Prozedur war schmerzhaft.
Wieder wurden die beiden Mädchen einbezogen, die noch immer neugierig in der Nähe standen. »Kommt, und verabreicht Euren Verehrern diese bitteren Pillen, denn jeder muss einmal eine bittere Pille im Leben schlucken«, wies der Wortführer die beiden jungen Frauen an.
Diese gingen auf Martin und Alexis zu und reichten ihnen die Tabletten.
»In den Mund damit! Füttern!«, skandierten die Zuschauer.
Martin und Alexis ließen sich die scheußlichen weißen Presslinge zwischen die Zähne schieben und schluckten sie herunter, so gut und so schnell sie konnten. Martin musste würgen, es schüttelte ihn, so bitter war der Geschmack auf seiner Zunge. Gerne hätte er noch mal aus dem Eimer gesoffen. Mit diesem üblen Geschmack, geteert und gefedert, wenigstens innerlich, sollten sie sich nun hinknien und ihre Sünden vor aller Ohren bekennen.
»Bekennt, um durch völlige Läuterung im Inneren wie im Äußeren ein würdiger Jünger der Wissenschaft zu werden!«
Martin wollte es hinter sich bringen und dem deutlich mehr leidenden Alexis ein Beispiel geben: »Ich bekenne, dass ich manchmal ein zügelloses Gemüt habe und mich nicht mehr kontrollieren kann.« Und dann fügte er humorvoll hinzu: »Insbesondere, wenn mich jemand demütigt und zur Weißglut treibt, kann ich zum Mörder werden, und er bekommt meinen Zorn zu spüren, wenn er am wenigsten damit rechnet!« Er spielte einen Wahnsinnigen und blickte seinen Peinigern böse ins Gesicht.
Die Menge grölte erneut. »Hört, hört!«
Alexis versuchte es ähnlich spielerisch: »Ich bekenne, dass ich nur schlecht verzeihen kann. Ich bin zwar nicht nachtragend, aber ich vergesse nie! Ich habe mir Eure Gesichter gemerkt«, drohte er mit dem Zeigefinger und lachte versöhnlich. Die Zuschauer applaudierten.
Nun sprach der Bursenrektor: »Ihr dürft Euch erheben! Gut habt Ihr Euch geschlagen. Es ist üblich, dass Ihr nun zu einem Schmaus und Umtrunk einladet, um Euch der Absolution zu versichern. Einen Drittelgulden je von Euch beiden.« Der Bursenmeister hielt die Hand auf.
Martin griff in seine Westentasche und zog eine Münze heraus. Alexis ebenso.
Martin schaute sich nach den Mädchen um. Sie waren im Begriff zu gehen. Aber nun drehte sich die Hübschere zu ihm um, lächelte ihn verlegen an und winkte unauffällig auf Hüfthöhe. Martin winkte genauso zurück und zwinkerte ihr zu.
Der Aufsicht führende Magister nahm das Geld und ging zur Fleisch- und Brotbank, kaufte ein paar leckere Sachen, und zusammen liefen sie gut gelaunt und einträchtig zurück in die Burse in den Speiseraum, wo sie gemeinsam aßen und tranken. Drei Bursalen holten ihre Instrumente und spielten Musik. Immer wieder legten ihre Bursengenossen beiden freundschaftlich die Arme um die Schultern und prosteten ihnen zu.
Martin erhob sich und lallte – denn so viel Bier war er nicht gewohnt: »Ich denke, das war nur der Anfang aller Depositionen, die uns allen ein ganzes Leben hindurch nicht erspart bleiben – nur ein Vorspiel dessen, was uns in Ausbildung, Ehe und Beruf bevorsteht. Wir danken für die Aufnahme.«
Der Bursenrektor nickte anerkennend. Der junge Martinus hatte die Lektion verstanden. Alle klatschten und stießen auf die klugen Worte an. Das Studium konnte beginnen.
Lange saßen sie beisammen. Bier und Wein machten sie redselig, und so lernten sie die anderen Bursalen schnell kennen und freundeten sich an. Martin wusste nun, dass man hier trinkfest sein musste, denn die älteren Studenten unterhielten sich lebhaft über ihre lustigen Zusammenkünfte in der Vergangenheit und stießen an, auf die, die noch kommen würden.
Am 23. April begannen die ersten Vorlesungen und Disputationen. Die Vorlesungen hielten entweder ordentliche Lehrstuhlinhaber oder Bakkalare sowie junge Magister, und sie wurden durch Übungen und Wiederholungen ergänzt. In den Disputationen wurde eine Frage in Rede und Gegenrede behandelt und gelöst. Anfangs war Martin zurückhaltend, aber als er merkte, dass er in Rhetorik den anderen in nichts nachstand, beteiligte er sich eifrig. Besonders mochte er die Quodlibet-Disputationen, in denen alles Mögliche zum Gegenstand der Diskussion gemacht werden konnte. Vor allem die Werke des Aristoteles wurden vorausgesetzt. Martin plante zum frühestmöglichen Zeitpunkt, nämlich anderthalb Jahre nach Aufnahme des Studiums, sein Bakkalariatsexamen abzulegen. Es war also keine Zeit zu verlieren.
Die Studien der Philosophie, die Urmutter der Sieben Künste, waren anspruchsvoll. Sein Professor war Bartholomäus Arnoldi. Er kam aus dem Ort Usingen, weshalb ihn die Kollegen auch Usingensis nannten. Er liebte Aristoteles, die Logik und den Nominalismus. Martin merkte sofort, dass er von diesen Themen noch wenig verstand. Es galt, die wichtigsten Philosophen und ihre Überlegungen kennenzulernen – Zeit, die Bibliothek aufzusuchen.
Beim ersten Rundgang hatten sie bereits kurz durch die Tür hineingucken können. Nun trat Martin ein und war überwältigt von der Menge der Bücher, den hohen dunklen Holzregalen mit den Tritten und fest arretierten Schiebeleitern davor, von den vielen Stehpulten und Lesetischen. Er schätzte die Zahl der Bücher auf über tausend Bände.
Der Bibliothekar sprach ihn an. »Ihr seid Bakkalar?«
»Noch nicht«, antwortete Martin. »Ich will es werden.«
»Nun, wenn Ihr etwas entleihen wollt, müsst Ihr Euch eines Magisters bedienen. Nur er darf sich eigenhändig mit Namen und Titel des empfangenen Buches, ferner Tag, Stunde und Ort, in das Registrum schreiben. Ich rate Euch, Euch schnell zu kümmern, denn immer zu Beginn der Semester werden die entliehenen Bücher zurückgegeben und sind dann auch sehr schnell wieder weg.«
Martin bedankte sich für den Hinweis, schaute sich noch ein wenig um und verließ dann die Bibliothek. Bald kam er jedoch mit einem Magister wieder und entlieh sich Johannes Baptista Mantuanus, danach die römischen Dichter Ovid und Vergil.
Alljährlich am Markustag, dem 25. April, fand eine Prozession von Erfurt nach der am Roten Berg gelegenen Markuskapelle statt. Dort waren einhundertfünfzig Jahre zuvor viele Pesttote beerdigt worden. Alle, die für diese Kapelle spendeten, anderweitige Werke der Frömmigkeit verrichteten sowie zur Kapelle pilgerten, um zu beten oder den dortigen Friedhof unter dem Gebet von fünf Vaterunsern und fünf Ave-Maria zu umschreiten, erhielten vierzig Tage Ablass.
Ganz Erfurt, so schien es, versammelte sich frühmorgens um neun Uhr auf dem Platz vor den Graden. Von der Außenkanzel an den Domstufen erinnerte der Priester die Menschenmenge an den Anlass und erzählte die Begebenheit, als am 21. März 1349 das Michaelisviertel brannte.
»Die Pest erreichte Erfurt erst ein Jahr später. Doch glaubte man, die Juden hätten das Wasser und die Brunnen vergiftet. Schließlich musste es eine Ursache für die Seuche geben. Juden schienen gegen die Krankheit gefeit. Immer wieder sehen wir, dass sie sich doch seltener anstecken. Nun, eine Gruppe um einen damaligen Ratsherrn, Hugo Lange, Stifter des goldenen Gemäldes der Kreuzigung unseres Herrn Jesus in der Ratskirche, nahm sich der Sache an und vertrieb die jüdische Gemeinde aus Erfurt. Aus Angst, sich den Erfurtern zu stellen, steckten sie ihre Häuser in Brand, die doch zum Teil gar nicht ihr Eigentum waren. So brannte es im Speicherviertel und beim Collegium Amplonianum. Doch das Ende der jüdischen Gemeinde kam zu spät. Der schwarze Tod fand seine Opfer auch in unserer Stadt. Deshalb gedenken wir ihrer an diesem Tag.«
Der Priester segnete die Prozession, und dann setzte sich der Pulk in Bewegung: die Geistlichen vorneweg, gefolgt von den Ratsherren und Patriziern, unter ihnen und dahinter Professoren der Universität, denen sich die Studenten anschlossen. Dann folgte ohne bestimmte Ordnung, so schien es, das restliche Volk.
Martin lief neben seinen Zimmergenossen. Immer wieder schauten sie interessiert nach hinten. Sie waren neugierig auf die jungen Erfurter und Erfurterinnen. Plötzlich erblickte Alexis die beiden »Mädchen von der Lehmannsbrücke«, wie Martin und er sie in ihren Gesprächen nannten. Die hatten sie schon entdeckt, und die Hübschere bedeutete ihm nun, dass Martin sich umdrehen solle.
»Sieh mal hinter dich!«, stieß Alexis seinen Freund mit dem Ellenbogen in die Seite.
Martin tat, wie ihm geheißen, und winkte überrascht, als er die beiden Schönheiten erblickte.
Der Weg zur Kapelle dauerte über eine Stunde, in der die jungen Männer und die Mädchen immer wieder Blicke und Gesten austauschten. Am Ziel angekommen, fasste sich Martin schließlich ein Herz und ging auf seine neue Bekanntschaft zu.
»Guten Tag, ich bin Martin. Schön, dass wir uns wiedersehen! Darf ich dich nach deinem Namen fragen?«
Das hübsche Mädchen senkte verlegen die Augen, aber es war ihm anzusehen, dass es sich über Martins Aufmerksamkeit freute. »Ich heiße Anna«, sagte sie schließlich und hob erwartungsvoll den Blick.
»Anna. Ein schöner Name!« Martin lächelte ihr aufmunternd zu. »Danke wegen letztens«, sagte er dann. »Magst du mir deine Stadt zeigen? Morgen oder am Wochenende?« Er bemerkte, dass Alexis ihm hektisch Zeichen machte, zu ihm zurückzukehren. »Ich muss mich wieder einreihen.« Er sah Anna entschuldigend an. »Also – werden wir uns sehen?«
»Ja, gerne«, gab sie eilig zurück. »Am Samstag. Elf Uhr am Brunnen vorm Rathaus!« Sie strahlte.
»Bring deine Freundin mit. Alexis kommt auch«, rief er ihr bereits im Weggehen zu.
Seinen Freunden zeigte er unauffällig, aber triumphierend den erhobenen Daumen, als er sich wieder zu ihnen stellte.
Sie beteten gemeinsam vor der Figur des heiligen Markus und gingen dann die erforderlichen fünf Runden. Nach Abschluss der Zeremonie sprach der Priester erneut seinen Segen und auf dem Rückweg spielten Spielleute einen freudigen Marsch.
Die Studenten unterhielten sich über die Pest und was sie davon gehört und gesehen hatten. »Alle zehn Jahre fast sucht sie uns heim. Sechzig, manchmal bis zu neunzig Prozent aller Menschen sterben an ihr. Die, die rechtzeitig fliehen und wissen, wohin, sind klug«, sagte Alexis.
»Klug oder feige? Darf ein Christ sich davonstehlen, anstatt den Kranken zu helfen?«, warf Crotus ein.
»Die Angst sollte uns eher antreiben, für unsere Seelen zu sorgen, als die Flucht zu ergreifen. Die Pest erinnert uns daran, dass die Welt nicht unser bleibendes Zuhause ist«, sagte Ludher weise. Die anderen nickten zustimmend.
Die Vorlesungen der sprachlich und logisch-argumentativ ausgerichteten Fächer bildeten die Grundlage für jede Beschäftigung mit der Wissenschaft und das weiterführende Quadrivium der mathematischen Fächer.
»Die freien Künste sind höherrangig als die praktischen. Schon Seneca schrieb 65 nach Christus in seinem 88. Brief: ›Du siehst, warum die freien Künste so genannt werden: Weil sie eines freien Menschen würdig sind.‹ Frei ist, wer für sein Brot nicht arbeiten muss. Aber denken!«, leitete ihr Dozent Georg Spalatin, der zwei Jahre zuvor seinen Bakkalartitel erhalten hatte, seine erste Vorlesung ein und erhob mahnend seinen Finger.
Ludher war begeistert: »Alle übrigen Universitäten sind gegenüber unserer Erfurter kleine Schützenschulen«, flüsterte er seinem Sitznachbarn Crotus zu und fühlte sich privilegiert. Adelige, namhafte Professoren bildeten den Lehrkörper, der zukunftweisend die Organisation der Welt analysierte. Antike Autoren wurden gelesen, um die Universität mit den Strahlen der politischen Kunst zu erleuchten.
Trutvetter vertrat die Grundauffassung des Nominalismus: »Es gibt keine allgemeine Entität. Es sind nur zwei Kategorien anzunehmen, nämlich Substanz und Qualität. Es entspricht also eher der Philosophie, nach dem principium universalisationis zu fragen als nach dem principium individuationis. Zuerst muss man die Sprachanalyse und die Sprachkritik üben, um dann kritisch die metaphysischen und philosophischen Sachthemen zu behandeln. Dieser Vorgang kann nur mithilfe der Dialektik bewältigt werden. Der Weg zu einer kritischen Wissenschaft führt nur über eine präzise Sprachanalyse, die jedoch nicht etwa die Metaphysik und die Theologie ersetzen kann.«
Martin nickte zustimmend und schaute begeistert zu Alexis, der verzweifelt den Kopf schüttelte: »Ich verstehe kein Wort!«
»Ich erkläre es dir gleich«, raunte Martin und erläuterte seinem Kommilitonen nach der Vorlesung auf dem Flur die Universalienfrage: »Universalien sind Allgemeinbegriffe wie ›Mensch‹ oder ›Menschheit‹, auch mathematische Entitäten wie ›Zahl‹ oder ›Relation‹. Ein Allgemeinbegriff bezieht sich also auf Merkmale, die mehrere Gegenstände gemeinsam haben. Die Frage ist nun, ob diese Begriffe real existieren – wie in der Theorie des Realismus – oder ob es sich um rein künstliche Begriffsbildungen handelt – wie im Nominalismus.«
»Ah, die Ideenlehre Platons: die These, dass Ideen eine eigene Existenz haben.«
»Genau. Doch der Nominalismus sagt, dass es sich leidlich um gedankliche Abstraktionen handelt und die Realität nur den Einzeldingen zukommt. Den Nominalismus bezeichnet man als Via Moderna, den Realismus als Via Antiqua. Verstehst du?«
»Und wozu braucht man das?«
»Es geht um Macht und Legitimierung. Nimm beispielsweise die Einheit der Dreifaltigkeit. Ist sie real oder handelt es sich um eine Umschreibung? Du musst Thomas von Aquin lesen. Er steht für den Realismus. Wilhelm von Ockham für den Nominalismus. Ich habe mir die Bücher geliehen. Du kannst sie gerne lesen.«
Alexis konnte in dieser Nacht schlecht schlafen und zerbrach sich darüber den Kopf, ob in Wirklichkeit nur Einzelseiendes oder auch Allgemeines eine eigene Existenz hatte. Er wusste von seinem Vater, dass es ihm als Schmied nichts ausmachte, Gitter für eine Kirche zu schmieden, deren Fertigstellung er nicht erleben würde. Er sah sich als Teil der Entität der Menschheit an, die die Kirche über Generationen nutzen würde. War Menschheit nun real oder nominal? Er verstand es immer noch nicht.
Am nächsten Tag lehrte sie Nikolaus Marschalk: »Das studium trilingue gibt Euch sprachwissenenschaftliche Impulse von fürs Leben grundlegender Bedeutung. Wir werden in diesem Jahr darüber diskutieren, ob Glaube und Wissen vereinbar sind. Ob sich im Zweifel das Wissen dem Glauben unterordnen muss. Ich bin gespannt auf Eure Gedanken!«
Obwohl das Studium schon in vollem Gange war, erfolgten mit der Vereidigung des Rektors am 1. Mai und der der neuen Studenten am 2. Mai noch die formvollen Zeremonien.
Diese fanden wie immer in der Michaeliskirche statt. Am 1. Mai musste der neue Rektor vor dem Altar seinen Eid ablegen, damit er am nächsten Tag schon den seiner neuen Studenten abnehmen konnte. Martin freute sich immer wieder, dass der Zufall ihm seinen Lateinlehrer als Rektor in Erfurt beschert hatte, und er verfolgte die Zeremonie mit großer Aufmerksamkeit.
Jodokus Trutvetter sprach mit sicherer Stimme feierlich: »Ich schwöre bei Gott und den Evangelien, die Rechte und Freiheit der Universität zu wahren, ihren Nutzen und ihre Ehre zu fördern, für die Eintracht der Fakultäten und aller Angehörigen zu arbeiten sowie die das Rektorenamt betreffenden Statuten nach Kräften zu wahren. Auch verspreche ich, die Statuten und Bestimmungen über das schickliche Auftreten, die Bescheidenheit und Gemäßheit der Kleidung und die sittliche Zucht der Angehörigen, über das für die Universitätsangehörigen geltende Verbot, sich Leistungen in Ware bezahlen zu lassen, insbesondere in Naumburger Bier und anderen Getränken und Speisen, über die mengen- und wertmäßige Wahrung des Buchbestandes der Universität in der Bibliothek des Universitätshauses, der Bücher des Kollegs zur Himmelspforte und der Bibliothek des Collegium Marianum auszuführen. Ich versichere weiterhin, nicht mehr als acht Gäste zur Feier meiner Wahl einzuladen, andernfalls bei der nächsten Sitzung des geheimen Consiliums an dieses einen viertel Rheinischen Gulden zu entrichten.«
Hier dachte sich Martin: welch sonderbarer Zusatz. So lädt er wohl doch mehr als acht Personen ein. Er musste schmunzeln. Die strengsten Regeln schienen aufweichbar zu sein.
Nach dem Eid folgte die offizielle Zepterübergabe des alten Rektors an seinen Nachfolger. Jede Fakultät verfügte über Insignien und Kleinodien als Zeichen ihrer Eigenständigkeit, Hoheit und Würde. Das Ornat des Rektors war aus kostbarem Stoff. Ein Magister übergab ihm seine Petschaft, eine Art Siegel, das die Rektoren und Dekane führten. Solch ein eigenes Zeichen, gleichsam wie ein Wappen, wollte Martin auch einmal besitzen. Als Jurist vielleicht mit der Justitia, dem Symbol der Gerechtigkeit, wenigstens aber mit einer Waage darauf. Er träumte vor sich hin und verpasste fast, sich zum Gebet zu erheben, hätte Alexis ihm nicht derbe seinen Ellenbogen in die Seite gestoßen.
Am nächsten Tag, am 2. Mai, erfolgte die feierliche Einschreibung in der Michaeliskirche. Um zehn Uhr in Verbindung mit dem Gottesdienst wurden die angehenden Studenten einer nach dem anderen einzeln nach vorne zum Altar aufgerufen, wo sie vor dem Rektor stehend ihre Eidesformel sprechen mussten. Als Martin Jodokus Trutvetter gegenüberstand, lächelte er ihn väterlich an und nahm ihm damit die letzte Unsicherheit. Nach dem Eid trat er zum Schreiber, der ihn als »Martinus Ludher ex Mansfeld« mit geschwungenen Lettern in die Universitätsmatrikel, ein dickes, schweres ledergebundenes Buch, eintrug.
Das Lernen bereitete Martin Freude. Er versäumte nie eine Vorlesung, befragte gerne seine Lehrer und besprach sich in Ehrerbietung mit ihnen. Alexis fiel das Studium schwerer.
»Komm, fleißig gebetet ist über die Hälfte studiert! Das eine kannst du bereits, das andere erkläre ich dir noch mal. Danach machen wir Übungen, die unseren Körper gesund halten. In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist!« Martin wusste immer einen klugen Spruch. Er hatte kürzlich den kleinen Weg zwischen der Burse und dem Frauenkloster entlang des Flusses für sich entdeckt und ermunterte seine Zimmergenossen, vor der Schließzeit der Burse bis zu den Inseln zu rennen und dort Liegestütze, Kniebeugen und Klimmzüge an einigen großen starken Ästen zu machen. Am Ende des Weges verzweigte sich die Gera und bildete kleine Inseln. Der Breitstrom ging hier in die Wilde Gera über, und die Schmale Gera trennte sich von ihr ab. Sieben Wassermühlen gab es hier. Martin hatte den Platz gleich zu seinem Lieblingsort auserkoren.