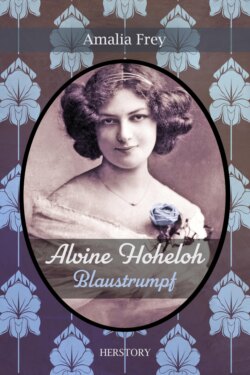Читать книгу Alvine Hoheloh - Amalia Frey - Страница 15
Sommer
ОглавлениеJuni 1910: Der Ball im Hause Caspari läutete jedes Jahr die Sommersaison ein und galt als einer der Höhepunkte für die Bourgeoisie dieser Stadt. Zu der diesjährigen Veranstaltung waren über einhundert der hochangesehensten Familien geladen, zudem Freund*innen und gute Bekannte des Gastgebers aus anderen Regionen.
Darum hätte der Ballsaal nicht ausgereicht und so war kurzerhand ein Festzelt gemietet worden, welches nun aufwendig auf einer groß angelegten Rasenfläche am Stadtrand aufgebaut, ausgeschmückt und mit einem prächtigen Buffet auf die Gäst*innen wartete. Etliche Dienstbote*innen und Kellner*innen huschten möglichst unauffällig zwischen den gutbetuchten Feiernden umher, kredenzten perlenden Champagner in Gläsern, schenkten vollmundigen Wein nach oder gaben an mehreren Schenken Hochprozentiges aus.
Edmund Caspari, seines Zeichens Großgrundbesitzer, Verpächter von Fabrikgebäuden, Werks- sowie Lagerhallen, außerdem Vermieter zahlloser Wohnblöcke für die unteren Klassen, wollte wie jedes Jahr nebst Gattin erst die Bildfläche betreten, wenn die Feier schon in vollem Gange war und die Paare anmutig zu der rhythmischen Musik des Ensembles tanzten.
Herr Caspari hatte in seinem Leben so viele Reichtümer und Geschäftsbeziehungen gemehrt, dass er es nicht nötig hatte, vor seinen Gäst*innen Spalier zu stehen – und das sollte auch jede*r spüren! Er kam stets als Letzter auf sein eigenes Fest und ließ sich sodann nickend für die Pracht bauchpinseln und verwies auf seine Frau Anna, deren Lebensaufgabe es geworden war, sich in der Organisation dieses Großprojektes immer wieder selbst zu übertreffen.
Familie Hoheloh erschien dieses Jahr zu siebt, denn außer den beiden erwachsenen Söhnen Eduard und Karl mit ihren Ehefrauen, war ihr jüngstes Kind Alvine mit von der Partie.
Die Fürstenbergs hatten sie in dem Wirrwarr aus prächtig-bunten Ballkleidern und Fräcken in gedeckten Farben noch nicht erspäht.
Eduard, seine Haut war nur bedingt heller als die seiner Geschwister, war groß und schlank, nannte einen beneidenswerten Schnurrbart sein Eigen und trug seine kastanienbraunen Locken schulterlang.
Mit ihm seine Gattin Marie, die Einzelkind einer Weinbaudynastie im Südwesten des Reiches war. Auf ihrem Gut lebten und wirtschafteten sie an dreihundert Tagen des Jahres und kamen nur für große Anlässe wie diese in die Hauptstadt.
Eduard war ganz hin und weg – und zwar von seiner kleinen Schwester: »Was aus so einem Wildfang wird, wenn man ihn pudert, parfümiert und in ein güldenes Ballkleid steckt«, spottete er angetan.
Ebenso Karl: einen halben Kopf größer als Eduard, trug seine dunklen Haare kurz, dennoch kringelten sie sich sichtlich. Er konnte mit Komplimenten nicht hinterm Berg halten: »Und wie dir die Brokatspange steht, die ich dir mitgebracht habe. Findest du nicht auch, Becky-Liebes? Ganz entzückend!«
Die beiden blonden, markant hellhäutigen und drallen Damen amüsierten sich über ihre Gatten: »Als hätte man euch ein Püppchen geschenkt«, stellte Rebecca, Tochter eines Seidenhändlers, trocken fest, die mit ihrem Mann die meiste Zeit des Jahres in Fernost und im osmanischen Raum umhertingelte, um Geschäfte abzuschließen. Der Handel mit dem feinen Stoff war dem jungen Paar gänzlich übergeben worden, seitdem die Eltern Hoheloh sich zu alt zum Herumreisen fühlten.
Eduard und Marie hatten bisher drei Kindern das Leben geschenkt, Karl und Rebecca zwei Söhne in die Welt gesetzt, die beide aber die meiste Zeit auf dem Weingut zusammen mit Vetter und Cousinen lebten.
Für wahr, Alvine fühlte sich bezaubernd. Das Kleid, ein blassgoldglänzender Traum mit kleiner Schleppe, einer senkrechten Reihe niedlicher brauner Schleifen am Rücken und rechteckigem Ausschnitt sowohl vorne als auch hinten, hatte sie sich schon Monate im Voraus ausgesucht. Es ließ ihre lohbraune Haut strahlen, im Gegensatz zu den Anzügen ihrer Brüder, die hellhäutigeren Männern mehr geschmeichelt hätten. Alvines Haar hatte Greta locker wenngleich aufwendig zu einem üppigen Knoten aufgesteckt und zwei lange Strähnen ihrer quirligen Locken vom Nacken über das Dekolleté entlang drapiert, die erst eine halbe Elle unterhalb ihrer Brust endeten.
Dennoch mutete ihr der Rausch, mit dem ihre Brüder sie lobten, deplatziert an.
»Ihr habt nicht geheiratet, um nach wie vor für mich die meisten Komplimente vom Stapel zu lassen«, gab sie also zurück.
Scherzhaft verneigten sich die Stammhalter vor ihr und widmeten sich wieder ihren Frauen, die ihrer Schwägerin dankbare Blicke schenkten.
»Sieh, dort ist Elfriede Fürstenberg. Dann kann der Rest der Sippe auch nicht weit sein«, rief Dorothea Alfred zu.
Alvine hatte letztendlich beschlossen, sich höflich und distanziert zu verhalten, und sollte der Junior ihr zu aufdringlich werden, könne sie ihm wohlwollend einen Korb geben. Sie wusste, würde sie sich heute Abend, an dem die Wände Augen und Ohren hatten, daneben benehmen, stünde ihrem Vater ein äußerst schwieriges Geschäftsjahr bevor. Mit aller Macht hielt sie ihre Gesichtszüge in Schach, als sie Heinrich Fürstenberg erblickte. Ein unförmiger Greis mit hängenden Wangen und schlurfendem Gang lief hinter der sichtlich jüngeren, hageren, aber freundlich aussehenden Elfriede, die ihre Mutter beschwingt begrüßte.
Dann fiel ihr ein: Sie hatte vergessen, zu fragen, wie alt der Sohn war.
»Oh, sieh nur, offenbar haben sie sich gefunden.«
»Hm?«, machte Theodor, bereits eine Flasche Rotwein und einige Portionen Pudding intus und angetan von den damenhaften Ausblicken.
»Hohelohs! Nun steh da nicht so rum. Halt mir den Rücken frei, ich muss einer alten Jungfer das Herz brechen«, fauchte Konrad.
»Ja doch.« Theodor, der an einem Tisch gelehnt stand, stieß sich ab und lief dem Bruder mit lustloser Miene nach.
Dann erblickte er sie.
»Guten Abend, Frau Fürstenberg. Das ist unser jüngstes Kind und unsere einzige Tochter, Alvine.«
Alvine knickste pflichtbewusst schüchtern vor ihr, die positiv angetan lächelte. Ebenso schmunzelte Heinrich. War es Erleichterung in seinem Blick oder gar Lüsternheit? Sie wollte es gar nicht wissen und knickste auch vor ihm kurz, während er ihr zwei Sekunden zu lange die Hand küsste.
»Fräulein Alvine, hocherfreut«, sagte Frau Fürstenberg, »und das ist mein Sohn …«
Ein Jüngling schnellte dazwischen und ergriff sich verneigend ihre Hand: »Theodor Fürstenberg. Ich bin zutiefst erfreut, Fräulein Hoheloh, Sie endlich kennenzulernen.«
Der Hüne küsste ihre Hand so zärtlich, als wären seine Lippen ein Schmetterling. Alvine, deren Blut einmal in ihre Füße schoss, dann in den Schädel und schließlich ins Herz, sah ihn wie vom Donner gerührt an, ehe sie stotterte: »Sie … Sie sind das? Ich hatte keine Ahnung, Herr Fürstenberg …«
»Die Überraschung ist ganz meinerseits …«
»Ich freue mich sehr, Sie wiederzusehen«, gab sie daraufhin, halbwegs zur Orientierung zurückgekehrt, zurück.
»Wäre es wohl anmaßend, wenn ich Sie gleich um diesen Tanz bitte?«
»Oh ich … mit Freuden gern«, lächelte Alvine.
Keine Sekunde ließen sie einander aus den Augen, sie schienen nicht einmal zu blinzeln, während er sie mit flirrender Hand zu den anderen tanzenden Paaren geleitete.
Die übrigen Familienmitglieder Hohelohs und Fürstenbergs hatten die Szene mit offenen Mündern beobachtet, Dorothea fing sich als Erste wieder. »Elfriede, Sie haben mir Ihren zweiten Sohn ja gar nicht vorgestellt« probierte sie, die Angelegenheit zu retten, »er scheint mir ebenso ein schmucker …«
Ehe sie enden konnte, hatte Fürstenberg Senior sich gefangen und polterte: »Soll das ein Witz sein? Dieser nichtsnutzige Kurmacher? Ich werde …«
»Heinrich, bitte«, hielt Elfriede ihn zurück.
Nun sahen Fürstenbergs peinlich berührt zu den Hohelohs, aber Dorothea lächelte freundlich: »Lassen wir sie erst einmal tanzen, danach wird er uns sicher erklären, was es damit auf sich hat. Wie hieß er doch gleich?«
»Theodor«, antwortete Elfriede nicht ohne Stolz.
»Theodor, Theodora oder Dorothea …«, Rebecca strahlte ihre Schwiegermutter an, »das heißt doch 'Geschenk Gottes'.«.
»Die Elfe und das Gottesgeschenk? Scheint mir eine lohnenswerte Mischung zu sein«, schloss Marie sich an.
Nur die Herren Hoheloh blieben zu Salzsäulen erstarrt.
Alvine wurde von Theodor entschlossen und gleichfalls behutsam über die Tanzfläche geführt. Sie sprachen nicht einmal miteinander und nahmen außer sich und ihren jubilierenden Herzen um sich herum nichts wahr. Sonst wäre ihnen aufgefallen, dass sie ein Paar waren, das jedwede Blicke auf sich zog, mehr noch, als sich im Saal herumsprach, welcher Familien Spross sie waren. In diesem Moment betrat das Ehepaar Caspari die Bildfläche, bereit, ihre Lobhuldigungen für dieses Jahr in Empfang zu nehmen. Wie sie feststellten, waren sie allerdings bei Weitem nicht die Hauptattraktion.
»Dorothea …«, Alfred flüsterte seiner Gattin ins Ohr, »würdest du mir bitte erklären, was da gerade passiert ist?«
»Um das zu verstehen, mein Liebling, müssten diese beiden es erst selbst begreifen.«
Ihre Tanzschritte passten sich an, sobald ein neues Lied gespielt wurde und der Takt sich änderte. Wahrnehmen, taten sie jedoch nichts davon.
Alvine suchte immer wieder nach einem Gesprächsfaden, an dem sie anknüpfen konnte, aber entgegen ihrer Natur erschien ihre Wortgewandtheit aufgebraucht, so ihr drei zusammenhängende Gedankengänge gelangen. Sie konnte doch schlecht mit »Sie sind also der große Unbekannte«, beginnen. Er würde sie für minderbemittelt halten.
Theodor wiederum quälten ähnliche Denkschwierigkeiten, von seiner Fähigkeit, seinen Körper ausreichend zu kontrollieren, ganz zu schweigen. Ihr überflüssige Komplimente für ihre Garderobe auszusprechen oder einmal mehr zu betonen, wie überrascht er wäre, dass ausgerechnet sie sich als Hohelohs Tochter entpuppt hatte, das wollte er ihr ebenfalls ersparen. Jedoch schien es ihm ebenso lächerlich sie mit debilgrinsenden Mundwinkeln (so stellte er sich sich selbst vor) anzustarren und dabei stumm wie ein Fisch zu sein. Sie hielt ihn gewiss für einen absoluten Schwachkopf.
»Wenn ich mir ein Lob erlauben darf, Herr Fürstenberg«, erlöste sie beide endlich, »Sie verstehen es nicht nur, ausgezeichnet zu reiten, sondern auch zu tanzen.«
Er spürte, wie er fast errötete, und zwang sich nicht zu erwidern: »Das Kompliment möchte ich gerne zurückgeben.«
»Oh je, auf diesen Nachmittag spielen Sie an«, entschied er stattdessen, »haben Sie mir verziehen?«
»Das kommt darauf an, ob Sie auf mich gehört haben.«
»Gewiss, Fräulein Hoheloh. Ich war seither nicht versucht, Damen über den Haufen zu reiten und was die Zuckerwatte für die umstehenden Kinder angeht: Da Sie es mir so eindringlich geraten hatten, drang es an die Ohren der Kleinen. Kurz um …«
»Sie wurden belagert?«, grinste Alvine.
»Zu Recht! Leider kam kein Zuckerwatteverkäufer des Wegs, aber wie durch ein Wunder stand einer dieser Stollwerk’schen Bonbonautomaten nur ein paar Meter entfernt, wie mich die Kinder sodann informierten.«
»Oha, der wird an Ihnen den höchstmöglichen Tagesumsatz seiner Zeit gemacht haben.«
»Nun, das hoffe ich doch. Jedoch eines war ärgerlich.«
»Es blieb nichts für Sie übrig?«, scherzte sie.
»Das leider auch, aber ich hätte so gerne Ihnen eine Portion Zuckerwatte spendiert.«
»Oh, Herr Fürstenberg, was reden Sie da? Niemand darf mich sehen, wie ich Zuckerwatte esse. Ich schlinge sie gar undamenhaft hinunter.«
»Das bezweifle ich.«
»Es ist so, ich könnte Sie nicht belügen.«
»Nun denn«, er drehte sie galant ein paar Mal, bevor er fortfuhr, »dann werde ich es so besorgen, dass Sie Ihre Portion genießen, während niemand anwesend ist, der fähig zu einem Urteil sein dürfte.«
»Wer wird mir dann Gesellschaft leisten?«, schlug sie ihm einen weiteren Spielball auf.
»Meine Wenigkeit, wenn Sie erlauben. Ich wäre niemals in der Lage, Sie als undamenhaft zu bezeichnen. Ebenso wenig kann ich mir, abgesehen von Ihrer Mutter und vermutlich Ihrer Gouvernante, niemanden vorstellen, der das Recht hätte, Sie zu gängeln.«
»Sie werden staunen: Ich hatte keine Kinderfrau.«
»Nun veralbern Sie mich«, wieder drehte er sie, ganz verzaubert vom Flug ihrer glänzenden Locken.
»Mitnichten! Meine arme Mama musste meine Erziehung allein bewerkstelligen, die Gouvernanten habe ich beizeiten vertrieben.«
Wie sie feststellte, wirkte er weder ungläubig noch schockiert. Er glaubte ihr und was umso angenehmer war: Es gefiel ihm. »Hatte Ihre Mutter ernstlich Schwierigkeiten, Sie am Ende zu diesem holden Persönchen auszuformen?«
»Sie würden sich wundern. Ich war und bin ein wahres Ungeheuer.«
Dann lachten sie herzlich, er drehte sie wieder, fand die Schleifen über der Knopfleiste an ihrem Rücken neckisch und sagte: »Sie müssen verstehen: Es ist schwierig für mich, sich das vorzustellen.«
»Nun, vielleicht glauben Sie mir, wenn ich Sie auf Folgendes aufmerksam mache: Ich habe das Gespräch mit Komplimenten für Sie begonnen. Erscheint Ihnen das nicht undamenhaft?«
»Meiner Vorstellung nach nicht. Vielmehr sollten Damen das Recht erhalten, Dialoge zu beginnen, wie es Ihnen beliebt. Und nicht nur dahingehend ist das Kräfteverhältnis schändlich ungleich.«
Alvines Herz tat einen Satz: »Sie sprechen wahre Worte!«
»Es freut mich, dass sie Ihnen nicht unangenehm sind. Erlauben Sie mir die Frage: Was ist Ihr Steckenpferd?«
»Es wird Sie gewiss überraschen: Auch ich reite gern.«
»Wie schön«, gab er knapp zurück.
»Leider ist mein Pferd fern meiner Heimat, nämlich im Elternhaus meiner Mutter untergebracht und ich sehe es nur, wenn wir dorthin reisen.«
»Wann wird das sein?«
»Oh, schon bald. Ehe wir gemeinsam in die baltischen Kaiserbäder fahren, meine Eltern, meine Brüder mit ihren Familien und ich, verbringen meine Mutter und ich ein paar Tage dort. Und sonst erlaube auch ich mir des Öfteren, über ein verlängertes Wochenende dorthin zu reisen, um reiten zu gehen.«
»Sie reisen allein?«
»Leider nein, normalerweise bringt mein Bruder oder einer unserer älteren Kammerdiener mich wenigstens bis zur Hälfte, wo mich unser Stallmeister in Empfang nimmt. Er ist der Einzige, von dem sich mein Hengst noch reiten lässt, und ist schon Ewigkeiten bei meinen Eltern angestellt. Und natürlich begleitet meine Gesellschafterin Greta mich überall hin.«
»Sie sagten leider?«, schmunzelte er.
»Gewiss. Sie können sich nicht vorstellen, wie lästig es ist, stets und ständig überwacht zu werden. Ich hatte jahrelange Fehden mit meinem Vater auszutragen, ehe er mir endlich erlaubte, mich wenigstens in der Stadt frei zu bewegen. Aber auch nur, wenn er überzeugt sein konnte, dass ich nur mit anderen Damen verabredet bin.«
»Das kann ich mir gewiss nicht vorstellen und muss zugeben, mir darüber nie Gedanken gemacht zu haben. Und wie dankbar ich nun für dieses Geburtsrecht bin. Obgleich ich auf die aktive Dienstpflicht hätte verzichten können.«
Ihr gelang darauf nur ein schwaches Lächeln. Sicher hatte sie kein Mitleid erwartet, aber eine erneute Versicherung ihrer gesellschaftlichen Unterdrückung aufgrund ihres Geschlechts erschien ihr noch unpassender.
»Wechseln wir das Thema …?«
»Gern«, gab er zurück, unfähig die Spur des Ärgers in ihrem Zungenschlag zu hören.
»Weitere Lieblingsbeschäftigungen … Nun, ich lese sehr gern, ich gehe gern spazieren oder besuche meinen Vater in der Hauptfabrik.
»Ist das so? Langweilt Sie das nicht?«
»Was von den dreien?«, erwiderte sie, Übles ahnend.
»Ich kann mir nicht vorstellen, was Sie im Büro Ihres Vaters interessant finden könnten. Oder motivieren Sie die Arbeiter?«
»Nun, auch wenn Sie es nicht glauben mögen«, ihr gereizter Ton war nun endlich für ihn deutlich, »ich interessiere mich sehr für die unternehmerischen Abläufe. Es als Steckenpferd zu bezeichnen, ist wohl maßgeblich untertrieben: Nein, mit meinem Vater zu arbeiten ist mein Lebensinhalt.«
Er spürte die Versteifung ihrer Gliedmaßen, was es ihm unmöglich machte, sie weiterhin zu führen. Daraufhin stoppte er behutsam und blickte in ihre funkensprühenden Augen. Wie hübsch sie war. »Verzeihen Sie mir. Ich muss zugeben, dass mir bisher noch keine Dame begegnet ist, die derartige Interessen bekundet.«
»Es mag Sie verwundern, Herr Fürstenberg«, gab sie zurück, »aber sehr viele Frauen legen Wert auf die gleiche Arbeit, die gleichen Rechte und Wertschätzung!«
Damit machte sie sich von ihm los und ließ ihn stehen. Mit offenem Mund starrte er ihr nach. Ihre Locken sprangen in ihrem eiligen Gang und trotz ihrer Enttäuschung auf und ab und ließen erneut den Duft nach Rosenseife in seine Nase steigen.
°°°
Obgleich es von jeher eine Angewohnheit der Brüder war, sich über Alvines maskulines Betragen lustig zu machen, konnte man durchaus behaupten, dass die beiden es am meisten gefördert hatten.
Seit dem Tod von Dorotheas Eltern fungierte Friedgolds Hof, der direkt an einem malerischen See lag, als Kleinod der Zuflucht für die Vollblutstädterin und ihre Familie. Ihr Onkel hatte seinen Grund, zu dem auch Friedgolds Forst gehörte, vor seinem Tod an Alfred Hoheloh überschrieben. Um die Wälder zu pflegen, hatte man eine Försterfamilie angestellt, die ebenso in dem Haus wohnte, dazu Dienstbot*innen, die die Anlagen in Schuss hielten und die dazugehörigen Pferde hüteten. Außerdem waren ein paar Nutztiere angeschafft worden, sodass das rege Treiben einem kleinen Bauernhof glich. Die Kräuter- und Kartoffelgärten vor den Bauten taten ihr Übriges.
Seit jeher war es für die Jungen Eduard und Karl eine Selbstverständlichkeit gewesen, während der Sommerferien, die sie hier verbrachten, morgens eine Runde schwimmen zu gehen – unbekleidet, verstand sich. Als Alvine drei Jahre alt wurde, ebenso Schwimmunterricht forderte und nicht einsehen wollte, warum in Gottes Namen sie diese elendig schwere Badekleidung zu tragen hatte, entschied ihr Vater das einzig Richtige: Er ließ eine circa Zehn-Quadratmeterfläche abstecken, einen robusten Steg und ein Durchgangshäuschen in dessen Mitte bauen und hinter dem Häuschen ließ er einen Sichtschutz aus Holz errichten. Frisches Wasser bekam dieser durch einen etwa anderthalb Quadratmeter großen unterirdischen Zufluss. Nun war es Klein-Alvine und dem Rest der Familie also möglich, den Bootssteg entlang in das Häuschen zu tippeln, sich dort all ihrer Kleider zu entledigen und dann in ihrem ganz eigenen Schwimmbecken herumzutollen.
Eduard und Karl waren begeistert über die Gunst, ihrer Schwester schwimmen beizubringen und mit ihr bald darauf wild im Wasser zu spielen. Und sie ließen es sich nicht nehmen, Mutproben mit ihr abzuhalten. Zuerst testeten sie ihre Waghalsigkeit, als sie sie dazu überredeten, trockenen Fußes vom Steg ins tiefe, oftmals kalte Wasser zu springen. Als sie ebenso Mutproben zum Tauchen bestand, forderten sie sie auf, durch den unterirdischen Zulauf zu schwimmen, was sie ebenfalls vorbehaltlos tat. Und schließlich ging es darum: Wer schwamm am weitesten auf den See hinaus? Alvine wäre einige Male fast ertrunken.
Mit 22 Jahren ehelichte Eduard die gleichaltrige Marie, einziges Kind eines verarmten Winzers. Er zog zu ihrer Familie. Das Weingut befand sich am südwestlichen Ende des Reiches. Binnen kurzer Zeit lehrte man ihn den Weinanbau, seine unternehmerischen Qualitäten kamen der Vermarktung zugute, obgleich dieses Unternehmen nach wie vor nur läppische Gewinne abwarf. Der grüne Daumen verschliss offensichtlich von Generation zu Generation mehr. Somit konzentrierten sich die junge Winzerin und ihr angeheirateter Jungweinbauer darauf, aus der karg geschöpften Maische ein edles Tröpfchen zu kreieren.
Die wenigen Flaschen erfreuten sich bald respektierlicher Beliebtheit unter den Kenner*innen und sicherten dem Weingut ein achtbares Einkommen. Reich wurden sie davon folglich nicht und um das uralte Anwesen regelmäßig zu sanieren und die Rebstöcke anständig zu hätscheln, benötigte es mehr als einmal Finanzspritzen aus der großen Stadt. Doch die Eltern liebten ihren Sohn und auch die heitere Schwiegertochter, sodass sie es wie eine Kleinigkeit behandelten, ihnen unter die Arme zu greifen.
Maries Herz gehörte ihrer Heimat und den Weinbergen, wenngleich sie in all den Jahren nicht herausbekam, wie sie die Rebstöcke zu beschneiden hatte, um höhere Ernten zu erzielen. Und um einen Experten anzustellen, dazu war sie zu stolz. Lieber verzichtete sie auf Schmuck und glänzende Feste, als sich in ihre Arbeit hereinreden zu lassen. Eduard nannte sie liebevoll: mein süßes Trotzköpfchen oder kurz: Süßchen.
Seine Eltern erkannten wohl die charakterliche Ähnlichkeit, die zwischen Dorothea und Marie und vor allem der kleinen Alvine bestand, und sahen geflissentlich über solche Launen hinweg.
Letztlich plante Alfred seinerzeit, Eduard zum Haupterben zu küren. Bis es so weit war, würde sich Marie schon daran gewöhnen, ihren Weinberg eher als Steckenpferd denn als Lebensaufgabe zu betrachten. Und immerhin hatte sie ihren flatterhaften Erstgeborenen gezähmt und von seinen delikaten Geschichten abgebracht, ehe ein Bastard gezeugt oder er in eine Anstalt geschickt werden konnte. Marie und Eduard liebten sich sehr und stritten, ob ihrer hitzigen Gemüter ebenso gern.
Außerdem setzte das Paar erst Zwillinge weiblichen Geschlechts und dann noch einen Jungen in die Welt. Dorothea liebte Kinder und bestellte sie so oft wie möglich in die große Stadt oder fuhr den weiten Weg zu ihnen, um ihren Enkel*innen beim Wachsen zuzusehen.
Nach einer dieser Reisen sagte sie ihrem Gatten so ruhig wie bedeutsam: »Alfred, Marie wird ihren Weinberg niemals hinter sich lassen und Eduard wird bleiben, wo Marie ist. Wir müssen einen anderen Erben finden.«
»Zum Glück hast du mir noch zwei Weitere geschenkt«, entgegnete er. Heimlich hatte er Eduards Ausscheiden aus der Kandidatenliste längst vermutet, spätestens seitdem das dritte Enkelchen geboren war.
Karl hingegen verliebte sich schon als Kind in seine Brieffreundin Rebecca Grün, die eigentlich in derselben Stadt, doch in einer völlig anderen Welt lebte. Zufällig waren die beiden einander auf der Exposition universelle de Paris begegnet, waren eher schreibfaul, ab dann aber nicht füreinander. Nach jahrelangem regen Austausch schüchterner Verse und gegenseitiger Geschenke von den Reisen in der Weltgeschichte bat der achtzehnjährige Karl um ein Treffen.
Missmutig traf sich daher die ganze Sippe in einem Kaffeehaus und machte höfliche Konversation, obgleich die jungen Leute vor Aufregung keinen Ton herausbekamen. Die Eltern amüsierte das beidseitig, begleitete doch Karl andernorts immer ein aberwitziger Redeschwall und besaß die elegante Rebecca sonst ein nicht zu verachtendes dominantes Gemüt. Zum Abschied traute er sich jedoch nicht einmal, ihr die Hand zu küssen und sie fixierte ihre Schuhspitzen.
Danach quälte den armen Buben schmerzhafter Liebeskummer, sodass Dorothea sich gezwungen sah, ihm Feuer unterm Allerwertesten zu machen. Mit seinen Eltern im Rücken rollte Karl ein Großaufgebot auf und machte seiner Angebeteten eifrig den Hof. Sein Werben um Fräulein Grün wurde schließlich erhört. Ihre Eltern erlaubten die Hochzeit mit dem Nichtjuden, vor allem, da er ebenfalls einer Familie aus Seidenhändler*innen entstammte. Zwar lagen die ständigen Reisen in den Orient seit Alvines Geburt brach, denn Hohelohs konzentrierten sich nun auf ihre Schuhwerkstätten. Doch als Karl anbot, mit seiner künftigen Frau auch die alten Kund*innen seiner Eltern zu bereisen, ließen sich Alfred und Dorothea nicht schlagen. Das überzeugte die Familie Grün endgültig von dem Anwärter: die Tochter glücklich zu wissen, nicht mehr reisen müssen und nebenbei über doppelt so viele Kund*innenkontakte verfügen – die Ehe war und blieb ein Geschäft.
Mit Rebecca eröffnete sich für die Hohelohs ebenso der Weg zu vielen, sehr reichen jüdischen Geschäftsfreundschaften und Kund*innen. Schnell merkten Rebeccas Anverwandte auch, dass sie von Alfred und Dorothea gleichwertig behandelt wurden. Beide hatten noch nie ein Problem im Glauben gesehen und hatten auch nie verstanden, warum sie Grenzen im eigenen Land ziehen sollten. Das, da ihr Kreis doch ohnehin über Landesgrenzen hinaus reichte. Diesen Glaubenssatz hatten sie ihren Kindern mitgegeben und so freundete sich vor allem die kleine Alvine flink mit der Heerschar an Cousins und Cousinen ihrer künftigen Schwägerin an.
Um alle Gemeinden gütlich zu stimmen, ließen Rebecca und Karl sich dreimal trauen: standesamtlich, evangelisch und ein letztes Mal mit massigem Pomp in der Traditionssynagoge der Familie Grün.
Seither übernahmen Karl und Rebecca Hoheloh die Reisen in den Orient, um Seidenhandel zu betreiben. Ihre zwei kleinen Söhne verbrachten die meiste Zeit auf dem Weingut von Onkel Eduard und Tante Marie, wo sie zusammen mit dem restlichen hoheloh’schen Nachwuchs von zwei Kinderfrauen betreut wurden.
°°°
Alvines Brüder kamen, seitdem sie in den heiligen Stand getreten waren, nur noch selten auf Friedgolds Hof. Auch Dorothea blieb dieses Jahr länger in der großen Stadt und wollte erst in zwei Wochen gemeinsam mit Alfred dazu stoßen. All das war Alvine sehr recht.
Nach dem Debakel auf dem Ball der Casparis hatte sie so gut wie nie eine ruhige Minute gehabt. Ihre Gesellschafterin Greta hatte sie natürlich begleitet und angenehmerweise davon abgesehen, sie wegen Theodor Fürstenberg zu befragen. Alvine wollte ihn schnell vergessen, dazu war ausreichend Abstand von seinem Umfeld hilfreich.
Die Tage des Sommers waren in dieser Gegend heiß, sodass es ihre morgendliche Angewohnheit wurde, nach dem Aufstehen eine Runde im kühlen See zu schwimmen. Auf diese Weise hielt sich die Erfrischung den ganzen Tag und sie konnte mit Strumpf getrost durch die Wälder jagen oder mit Greta spazieren gehen.
Im Umkleidehaus entledigte sie sich ihres Morgenmantels, mehr trug sie nicht am Leibe und sprang in alter Tradition ins Tiefe. Ihr von der Nacht und wilden Träumen mit Theodor Fürstenberg, dem Narren, erhitzter Körper erstarrte bei dem Temperaturunterschied und für einen Wimpernschlag stand ihr Herz still. Unter Wasser sah sie kaum etwas und blickte gen Oberfläche, die hell erleuchtet einen starken Kontrast zu ihren schwebenden Locken bildete. Dann tauchte sie auf, drehte ein paar Runden und tauchte wieder ab, um durch den unterirdischen Zufluss zu entschlüpfen. Es war ihre Art der Rebellion – eine davon – gegen die groben Ungerechtigkeiten, die für ihresgleichen galten. Wohl wissend, dass sie sich äußerst unschicklich benahm und mit wild pochendem Herzen schwamm sie weit hinaus auf den See und zurück.
Als sie im sichtgeschützten Becken auftauchte, erwartete sie Greta auf dem Steg mit einem Handtuch. Ihre Gesellschafterin und Kammerzofe diente ihr seit einigen Jahren und hatte es aufgegeben, sie wegen ihrer Flausen zu ermahnen.
Am frühen Nachmittag sattelte Alvine, wie immer behost und mit luftiger Bluse gekleidet, ihren Hengst. Strumpf begrüßte es einerseits, gefordert zu werden, aber anderseits war er es nicht gewohnt und daher schnell ermüdet. Dennoch ließen sie es sich nicht nehmen, sogleich am See entlang und schließlich in den Wald hinein zu galoppieren.
Inmitten der reichen Buchen- und Tannenwälder des Friedgolds Forsts lag eine Lichtung mit einem kleinen Gewässer. Fröhliche Frösche quakten, Grillen zirpten und etliche Schmetterlinge und Bienen labten sich an den reichlichen Blumen. Das Gras war von der Sonne ausgetrocknet und fast zwei Ellen hoch. Alvine saß ab und ließ Strumpf vom Wasser saufen. Eine fette Kröte sprang erschrocken mit einem dumpfen Plopp ins warme Nass. Schließlich graste der Hengst nahe einer einzelnen Eiche, die neben dem Weiher mittig der Lichtung wuchs und unter der der Rasen grün und saftig war. Ein paar Eidechsen beobachtend, hatte Alvine sich in den Schatten des Baumes gesetzt und gedöst.
Erst als Theodor schon fast neben ihr stand, kam sie zu sich.
Seiner Pollenallergie trotzend hatte er sich den Weg durch das hohe Gras zu ihr erkämpft. Sogleich schnellte sie hoch und wich drei Schritte von ihm zurück. Er rang sich ein Lächeln ab, das ob seiner leuchtenden Augen durchaus glaubwürdig erschien.
Hinter ihm stand ein Pferd. Sie kannte Asra, den Rappen. Er gehörte dem hiesigen Gastwirt.
Strumpf beschnupperte das Leihpferd neugierig.
»Bevor Sie schimpfen«, begann er, »darf ich etwas sagen?«
Sie schnappte nach Luft. »Bitte«, platzte sie schließlich heraus.
»Mir ist bewusst, dass ich Sie an besagtem Abend schwer verärgert haben muss. Nach Ihrem Abgang hatte ich Zeit, darüber nachzudenken und nun, da ich etwas über ihren bisherigen Lebensweg in Erfahrung bringen konnte, tut sich mir auch auf, wie es um Ihre Einstellung steht. Ich verstehe nun, woher Ihr Ärger rührt.«
»Ist das so?«, blaffte sie zurück.
»Fräulein Hoheloh, ich muss gestehen, dass ich noch mit wenigen Frauen wie Ihnen zu tun hatte. Gewiss waren die Damen, die mich bisher mit ihrer Gegenwart beehrten, oftmals ebenso unzufrieden mit ihrer gesellschaftlichen Stellung. Aber es kam mir eher so vor, als hätten diese jedenfalls sich damit arrangiert und würden nicht aktiv dagegen angehen. Dass sie sich unter dem Schutz der Männer, die die volle Verantwortung tragen, wohlfühlten.«
Alvine holte Luft, doch Theodor erhob bittend die Hand, auf dass er weiter reden dürfe.
»Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Von Kindesbeinen an habe ich mich gefragt, warum die Damen von Stand sich das antun, bis ich zu dem Schluss kam, dass viele offenbar nicht Kraft und Mut aufbringen konnten …«
»Es wird uns regelrecht aberzogen!«, spie sie nun wider, »Sie reden von Verantwortung der Männer. Aber wenn diese nur daher rührt, dass sie die alleinige Macht haben, und Frauen der Weg zu Bildung und Selbstverwirklichung verwehrt bleibt, ist das ein erbärmliches Argument für diese Kompetenz. Sie haben überhaupt keine Vorstellung, Herr Fürstenberg! Also erlauben Sie sich gefälligst auch kein Urteil.«
»Ich will Sie nicht verurteilen«, gab er um Ruhe ringend zurück, »ganz im Gegenteil, ich bewundere die Damen, die sich ihre Rechte einzufordern versuchen. Die um das Anrecht politischer Mitbestimmung und hoher Bildung ringen. Wie meine Genossinnen. Aber Sie … Sie sind die erste reiche Tochter, die die gleichen Ziele wie sie verfolgt.«
Strumpf begann derweil an Asras Ohr zu knabbern, was er nur zu gerne tat. Es war seine Art, die Stuten zu necken, dass er es auch bei Hengsten tat, war jedoch neu. Alvine sah die Szene im Augenwinkel und hätte darüber am liebsten laut gekichert. Sie riss den Blick ruckartig zurück zu Theodor, der da in gebührendem Abstand vor ihr stand.
Er trug dunkelblaue Reiterhosen, schwarze Reitstiefel und oben ein schneeweißes Hemd, dessen obere Knöpfe geöffnet waren. Für eine Sekunde besah sie den winzigen Ausblick auf seine nackte Brust, der sich ihr bot und wieder trat dieses Pochen im Unterbauch auf.
»So ist das, Sie bewundern es? Warum in Gottes Namen gaben Sie sich dann letztens so herabwürdigend?«
»So … haben Sie mich wahrgenommen?«, entgegnete er.
»Wie hätte ich Sie anders wahrnehmen sollen? Sie hatten meine Verärgerung ja nicht einmal bemerkt.«
»Ich muss Ihnen recht geben, doch ich versichere Ihnen, es geschah nicht aus böser Absicht. Zudem möchte ich wiederholen, dass ich bisher nicht mit einer Dame wie Ihnen gesprochen habe und ich nicht die Möglichkeit hatte, es einzuordnen.«
»Einzuordnen? Ein Geburtsrecht, das für jeden Menschen gelten sollte?«
»Ich bin Ihrer Meinung, jedoch, das sagte ich bereits, war ich an jenem Abend überrumpelt. Ich hatte schlichtweg nicht damit gerechnet …«
Wieder unterbrach sie ihn: »Damit gerechnet, dass Frauen durchaus daran Anstoß nehmen, wenn sie als Menschen zweiter Klasse behandelt werden?«
Er schnaubte. Sie schien ihm völlig festgefahren. Wie oft sollte er ihr noch gestehen, dass er diese Meinung nicht teilte? Verlangte sie von ihm, zuzugeben, dass er trunken gewesen war? Sowohl von seinem Glück, sie wieder zu sehen als auch vom Wein?
»Ich kann nicht mehr sagen, als dass es mir leidtut und ich absolut auf Ihrer Seite bin.«
»Wären Sie es doch schon an diesem Abend gewesen!«
»Das war ich, nur gelang es mir nicht, meine Gedanken zu ordnen.«
»Warum nicht?«, höhnte sie nun, »Sie verfügen über einen Kopf, der Ihnen gestattet, das Gesagte zu reflektieren.«
Dieses Weib ist nicht zu fassen, dachte er.
Entweder war sie immer so uneinsichtig oder, was er mittlerweile eher vermutete, hatte sie so lange über dieses Gespräch nachgedacht, dass sie zu tief drinsteckte, als dass sie von ihrem Urteil über ihn lassen konnte. Demnach war er ihr also im Gedächtnis geblieben und kurz fühlte er sich geschmeichelt. Daraufhin wurde ihm allerdings gewahr, was für einen Dickschädel sie haben musste, was ihn einerseits rührte und ihn andererseits aber auch verärgerte. Hätte sie sich an jenem Abend nur eine Minute Zeit genommen, sodass er sich hätte erklären können, wäre ihnen beiden die Odyssee der letzten Woche erspart geblieben.
»Nein, ich habe gar nicht nachgedacht«, gab er zu.
»Wie kann ein Mensch des Denkens nicht fähig sein?«
»Fragen Sie mich nicht, es war so. Ich war überwältigt von allem, sodass ich von diesem evolutionären Vorteil keinen Gebrauch machte.«
»Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen!«
Wie vom Donner gerührt sahen sie einander an. Entgegen ihrer Natur hatte sie es zugelassen, ihm im Streit näher und näher zu kommen, sodass ihre Gesichter nun nur eine faustbreit voneinander entfernt waren.
»Es ehrt Sie, dass Sie Ihr Leben lang stets die Kontrolle über sich hatten und Ihnen das nie widerfahren ist.« Er steigerte sich in seinen Redefluss hinein. »Aber Sie scheinen mir ohnehin eine Denkerin zu sein. Ich wette, Sie können gar nicht anders, als tagaus tagein ihr Hirn zu quälen. An der Tiefe der Denkfalte auf Ihrer Stirn wird nur allzu deutlich erkennbar, wie scheußlich Sie selbst darunter leiden!«
»Ich darf doch sehr bitten! Was erdreisten Sie sich mit dieser Unterstellung?«
»Ist es nicht so? Aber wenn Sie an jenem Abend kurz innegehalten und mir eine Gelegenheit gegeben hätten, wären wir im Guten auseinandergegangen.«
Ihre Augen schossen Blitze aufeinander. Alvine wurde für eine Sekunde gewahr, dass sie bei Diskussionen eher dazu neigte, zurückzuweichen, um Anlauf zu nehmen, selbst bei ihrem Vater. Vor Theodor jedoch war sie nicht zurückgewichen, im Gegenteil: So gefährlich nahegekommen war ihr bisher kein Mann.
Ein lautes Wiehern schreckte sie aus ihrer beider Dämmerzustand auf und sie sahen nur, wie Asra davondonnerte, dicht gefolgt von Strumpf, der ihn offenbar noch immer zu ärgern gedachte. Alvine und Theodor standen mit einem Mal allein auf der Lichtung inmitten des Waldes, und auch, dass sie auf zwei Fingern nach ihrem Hengst pfiff, was ihn maßgeblich beeindruckte, brachte die Tiere nicht zurück.
Nach einem Moment des ratlosen Schweigens entschieden sie beide, ihre Wutausbrüche zu verschieben, und stapften eiligst in die Richtung, in die die Pferde entkommen waren.
»Wie haben Sie mich gefunden?«, fragte Alvine irgendwann.
»Vor ein paar Tagen habe ich bei Ihrer Mutter vorgesprochen, die mir mitteilte, dass Sie hier seien. Und dass sie einverstanden wäre, dass ich Sie besuche, um die Sache zu klären.«
Alvine grummelte: »Das sieht ihr ähnlich. Aber dass sie so einfach meinen Aufenthaltsort preisgibt, das überrascht mich.«
Dorothea war Alvines Veränderung freilich nicht entgangen, aber sie hatte ihre Tochter in Ruhe gelassen und ihr keine Vorwürfe gemacht. Nur ein einziges Mal hatte sie angeregt: »Du solltest besser noch einmal mit ihm reden, sicher war es ein Missverständnis, worum auch immer es ging.«
»Hat sie nicht. Sie gab mir die Aufgabe, es herauszufinden, und glücklicherweise habe ich meine Quellen …«, dass er schon seit drei Jahren wusste, wo ihr traditioneller Urlaubsort sich befand, verschwieg er.
»Sind Sie ernsthaft hergekommen, um mir das mitzuteilen?«
»Gewiss. Mir erschien unser beider Aufeinandertreffen äußerst erfreulich, bis dieses Missverständnis auftrat. Ich hätte es sehr schade gefunden, wenn alles daran scheitern würde.«
Sie gab nicht zu, dass er recht hatte und sie beeindruckt war. Dennoch fiel ihm ihre besänftigte Stimme auf: »Nun denn, das haben Sie ja jetzt. Und wie gedenken Sie, geht es weiter?«
»Als Erstes finden wir die Pferde«, schlug er vor, »und dann, so hoffe ich, setzen wir unser interessantes Gespräch von letztens fort.«
Die Pferde fanden sie tatsächlich erst ein paar Stunden später, in denen sie zuerst über die Landschaft, dann über Gedichte und schließlich über ihre Kindheit philosophiert hatten, dabei aber tunlichst verschwiegen, wie sehr sie in den letzten Tagen, ob der jüngsten Ereignisse gelitten hatten.
Nach dem Ball war Theodor erst genauso wütend gewesen wie Alvine. Erst auf sie, schließlich auf sich selbst. Und der Duft ihrer Haare hatte sich quälend in seiner Nase festgesetzt, wenngleich diese wie jedes Jahr von seiner allergischen Rhinitis juckte. Dann war er Hals über Kopf losgestürmt und hatte zum Glück das einzige Familienmitglied Hoheloh angetroffen, das auf seiner Seite war.
Dorothea saß mit ihrem Dienstmädchen Alma in der offenen Kutsche, um zu einem Termin zu fahren. Sie durchquerte gerade das Haupttor des hoheloh’schen Anwesens, als sie den Hünen auf seiner wunderschönen braunen Stute herannahen sah und sofort sein Gesicht erkannte.
Entschlossen hob sie ihren Arm, sodass er sie bemerkte. Sie stieg aus der Kutsche und lief ein paar Schritte mit ihm. Sie ließ sich leidenschaftslos von ihm rekonstruieren, was geschehen war, und er offenbarte auch, dass Alvine und er einander wenige Tage zuvor bereits getroffen hatten. (Woraufhin sie schlussfolgerte, dass daher die letzte Grübelei ihrer Tochter rührte.)
Sie erzählte ihm sodann etwas über Alvines Lebens- und Bildungsweg, und dass es das Beste sei, wollte er künftig mit ihr Umgang pflegen, diesen Zwist besser heute als morgen aus dem Weg zu räumen. Kaum zehn Minuten hatten sie für all das gebraucht.
Theodor kam diese Erlaubnis nur allzu günstig, da er sich vor Sehnsucht fast verzehrte. Mit dem nächsten Zug kam er angefahren, nahm sich in der Dorfschenke ein Zimmer, begrüßte seine alte Flamme, die Wirtstochter, die mittlerweile dreifache Mutter war, im Vorbeigehen und ritt auf dem Leihpferd Asra zu Friedgolds Hof.
Dort erklärte ihm ein mehr als verwirrter Stallmeister, dass Alvine unterwegs sei, er aber warten könne. Doch das war für Theodor keine Alternative und so stürmte er stundenlang durch den Wald, bis er auf einmal ihren Geruch wahrzunehmen schien.
Wie sie feststellten, lahmte Asra und Strumpf hatte nichts Besseres zu tun, als ihm noch immer an seinem Ohr herumzuknabbern. Nur langsam traten sie den Rückweg an, bei dem sie die Pferde führten und das Gespräch fortsetzten.
Theodor beeindruckte Alvine zusehends, vor allem als er durchblicken ließ, dass er stark mit der aufstrebenden Arbeiter*inpartei sympathisierte und einige Funktionär*innen persönlich kannte.
»Kennen Sie Frau Luxemburg?«
»In natura habe ich sie leider noch nicht getroffen«, musste er zugeben, »doch wie ich hörte, ist auch sie eines Ihrer Vorbilder?«
»Man kann es so vielleicht nicht sagen, ich bewundere sie – gewiss. Aber ich habe die Befürchtung, dass sie in ihren Kämpfen für die Arbeiterklasse die Frauenrechte übersieht.«
»Sie unterteilt die Arbeiterschaft nicht in Frauen und Männer. Sie glaubt an eine gemeinsame Befreiung, sollte diese erst errungen sein. Damit ist sie beileibe nicht die Einzige«, sinnierte Theodor.
»Nur frage ich mich, ob es so einfach ist, wie sie es sich vorstellt.«
»Die Frauenunterdrückung scheint mir jede Klasse zu betreiben«, sagte er traurig, »daran sieht man allerdings auch, wie gleich wir alle sind.«
»Sie scheinen mir ja doch ein kluger Kopf zu sein.«.
»Danke«, lächelte er.
»Wie war es Ihnen an jenem Abend dann nicht möglich, ihn zu benutzen?«, fragte sie erneut, diesmal jedoch weitaus sanfter.
»Ich war überwältigt, Fräulein Hoheloh. Von der Tatsache, dass Sie besagte Tochter waren und davon, was das Leben so für mich bereithielt. Und zudem verstanden wir uns so gut, dass ich mein Glück kaum fassen konnte.«
»Auch ich muss zugeben, dass ich mich amüsiert habe.«
»Das freut mich.«
Als es Alvine bewusst wurde, sprudelte es sodann aus ihr heraus: »Es ist äußerst erfrischend, einmal die Meinung eines einsichtigen Herren zu erfahren, der mir nicht so nahe steht wie meine Brüder oder mein Vater.«
Theodor verbarg die Enttäuschung über das Nicht-nahe-Stehen und fragte stattdessen: »Was halten die denn davon?«
»Ich will es so sagen: Ich habe meine Familie wohl Schritt für Schritt daran gewöhnt. Da es bei uns Sitte ist, alles zu bereden, was wir erlebt und gelernt haben, und da sie wohlwollende Menschen sind, erkannten sie die Missstände schon vor meiner Geburt. Zudem wuchsen meine Brüder mit dem Wissen auf, dass meine Eltern Geschäftspartner sind. Sie billigten ihren Ehefrauen das gleiche Recht zu. Sie hatten die Wahl, ob sie den vollkommenen Schutz ihrer Männer genießen und nur innerhalb des Hauses walten wollten oder ob sie mit ihnen zusammen Geschäftliches und Privates organisieren. Marie und Rebecca wählten das Beispiel, das auch meine Eltern leben: Unser Unternehmen funktioniert, weil meine Mutter gesellschaftet und mein Vater die Aufträge, die sie uns ermöglicht, betreut und abwickelt.«
»Uns?«
»Ich sagte Ihnen bereits, dass ich ihm in der Firma zur Hand gehe?«
»Gewiss und das verhält sich wie genau?«
Alvine bat ihn erst um Verschwiegenheit und er schwor bei seiner Mutter, ehe sie ihm verriet, dass sie selbst mehr und mehr die Geschäfte leitete, Aufträge aushandelte und Kaufverträge – wenn auch postalisch – schon ein ums andere Mal unterzeichnet hatte.
»Das ist äußerst faszinierend, Ihr Vater scheint Sie sehr zu lieben.«
»In allererster Linie glaubt er an mich und meine Fähigkeiten«, gab sie stolz zurück.
»Chapeau! Was für beneidenswerte Familienverhältnisse.«
Sie vernahm wohl die Spur Trauer in seiner Stimme und schlussfolgerte: »Ist es bei Ihnen zu Hause anders?«
Nun ließ er sich den Schwur auf ihre Mutter abnehmen, dass sie mit niemandem darüber sprechen würde. Sie lachten, ehe er fortfuhr: »Leider ja. Vor allem mein Vater ist äußerst unzufrieden mit mir. Schon immer. Es war egal, was ich tat oder sagte. Meinen Bruder allerdings mag er.«
»Sie haben einen Bruder?«
»Ja, Fräulein Hoheloh«, lachte er, »wussten Sie nicht, dass er eigentlich derjenige war, der Ihnen an jenem Abend vorgestellt werden sollte?«
»Nun veralbern Sie mich.«
»Mitnichten! So war es. Doch als ich sah, um wen es sich handelte, Sie werden mir verzeihen, entschied ich, lieber dazwischen zu gehen.«
Alvine lachte herzlich: »Ich muss gestehen, niemand hatte mir den Vornamen desjenigen verraten, den ich kennenlernen sollte.«
»Nun, das war mein Glück. Sonst hätten Sie mir geantwortet: Verzeihung, ich soll heute mit Konrad tanzen.«
»Das hätte ich gewiss nicht«, gab sie lächelnd zurück.
Mittlerweile waren sie am Gestüt angekommen und sofort wurde der Tierarzt gerufen, der bei Asra eine Sehnscheidenentzündung im vorderen linken Huf diagnostizierte. Vermutlich war er bei der wilden Jagd in ein Erdloch getreten.
Alvine empfand Mitgefühl für das Tier, schließlich hatte ihr Pferd das zu verantworten – folglich musste sie die Schuld auf sich nehmen. Sie besuchte am Abend den Wirt und versprach, dass Asra die beste Pflege erhalten werde und solange in einem ihrer Ställe versorgt würde.
Ihr Abendbrot genehmigte sie sich im Wirtshaus, zusammen mit Theodor Fürstenberg – worauf eine Welle der Spekulationen in dem kleinen Ort losbrach.
»Werden Sie noch eine Weile hier bleiben oder gedenken Sie, bereits morgen zu fahren?«, fragte sie ihn, als sie sich verabschiedeten.
»Wenn es Ihnen recht ist, würde ich Sie morgen gerne zu einem Bootsausflug mitnehmen und erst übermorgen gen Heimat aufbrechen.«
»Oh gewiss, das wäre zauberhaft«, lachte sie.
Er schmunzelte und küsste ihre Hand.
Daraufhin konnte sie nicht anders, als zu lächeln. In ihr regte sich zu ihrer Verwunderung ein Gefühl, das sie bisher nur für Frauen empfunden hatte – zuletzt für ihre Gönnerin. Er lächelte zurück und ihr Herz tat einen Satz.
Entgegen seiner Hoffnung erschien Alvine am nächsten Tag nicht allein, sondern mit einer hageren schwarzen Anstandsdame in einem dunklen, hochmodischen Kleid am vereinbarten Treffpunkt. Sie wurde ihm als die Kammerzofe Greta vorgestellt, konnte zwischen zwanzig und fünfzig Jahren alt sein und war ganz offenkundig nicht einverstanden mit den Plänen der jungen Leute, eine Ruderpartie zu unternehmen.
Aber Alvine wirkte fröhlich, geradezu euphorisch, davon ließ sich Theodor anstecken und ruderte sie bereitwillig den schattigen Fluss entlang.
Verzückt stellte er fest, wie gut ihr das helle Sommerkleid stand, dazu hatte sie einen schneeweißen dünnen Schal über ihr Haar gelegt und trug gänzlich damenhaft einen aufgespannten Sonnenschirm bei sich. Kaum waren sie ein paar Schläge aufs Wasser hinaus gerudert, entledigte Alvine sich ganz nebenbei ihrer zierlichen Stiefelchen, ihrer blauen Strümpfe und tauchte die nackten Füße ins Wasser.
Theodor saß auf der mittleren Bank, Gretas Blick im Nacken und Alvine thronte freudig lachend auf der hinteren. Wieder plauderten sie angeregt über dieses und jenes nur leider, das verstand auch Alvine schnell, konnten sie unter diesen Umständen nicht frei über seine Familie reden. Dabei hätte er ihr so gerne das Herz ausgeschüttet und sie war so neugierig gewesen, wie die Kindheit dieses Menschen verlaufen war.
So redeten sie über Politik, schließlich über Literatur, als sie auf einmal ein leises Röcheln vernahmen. Wie sie nun sahen, erschienen all diese Themen für Greta bei Weitem weniger interessant, denn sie schnarchte zahm vor sich hin.
Die jungen Leute kicherten und so zog auch Theodor seine Stiefel aus, um seine Füße kurz im Wasser abzukühlen. Schließlich stellten sie die Zehen voreinander ab und vergleichen kindlich amüsiert den Größenunterschied und die verschiedenen Hauttöne.
»Greta muss Ihnen vertrauen«, sagte Alvine dann, »sonst wäre sie nicht eingeschlafen.«
»Warum auch nicht? Ich hatte nicht vor, Sie im See zu ertränken«, er zwinkerte ihr zu.
»Ich gehöre nicht zu jenen Menschen, die sich ängstigen jeder Mann würde bei der ersten Gelegenheit über eine Frau herfallen, nur weil sie allein sind. Und wenn doch, gibt es noch immer die gute alte Hutnadel.«
Theodor lächelte überrascht: »Da Sie heute keinen Hut tragen, darf ich wohl sagen: Danke, dass Sie mir vertrauen.«
»Was wäre das für ein Leben, würde ich jeden Vergewaltiger an jeder Ecke fürchten«, gab Alvine müde zurück.
Seine Mundwinkel zuckten merklich.
»Oh Pardon, wenn Ihnen das Thema unangenehm ist«, wiegelte sie daraufhin ab.
»Es gibt gewiss Angenehmere, aber da Sie darüber sprechen wollen: Ich bin selbstbewusst genug für einen Austausch.«
»Ich bitte Sie, ich werde Rücksicht auf Ihren Selbstwert nehmen.«
»Damit hat das nichts zu tun, ich sagte ja, dass mein Selbstvertrauen ausreicht, um mich mit einer intelligenten Frau über Urängste auszutauschen.«
»Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind nicht das Gleiche, Herr Fürstenberg. Ich traue Ihnen durchaus zu, dass Sie allem gewachsen sind, aber bitte biedern Sie sich nicht an.«
»Sie haben eine hohe Meinung von mir.«
»Warum sollte ich nicht? Sind Sie nicht der Ansicht, wertvoll zu sein?«
»Darüber habe ich bisher nie nachgedacht.«
Sie lächelten einander traurig an und es war offensichtlich, dass es zu dieser Angelegenheit noch einige Fragen geben würde.
Dann schreckte Greta aus dem Schlaf auf und ihrer beiden Gesichter stoben auseinander, um sofort das Gespräch über Handelsabkommen und Verkaufsstrategien fortzuführen und schließlich angeregt das Flottenwettrüsten zu diskutieren.
Zum Abendbrot lud sie ihn ein. Das rustikale Esszimmer ihrer Großeltern, verziert mit Geweihen und anderen Jagdtrophäen, wirkte kühl. Der Dielenboden knarrte, wenn Schritte ihn belasteten.
Noch erhitzt vom Tage verzichteten sie darauf, ein Feuer im Kamin entzünden zu lassen. Sie saßen voreinander an einem Ende des zwei Meter langen Esstisches. Als das Personal endlich fort war, befragte sie ihn zu seiner Kindheit.
Er erzählte vom Lungenleiden seiner Mutter, von den strengen, aber wohlwollenden Großeltern und vom jähzornigen Vater. Beim Tod seiner Großeltern war er sieben Jahre alt gewesen und man brachte ihn dauerhaft ins Stadthaus, wo er zuvor nur alle paar Monate für wenige Tage zu Besuch gewesen war. Plötzlich waren all das Grün um ihn herum und die Spielkameraden verschwunden. Auch die Mutter blieb lange verschollen, weil, so verstand er irgendwann, sie sich am Meer auskurierte. Wenn er sie vermisste oder fragte, wann er heimdürfe (Heim hieß zurück in das Haus der Großeltern), dann schrie der Vater ihn an. Und sollte er darauf weinen, brüllte er noch mehr, weil Jungen nicht flennten.
»Wie furchtbar«, warf Alvine ein, »warum soll es generelle Unterschiede geben in der Gefühlswelt der Geschlechter?«
»Das mag wohl sein, jedenfalls trifft Ihre Vermutung auf mich zu. Meine Mutter sagte mir des Öfteren, dass ich ein viel gefühlvolleres Gemüt hatte, bevor mein Vater mich darin unterwies, dass ich es nicht haben sollte.«
»Ganz offensichtlich blieb Ihnen aber ein großer Teil davon erhalten.«
»Das mag vielleicht auch Ihr Umgang sein.«
Alvine errötete hold lächelnd.
Sie kamen wieder auf die Thematik Selbstwertgefühl zu sprechen und zu dem Schluss, dass er über wenig davon verfügte, jedoch hingegen ein starkes Selbstbewusstsein in ihm wohnte. Alvine meinte, bei ihr sei es andersrum, denn sie übte sich in der Selbstsicherheit. Nur ihre nichtvorhandene Geduld, vor allem mit sich selbst, mache ihr oft einen Strich durch die Rechnung.
»Wir haben beide noch viel zu lernen«, schloss sie und lachte mit ihm, froh darüber, einen Weggenossen gefunden zu haben.
Zum Abschied verbeugte er sich und küsste abermals ihre Hand, diesmal für einige sehnsuchtsvolle Augenblicke.
»Und morgen müssen Sie schon gehen?«, rutschte es ihr traurig heraus.
»Wenn Sie wünschen, kann ich morgen auch noch bleiben«, erwiderte er lächelnd, »mein Vater wird sowieso toben, egal wie lange ich fort sein werde.«
»Lassen Sie uns morgen reiten gehen«, schlug sie vergnügt vor, »ich kann Ihnen ein ausgezeichnetes Rennpferd leihen.«
Theodor tat am Abend und morgens nach dem Aufwachen etwas, das er ewig nicht getan hatte: Er betete. Als er feststellte, dass er erhört worden war, fiel er fast von seinem nichtvorhandenen Glauben ab – Alvine erschien wieder in Hosen.
Wie versprochen stellte sie ihm einen weiteren Liebling ihrer Zucht zur Verfügung: Heros, ein Rappe, dessen muskulöser Rücken seinesgleichen suchte. Der Hengst beschnupperte Theodors dargebotene Handfläche neugierig.
»Das ist ein gutes Zeichen. Wobei ich mir schon dachte, dass er Ihre Ausgeglichenheit spüren wird.«
»Mag er Äpfel? Ich habe mir vom Wirt welche als Wegzehrung mitgeben lassen.«
Die Gefragte lachte und kam nicht umhin, die sich ihr bietende Szene herzergreifend zu finden. Gierig schleckte die riesige Pferdezunge die Apfelspalten von Theodors Händen. Als Alvine auffiel, wie sehr ihr seine langen und dennoch kräftigen Finger gefielen, biss sie sich unmerklich auf die Lippe.
Kurz darauf stieg er gekonnt in den Sattel und ließ den Hengst ruhig auf dem Hof umher traben. Als Pferd und Reiter sich offenbar angefreundet hatten, saß auch Alvine auf den ungeduldig scharrenden Strumpf auf und gab ihm wuchtig die Sporen.
Eine wilde Jagd am Wasser entlang, über die Waldwege, die sich bis zu den Feldern erstreckten, folgte. Dann lenkte sie Strumpf durchs Weizenfeld und Theodor ließ seinen schwarzen Hengst amüsiert folgen.
Inmitten all der goldenen Halme wuchs eine schattige Baumreihe, wo sie die Tiere grasen ließen und Theodor überrascht feststellte, dass es Damen gab, die auf Bäume kletterten.
Unmerklich putzte er sich die von den Pollen triefende Nase und erklomm ebenfalls die starke Eiche.
»Hier oben weht es und wir sind im Schatten«, sagte sie, auf einem Ast in fünf Metern Höhe thronend, als er sich neben sie setzte, »das wird uns Kühlung verschaffen.«
Heute waren sie beide zu fröhlich, um über seine Kindheit zu reden, oder über Politik zu streiten. Sie gaben lieber heitere Anekdoten zum Besten und tauschten sich schließlich über ihre Lieblingspferde aus.
Doch dann lief das Gespräch in ernstere Bahnen und bald kamen sie beim Thema Glauben an. Nachdem er wusste, dass sie beide dieselbe Konfession teilten, sagte er: »Noch nie habe ich mich gewagt, das eine Dame zu fragen, aber sagen Sie: Folgen Sie Ihrem Gott treu, obgleich er Ihresgleichen benachteiligt?«
»Mein Gott tut dies nicht, Herr Fürstenberg. Menschen benachteiligen mich. Die hohe Macht kann nichts dafür, dass die Menschen, denen freier Wille gegeben wurde, die Gesetzte des Universums verdrehen.«
Völlig verblüfft sah er sie an: »Also sind Sie doch nicht christlich?«
»Ich wurde christlich getauft, aber anders als die meisten, hatte ich dank der Reisen mit meinen Eltern schon früh die Gelegenheit, mir von der Welt ein spirituelles Bild zu machen. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich glaube an eine Allmacht, die uns lenkt. Nicht an einen weißen Mann in den Wolken, der mich als Mädchen schuf und deswegen unterdrücken will.«
Theodor sah sie gebannt an und lächelte. Seine liebevollen Blicke wurden ihr zweifellos gewahr und schmeichelten ihr. Dennoch und das verwunderte sie zusehends, wirkte er kein bisschen bedrohlich oder auch nur einengend auf sie, wie es mit vorherigen Verehrern der Fall gewesen war. Sie gab sich, als sei sie mit einem Bruder unterwegs – einer, der sie nicht scherzhaft gängelte, sondern ihre knabenhaft anmutenden Gewohnheiten faszinierend fand.
»Kommen Sie heute wieder zum Abendessen?«, fragte sie, als sie die Pferde beim Stalljungen abgaben.
»Das kommt darauf an – was gibt es denn Feines?«
Im ersten Moment fiel sie auf seinen Witz herein und im nächsten knuffte sie ihn gegen den Arm und lachte: »Seit wann genügt Ihnen meine Gesellschaft zum Essen nicht mehr?«
»Vater tobt! Komm«, lautete das Telegramm, das ihn in der Pension erwartete.
Man hatte ihn also gefunden und zurück in die Realität beordert. Theodor fiel seine Mutter ein, die schwerstleidend unter den Wutausbrüchen ihres Gatten zu leben hatte. Da konnte der Sohn ihm nicht noch mehr Gründe liefern. Obgleich der Alte immer wieder betonte, wie sehr ihm die Anwesenheit des Jüngeren in seinem Haus zuwider sei – verschwand er für ein paar Tage, war dies auch verkehrt.
Alvine fiel der Trübsinn in den Augen ihres Gastes wohl auf und so bemühte sie sich, ihn aufzumuntern. Zuerst präsentierte sie ihm das Menü, welches sie mit Hilfe der Köchin zusammengestellt hatte, und entlockte ihm schließlich ein Lächeln, als sie auf das Dessert verwies: »Sie können Marthas Käsekuchen nur lieben. Das Rezept dafür zu perfektionieren, hat sie so dick gemacht.«
»Verzeihen Sie, dass ich heute Abend nicht so amüsant bin wie sonst«, schmunzelte er.
»Ach, machen Sie sich darum keine Sorgen«, beschwichtigte sie liebevoll und schob sich einen weiteren Löffel kalte Gurkensuppe in den Mund, »jeder hat mal miese Laune. Aber morgen beim Reiten, wird der Wind um Ihre Nase wehen und Sie fühlen sich wieder wohl.«
»Fräulein Hoheloh, Sie haben gekleckert«, grinste er verlegen.
Alvine wischte sich lachend mit einem Finger einen Tropfen vom Kinn, den Zweiten von der Bluse und leckte ihn wonnevoll ab. Theodor wurde gewahr, dass er den Anblick ihrer besonderen Tischmanieren nun eine ganze Weile nicht würde genießen dürfen. Und wie gern mochte er dieser Frau beim Essen zusehen. Sie speiste genüsslich, mit viel Appetit, war allen Gerichten zugetan und rupfte ihr Brot Stück für Stück, bevor sie es mit Butter bestrich, um es mit den Fingern zum Mund zu führen.
Er seufzte schwer, ehe er zugab, was für eine Nachricht ihn heute ereilt hatte und er seiner Mutter zuliebe entschieden hatte, heimzufahren.
»Also treffen wir uns in drei Wochen wieder, wenn ich von der Ostsee zurück bin?«, Alvine war zu geschmeichelt von seinem Bedauern, als dass sie hätte sehr traurig sein können, »ich werde Ihnen eine Postkarte schicken, dann vergeht Ihre Wartezeit schneller.«
»Wir sehen uns wohl erst in vier Wochen«, erwiderte er. »Meine Mutter hat, wie Sie wissen, ein Lungenleiden, das sie wie jedes Jahr in einem Sanatorium etwa eine Stunde zu Pferd von den baltischen Kaiserbädern entfernt auskuriert. Anstelle meines Bruders begleite ich sie in diesem Sommer und werde eine Woche bei ihr bleiben, bis sie sich eingelebt hat.«
»Dann verpassen wir uns also ganz knapp?«
»Es sieht so aus. Aber bitte machen Sie sich keine Gedanken. Diese eine Woche müssen Sie wohl auf mich warten.«
Theodor sah ihre Enttäuschung, doch er würde an seinem Plan nicht rütteln. Seine Mutter brauchte ihn zu Hause, es wäre mehr als egoistisch, bei Alvine zu bleiben und seiner Glückseligkeit zu frönen. Das Gespräch bei Tisch erkaltete und so verbeugte er sich zum Abschied nur höflich und schritt von dannen.
In der Nacht streifte sie im Zimmer auf und ab, wieder einmal in der Hoffnung, ihr Kopf und ihr Herz würden Ruhe geben. Etliche Male überlegte sie, ob sie im Morgengrauen zum Bahnhof reiten sollte, um ihn noch einmal kurz zu sehen.
Aber wo bliebe da ihr Stolz? War es nicht schon zu viel verlangt, dass sie auf ihn zu warten hatte?