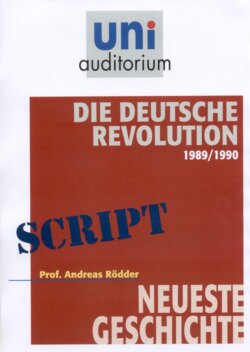Читать книгу Die Deutsche Revolution 1989/1990 - Andreas R - Страница 5
II. Das Ende des SED-Staates
ОглавлениеGorbatschow war Kommunist, er war Idealist, und er war Optimist. Nur so jemand konnte, nachdem er 1985 zum mächtigsten Mann der östlichen Welt aufgestiegen war, einen Reformprozess in Gang setzen, der den Kommunismus retten und verbessern sollte. Bald allerdings verselbständigten sich die Reformen, und Gorbatschow, der Zauberlehrling, wurde die Geister, die er gerufen hatte, nicht mehr los. Statt den sowjetischen Kommunismus zu retten, löste Gorbatschows Reformpolitik seinen Zusammenbruch aus – und sie machte die deutsche Revolution erst möglich, weil Gorbatschow, als das sowjetische Imperium zusammenbrach, den Einsatz des letzten Mittels verzichtete, um die sowjetische Herrschaft doch noch zu retten: auf den Einsatz von Gewalt.
Für die SED hatte das tödliche Folgen. „Erich, ich sage dir offen, vergesse das nie”, so hatte Leonid Breschnew im Juli 1970 zu Erich Honecker gesagt: „die DDR kann ohne uns, ohne die SU, ihre Macht und Stärke nicht existieren. Ohne uns gibt es keine DDR.” Ohne Unterstützung aus Moskau war die überalterte Führung des SED-Staates in frappierendem Maße hilflos. „Den Sozialismus in seinem Lauf”, so erinnerte Honecker noch im Sommer 1989 an die „alte Erkenntnis der deutschen Arbeiterbewegung, hält weder Ochs noch Esel auf.” Das Politbüro debattierte über die Versorgung mit Dachpappe, Gewürzen und Büstenhaltern, und als sich die Krise mit dem Flüchtlingsstrom über Ungarn aufbaute, brachte Günter Mittag die vorherrschende Haltung auf den Punkt: „Ich möchte auch manchmal den Fernseher zerschlagen, aber das nützt ja nichts.”
Das waren die Voraussetzungen für die deutsche Revolution – aber damit war sie noch nicht geschehen. Dafür brauchte es das Zutun der Bürgerbewegung in der DDR, jener Verbindung, die sich im Herbst 1989 für wenige, aber entscheidende Wochen zusammenfand. In der Bürgerbewegung der DDR im Herbst 1989 flossen – etwas vereinfacht gesagt – zwei Strömungen zusammen. Eine der beiden war die Oppositionsbewegung im engeren Sinne. Sie hatte bis 1989 in der DDR eine Existenz am Rande der Gesellschaft geführt, unter den Augen der Staatssicherheit und im Griff der Staatsgewalt.
Dieser Staatsgewalt blies am Ende der achtziger Jahre allerdings der frische Wind aus Moskau ins Gesicht, den die Opposition als Morgenluft witterte. „Von der Sowjetunion lernen, heißt siegen lernen”, hatte die SED stets propagiert – in den Jahren der Perestroika kehrte sich die orthodoxe Parole mit einem Male gegen die Staatspartei der DDR. Die SED heischte unterdessen nach Bestätigung und suchte sie in den Kommunalwahlen vom 7. Mai 1989 – damit allerdings beförderte sie ihren eigenen Untergang. Wie eh und je waren die Ergebnisse gefälscht. Am Wahltag aber zogen erstmals auf breiter Front oppositionelle Wahlbeobachter auf. Und als die veröffentlichten Ergebnisse offenkundig dem widersprachen, was sie im Wahlbüro beobachtet hatten, erstatteten sie Anzeige.
Die Reaktion der Staatsmacht war altbekannt: Anzeigen, so hieß es in einer Anordnung „sind ohne Kommentar entgegenzunehmen. Nach Ablauf der vorgesehenen Fristen [... ] ist von den jeweils zuständigen Organen zu antworten, daß keine Anhaltspunkte für den Verdacht einer Straftat vorliegen. [...] Beschwerden gegen die getroffenen Entscheidungen sind [...] abschlägig zu entscheiden.” So hatte die Staatsmacht es immer gehalten. Neu hingegen war, dass es damit nicht getan war.
Die Kommunalwahlen vom 7. Mai waren die Initialzündung dafür, dass sich die Opposition in der DDR neu und breiter als zuvor formierte. Zunächst jedoch kam die Entwicklung – im wörtlichen Sinne – auf anderen Wegen in Gang. Es war die massenhafte Ausreisebewegung, über Ungarn, dann über die bundesdeutschen Botschaften in Prag und in Warschau, die das SED-Regime erheblich unter Druck setzte – zumal vor den groß angelegten Vierzig-Jahr-Feiern der DDR. Bald kam der Druck in die DDR zurück. Wenn es dort nun nicht mehr hieß „wir wollen raus”, sondern „wir bleiben hier” – dann klang dies mit einem mal wie eine Drohung.
So begann im Spätsommer 1989 die zweite Strömung der Bürgerbewegung anzuschwellen: die Massenbewegung von Ostdeutschen, die mit einem mal Mut gegen die Obrigkeit fassten, gehen eine Obrigkeit, die sie jahrzehntelang bevormundet und entmündigt hatte. In einer plötzlichen Welle der Solidarisierung und der Politisierung breiter Teile der Bevölkerung wurde die Sehnsucht nach Freiheit stärker als die Erfahrung der Angst und die Gewohnheit der Resignation.
„Wir sind das Volk” – mit dieser Losung formulierte die Bürgerbewegung gegen die sozialistischen Machthaber und ihren Anspruch, die Partei habe immer recht, eine Forderung, die tief eingelagert war in die Geschichte der bürgerlichen Moderne: die Volkssouveränität. Es war gerade der Anspruch gegenüber den Herrschenden gewesen, das „Volk” zu sein, mit dem die bürgerlichliberale Bewegung seit der Aufklärung ihr Begehren nach Mitsprache und Machtteilhabe begründet hatte.
Und eine weitere zentrale Parole war: „keine Gewalt” – betende und friedliche Menschen mit Kerzen, bald auch mit Humor und Ironie, sie liefen ganz den Erwartungen und Verhaltensweisen, den Feindbildern und den Sprachmuster der staatlichen Führung und der Sicherheitskräfte zuwider, und sie machten diese um so hilfloser. Innerhalb von vier Wochen zerfiel die Staats- und Parteiführung der DDR – es waren die halkyonischen Wochen der Bürgerbewegung, nach der Kapitulation der Staatsmacht am 9. Oktober in Leipzig. Am 4. November, auf dem Ost-Berliner Alexanderplatz, erreichte die Bürgerbewegung in der DDR ihren Höhepunkt – und zugleich ihren Wendepunkt. Denn fünf Tage später wurde wieder alles anders als gedacht.