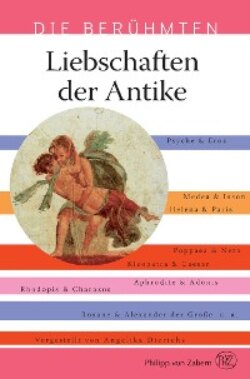Читать книгу Liebschaften der Antike - Angelika Dierichs - Страница 10
Оглавление[Menü]
Jüngling mit wechselndem Wohnsitz und Göttinnen mit aufgezwungenen Terminen
Aphrodite und Adonis
Dauer der Beziehung: Unbestimmt
Art der Beziehung: Unehelich
Kinder: Keine
Aphrodite, bekannt als: Liebesgöttin
Eltern: Zeus und Dione
Mutterlose Geburt: Mit einer Sichel entmannt Kronos seinen Vater Uranos, den Himmelsgott. Infolge der Verstümmelung fallen Blutstropfen auf die Erde. Sie bilden Erinyen, Giganten und Nymphen. Das ins Meer stürzende Glied des Uranos gebiert Aphrodite, die an Zyperns Strand den Fluten entsteigt.
Erscheinungsbild: Voll Anmut, Grazie und Schönheit; prächtig gekleidet; veilchenbekränzt
Unveränderliche Kennzeichen: Schönäugig, schönhalsig, schönbrüstig; sie trägt den Kestos, ein Busenband, das Liebe, Liebesverlangen und Liebesgeplauder garantiert; Attributtiere: Gans, Schwan, Taube, Ziegenbock
Hauptwohnsitze: Götterwelt; Paphos auf Zypern
Adonis, bekannt als: Begehrter Jüngling
Eltern: Kinyras (Theias) und Myrrha (Smyrna) oder Phoinix und Alphesiboia
Erscheinungsbild: Schön
Unveränderliche Kennzeichen: Keine
Hauptwohnsitze: Unterwelt; Götterwelt
Es war einmal …
Vorgeschichte – ein Knabe und zwei Göttinnen
Beleidigt fühlte sich die Liebesgöttin Aphrodite, weil ihr die junge Myrrha zu wenig Beachtung schenkte. Sie bestrafte das Mädchen mit einer unbeherrschbaren Liebe zu ihrem Vater Kinyras. Die Amme half und führte ihm das Mädchen zu. Er erkannte seine Tochter nicht und schwängerte sie. Als der König die Wahrheit erfuhr, verfolgte er Myrrha mit dem Schwert, um sie zu töten. Erbarmen zeigten die Götter und verwandelten die Schwangere in einen Myrrhenbaum, dessen Rinde aufplatzte, damit die junge Frau mit ihrem Sohn Adonis niederkommen konnte. Die Liebesgöttin Aphrodite sah den Neugeborenen, gewahrte seine Schönheit, versteckte ihn in einer Truhe und brachte ihn zur Unterweltsgöttin Persephone, damit sie ihn pfleglich hüte. Auch diese erkannte nun die Schönheit des Knaben und wollte ihn für sich behalten. Aphrodite und Persephone kämpften um das Baby, als sei es ihr wertvollstes Spielzeug. Heftiger Streit entbrannte und autoritäre Schlichtungsmodi waren unerlässlich. Zeus, der oberste der olympischen Götter, entschied: Adonis gehört vier Monate Aphrodite, vier Monate Persephone und vier Monate darf er allein über sich verfügen. Obgleich im Auftrag des Zeus um ein Urteil gebeten, bestimmt die Muse Kalliope anders: Adonis bleibt ein halbes Jahr bei Persephone und ein halbes Jahr bei Aphrodite. Letzterer gefällt dieser Richtspruch gar nicht. Wütend reagiert die Liebesgöttin auf Kalliopes Entscheidung und steuert den Tod von Kalliopes Sohn Orpheus.
Tizian: „Venus und Adonis“, 1553. Öl auf Leinwand, 86 x 207 cm. Museo del Prado, Madrid
Aphrodite
Was sie für Adonis ist, ist sie auch für andere. Sie verkörpert süßes Verlangen und sinnliche Lust, schenkt beides anderen; befiehlt Leidenschaft; agiert mit mächtigem Nachdruck; übt trotz ihres zauberhaften Wesens Gewalt aus; stiftet Frieden in der Natur; dominiert Winde und Wolken; schützt Blüten und Bäume; kümmert sich um das Meer und die Seefahrt; liebt Düfte und Räucherwerk, Salben und Öle; bevorzugt Weihrauch als Lieblingsopfer; favorisiert Goldschmuck; zeigt sich in der Bildenden Kunst bekleidet, teilbekleidet oder nackt.
Mit roten Blumen endet die eigentliche Liebesgeschichte
Sehr gern verzichtet Adonis auf die ihm durch Zeus gewährten Urlaubswochen zur eigenen Nutzung. Bereitwillig schenkt er sich Aphrodite in seinen vier freien Monaten. Das passt sowohl zur „romantischen Vorstellung der Konstellation Liebespaar“ als auch zur anderen Version des Mythos, nach der Aphrodite den umworbenen Adonis erstmalig sieht, als er schon zum hübschen jungen Mann herangewachsen ist. Sie verliebt sich heftig in ihn und verbringt viel Zeit mit dem schönen Jüngling. Beim Sichten der Denkmäler aus der bildenden Kunst ist die Liebespaarsituation am innigsten und erotischsten wiedergegeben auf einer Applique, die zu einem korinthischen Bronzespiegel aus der Zeit um 350–325 v. Chr. gehört (Paris, Musée du Louvre, Inv. Nr. 1715). Adonis sitzt auf einem Stuhl, Aphrodite schmiegt sich hingebungsvoll in seinen Schoß und hat die Arme um seinen Hals gelegt. Beider Gesichter sind sich sehr nahe. Aphrodite blickt Adonis mit großem Verlangen an. Der Moment unmittelbar vor dem Kuss ist eingefangen. Diese Darstellung versinnbildlicht eingängig, wie sehr Aphrodite dem Adonis zugetan ist, und lässt verstehen, dass sie sich um den Geliebten sorgt, wenn er seine Jagdleidenschaft auslebt. Aus Angst um sein Leben bittet sie ihn, nur Kleinwild zu erlegen. Vergeblich wohl, denn noch in der Blüte seiner Jahre wird Adonis getötet, weil er einen bedeutenden Rivalen und Aphrodite einen ihrer stärksten Liebhaber, den Kriegsgott Ares/Mars, unterschätzt. Dieser verwandelt sich nämlich während einer Großwildjagd in einen Eber und durchbohrt Adonis mit einem Hauer den Oberschenkel. Das traurige Ereignis ist anschaulich geschildert in: M. Benjamin Hederichs, Gründliches Lexicon Mythologicum (1724). „Weil aber Mars die Venerem auch liebete, und daher nicht vertragen kunte, daß sie ihm den Adonin vorzog, verwandelte er [Mars] sich selbst in ein wildes Schwein, und stieß also demselben auf der Jagd auf, welcher denn an dessen Erlegung eine sonderbare Ehre zu erlangen suchte, und sich mithin an ihn machte, allein, auch so empfangen wurde, daß er selbst mit dem Leben bezahlen mußte.“ Die Liebesgöttin klagt, findet keinen Trost, weint, lässt aus dem Blut des Toten die blutroten Anemonen wachsen. Man liest auch von Adonisröschen bzw. ganz allgemein von roten Blumen, die auf gleiche Weise entstanden sind. Einst erhielt Adonis einen Kult mit besonderen Feierlichkeiten. Sie fanden alljährlich Mitte Juli statt. Frauen aus allen Gesellschaftsschichten betrauerten den Tod des Adonis, indem sie nächtens ekstatisch tanzten.
Lasterhaftes
Die Adonis-Feste (Adonien) hatten den „schlechten Ruf“, voreheliche Formen von Sexualität zu begünstigen, und die Schwestern des Adonis instrumentalisierte man zu den „Erfinderinnen der Prostitution“.
Der Dichter Theokrit (1. Hälfte 3. Jh. v. Chr.) berichtete in einem Gedicht anschaulich über ein Adonis-Fest im ptolemäischen Alexandria, an dem die unternehmungslustigen Frauen Praxinoa und Gorgo hocherfreut teilnahmen, weil sie ohne Beaufsichtigung das Haus verlassen durften.
Das Paar auf dem Ruhebett
Statuen der Aphrodite und des Adonis, so wird überliefert, wurden zur Zeit Ptolemaios II. (308–247 v. Chr., regiert ab 285 v. Chr.) auf Ruhebetten gelagert und von automatischen Eroten umflattert. Das Ensemble präsentierte sich prächtig in Gold, Elfenbein, Ebenholz und Stoff.
In den Rahmen der Adonis-Feiern, deren Rituale u. a. Sinnbilder der Vergänglichkeit zelebrierten, gehörte die liebevolle Pflege der „Gärten des Adonis“. Es handelte sich um Samen bestimmter Grünpflanzen (z. B. Fenchel, Gerste, Lattich, Weizen), die in einer flachen Erdschicht in Schalen oder Keramikscherben ausgesät wurden, schnell wuchsen und sehr bald verdorrten. Die Frauen warfen alle verwelkten Pflanzen ins Meer oder in Fließgewässer und verabschiedeten sich abermals von Adonis, indem sie ihn wiederholt rituell beklagten.
Nachantike Seitenblicke
Adonisröschen
Eine Art der Adonisröschen (Adonis aestivalis) blüht im Sommer und wurde 1984 zur Blume des Jahres gekürt (Stiftung Naturschutz Hamburg und Stiftung zum Schutze gefährdeter Pflanzen). Das moderat giftige Adonisröschen – seine meist sieben intensiv roten Blütenblätter sind am Ansatz dunkelviolett – nutze die Volksmedizin zur Behandlung von Herzbeschwerden (Blätter) und Verstopfung (Wurzeln und Samen). Vor den Zeiten der Unkrautbekämpfung wuchs es wild auf den trockenen kalkreichen Feldern für Wintergetreide.
Schön wie Adonis
Im Deutschen Fremdwörterbuch (Band I, 1995) ist u. a. über Adonis zu erfahren: „Adonis“ benennt seit dem 18. Jahrhundert einen außergewöhnlich schönen Jüngling. In ironischer Brechung bezeichnet „kein Adonis“ eine männliche Person ohne besondere körperliche Attraktivität.
Werbung
Die Wellness Anlage „Vita Classica“ in Bad Krozingen lockt mit der Anregung „für Sie“, „Ihn“ oder „Beide“: „Schön sein wie Aphrodite und Adonis!“
Leseprobe
Blumen aus Blut
Als Aphrodite den sterbenden Jüngling erreichte, „ Sprengte sie unter das Blut wohlriechenden Nektar, und schellend / Stieg es, von diesem berührt, nach Art durchsichtiger Blasen, / Die beim Regen entstehn. Nicht länger wohl als eine Stunde / Hat es gewährt, da wuchs aus dem Blut gleichfarbige Blume, / So wie die punische Frucht [Granatapfel] sie trägt, die unter der zähen Schale die Kerne verschließt.“
Ovid, Metamorphosen 10, 732–237 (Übersetzung: Christoph Martin Wieland)