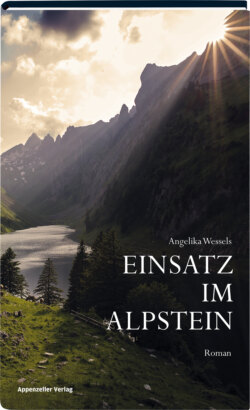Читать книгу Einsatz im Alpstein - Angelika Wessels - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеJANUAR
Schon nach wenigen Tagen erhielt Koller telefonisch und dann noch schriftlich einen positiven Bescheid: Seine Bewerbung war angenommen worden. Die Tatsache, dass sein zukünftiger Arbeitgeber, die Privatschule am Lehn, von all ihren Angestellten das Einhalten eines Dress-Codes verlangte, belastete ihn kaum. Er besass seinen alten, gutgeschnittenen Massanzug, den er jeweils bei den wichtigsten Schulanlässen am Gymnasium und weiteren wichtigen gesellschaftlichen Anlässen getragen hatte. Da die Dauer dieser Anlässe jeweils begrenzt gewesen war, störte es ihn auch nicht besonders, dass ihm Hose und Jackett um einiges zu eng waren.
An einem tristen Nachmittag im Januar, die Arbeit am Computer ödete ihn an, für das Krafttraining im Fitnesscenter, wohin er im Winterhalbjahr regelmässig ging, war er zu faul, für eine Wanderung war das Wetter – Nassschnee und Bise – sogar ihm zu garstig, rief er kurzentschlossen ins Atelier: «Rena, ich fahre noch rasch ins Dorf. Brauchst du was?»
«Der Käse ist schon wieder fast alle, hol doch noch etwas, Rainhüttenkäse, wenn’s geht. Ach, und noch ein neues Halogenlämpchen.»
Koller hörte Rena herumgehen, die alten Holzdielen knarrten, die Schritte kamen zur Tür.
«Hier – die ist kaputt.»
«Gut, dann nehme ich zwei, fürs nächste Mal.»
Und schon war er zur Türe hinaus, noch die Einkaufstasche vom Haken an der Garderobe nehmend. Kleiderkauf war eine Sache, die er rasch hinter sich bringen wollte, es sei denn, es ging um Bergkleider oder -ausrüstung. In den verschiedenen Appenzeller Bergsportgeschäften hielt er sich gerne länger auf, dort wurde es ihm nie langweilig.
Koller fuhr zum Modehaus Goldener, das direkt gegenüber dem Gymnasium lag. Er stellte das Auto auf einem der reservierten Parkplätze ab, betrat entschlossen das Geschäft, äusserte gegenüber dem freundlichen Verkaufspersonal seine Wünsche und marschierte nach nicht einmal dreissig Minuten mit drei Anzügen, fünf Hemden und zwei Krawatten und um eine vierstellige Franken-Summe ärmer wieder aus dem Laden hinaus, verfolgt von den teils überraschten, teils zufriedenen Blicken der Verkäuferinnen.
Die beiden Lehrtöchter kicherten und tuschelten, hatten sie Koller doch regelmässig zu Fuss, auf dem Fahrrad oder – seltener – im Auto vor dem Gymnasium vorfahren sehen. Die eine hatte dabei immer gewitzelt, da komme der Geissen-Peter, die andere hatte ihn in seinen karierten Hemden eher für den Alp-Öhi gehalten. Und jetzt hatte dieser Naturbursche ruck-zuck, zack-zack mit sicherem Blick eine Komplettausstattung erworben, mit der er hätte im Fernsehen auftreten können, ohne sich zu schämen.
Koller fuhr, keine Gedanken an seine neuen Kleider verschwendend, über den Landsgemeindeplatz zum Ziel, stellte den Wagen auf dem Parkplatz beim Spar ab und marschierte durch das einsetzende Schneetreiben, das sich hier unten auf 760 Metern über Meer eher als Matsch-Guss präsentierte, zum Einkauf. Die Halogenlampen fand er in der Migros, den gewünschten Käse erstand er im Spar an der gut assortierten Käsetheke, wo er der Versuchung nicht widerstehen konnte, ihn noch mit einer Auswahl weiterer Käsestücke zu ergänzen. Und weil er gerade dabei war, liess er sich auch noch von der äusserst ansprechend präsentierten Auslage der Metzgerei Breitenmoser verführen.
Zu Hause musste er zwei Mal laufen, um all die Säcke und die Einkaufstüte ins Trockene zu bringen. Er stellte das halbe Dutzend Bierflaschen in eine freie Ecke, im Wissen darum, dass diese den Platz nicht lange versperren würden, das Fleisch und der Käse kamen in den Kühlschrank und das Brot zusammen mit den Halogenlämpchen auf die Anrichte. Mit den beiden prall gefüllten Säcken des Modehauses wollte er in den oberen Stock gehen, als Rena ihn erblickte.
«Was ist denn das? Sag bloss, du hast dir neue Kleider gekauft!?»
«Ja!»
«Na, dann zieh sie doch mal an und zeig dich!»
Koller stellte die Säcke ab und sah seine Frau verständnislos an. «Wozu?»
Einen Moment lang musterten sich beide, dann sagte Rena scheinbar resigniert: «Dann lass es halt.»
Kopfschüttelnd begab er sich hinauf in sein Schlafzimmer, wo er die Hemden, Hosen, Jacketts und Krawatten sorgfältig in den Schrank einordnete, wo noch genügend Platz vorhanden war.
Es vergingen nur wenige Tage, bis Rena Koller Gelegenheit bekam, ihren Mann in den neuen Kleidern zu sehen, denn er hatte auf den Freitagnachmittag ein erstes Vorgespräch mit der Bibliothekarin und Geschichtslehrerin Marianne Dörig abgemacht. Koller hatte sich für den einfachsten der drei Anzüge, jenen in einem mittleren, fast warmen Grau, entschieden. Beim Binden der Krawatte hatte er mangels Übung drei Anläufe gebraucht, doch nun sass sie halbwegs anständig, und er würde es wohl wagen können. Rena, die von dem Termin wusste, lauerte ihm in der Küche auf, überzeugt, dass er noch ins Bad ginge, das nur von der Küche her erreichbar war. Neugierig blickte sie hoch, als sich die Türe öffnete.
«Ach, du bist hier und nicht im Atelier», sagte Koller überrascht.
«Ja, ich wollte mir den Anblick keinesfalls entgehen lassen.» Zufrieden musterte sie ihn. «Da hast du aber eine gute Wahl getroffen, Gian! Schöne Farbe, guter Schnitt.»
Koller verschwand, einige unverständliche Worte murmelnd, ins Bad, während seine Frau ihm lachend nachrief: «Aber vergiss nicht, dich zu kämmen!»
In dem neuen Anzug fühlte sich Koller sofort wohl, und das war ihm das Wichtigste. In Anbetracht des Schneematsches zog er seine Winterstiefel an, die unter den Hosenstössen sicher nicht auffielen, und machte sich auf die Fahrt zur Privatschule am Lehn.
Ins Kollegi war er häufig zu Fuss oder mit dem Fahrrad gelangt, da die Privatschule aber am anderen Ende des Dorfes und recht weit oben am Hang lag, würde er wohl oder übel in Zukunft vermehrt das Auto benützen müssen. Da Rena ihren alten Panda besass, war dies auch kein Problem. Zudem war er so auch flexibler, wenn ein Alarm einging. Als Obmann der Rettungskolonne war dies unabdingbar, ausser er würde für einen wichtigen Einsatz direkt vom Helikopter abgeholt – neben seinen jungen Kollegen Reto und Martin war er der einzige «Rettungsspezialist Helikopter» in der Alpinen Rettung Alpstein. Und es machte ihm auch nichts aus, denn Bewegung hatte er in seiner Freizeit, bei den Übungen und allfälligen Einsätzen genug, zudem belastete ihn das Fahren überhaupt nicht.
Mit diesen Überlegungen langte Koller auf dem ihm nun schon vertrauten Parkplatz der Schule an. Dieser war fast leer, es war wieder ein Freitag, wieder früher Abend. Oben hinter den grossen Fensterscheiben der Bibliothek brannte Licht, warf einen warmen Schein auf die grauweiss gefleckten Wiesen des mit den alten Bäumen bestandenen Parks. Koller schloss den Wagen ab und eilte – er war ohne Winterjacke gegangen – zum Eingang und die Treppe hinauf zur Bibliothek, wo ihn Marianne Dörig schon erwartete.
Freundlich rief sie vom Pult her: «Grüezi Herr Koller, schön, sind Sie da.»
Ihr rundliches Gesicht hatte dieselbe Wirkung wie ihre Worte. Koller schloss die Türe und ging auf das grosse Pult zu, dessen Fläche fast zur Gänze von einer Tastatur, einem Telefon und dem grossen Flachbildschirm eingenommen wurde.
Marianne Dörig erhob sich und streckte ihm die Hand entgegen. «Wir siezen uns hier alle», sie lächelte verschmitzt, «aber nur, wenn uns die Schülerinnen und Schüler oder die Schulleitung hören können. Ich bin Marianne.»
«Und ich Gianfranco.»
«Willkommen in der Privatschule am Lehn. Ich bin sicher, wir werden uns prächtig verstehen. Und du wirst auch keine alten Folianten klauen.»
Marianne Dörig lachte schallend, und Koller lachte mit. Die Frau war ihm sofort sympathisch.
Sie begutachteten das Archiv, wo die Historikerin sorgfältig einige riesige, in Leder gebundene Bücher aus einem Regal zog, weisse Handschuhe über die Hände streifte und Koller gemeinsam mit ihr in ehrfurchtsvollem Respekt Tier- und Blumendarstellungen betrachtete, handgeschriebene Beschreibungen las und sich einen Überblick über die gesammelten Werke von Hans Balthasar und Balz von Lehn verschaffte. Koller las die mit Goldlettern ins Leder eingeprägten Titel der Bücher. Das Herz ging ihm dabei auf.
«Hier: ‹De montibus Sambatinii›. Kannst du das bitte einmal herausnehmen, Marianne?»
Marianne Dörig zog das schmale Bändchen aus dem Regal und schlug es auf.
«1729», murmelte Koller.
Seine Kollegin blätterte. Auf einer der ersten Seiten begann ein Verzeichnis der Alpen auf der Innerrhoder Seite des Alpsteins. Das Verzeichnis war auf Deutsch abgefasst, Koller überflog es rasch. Er las von der Meglisalp, von deren langer Geschichte, die Hans Balthasar von Lehn offenbar akribisch untersucht hatte, denn er zitierte Quellen von 1071. Er beschrieb aber auch, wohin das Vieh getrieben wurde; er beschrieb sogar die Verbindungswege zu den anderen Alpen, unter anderem auch jenen nun fast dreihundert Jahre später beinahe in Vergessenheit geratenen Übergang von der Meglisalp über Spitzigstein, Borsthalden vorbei an den Freiheittürm und über den heute als «Mörderwegli» bekannten Kletterer-Pfad zur Fählenalp.
Fast hätte Koller mit der blossen Hand, einer grossen, kräftigen Hand mit trockener Haut an den Fingerknöcheln, aber gepflegten Fingernägeln, umgeblättert. Marianne Dörig tat es für ihn und meinte, wiederum lachend: «Ich glaube, als Erstes besorgen wir passende Handschuhe, die hier sind sicher vier Nummern zu klein.»
Koller richtete sich auf: «Und wie steht es mit den technischen Einrichtungen? Einen kleinen Einblick habe ich beim Bewerbungsgespräch erhalten.»
Die Bibliothekarin zeigte ihm den PC, den Scanner sowie einen zusätzlichen Handscanner, ein praktisches, kleines Gerät, mit dem man einzelne Textpassagen oder Bilder erfassen konnte, ohne die Bücher aufgeklappt auf eine Oberfläche legen zu müssen.
«Der PC besitzt eine externe Festplatte, die Tarzisius, unser Hausmeister, zur Sicherheit abends in einen feuersicheren Tresor legt. Zudem macht ein externes Unternehmen einmal wöchentlich ein Back-up von allen Daten.»
«Aha!» Koller besah sich das schwarze Plastikgehäuse der Festplatte. «Zwei Tera, das kann man natürlich noch ausbauen.»
«Ich sehe schon, du bist der Richtige», meinte Marianne Dörig vergnügt. «Du kannst dich für die alten Schinken ebenso begeistern wie für die moderne Technik, die mir überhaupt nichts sagt.»
«Ach, ich bin kein Informatiker», sagte Koller, dem Komplimente immer etwas peinlich waren.
«Klar, da haben wir auch unsere Spezialisten. Aber noch besser als diese ist Tarzisius. Der ist ein Allround-Talent. Ein Leonardo da Vinci des Lehn. Du wirst schon sehen! Gehen wir auf einen Kaffee ins Lehrerzimmer, dann kann ich dir auch dort noch das Wichtigste zeigen.»
«Aber gerne.»
Als Koller später am Abend nach Hause zurückkehrte, war er voller Vorfreude auf seine zukünftige Aufgabe. Er eilte umgehend in sein Schlafzimmer, um sich etwas Bequemeres anzuziehen. Bei der Zubereitung des Abendessens – Rena hatte, da sie nicht genau wusste, wann er heimkehren würde, ein Fondue vorbereitet – sass er am Esstisch und pickte Brotwürfel aus dem Korb mit der rot karierten Abdeckung. Dabei erging er sich in begeisterten Erklärungen über die beiden Naturforscher, wobei ihm der Vater augenscheinlich näher lag als der eigentlich viel bekanntere Sohn.
Ohne seinen Redeschwall zu unterbrechen, entzündete Koller die Brennpaste, öffnete eine Flasche St. Saphorin, schenkte ein, stellte die Flasche, dabei seine Frau leicht am Rücken berührend, wieder in den Kühlschrank, nahm Perlzwiebeln, Gewürzgurken und den schon zuvor angerichteten Maissalat heraus und stellte alles auf den Tisch. Hier wechselte er zu den qualitativ hochstehenden Einrichtungen des Archivs und bemerkte schliesslich, als seine Frau das Caquelon auf den Brenner stellte: «Aber was mich am meisten freut, ist, dass Marianne Dörig, meine Kollegin, die Historikerin und Bibliothekarin, eine ganz nette Frau ist, mit der ich mich sicher bestens verstehen werde.»
«Ja, dann hat die Verwalterin wenigstens einen weiblichen Widerpart gefunden. Es gibt offenbar auch nette Frauen an dieser Schule.»
«Ja, gottlob, und dieser anderen Dame kann ich ja aus dem Weg gehen. Der Maissalat schmeckt wieder wunderbar.»
«Danke, Gian! Prost! Auf deine neue Arbeit!»
«Zum Wohl! Auf dass es so positiv weitergeht.»
Seine alte Arbeitsstelle hatte Koller, nicht ohne Bedauern, gekündigt. Allerdings mit gutem Gewissen, da sein junger Kollege Urs Weller mit Freude sein Pensum übernahm und im Überschwang schon angekündigt hatte, jetzt könne er endlich seine langjährige Freundin heiraten und eine Familie gründen.
Beim nächsten Besuch im Lehn konnte sich Koller den beiden Klassen vorstellen, die er in Vertretung von Geografielehrerin Milena Dürst unterrichten sollte, solange diese Babypause machte. Neugierig betrachteten ihn die jungen Leute, die er bald würde unterrichten dürfen, und er blickte ebenso neugierig zurück. Sie unterschieden sich auf den ersten Blick in nichts von jenen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die Koller bis anhin unterrichtet hatte.
Ende Januar nahm Koller am letzten Konvent des Semesters und damit am ersten des neuen Jahres teil. Der Umgangston war hier förmlicher, das Ambiente im ehemaligen Rittersaal Ehrfurcht gebietend. Nachdem sich sowohl Konrad Wild als auch seine Gattin an die versammelte Lehrerschaft gewandt hatten, er eloquenter und in freier Rede, sie mit Unterstützung einer perfekt gestalteten Power-Point-Präsentation, folgten die üblichen Traktanden, bei deren Abhandlung Koller – es war schon 18.30 Uhr, dunkel, kalt – beinahe eingenickt wäre.
Die letzte Januarwoche verbrachte er, schon fast etwas gestresst, mit letzten redaktionellen Änderungen am Abschlussbericht seines Nationalfondsprojekts und mit der Vorbereitung des Semesters, wobei er dank seiner langjährigen Erfahrung aus dem Vollen schöpfen konnte.
Die allmonatliche Übung der Rettungskolonne am Donnerstagabend war ihm eine willkommene Abwechslung. Grubenmann hatte vor Freude über Kollers Ankündigung, dass dieser ihn von seinen Aufgaben entlasten würde, keinen Luftsprung gemacht; vielmehr musste er sich vor lauter Erleichterung setzen. Und so überliess er seinem bisherigen Stellvertreter mit Freude die Organisation der ersten Übung im neuen Jahr.
Sie fand im Restaurant Alpenblick in Schwende statt und bestand aus zwei Teilen, einem theoretischen mit Informationen über das neue Funksystem Polycom und einem praktischen mit einer Repetition der Erste-Hilfe-Massnahmen. Jede Station der Alpinen Rettung verfügte über zwei Polycom-Funkgeräte für den Führungsfunk zur Kommunikation mit der Polizei. Das Hauptthema war an diesem Abend die Repetition der Erste-Hilfe-Massnahmen – etwas, das man nicht genug üben konnte. Koller und Grubenmann hatten gemeinsam mehrere Stationen eingerichtet, angesichts des garstigen Wetters im Restaurant und nicht im Gelände. Eifrig brachten die Mitglieder der Rettungskolonne Verbände an, schienten Glieder, lagerten Beine hoch und diskutierten ihre Vorgehensweise anhand vorbereiteter Unterlagen. Gegen 21.30 Uhr beendet Koller die Übung, und die Kolonne sass noch gemütlich bei Bier und Kaffee zusammen.
Rena Koller genoss derweil den Abend zu Hause, wie sie überhaupt die Abende, an denen ihr Mann nach Übungen oder Sitzungen später nach Hause kam, schätzte. Sie war nicht ungern alleine und konnte genug mit sich selber anfangen. War ihr Mann nicht da, konnte sie laute Musik hören, klassische Konzerte oder Unterhaltungsmusik, mit der er rein gar nichts anfangen konnte. So hing sie, die noch nicht fertig gelesene Biografie von Giovanni Segantini in der Hand, auf dem Sofa in der Stube ihren Gedanken nach.
Obwohl sie sich in vielem unterschieden, oder gerade aus diesem Grund, harmonierten sie und ihr Mann, wie Rena fand, erstaunlich gut. Sie, die oft aufbrausende, extrovertierte Künstlerin, kritisch und unkonventionell im Denken, der in vielen Dingen die Konstanz fehlte. Die trank, regelmässig und mit gelegentlichen Exzessen. Die trotz ihres grossen Freundes- und Bekanntenkreises den Menschen und dem Menschlichen an sich wenig abgewinnen konnte, die – wie ihr Mann oft bemerkte – fast krankhaft misanthropisch war. Die mit vielem, ihrer Herkunft, ihrer Kindheit, ihrem Suchtverhalten, häufig auch mit ihrer Kunst – obwohl diese mittlerweile durchaus anerkannt wurde – haderte, die sich aber auch haltlos für etwas begeistern konnte. Die trotz ihrer angeborenen Kondition und Gelenkigkeit keinerlei sportlichen Ehrgeiz zeigte, die sich mit Ausnahme der sich sporadisch treffenden Frauen-Kulturgruppe nicht gesellschaftlich engagierte, die derlei Engagement, wie auch politisches, für völlig sinn- und nutzlos hielt.
Demgegenüber er, mit seiner überlegten Beherrschtheit, seiner Ruhe und Beständigkeit in vielen Dingen, die dazu führte, dass ihn manche für einen Langweiler hielten. Seine natürliche Hilfsbereitschaft, sein technisches Verständnis und seine enorme Leistungsfähigkeit hatten wohl dazu beigetragen, dass er sich schon als junger Mann in der Bergrettung engagiert hatte. Seine Körperkraft, die ihn schwere Rucksäcke scheinbar mühelos über grosse Distanzen und Höhendifferenzen tragen liess und die sie jedes Mal bewunderte, wenn er – von Hand mit dem Beil – das angelieferte, nur rudimentär zugeschnittene Brennholz für den Winter vorbereitete. Seine Toleranz ihr gegenüber, gepaart mit einer natürlichen Autorität gegenüber seinen Schülerinnen und Schülern und nicht zuletzt seine Integrität und Rechtschaffenheit, die ihm zahlreiche Ämter eingebracht hatten, von denen er sich – mit Ausnahme der Bergrettung – jedoch in den letzten Jahren ohne Bedauern gelöst hatte.
Sie erinnerte sich daran, wie sie sich kennen gelernt hatten: Es war an einer Vernissage gewesen, Bilder einer jungen Künstlerin, die sich mit verschiedenen Geländeformen beschäftigte. Sie, Rena Fässler, hatte sich schon, gelangweilt von der beliebigen Ansprache und dem elitär-arroganten Publikum, heimlich davonmachen wollen. Da war sie auf Gianfranco Koller gestossen. Seine eigenwilligen, von persönlichem Interesse und intensiver Auseinandersetzung geprägten Kommentare, seine Ernsthaftigkeit hatten sie beeindruckt. An jenem Abend hatten sie sich lange unterhalten, dann aber aus den Augen verloren – nur um Wochen später, in der Stadt, zufällig wieder aufeinanderzutreffen, als beide an derselben Schule eine Stellvertretung hatten: sie für den Gestaltungslehrer, der einen unbezahlten Urlaub eingezogen hatte, er für den Geografielehrer, der einen militärischen Wiederholungskurs absolvieren musste.
Sie hatten sich sofort erkannt, sich auf die Gespräche im Lehrerzimmer gefreut. Und eines Tages hatte Rena Fässler, nachdem sie am Vortag die Chromstahlumrandung des Lavabos mit dem dafür vorgesehenen Baumwolltuch trockengerieben hatte, festgestellt, dass dieses Tuch andersherum gefaltet dalag. Nach ihrem obligaten Espresso hatte sie das rot-weiss gestreifte Tuch wieder so zusammengelegt, wie es zu Beginn gewesen war. Als sie das nächste Mal in das Lehrerzimmer gekommen war, hatten zwei Würfelzucker mit dem Bündner Wappen auf dem – nun wieder anders gefalteten – Tuch gelegen, worauf sie mit Innerrhoder Zucker und einem neuerlichen Falten des Tuches geantwortet hatte. Dieses Spiel hatte sich wiederholt, bis die Würfelzucker mit den Bündner und Innerrhoder Wappen ausgegangen waren.
Nach drei Wochen war Kollers Stellvertretung zu Ende gewesen, und er hatte bei der gestrengen Schulsekretärin nach Renas Adresse zu fragen gewagt, derweilen sie ihm schon eine selbst gestaltete Karte mit ihrer Adresse und Telefonnummer per Post hatte zukommen lassen. Und dann waren sie während fünf Jahren zusammen gewesen, nur unterbrochen von einer kurzen Zeit der Trennung, bis sie geheiratet hatten.
Ihre beste Freundin hatte damals schon bemerkt, dass sie sich auch körperlich perfekt ergänzten: Denn Rena wirkte trotz ihrer durchaus weiblichen Formen schlank und eher sportlich; sie band die blondierten Haare streng zurück – auch damit sie sie beim Malen nicht störten – und achtete stets auf ein gepflegtes Äusseres, interessierte sich auch für Mode, wobei sie ihrem eigenwilligen Kleidungsstil stets treu geblieben war.
Gian hingegen schien kaum einen Gedanken daran zu verschwenden, wie er auf andere wirkte. Er trug, was ihm bequem war, in der Regel eine dunkle Hose und ein schwarzes oder ein kariertes Hemd. Zum Frisör war er in den letzten Jahren nicht mehr gegangen, hatte sich lieber von ihr die widerspenstigen dunklen Haare stutzen lassen, die an den Schläfen schon grau wurden. Ein ebenso unkompliziertes Verhältnis schien er zum Rest seines Körpers zu haben. Er achtete in keiner Weise darauf, sich beim Essen irgendwie einzuschränken, was man ihm auch ansah. Sein leichtes Übergewicht kompensierte er aber problemlos mit seiner hervorragenden körperlichen Kondition, die er durch die regelmässige sportliche Betätigung hielt.
Dass er immer gebräunt wirkte, lag nicht nur am regelmässigen Aufenthalt im Freien. Während sie von Natur aus eher hellere Haut hatte und sich jeweils im Frühling immer erst langsam an die Sonne gewöhnen musste, wirkte er während des ganzen Jahres so, als käme er direkt von einem Ferienaufenthalt aus dem sonnigen Süden. Auch seine verstorbene Mutter, die sie noch kennen gelernt hatte, eine Bündnerin aus der Surselva, war so ein dunkler, südländischer Typ gewesen.
Rena erinnerte sich an ein lange zurückliegendes Gespräch mit einer Kollegin, es war ganz am Anfang ihrer Beziehung gewesen, als diese über Gianfranco gesagt hatte: «Und zudem ist er völlig humorlos! Und hast du ihn einmal in der Badehose gesehen? Er sieht ja von hinten aus, als sei er gehäutet worden. Also, nicht dass ich so viel auf Äusserlichkeiten geben würde. Aber sein Rücken sieht aus wie aus einem dieser Horrorfilme.»
Ihr Mann hatte ihr schon kurz nach dem Kennenlernen erzählt, wie es zu dem Brandmal gekommen war, das von seiner rechten Schulter quer über seinen Rücken zog. Schon als Kind sei er gerne herumgeklettert, habe vor nichts Halt gemacht, auch nicht vor dem Herd, auf dem ein Topf mit kochendem Wasser gestanden habe, der Stiel wohlweislich gegen hinten gerichtet. Nur kurz habe ihm die Mutter den Rücken gekehrt, schon sei es passiert gewesen. Er erinnere sich noch heute an den vernichtenden Schmerz, die endlose kalte Duscherei in der Badewanne, bis er endlich, schlotternd und mit blauen Lippen, von dem von der Arbeit herbeigeeilten Vater ins Kantonsspital nach Chur gefahren worden sei.
Die Narben waren geblieben. Sie seien ein Teil von ihm, wie er sagte, ein Teil, dessen er sich nicht schäme, im Gegenteil, es errege ihn, wenn sie die dünne, rosarote Haut berühre. Und sie hatte diese unebene, teils zarte, teils raue und knotige Fläche entdeckt, sie spielte mit ihr, hatte sie lieben gelernt, genauso wie seinen ernsthaften, eher schweigsamen und auf andere offenbar humorlos wirkenden Charakter.
Humorlosigkeit war es beileibe nicht, die ihn auszeichnete. Der laut herausbrechende, schenkelklopfende Humor, das Erzählen von Witzen in einer lustigen Runde, die Gabe, andere mit irgendwelchen Schilderungen zum Lachen zu bringen, dies alles war ihm tatsächlich fremd. Sein Humor war ein anderer: feiner, unauffälliger, einer, der nicht forsch und frech jeden ansprang, ungefragt und unsensibel.
Oft beobachtete sie Gian heimlich, wenn er sich konzentriert und ernst mit etwas beschäftigte, sei dies die Lektüre der jährlichen Bergunfallstatistik des Alpenclubs, die Kontrolle seiner Bergausrüstung oder wenn er am Abend die Säntiskette betrachtete. Dieser tiefe Ernst, der all seinen Handlungen innewohnte, der andere dazu veranlasste, ihn für einen Langweiler oder einen humorlosen Menschen zu halten, dieser Ernst war es, der sie von Beginn weg angezogen und der sie schliesslich so eng mit ihm verbunden hatte.
Auch mit seiner Zurückhaltung und Schweigsamkeit hatte sie sich abgefunden. Dies war ihr weniger leicht gefallen, denn sie brauchte das Zwiegespräch, bedurfte des gedanklichen Austausches, der ihm offenbar weniger wichtig schien. Doch da waren die wenigen Augenblicke, in denen sie, oft aus nichtigem Anlass, diese entscheidenden Worte und Blicke wechselten, die ihr zeigten, dass sie sich ihm auch gedanklich verbunden fühlte, ebenso wie er sich ihr.
Rena Koller klappte ihr Buch zusammen, in dem sie kaum ein paar Seiten gelesen hatte, als sie hörte, wie die Haustüre zufiel.
Am nächsten Tag beabsichtigte Koller, hinauf zur Privatschule am Lehn zu fahren. Denn bevor er seine Arbeit antrat, lag ihm daran, sich auch mit den weiteren Gegebenheiten vor Ort, besonders aber mit seinen zukünftigen Arbeitskolleginnen und -kollegen, vertraut zu machen. Einige Lehrkräfte kannte er schon von früherer Zusammenarbeit oder von gesellschaftlichen Anlässen, den Hausmeister Tarzisius Knechtle jedoch nur vom Hörensagen; dessen Frau Antonia hatte er jedoch schon öfter getroffen. Sie war bei den Samaritern. Man munkelte, sie sei auch die beste psychologische Beraterin, was die Schülerinnen und Schüler des Lehn anging. Bei einer gemeinsamen Übung verschiedener Rettungsorganisationen vor vielen Jahren hatte Koller sie als patente Person mit ruhigem Überblick schätzen gelernt.
Da er in Erfahrung gebracht hatte, dass das Ehepaar mit einigen weiteren Angestellten jeweils vor der Lehrerschaft Pause zu machen pflegte, begab er sich mit einer Papiertüte voller Gipfeli um neun Uhr ins Lehrerzimmer, wo er auf die versammelte Runde mit Knechtles, der Sekretärin und dem Hauspersonal traf. Er stellte sich vor, schüttelte allen die Hand mit der Bemerkung, er heisse Gianfranco – mit Antonia Knechtle war er ohnehin schon per Du –, und gemeinsam verspeisten sie die Gipfeli.
Bevor der grosse Aufmarsch der Lehrkräfte begann, verliessen sie das Lehrerzimmer, und Antonia Knechtle lud Koller in ihre Dienstwohnung ein, um dort einen «Säntisführer» zu begutachten, ein altes Büchlein mit den Kletterrouten und Wanderungen des Alpsteins, das sie von ihrem Vater geerbt hatte. Gefolgt vom Hausmeister, der noch die gerade eingetroffene Post aus dem Schulbriefkasten neben dem Eingang der Wohnung nahm, betraten sie einen eher dunklen Vorraum. Durch diesen gelangten sie in einen helleren Raum mit sehr hoher Decke, dessen Wände von dicht gefüllten Bücherregalen gesäumt waren, die lediglich das eine, zum Park hinausgehende Fenster freiliessen.
Koller bemühte sich, seine Überraschung nicht allzu deutlich zu zeigen: Hier standen gefühlt doppelt so viele Bücher wie in der Schul-Bibliothek, und es war sogar eine verschiebbare Leiter vorhanden, mit der man in die oberen Regionen gelangen konnte. Das Idealbild einer Bibliothek also. Zwar hatte er von den Vorlieben des Hausmeisters für Literatur, Philosophie und Musik gewusst, ebenso davon, dass Tarzisius ein eigentliches Multitalent war – Marianne Dörig hatte ihn nicht umsonst als «Leonardo da Vinci des Lehn» bezeichnet –, doch die reine Menge der hier versammelten Bücher erschlug Koller fast.
Flüchtig las er einige Titel im nächststehenden Regal, Klassiker und aktuelle Schweizer Autoren, bevor Antonia Knechtle ihn zu einem Regal mit offenbar älteren Büchern führte, wo sie ein schmales Bändchen mit einem dunkelblauen Einband heraussuchte. Auf dessen Vorderseite prangte eine Abbildung des Altmanns, stilisierte Darstellungen von Felsen, einem Seil, einem Rucksack und einem Pickel neben dem Titel «Das Säntis-Gebiet. Illustrierter Touristenführer v. Gottlieb Lüthi & Carl Egloff. Fehr’sche Buchhandlung in St. Gallen».
Koller schlug das Büchlein auf, sah, dass es sich um einen der von Sammlern gesuchten «Säntisführer» aus dem Jahr 1919 handelte, blätterte willkürlich auf eine der Seiten im vorderen Teil. Er versank in der Lektüre des Textes, las mit zunehmender Begeisterung, was da auf dem gelblichen Papier stand, erfuhr von einem Aufstieg durch eine breite, schluchtartige Rinne, las dann die Worte, die die Autoren für diesen Platz 1919, nach dem Ersten Weltkrieg, gefunden hatten, laut vor.
Er las den Text fast ohne Akzent, in seiner jahrelang geübten Aussprache des Schriftdeutschen: «‹Stundenlang möchte man hier oben, auf weichem Graskissen des dolce far niente pflegend, verweilen in träumerischem Geniessen all der Pracht und Herrlichkeit, die bei klarem Himmel in weiter Runde sich entfaltet. In schwindelnder Tiefe, 1500 m unter uns, breitet das stromdurch-schlungene Rheintal seine gesegneten Fluren. Fern im Osten und Süden glitzern und gleissen die silbernen Hochfirne von Österreich und Graubünden im Azur des Firmaments, im Westen aber, fast überwältigend nahe, türmt der Alpstein seine höchsten und trotzigsten Felsburgen zum Himmel. Eine köstliche, stillbeschauliche Einsamkeit umfängt uns auf diesem selten besuchten Bergthron, und fast dünkt es uns, als hätte der vielgepriesene und langverheissene Weltfrieden hier oben ein Asyl gefunden.›»
Aufatmend klappte Koller das Büchlein zu, beim Lesen der letzten Worte hatte er Gänsehaut bekommen. «Unsere Vorfahren hatten da schon noch eine ganz andere Art, so etwas zu beschreiben. Fast schon poetisch und philosophisch. Heute liest man da vor allem nüchterne Sätze und viele technische Daten. Ich kenne den Ort; was für treffende Gedanken!»
«Wir beide sind halt gar keine Bergsteiger, nicht einmal Wandervögel, wir können das, im Gegensatz zu dir, gar nicht richtig ästimieren. Darum habe ich es dir gezeigt», meinte Antonia Knechtle lachend. «Hier, bitte Gianfranco, nimm es als Willkommensgeschenk und behalte es. Ich sehe, dass du es richtig zu schätzen weisst.»
«Das kann ich doch nicht annehmen!»
«Aber sicher doch!»
Trotz seiner Einwände sah sich Koller genötigt, das Büchlein zu behalten. Vorsichtig steckte er es in die Innentasche seines Jacketts, bedankte sich mehrmals herzlich und verliess dann mit Tarzisius Knechtle die Bibliothek.
«Soll ich dir noch die Finessen der Feuerschutztüren und des Alarmsystems im Archiv zeigen?», fragte der Hausmeister.
Koller willigte freudig ein, und so stiegen sie nebeneinander, in ein angeregtes Gespräch vertieft, die Treppen im Schulhaus hoch, wobei Knechtle an den dafür bestimmten Orten die Post deponierte. Auf ihrem Gang begegneten sie auch der Verwalterin, die beide überaus freundlich grüsste. Interessiert folgte Koller den Erklärungen des Hausmeisters zu den technischen Einrichtungen des Archivs.
«Und wenn der Scanner spinnt, darf ich auch dich fragen, Tarzisius, habe ich gehört.»
«Wenn du den Instanzenweg einhalten willst, fragst du den Informatiker. Und wenn es schnell gehen soll, dann fragst du mich», entgegnete der Hausmeister mit einem Augenzwinkern.
Lachend verliessen sie Archiv und Bibliothek. Tarzisius Knechtle begab sich in die Garage, um die Schneeschleuder auf den angekündigten nächtlichen Schneefall vorzubereiten – er räumte täglich, lange vor Schulbeginn, den Parkplatz und sämtliche Wege –, und Koller beschloss, sich das nun leere Lehrerzimmer und den Lehrerkopierraum noch eingehender anzusehen. Im Lehrerzimmer traf er zu seiner Überraschung auf die einsam an ihrem Tee nippende und die «Neue Zürcher Zeitung» lesende Verwalterin.
«Ach, Herr Koller! Schauen Sie sich alles noch genau an? Das ist aber recht!», meinte sie mit wohlwollendem Lächeln.
Ihre Freundlichkeit schien ihm irgendwie aufgesetzt, und dieser Eindruck trog nicht, denn Ewa Lendenmann Wild setzte sofort nach: «Ich finde sehr lobenswert, dass Sie sich mit den hiesigen Gepflogenheiten vor Ihrem Arbeitsantritt vertraut machen, Herr Koller. Und wenn Sie gerade dabei sind: Denken Sie bitte daran, dass wir uns hier aus wohl überlegten Gründen nicht duzen. Dies gilt selbstverständlich nicht nur für die Lehrkräfte, sondern auch für das Hauspersonal. Vielleicht war Ihnen das nicht bewusst. Aber wir wollen auch diesen Mitarbeitern und ihrer Arbeit die notwendige Wertschätzung entgegenbringen. Wie ich vorher im Gang gehört habe, sind Sie offenbar dem Reflex erlegen, Ihre Untergebenen einfach zu duzen.»
«Aber …»
«Ich denke, wir haben uns verstanden, Herr Koller!»
«Jawohl, Frau Lendenmann!»
«Dann wünsche ich Ihnen noch viel Spass auf Ihrem Rundgang und einen schönen Tag. Auf Wiedersehen, Herr Koller.»
«Danke, ebenfalls, auf Wiedersehen, Frau Lendenmann.»
Koller stand wie ein begossener Pudel im grossen, hellen Raum und starrte auf die Teetasse, die die Verwalterin auf dem niedrigen Tischchen hatte stehen lassen und auf die daneben liegende aufgeschlagene Zeitung. Auf dem schwarzen Ledersofa zeichneten sich noch die Umrisse ihres Pos ab. Hatte sie wirklich geglaubt, er habe den Hausmeister aus Herablassung geduzt? Ging sie nicht eher von sich aus? Und seit wann war er der Vorgesetzte der Knechtles?
Koller war mit den meisten Menschen in Appenzell per Du, als er noch im Bezirksrat gewesen war, am Gymnasium, im gesellschaftlichen Leben allgemein, mit seinen Bergkameradinnen und -kameraden ohnehin. Selbst bei Rettungen sprach er die zu Rettenden häufig mit dem Vornamen an, wenn es sich so ergab. Nie war dies ein Zeichen mangelnder Wertschätzung, im Gegenteil. Offenbar musste er in einigen Dingen umdenken, wenn er hier arbeitete. Nachdenklich besichtigte er noch den Raum mit dem Lehrerkopierer, probierte erfolgreich den Kopier-Code aus, den ihm Knechtle gegeben hatte, und begab sich dann wieder nach Hause.
Als er, am letzten Wochentag vor dem Schulbeginn, einige Unterlagen für den Geografieunterricht kopierte, begegnete er Tarzisius Knechtle, der neues Kopierpapier in die Schränke stapeln wollte. Koller hielt ihm die Türe auf, damit er mit dem Rollwagen hineinfahren konnte, und sagte dabei überlaut, in Anbetracht der offenstehenden Türe: «Guten Morgen, Herr Knechtle, wie geht es Ihnen?»
Der Hausmeister sah ihn belustigt an und meinte, während die Türe hinter ihm zufiel: «Guten Morgen, Herr Koller! Mir geht es prima, und wie geht es dir?» Er lachte. «Hör mal, Gianfranco, wir handhaben das hier so: Im Gang draussen, während des Unterrichts und an allen Schulanlässen siezen wir uns, überall sonst, also dort, wo uns die Verwalterin und die Schüler nicht hören können, duzen wir uns. Hat sie dich belehrt, gell?»
«Und wie, abeputzt wäre wohl der bessere Ausdruck. Und darüber, wie das gehandhabt wird, hat mich Marianne Dörig schon aufgeklärt. Aber ich muss, so glaube ich, noch etwas üben. Ich wollte mich gegenüber der Verwalterin natürlich rechtfertigen, aber ich bin gar nicht zu Wort gekommen.»
«Das hat gar keinen Sinn, ihr Wort ist Gesetz und nicht zu hinterfragen. Und sonst: Man gewöhnt sich daran.»
Koller half Knechtle, das Papier auf die dafür vorgesehenen Tablare im Schrank zu verteilen, worauf der Hausmeister wieder lachte und ergänzte: «Mach so etwas ja nie vor den Augen der Verwalterin. Sie sähe das als Anbiederung an, ja als Fraternisieren. Für sie sind wir getrennte Parteien. Sie oben, wir unten. Wir haben uns nicht zu verbrüdern. Das hat sie alles in ihrem vornehmen welschen Internat gelernt und offenbar verinnerlicht. Nun überträgt sie es auf den Lehn.»
«Dachte ich mir’s doch!»
«Lass es sie einfach nie merken. Sie dreht dir aus allem einen Strick!»
«Gut, Tarzisius, ich glaube, ich habe es kapiert.»
«Na dann – bis Montag zum Semesterbeginn!»