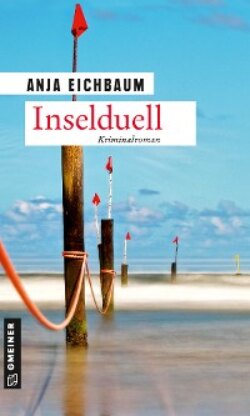Читать книгу Inselduell - Anja Eichbaum - Страница 7
Donnerstag, 21.03.
ОглавлениеNeid
Verdammt. Den Weg nahm er doch jeden Tag. Jeden gottverdammten Tag, den er auf Norderney verbrachte. Und das waren nicht wenige. Sondern zunehmend mehr. War es früher nur der Sommerfamilienurlaub gewesen, so waren sie später dazu übergegangen, alle Ferien auf der Insel zu verbringen. Dann, als die Kinder größer und selbstständiger wurden, kamen die Feiertage und langen Wochenenden hinzu. Es war ein Katzensprung auf die Insel von Nordhorn aus. Und trotzdem lebten sie hier in einer anderen Welt. Besonders, seit sie den festen Stellplatz gemietet hatten. Der Wohnwagen war eine Übernahme gewesen von einem freundlichen Ehepaar, das sie beim Campen über die Jahre kennengelernt hatten.
Heile Welt, nannten sie die kleine Parzelle. Das stand auch auf dem dicken Findling, den sie neben den Eingang gewuchtet hatten. Eine heile Welt, das war die Insel immer gewesen. Und wenn er den Planetenweg morgens mit dem Segway auf dem Weg zum Bäcker befuhr, dann war das Leben für ihn in Ordnung. Später am Tag waren die Wege zu oft von rücksichtslosen Spaziergängern und Fahrradfahrern verstopft, und das brachte ihn um den Genuss des selbstvergessenen Fahrens. Einzig das Damwild und die Kaninchen kreuzten in der Frühe seinen Weg, aber hieran war er gewöhnt.
Der Koffer lag mitten auf dem Weg. Unmöglich, daran vorbeizufahren. Nur deswegen hatte er so abrupt abgebremst. Ob er sonst an ihr vorbeigefahren wäre?
Thorsten Henkel drehte sich um, um sich zu vergewissern, dass sein Kopf ihm keinen Streich spielte. Dass er sich das nicht alles einbildete.
Er zog die Jacke enger, weil ihn fröstelte. Der Frühnebel über der Wattseite und den kleinen Binnenseen, an denen der Weg entlang führte, hatte sich noch nicht vollständig aufgelöst. Deswegen wäre es möglich gewesen, dass er sie nicht bemerkt hätte, wenn er nicht wegen des Koffers hätte halten müssen.
Wie lange es dauerte, bis die Rettungskräfte kamen. Angestrengt lauschte er. Nichts. Das Martinshorn war noch nicht zu hören. Dabei war das Krankenhaus doch gar nicht so weit entfernt. Wobei er sich sicher war, dass kein Notarzt und kein Rettungsassistent mehr helfen konnte. Das ahnte auch er als Laie. Da brauchte er gar nicht hin, um Puls und Atmung zu kontrollieren. Das sah er auf die Entfernung – und das war ihm recht. Schließlich wirkte es von hier aus gruselig genug. Weit aufgerissene Augen, der Mund heruntergeklappt, von den Mundwinkeln aus zogen sich wohl getrocknete dunkelrote, fast schwarze Blutspuren zum Unterkiefer.
Die Polizei, die war wichtig. Denn die Tote hatte eindeutig ein Einschussloch. In der Höhe des Herzens. Dort war die Kleidung zerfetzt, und eine Blutlache hatte sich kreisförmig ausgebreitet. So wie in den Western, die Thorsten als Kind so gerne gesehen hatte. Als er glaubte, der Tod sei ein temporärer Zustand wie der Schlaf. Später wusste er es besser und hatte jedes Zusammentreffen vermieden. Was sich nicht durchziehen ließ. Die Eltern starben. Der Onkel. Sein bester Freund. Was seinen Rückzug auf die kleine Parzelle nur attraktiver gemacht hatte. Seitdem schaute er keine blutrünstigen und tragischen Filme, las keine Thriller. Nichts. Happy Ends waren für sein Seelenheil das Beste. Nur das hier – da war ein Happy End nicht mehr möglich.
Noch einmal blickte er zurück. Die Frau, so verzerrt ihr Gesicht im Tod auch war, schien jung zu sein. Viel, viel jünger als er mit seinen nahezu 70 Jahren. 35 vielleicht, möglicherweise 40. Er war im Schätzen nicht so gut, und bei einer Leiche konnte man wahrscheinlich schnell danebenliegen. Nur gut, dass sie darüber nicht beleidigt sein konnte.
Thorsten Henkel schüttelte den Kopf über seine abstrusen Gedanken. Die Züge der Frau kamen ihm seltsam bekannt vor, aber das war etwas, was ihm mit zunehmendem Alter immer öfter passierte. Dass ihm Fremde vertraut vorkamen und er schneller Ähnlichkeiten zwischen Menschen entdeckte. Ihre kastanienbraunen Haare waren eine Allerweltsfarbe bei Frauen, so gut kannte er sich aus. Das war wie bei seiner Christel, die hatte diesen Grundton auch, mit Varianten in Richtung rot oder einer dunkleren Haselnuss.
Endlich. Aus weiter Ferne klang das Martinshorn durch den Nebel. Gedämpft, aber stetig lauter werdend. Er seufzte erleichtert auf. Gleich müsste er sich nicht mehr verantwortlich fühlen. Er würde eine Zeugenaussage machen und dann sein Segway drehen und zurück zu seiner Christel fahren. Brötchen brauchte er heute keine. Der Appetit war ihm vergangen. In seiner Parzelle würde er den Schrecken hoffentlich schnell vergessen. Am liebsten würde er gar nicht wissen, was aus der Sache würde. Warum, weshalb, wieso diese Frau hier lag. Was ging es ihn an? In seiner heilen Welt spielte das keine Rolle. Nur Christel würde sich wundern, wo er so lange blieb und warum er ohne Brötchen käme. Wenn er ihr etwas erzählte, wäre es aus mit der Ruhe. Da kannte er sie nur zu gut. Er hoffte einfach, dass die ganze Geschichte keine allzu großen Auswirkungen auf das Norderneyer Leben hatte. Wenn er Glück hatte, war es nur ein profaner Selbstmord. Schrecklich, ohne Frage. Besonders für die Frau. Doch die Aufregung würde sich nach ein oder zwei Tagen legen. Und das wäre ihm ehrlich gesagt am allerliebsten.
*
»Polizei Norderney. Olaf Maternus. Was liegt an?«
»Moin. Ich rufe an aus der Wohnung von Petra Mertens. Sie wissen schon. Der Bürgermeisterkandidatin.«
»Ja und?«
»Ich glaube, Sie müssen kommen. Frau Mertens ist nicht da.«
»Ich glaube, ich verstehe nicht, was Sie wollen. Das ist doch kein Anlass für die Polizei, wenn jemand nicht zu Hause ist. Überhaupt. Wieso sind Sie da, wenn Sie nicht die Wohnungsinhaberin sind? Das ist viel eher von Relevanz für uns. Nennen Sie mir bitte Ihren Namen und den genauen Grund Ihres Anrufs.«
»Ich bin die Nachbarin. Und ich habe einen Schlüssel für die Wohnung von Frau Mertens. An Ihrer Stelle würde ich mich auf den Weg machen. Frau Mertens ist nicht in der Wohnung. Ihre Kinder sind es sehr wohl. Allein. Die Kinder sind aufgewacht, die Mutter war verschwunden. Das Bett nicht benutzt. Kein Zettel auf dem Küchentisch oder an der Wohnungstür. Keine Nachricht an mich. Das Handy ist ausgeschaltet. Sie ist nicht erreichbar. Kein Lebenszeichen. Nichts.«
Olaf Maternus runzelte die Stirn. Alle verfügbaren Kollegen einschließlich des Chefs waren ausgerückt. Fund einer weiblichen Leiche am Planetenweg. Die Haare an seinen Armen stellten sich auf. Es würde doch hoffentlich keinen Zusammenhang geben?
Mit aller Professionalität suchte er nach einer beruhigenden Antwort. »Dafür wird es sicher eine harmlose Erklärung geben. So jung sind die Kinder von Frau Mertens doch nicht, wenn ich das von ihrer Wahlvorstellung richtig in Erinnerung habe. Da darf man auch die Wohnung einmal verlassen.«
»Glauben Sie mir. Frau Mertens macht das nicht. Bitte kommen Sie her. Es muss sich einer um die Kinder kümmern.«
»Um die Kinder. Ja, natürlich.«
»Sagen Sie mal. Sie werden doch eine Kollegin vorbeischicken können, oder nicht? Bin ich überhaupt mit der Polizei verbunden?«
Maternus räusperte sich. »Selbstverständlich. Es ist nur so …« Er konnte ihr beileibe nicht sagen, weshalb alle diensthabenden Kollegen ausgerückt waren. »Ich denke, dass ich sicherheitshalber das Jugendamt benachrichtige.«
»Das Jugendamt? Wollen Sie aus der Tatsache eine politische Nummer machen? Weil Wahlkampf ist? Sie haben doch eben selbst gesagt, es könnte einen harmlosen Grund haben. Warum die Pferde scheu machen. Das Jugendamt.« Er konnte sich vorstellen, wie sie bei den Worten den Kopf schüttelte.
»Also gut. Ich kümmere mich. Bitte bleiben Sie bei den Kindern. Es kann etwas dauern, ja?«
Ratlos legte Olaf auf. Wen sollte er bloß zuerst benachrichtigen? Martin, seinen Vorgesetzten? Der da draußen am Fundort der Leiche genug zu tun hatte? Oder Norden um Unterstützung bitten? Das Jugendamt? Als Erstes würde er versuchen, eine der dienstfreien Kolleginnen zu erreichen. Und dann doch lieber Martin. Er hatte ein mulmiges Gefühl bei der Sache. Das ließ sich nicht von der Hand weisen.
*
Martin Ziegler strich sich die Haare aus der Stirn. Wahrscheinlich würde er sie doch wieder kürzer tragen müssen. In Situationen wie diesen machte es ihn verrückt, dass sie ihm ständig die Sicht nahmen. Andererseits hatte er keinen größeren Wunsch, als die Augen vor dem zuzumachen, was er vorgefunden hatte.
Noch kniete der Notarzt auf einer Plastikunterlage neben dem toten Körper. Aber es gab keinerlei Reanimationsversuche. Das hatte er erwartet. Doch auf einen oberflächlichen Augenschein durfte sich kein Arzt verlassen.
Wenige Minuten waren das, in denen er, Martin Ziegler, leitender Inselpolizist, über das weitere Vorgehen nachdenken konnte. Vorausahnen konnte, was der nächste Anruf für Konsequenzen haben würde. Wenn er zugeben musste, dass es schon wieder einen Todesfall auf der beliebten Ferieninsel gab. Und zwar nicht irgendeinen, sondern einen unnatürlichen. Möglicherweise sogar Mord. Wenn er eingestehen musste, dass so etwas seit seinem Amtsantritt gang und gäbe war. Was man daraus bei der Kriminalpolizei in Aurich für Schlüsse zog, hatten sie ihm im letzten Jahr deutlich vermittelt. Die Stimme der zuständigen Kommissarin hatte er noch sehr gut im Ohr. Er stöhnte auf, als er daran dachte, dass sie in zwei, drei Stunden wieder vor ihm stehen würde. Es durfte nicht wahr sein. Als läge auf der Insel ein Fluch seit seinem Amtsantritt.
Der Arzt erhob sich und trat auf ihn zu. »Da kann ich nichts mehr ausrichten. Da müssen die Fachleute aus der Gerichtsmedizin ran. Tut mir leid.«
Er hörte das Mitgefühl in der Stimme des Arztes. Er war ein Kollege von Martins Lebensgefährtin. Ob Anne mit ihm über seine Zweifel und Sorgen gesprochen hatte? Ein unbehagliches Gefühl erfasste ihn. Schlimm genug, wenn Aurich nichts von ihm hielt. Mitleid war das Allerletzte, was er auf der Insel haben wollte. Ob auch Anne …?
Unwillig hob er die Hand. »Können Sie denn schon was sagen? Eine erste Einschätzung?«
Der Arzt zog eine Zigarettenpackung aus seiner Rettungsjacke und zündete sich eine an. »Sorry. Ich rauche nur nach Todesfällen. Aber das muss sein. Also: sieht für mich nach einer tödlichen Schussverletzung aus. Ich will mich nicht endgültig festlegen, ob es ein Suizid sein könnte. Sieht aber weniger danach aus. Auf den ersten Blick habe ich keine Waffe gesehen. Das Ganze hat eher den Charakter einer Inszenierung. Wenn Sie näher rangehen, werden Sie wissen, wovon ich spreche. Ich weiß nur: Wenn das ein Mord ist, dann aber gute Nacht, Norderney.«
»Wieso?« Martin fuhr ein kalter Schauder über den Rücken.
»Haben Sie sie noch nicht erkannt? Die Tote? Ich dachte, wo im Augenblick doch jeder …« Das laute Schrillen von Martins Diensthandy ließ den Notarzt stocken.
Fast wollte Martin den Anruf wegdrücken. Was würde Olaf Maternus schon Wichtiges wollen? Nichts konnte eine so hohe Priorität haben wie der Leichenfund. Doch dann nahm er das Telefonat an und spürte, wie ihm seine Züge entglitten. Sein Blick fiel auf die Frau, die dort hinten an der Stange des Jupiters lehnte. Das konnte doch unmöglich wahr sein. Er starrte den Notarzt an, der an seiner Zigarette zog und tief inhalierte.
Martin ließ das Handy sinken. Der Arzt sprach, als hätte es keine Unterbrechung gegeben, aus der Rauchwolke heraus, die seinen Mund wabernd verließ und sich mit dem Dunst des Morgens zu vermischen schien: »… das Wahlplakat kennt. Das ist eindeutig Petra Mertens, die Bürgermeisterkandidatin. Hundertpro würde ich sagen. Da möchte ich nicht in Ihrer Haut stecken.«
*
Die Plakate waren beschmiert. Alle. Samt und sonders. Es gab kein einziges, das nicht betroffen war.
KWK hatte ein Hitlerbärtchen, und dem Kandidaten der Fortschrittspartei, Häusler, hatte jemand Dollarzeichen in die Augen gemalt. So weit – so banal, weil fantasielos. Am schlimmsten hatte es aus Anne Wagners Sicht die Kandidatin der Zukunfts- und Umweltpartei, der ZUP, erwischt. Und damit die einzige Frau. Die angedeutete Banane an ihren Lippen war eindeutig sexistisch und obszön gemeint. Anne machte so etwas wütend. Der Zustand der politischen Landschaft war ein Trauerspiel, egal, wohin sie sah. Weltweit, europaweit, deutschlandweit. Das brach sich bis in die kleinsten kommunalen Zellen runter. Ein unsäglicher Umgang miteinander. Manipulative Stimmungsmache und ein Toben des Mobs im Internet waren alltäglich geworden.
Bisher hatte sie Norderney für so etwas wie die Insel der Glückseligen gehalten. Klar gab es auch hier Probleme. Die waren ja zuletzt oft genug benannt worden. Stichwort: Ausverkauf der Insel. Auf der anderen Seite waren das doch Luxussorgen im Vergleich dazu, was anderswo abging. Oft hatte sie sogar ein schlechtes Gewissen, so weit vom Schuss zu sein.
Und trotzdem machte sich auf der Insel etwas breit, was ihr nicht gefiel. Der Respekt voreinander schwand, das Verständnis füreinander genauso. Jeder war sich selbst der Nächste, der Spruch galt mehr denn je. Das »first« reklamierte mittlerweile jedermann für sich.
Anne bremste ab, als ein paar Kaninchen hinter der Kurve ihren Weg blockierten. Die kühle, frische Luft auf der Strecke zum Krankenhaus tat ihr wie jeden Morgen gut. Am liebsten würde sie weiterfahren in die Dünen hinein Richtung Ostende der Insel. Doch dagegen sprach der Dienstbeginn. Wenn sie heute Nachmittag einmal pünktlich die Station verlassen konnte, würde sie eine ausgiebige Runde drehen. Schon seit Anfang des Monats lag Frühjahrsluft über der Insel. Die Tage wurden länger, spätestens in drei Wochen würde die Saison Fahrt aufnehmen, und am Ende des nächsten Monats begann die Tennissaison. Schade, dass Norderney keine Halle besaß. Vielleicht würde sich das ändern, wenn die Insel über die Wintermonate attraktiver wurde. Davon hätten sie doch alle etwas. Anne grinste. Bei der nächsten Wahlveranstaltung würde sie das einfach ansprechen. Mal sehen, was für wohltönende Argumente von den Kandidaten kämen. Schlichtweg Wählerwünsche abzulehnen, traute sich ja kein Kommunalpolitiker in der heißen Phase des Wettkampfs.
Wobei sie schon wusste, wem sie ihre Stimme geben würde. So etwas war mittlerweile eher ein Wählen des geringsten Übels. Aber im Fall von Petra Mertens war das anders. Die Frau überzeugte sie. Sie war authentisch, energiegeladen und lebte vieles von dem, was sie sagte, vor. Bei den beiden anderen hatte Anne das Gefühl, sie sorgten eher für das eigene Wohlergehen. Aber sie wollte nicht ungerecht sein. Sie würde den Job, der mit einigem Klinkenputzen verbunden war, nicht machen wollen. Die vielen unbezahlten Stunden hinter den Kulissen wollte kaum einer sehen, aber sie gehörten für jeden Politiker dazu. Anne wusste das. Ihre Eltern waren beide seit jeher kommunalpolitisch aktiv. Sie stand auf dem Standpunkt, wer nur meckert, muss es selbst machen. Und da sie das nicht wollte, zollte sie so manchem unliebsamen Kompromiss der Politik doch Anerkennung.
Das mit den Plakaten jedenfalls war eine Schweinerei. Anonymes, feiges Verhalten. Nur auf Randale und Zerstörung ausgerichtet. Was sollten denn das für Botschaften sein? Das war für sie nicht ernst zu nehmen. Im Gegenteil. Umso mehr empfand sie Sympathie selbst für die Kandidaten, die ihr politisch fernstanden. Plakative Urteile mochte sie nicht. Basta.
Anne bremste vor dem Krankenhaus scharf ab, weil sie in ihrem Gedankenfluss zu heftig in die Pedale getreten hatte. Fast wäre ihr Fahrrad zur Seite gerutscht, im letzten Moment konnte sie sich auffangen. Das wäre was gewesen, wenn sie sich statt im Arztkittel im Flügelhemdchen auf Station wiedergefunden hätte.
Im gleichen Augenblick hielt neben ihr der Notarztwagen. Ihr Kollege grüßte mit ernstem Gesicht.
»So schlimm?«, rief Anne zu ihm rüber.
»Schlimmer. Ich hatte schon ein Date mit deinem Mann.«
»Ja, ich weiß, dass er früh herausgerufen wurde. Kannst du etwas sagen?«
Der Notarzt zögerte. Zog eine Zigarettenpackung aus der Tasche, sah sie an und steckte sie zurück. »Frag ihn lieber selbst. Spätestens heute Mittag wird auf der Insel nichts mehr so sein, wie es war.«
*
Über die Identität der Toten bestand kein Zweifel. Da waren sie sich alle einig. Martin Ziegler drückte die Finger gegen seine Stirn, hinter der sich ein dumpfer Kopfschmerz eingetrommelt hatte. Er wusste, was das zu bedeuten hatte. Zu viel der speziellen Teezeremonie und zu wenig Schlaf trafen auf scharfen Nordseewind und extremen Stress. Da würde auch das Einwerfen von Tabletten nichts gegen ausrichten. Ruhe wäre etwas, das helfen würde. Er lachte bitter auf. Ausgerechnet Ruhe.
Sein Kollege auf dem Beifahrersitz schaute ihn schräg von der Seite an. »Was ist los, Chef? Eine Idee?«
»Schön wär’s«, grummelte Ziegler. »Ich stelle mir gerade vor, was uns gleich, wenn die Kripo ankommt, an Sprüchen um die Ohren fliegen wird. Von wegen …« Er brach mitten im Satz ab. Es wäre für seine Autorität nicht förderlich, wenn er die abwertenden Einschätzungen von Aurich höchstpersönlich an seine Mitarbeiter weitergab.
Ronnie schien aber zu wissen, was er meinte, denn er nickte ernst vor sich hin. »Ja. Aurich. Ich erinnere mich an das letzte Mal. Braucht man eigentlich nicht.«
»Wer braucht schon Mord und Totschlag? Wir nicht und die Opfer ganz sicher nicht.«
»Schon klar, Chef, habe auch eher gemeint, dass die doch froh sein sollen, wie wir die Dinge regeln. Mit einem kollegialen Führungsstil. Sonst verliert unsereins doch schon nach kurzer Zeit die Lust am Polizeidienst.«
Martin Ziegler wusste das Kompliment zu schätzen, das in den Sätzen von Ronnie lag. Auf seine Truppe konnte er sich verlassen. Auch auf Olaf Maternus, der eine Zeit lang mit ihm als Vorgesetztem gehadert hatte. Der Feind befand sich in ihm selbst. Er war es, der unter zu großen Rechtfertigungsdruck geriet. Er war derjenige, den die Selbstzweifel immer wieder überfielen. Weshalb er auf Norderney gestrandet war, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur, dass die Verbrechen ihn verfolgten, sich nicht darum scherten, was er sich erhofft hatte.
»Jedenfalls haben die von der Kripo und der KTU nichts zu meckern, von wegen unsachgemäßer Spurenvernichtung und so. Wir haben den Fundort abgesperrt und harren der Dinge, die da kommen. Alles richtig gemacht, Chef.«
Martin klappte die Sonnenblende herunter und betrachtete sein müdes Gesicht im Spiegel. »Mag sein. Wobei ich das kaum aushalten kann, tatenlos abzuwarten.«
»Hat Aurich aber extra betont.«
»In so einem Fall verfluche ich das Inseldasein. Was für ein Aufwand, bis der ganze Ermittlungstrupp vor Ort ist. Als wenn es nicht auch darauf ankäme, schnell zu sein. Ich mag gar nicht daran denken, wie viel Zeit ein Täter dadurch gewinnt.«
»Du meinst also, es war ein Mord?«
»Mir fehlt gerade die Fantasie, mir etwas anderes vorzustellen. Petra Mertens hat zwei Kinder. Mir dreht sich der Magen rum, wenn ich daran denke, dass die Kollegen gerade vollkommen handlungsunfähig auf das Jugendamt und die Ergebnisse warten müssen. Was das für die Kinder bedeutet, dass ihre Mutter tot aufgefunden wurde – wirklich, ich will das gar nicht zu Ende denken. Erst recht kann ich nicht daran glauben, dass eine Frau wie Petra Mertens ihre Kinder im Stich lassen würde, um sich selbst zu töten.«
Ronnie schwieg, und Martin konnte sich denken, dass er an die Fälle dachte, wo genau so etwas passiert war.
»Überhaupt – sie war ja voller Zukunftspläne«, unterstützte er eilig seine These weiter. »Wer strebt denn ein politisches Amt an, wenn er aus dem Leben scheiden will?«
»Und wenn es genau deswegen ist?« Ronnies Stimme klang gepresst, als traute er sich nicht, einen Gedanken zu äußern, der ihnen allen wahrscheinlich als Erstes gekommen war.
Martin hob abwehrend die Hände. »Ronnie, ich bitte dich. Wir sind in Ostfriesland. Auf Norderney. Weder im Wilden Westen noch bei der italienischen Camorra.«
»Da bin ich mir manchmal nicht so sicher, wenn ich den einen oder anderen Politiker reden höre.«
»Jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Zwischen Wahlkampfreden und einem Mord liegen Welten. Das darf man nicht leichtfertig miteinander vermischen.« Es nervte ihn, wie lehrerhaft er klang. Deswegen schob er schnell hinterher: »Oder gibt’s was Konkretes, auf das du anspielst?«
Erstaunt stellte Martin fest, dass Ronnie statt einer prompten Antwort anfing, mit seinen Händen zu knacken, während er den Blick auf die Tote richtete. »Nö«, sagte er schließlich wenig überzeugend. »Nö, eigentlich nicht.«
»Sag mal, Ronnie, willst du mich verhohnepiepeln? Was weißt du?«
»Ach, du weißt doch, wie die Leute reden. Der eine dies, der andere das.«
»Ronnie!«
»Schon gut, Chef, schon gut. Na ja, der Ton gegenüber der Mertens ist nicht gerade freundlicher geworden zuletzt. Ich habe gehört, wie der ein oder andere sich darüber ausgelassen hat, was ihr wohl fehlen würde. Weißt doch, die alten Sprüche: Der muss es nur mal einer richtig besorgen. Die hat wohl lange keinen Mann mehr gehabt.«
»Zum Kotzen.«
»Stimmt. Irgendwie denkt man ja, das wächst sich irgendwann aus.«
»Glaube ich nicht.« Martin dachte an Anne, mit der er zuletzt über die ›Me too‹-Debatte diskutiert hatte. Und daran, dass auch Ronnie dazu neigte, den ein oder anderen Spruch rauszuhauen.
»Na ja, und wenn das wirklich so eine Geschichte wäre? Dass es eine Vergewaltigung war und der Täter Angst bekommen hat?«
»Und dann wüsstest du, wer so darüber gesprochen hat? Also, wer so etwas zumindest mal gedacht und geäußert hat?« Martin sah, wie Ronnie bei seinen Worten in den Sitz rutschte.
»Hm. Ja. Wenn es so was wäre, dann wüsste ich wohl, wer das geäußert hat.«
Martin hoffte nur, dass Ronnie sich nicht aktiv an diesen Sprüchen beteiligt hatte, sondern nur stillschweigend ertragen hatte, wie Freunde oder Nachbarn solche Zoten losgelassen hatten. Aber er war zu lange im Polizeidienst, um nicht genau zu wissen, wie so etwas unter Männern lief.
Schweigend starrte er nach draußen.
»Also gut«, sagte er schließlich. »Ich brauche dazu gar nichts von dir zu hören. Zumindest, solange nicht feststeht, dass der Fall sich tatsächlich in diese Richtung entwickelt. Das werden die Untersuchungen ja zeigen. Aber ich halte es schon für unwahrscheinlich, dass ein Vergewaltiger eine Pistole dabei hat. Letzteres klingt so viel mehr nach Absicht. Aber auszuschließen ist es nicht.«
Ronnie richtete sich erleichtert auf und fuhr sich durch seine stachelig gegelten Haare. »Nee, klar, Chef, dann würde ich auch etwas sagen, wenn das darauf hinausliefe. Aber wir warten ab, ja? Alles andere ist schließlich unseriöse Spekulation.«
Martin kannte seinen Mitarbeiter genug, um die Erleichterung hinter dem plappernden Tonfall zu erkennen. Ronnie war einer der Guten, auch wenn er sich nicht immer dem Gruppendruck entziehen konnte. Aber für ihn würde er seine Hand ins Feuer legen. »Schon gut. Abwarten ist genau richtig. Ich wüsste auch gar nicht, was das mit dem Koffer neben der Leiche sollte, wenn es denn ein Sexualdelikt wäre.«
»Der Koffer, ja«, entfuhr es Ronnie. »Stimmt. Ich möchte nur zu gern wissen, was es damit auf sich hat.«
*
Nicole war immer wieder überrascht, wie Kinder in Situationen reagierten, mit denen sie vollkommen überfordert sein mussten. Das Erscheinen von Olaf und ihr hatte zwar fragende Blicke ausgelöst, nachdem sie sich aber der Nachbarin und den Kindern vorgestellt hatten, war vor allem der Junge schnell in die Rolle des verantwortlichen Familienoberhauptes geschlüpft. Zuerst hatte er sich bei der Frau bedankt, danach die Arme schützend um seine kleine Schwester gelegt und gefragt, ob sie schon sagen könnte, wo seine Mutter sei.
Früher hatte Nicole geglaubt, dass Kinder schrien und weinten, wenn sie in Sorge um ihre Eltern waren, aber die Erfahrung hatte sie anderes gelehrt. Als wäre es ein magischer Glaube, der sie stark machte, um sich damit vor Unvorstellbarem zu schützen. Trotzdem wusste sie, dass der Junge und das Mädchen mit unheilvoller Angst darauf warteten, was die Polizei sagen würde.
Dass Nicole nun im Kinderzimmer auf dem Boden lag, während Olaf sich aus der Küche einen Stuhl dazugestellt hatte und mit ihnen Lego und Playmobil spielte, schien ihr schon fast abstrus.
»Kommt Mama gleich wieder?«, hatte das Mädchen vorhin gefragt und sie mit ernsten braunen Augen angeschaut.Bevor sie antworten konnte, hatte Mattis, der Junge, geantwortet: »Was denkst du denn? Klar, kommt sie gleich. Die Polizei passt nur auf, weil kein anderer Zeit hatte.«
»Aber wo soll Mama denn sein, ohne uns Bescheid zu sagen? Das macht sie doch nie. Immer will sie, dass einer bei uns ist.«
»Deswegen ist ja die Polizei da. Mama musste bestimmt wegen der Wahl weg. Du weißt doch: Damit sie Bürgermeisterin wird. Da müssen wir sie unbedingt unterstützen.« Der Junge hatte mit einem schrägen Blick zu Nicole und Olaf geblickt, wahrscheinlich in der Sorge, sie könnten einen Einwand gegen seine Theorie erheben. Aber sie war erleichtert, dass er die Antworten fand, die für den Augenblick beruhigten. Ihr wäre das nicht gelungen.
Stattdessen baute sie nun einen pinken Hundesalon neben der Piratenbucht auf.
»Eigentlich spielt Mattis so was gar nicht mehr«, ließ Klara sie wissen, die langsam Zutrauen zu ihr gewann. »Mattis spielt immer nur an der Playstation.«
»Und du an deinem Handy.« Der Junge klang sauer.
»Ich schaue mir nur meine Serien an. Aber Mama will nicht, dass du so viel Fortnite spielst.«
»Mache ich ja gar nicht.«
»Jetzt nicht. Mama wird sich freuen, wenn sie heimkommt, dass wir mal wieder zusammen spielen.«
»Hm«, antwortete Mattis nur, und Nicole war sich sicher, dass seine Angst mit jeder Minute, die verstrich, größer wurde.
Nicole schnürte es die Kehle zusammen, wenn sie an das kurze Gespräch mit Martin dachte. Mit aller Macht versuchte sie, den Gedanken auszublenden, dass die Leiche, an deren Fundort ihr Vorgesetzter auf die Kripo wartete, etwas mit der verschwundenen Mutter der beiden Kinder zu tun hatte. Selbst wenn das, was Martin gesagt hatte, wenig Zweifel an der Situation ließ.
Bis jetzt hatte Nicole sich nicht dazu hinreißen lassen, allzu viel zu fragen. Wenn es sich bei der Toten tatsächlich um Frau Mertens handelte, dann taten sie gut daran, die Kinder nicht durch Fragestellungen zu beeinflussen. Dann wäre jede Erinnerung wichtig, ohne dass sie jetzt durch Gespräche überlagert wurden.
Trotzdem rutschte es ihr irgendwann heraus: »Und euer Papa? Den seht ihr doch bestimmt auch ab und an. Vielleicht können wir ihn ja anrufen.«
Sie merkte sofort, dass sie einen Riesenfehler begangen hatte. Idiotin, beschimpfte sie sich selbst. Wie eine Anfängerin. Mit ihrem Heile-Welt-Denken von Komplettfamilien. Sie wusste ja, dass Frau Mertens alleinerziehend war. Trotzdem hatte sie dem Familiensystem sofort einen existenten Vater angedichtet. Als wenn sie es nicht kennen würde, die Sorgerechtsstreitigkeiten, die Umgangsverbote von Seiten der Mütter, die abgetauchten Väter, die nicht zahlen wollten. Natürlich kannte sie das. Die ganze Palette. Bis hin zu Gewalttaten und Frauenhaus. Nur hier war sie wohl reingefallen mit ihrer fatalen Neigung zu Friede, Freude, Eierkuchen. Als wenn es das Komplementärprogramm zu ihrem Job wäre.
Es dauerte einen Moment, bis sie begriff, dass die Kinder sie immer noch entsetzt anschauten und nicht antworteten. Verlegen griff sie zu der Kanone und richtete sie auf die herumstehenden Piraten. »Na, ist ja auch egal, da können wir uns später drum kümmern«, versuchte sie, mit Gemurmel ihre Frage abzuschwächen. »Spielt ihr weiter mit, oder wollt ihr lieber etwas anderes machen?«
Nicole schielte auf ihre Armbanduhr. Hoffentlich war das Jugendamt bald da und konnte übernehmen. Sie hatten doch Erfahrung in solchen Dingen. Es ging ja diesmal um deutlich mehr als um ein am Strand verloren gegangenes Kind, mit dem sie sich auf Norderney manchmal beschäftigen mussten.
Die Geschwister rührten sich immer noch nicht.
Dann räusperte sich Mattis. Täuschte sie sich oder klang die Stimme des Jungen deutlich tiefer als vor wenigen Minuten? Erwachsener sah er auf jeden Fall aus, als er sich halb aufrichtete und sich zwischen seine Schwester und Nicole schob. »Unser Vater? Unser Vater lebt doch nicht mehr. Schon lange.«
*
»Gert Schneyder, guten Tag, Herr Ziegler. Wir kennen uns dem Namen nach, oder?«
Martin Ziegler hatte sich neben dem Polizeiwagen ausgestreckt und den Kopf im Nacken rollen lassen, als sich hinter dem Pritschenwagen ihrer Dienststelle eine Kolonne von Einsatzwagen näherte. Er bereute nach wie vor jeden Schluck der ostfriesischen Teezeremonie von gestern Abend und die fehlenden Stunden Schlaf, weil er lange mit Anne bei Daniela und Frank geblieben war, auch, als Frau Dirkens sich schon in ihre Wohnung unter dem Dach zurückgezogen hatte. Die Aussicht auf die Mordkommission vom Festland ließ seine Laune in den Keller sinken. Wenn er an das letzte Mal dachte, wünschte er sich nichts lieber als einen klaren Kopf.
Umso erstaunter reagierte er auf den Kollegen. Irritiert schaute er hinter ihn, in der Erwartung, dass ein blonder Haarschopf auftauchte, der ihm in unliebsamer Erinnerung geblieben war.
Der Mann grinste: »Falls sie Frau Lichterfeld vermissen, da muss ich Sie enttäuschen. Sie ist leider im Urlaub. Dieses Mal müssen Sie mit mir vorliebnehmen.«
Martin sah, wie sich das Grinsen verstärkte, als er hörbar ausatmete. Wenigstens das blieb ihm erspart. Alles andere konnte nur besser sein, als der despektierliche Blick, dem er beim letzten Mordfall ausgesetzt war. Die Reaktion des Hauptkommissars, der heute im Einsatz war, deutete darauf hin, dass die Unstimmigkeiten zwischen Aurich und Norderney durchaus nicht unbemerkt geblieben waren. Mit welcher Bewertung wollte er lieber gar nicht so genau wissen.
»Also, was gibt’s denn?«, fragte dieser Schneyder und schien sich nicht zu wundern, dass Martin ihm nur wortlos die Hand gereicht hatte. »Eine weibliche Leiche? Wissen Sie schon mehr?« Er blickte zur Fundstelle herüber, hob den Daumen und lobte: »Vorbildlich. Soweit ich sehen kann, habt ihr nur abgesichert und keine Spuren vernichtet.«
Der joviale Ton entspannte Martin sofort. Kein Vorwurf, keine Skepsis in den ersten Sätzen. Er straffte seine Schultern und gab in wenigen Worten wieder, was sie wussten: »Ein Dauercamper ist heute Morgen mit dem Segway hier entlanggekommen. Er hat die Frau gefunden und sowohl den Notarzt als auch uns verständigt. Eine Reanimation war nicht mehr möglich. Auf den ersten Blick sieht es nach einer Schussverletzung aus. Eine Waffe ist allerdings bisher nicht sichtbar. Wir wollten nicht …«
»Vollkommen richtig.« Der Kripobeamte klopfte auf Martins Schulter, was selten jemand wegen seiner Größe tat. Aber Schneyder, der sicher an der Zwei-Meter-Marke schrappte, überragte ihn noch. »Alles richtig gemacht. Vielleicht liegt sie unter dem Körper oder in den Gräsern. Je nachdem, wie stark der Rückstoß war.«
»Wenn es ein Suizid sein sollte, ist das Aufgebot groß, aber angesichts der Brisanz wollen wir auf Nummer sicher gehen.«
»Der Brisanz? Was genau ist damit gemeint?« Schneyder sprach unaufgeregt und gelangweilt. Martin war sich nicht sicher, ob er das mochte oder nicht. Seltsam fand er es auf alle Fälle.
»Ich dachte, wir hätten es am Telefon erwähnt.«
»Was?«
»Nun, wir gehen davon aus, dass es sich bei der Toten um unsere Bürgermeisterkandidatin handelt. Petra Mertens. Gebürtige Rheinländerin, lebt aber schon einige Jahre in Norddeutschland. Seit drei Jahren auf Norderney. Hat in einer Forschungseinheit gearbeitet.«
»Mit absoluter Gewissheit?« Schneyder knibbelte an seinen Fingern, auf die er angestrengt starrte.
Martin irritierte der fehlende Blickkontakt, aber er holte weiter aus. »Das Konterfei der Frau lächelt uns seit Wochen von jedem dritten Wahlplakat an. Da kann man sich schon relativ sicher sein.«
»Ha! Sie sagen es. ›Relativ‹ sicher. Nicht hundertprozentig.« Das Grinsen flackerte erneut auf, um dann in eine überaus ernste Mimik überzugehen, bei der die Mundwinkel sich drastisch absenkten.
Martin starrte ihn verwundert an. Er wurde nicht schlau aus diesem Mann.
»Bürgermeisterkandidatin, sagen Sie?«, murmelte dieser vor sich hin.
Martin nickte. Es war ihm egal, ob Schneyder das sah. Er schien in seiner eigenen Welt.
»Brisant, brisant, brisant.«
Martin rollte ansatzweise mit den Augen. »Sag ich doch.«
»Gut, das werde ich gleich mit Aurich besprechen. Lassen Sie uns aber erst einmal Orientierung schaffen. Was ist denn mit dem dunklen Gegenstand da hinten bei der Leiche? Ein Koffer?«
»Dazu komme ich gleich. Vorab: Es gibt etwas, was uns sicher macht, dass es sich um Frau Mertens handelt. Sie ist alleinerziehende Mutter. Gerade heute Morgen wurden die Kollegen aus der Wohnung von Frau Mertens verständigt. Eine Nachbarin hat uns informiert, dass die Kinder alleine sind. Ohne zu wissen, wo sich die Mutter aufhält. Die über Nacht einfach verschwunden ist. Was sonst nie vorkommt.«
»Herrgott, wie dramatisch ist das denn?«
Martin zwinkerte mit den Augen. Dramatisch fand er sein Gegenüber mit den überzogenen Reaktionen.
»Ja. Wir sind in großer Sorge. Im Moment sind zwei Kollegen bei den Kindern. Zwölf und acht Jahre im Übrigen. Wir haben das Jugendamt verständigt. Für alle Fälle. Ich dachte, das sollten Sie wissen.«
»Sehr gut. Vorbildlich. Umsichtig.« Schneyder nickte und sah ihn diesmal mit wasserblauen Augen an. »Gute Arbeit bisher, Herr Kollege. Und nun zu meiner Frage – was ist das dort hinten?«
»Ja, das ist wirklich seltsam. Wir haben uns nur einen oberflächlichen Eindruck verschaffen können.« Martin nickte mit dem Kinn in Richtung Fundstelle. »Stichwort Spuren. Aber der Koffer steht weit auf und …« Er stockte. Alles kam ihm unwirklich vor. Hatte er nicht richtig hingeschaut? Konnte das überhaupt sein? Entschlossen packte er Schneyder am Ärmel seiner braunen Öljacke. »Lassen Sie uns nicht reden. Schauen Sie es sich einfach mal an!«
*
Ruth Keiser atmete hörbar aus, als mit der roten Stange, die hoch hinausragte, der Bonner Verteilerkreis in Sichtweite kam. Obwohl sie heute Morgen früh losgefahren war, hatte der Verkehr auf der Autobahn sie geschafft. In ihrem Mini Cooper fühlte sie sich angesichts der Kolonnen von LKW neben ihr äußerst unwohl. Jetzt aber freute sie sich auf das Wochenende und auf Oskar.
Beim Gedanken an ihn drehte sie die Musik, die sie auf der ganzen Fahrt begleitet hatte, etwas lauter. Die ›Seaside Season‹ von Blank and Jones erinnerte sie nicht nur an die gemeinsame Zeit auf Norderney und in der Milchbar, sondern half ihr, beim Autofahren die Gedanken schweifen zu lassen.
»Dich hat es ganz schön erwischt«, hatte Lisa-Marie, ihre erwachsene Tochter, beim letzten Telefonat lakonisch festgestellt.
Ruth hatte nicht widersprochen, auch wenn es ihr selbst seltsam vorkam.
»Wie oft hast du mich eigentlich am Bodensee besucht, seit ich hier studiere?«
Nur einen winzigen Moment erfasste Ruth das schlechte Gewissen, dann lachte sie hell auf. »Sag nur, das hätte dir gefallen, wenn ich ständig bei dir aufgelaufen wäre? Ich hatte immer das Gefühl, dass du uns deswegen dankbar bist.«
Lisa-Marie hatte prompt in ihr Lachen eingestimmt. »Hast ja recht. Hab keinen Bock auf Heli-Eltern. Es reicht, was ich bei den Kommilitonen mitbekomme.«
»Ich habe gerade von einer Studie gehört, die besagt, dass das Konzept der Helikopter-Eltern aufginge. Die Kinder seien erfolgreich …«
»Drehst du den Spieß jetzt um und machst mir einen Vorwurf? Weil ich nicht straight genug zum Abschluss komme?«
»Blödsinn. Ich bin froh, dass du dir Zeit nimmst.«
»Anders als du, wolltest du sagen, was?«
»Vielleicht.«
»Ach Muttchen, komm, du hast alles richtig gemacht. Ihr habt beide alles richtig gemacht.«
Ruth lachte erneut. »Du weißt, wie du mich kriegst. Sag du noch mal ›Muttchen‹, dann fällt die nächste Überweisung etwas kleiner aus.«
»Erpressung.«
»Kindererziehung besteht zu großen Teilen aus Erpressung, weißt du doch.«
»Stimmt nicht. Ihr habt das besser gemacht. Bis jetzt.«
»Apropos: Wie geht es Michael? Hörst du was von deinem Vater?«
»Ja. Er kommt demnächst vorbei, auf dem Weg nach Italien. Ich habe ihm von Oskar und dir erzählt.«
Ruth stockte einen Moment der Atem. »Echt?«
»Mama. Chill mal. Ihr seid ewig getrennt. Papa bekommt keinen Herzinfarkt, weil du nach über 20 Jahren wieder richtig verliebt bist.«
»Nach über 20 Jahren«, murmelte Ruth und fasste in ihre Haare, als fände sie dort Halt. »Wie sich das anhört.«
»Ist ja nicht so, als wenn Papa und ich glauben, dass du in all den Jahren keusch gelebt hast. Sondern eher, dass du es verstanden hast, große Geheimnisse um dein Liebesleben zu machen. Aber Papa findet es gut. Das mit Oskar.«
»So. Findet er gut.« Ruth wusste selbst nicht, warum sie so fahrig daherredete. Plötzlich hatte sie wie befreit geantwortet: »Weißt du was? Ich finde es auch gut!«
Und so war es. Sie fühlte sich in den letzten Monaten wie ausgewechselt. Als hätte irgendetwas sie angeknipst. Sie wachte erfrischter auf, ging beschwingt durch den Tag, erfreute sich an Kleinigkeiten, die sie zuletzt oft vor lauter Grübelei kaum gesehen hatte, und kam sich vor allem wieder jung vor. So banal das klang. Würde eine ihrer Freundinnen sich so geäußert haben, dann hätte Ruth ihr einen Rückfall in pubertäres Verhalten attestiert, ohne wirkliches Verständnis aufbringen zu können. Psychologin, die sie war, hin oder her. Wie schon gesagt, Verliebtheit war zu banal für ihre Verhältnisse. Normalerweise.
Ruth setzte den Blinker und fuhr kurz vor dem Verteilerkreis auf die Stadtautobahn Richtung Südstadt. Als Erstes würde sie einen Kaffee trinken gehen. Danach ihre Reisetasche in Oskars Wohnung vorbeibringen und ihm eine kurze Nachricht schicken, dass sie da war. Und dann? Museum oder Rhein? Beides war verführerisch. Zumal er am Telefon davon gesprochen hatte, dass die ersten Bäume blühten.
Sie bog in die Straße ein, in der ein Café lag, in dem sie gerne ihren Cappuccino tranken, als ihr Handy klingelte. Oskars Nummer erschien auf dem Display. Sie drückte den Knopf der Freisprechanlage.
»Hallo. Bist du gut gelandet?« Er wartete gar nicht ab, dass sie sich meldete.
»Wenn du den Verteilerkreis als Bonner Flughafen betrachtest, dann ja. Den kann man mit seiner Stange kaum verfehlen.«
»Das ist nun mal verbindende Kunst. Köln hat an seinem Verteiler das Gegenstück.«
Ruth schnaufte gespielt. »Ich weiß. Und ja, es soll Kunst sein. Habe ich verstanden.«
»Nicht? Du bist doch die große Kunstexpertin von uns beiden.«
»Das glaubst du.«
»Nun, ich kenne wenige Leute, die so viel zeitgenössische Malerei an ihren Wänden haben wie du. Und deine eigenen Werke …«
»Versuche, meinst du wohl. Nicht Werke.«
»Stell dein Licht nicht unter den Scheffel, Frau Keiser mit Ei. Ich habe mich in die selbstbewussteste und in sich ruhendste Frau, die mir seit Langem untergekommen ist, verliebt.«
»Da muss eine Verwechslung vorliegen, das kann nicht ich gewesen sein«, raunte Ruth, die sich trotz allem über seine Worte freute.
»Never ever. Und das weißt du auch.«
»Vielleicht. Das musst du mir später noch einmal persönlich sagen.«
»Das werde ich, darauf kannst du wetten. Warte nur ab.« Seine Stimme hatte sich abgesenkt. Ruths Körper kribbelte.
»Vielleicht sollte ich doch lieber nach Osnabrück zurückfahren.« Dass sie bei ihren Worten verträumt lächelte, bemerkte sie erst, als sie der Mann neben ihr an der roten Ampel anfangs irritiert anschaute, dann aber mit einem Winken reagierte. Schnell drehte sie den Kopf beiseite.
»Unterstehe dich. Ich habe uns ein schönes Wochenendprogramm zusammengestellt. Lass dich mal überraschen. Ganz viel Kunst und Kultur dabei, aber keine roten Stangen.«
»Na, das beruhigt mich ja ein wenig. Dann sollte ich vielleicht heute noch nicht ins Museum? Ich hatte mir das Macke-Haus vorgenommen.«
»Doch, doch. Mach ruhig. August Macke habe ich nicht geplant. Bei mir wird es übrigens heute länger, dafür muss ich morgen nur kurz in die Redaktion. Ach ja: Ich habe von einer Nachbarin ein Fahrrad für dich abgestaubt. Steht bei mir im Keller. Der Schlüssel dafür hängt am Bord neben der Tür. Ist beschriftet.«
»Das ist ja genial. Kannst du Gedanken lesen? Dann mache ich beides. Museum und mit dem Fahrrad am Rhein entlang.«
»Hört sich nach einem guten Plan an.«
»Finde ich auch.« Sie räusperte sich kurz. Manche Sätze fielen ihr immer noch schwer. »Übrigens, habe ich es schon gesagt? Ich freue mich auf dich. Sehr.«
Bevor er antworten konnte, beendete sie die Verbindung. Verliebtsein war kein Zustand, der ihr leichtfiel. Aber sie würde sich hoffentlich daran gewöhnen.
*
»Was soll das denn? Haben Sie eine Erklärung dafür?« Schneyder richtete sich auf.
Martin fuhr sich über seine Bartstoppeln und genoss das leicht kratzende Geräusch, das ihn stets beruhigte. »Bisher nicht. Ist schwer einzuordnen bei so einer oberflächlichen Betrachtung. Vielleicht können die Kollegen von der Kriminaltechnik uns etwas mehr dazu sagen.«
»Aber auch auf den ersten Blick seltsam. Diese Kombination aus Schriftpapieren, die wie offizielle Dokumente wirken, einem toten Fisch und einer venezianischen Pestmaske. Das sieht verdammt nach Statement aus.«
»Das vermute ich auch, meine Herren.« Eine Frau, Mitte 30, mit sehr weißen Zähnen strahlte Martin an, als würde sie gerade den Small Talk auf einer Cocktailparty unterbrechen. »Hallo, ich bin Theresa Westerkamp, diensthabende Rechtsmedizinerin.« Sie hielt die behandschuhten Finger hoch wie im Operationssaal. »Hände schütteln gerne ein andermal.«
Gert Schneyder lächelte. »Theresa und ich haben schon den Ruf, miteinander verbandelt zu sein, so oft trifft es uns gleichzeitig bei den Bereitschaftsdiensten. Wie sagen wir dazu gern: ›It’s a match again.‹«
Die beiden strahlten sich dermaßen an, dass Martin verlegen zur Seite sah. Er war ja nicht spießig, aber irgendwie fand er das Verhalten etwas pietätlos. Deswegen räusperte er sich laut, nannte seinen Namen und seine Funktion auf Norderney und fragte dann geradewegs: »Ihre Bemerkung eben. Dass Sie das auch vermuten. Können Sie das näher erklären?«
»Ja, selbstverständlich.« Frau Westerkamp pustete sich ihren Pony aus den Augen und schüttelte leicht den Kopf, sodass ihr Pferdeschwanz von einer Seite auf die andere schaukelte. »Wenn Sie sich die Tote genauer anschauen, werden Sie wissen, was ich meine. Sie sind bisher wegen der Spuren auf Abstand geblieben? Vorbildlich, das muss ich einmal sagen.«
Der fröhliche Plapperton der Ärztin irritierte Martin weiterhin. Trotzdem bemühte er sich um Freundlichkeit und Professionalität. »Der Notarzt hat den Tod festgestellt. Ja, und er hat eine Bemerkung gemacht, dass es wirke, als sei die Tote ausgestellt. Genau dieses Wort hat er benutzt: ausgestellt.«
»Das trifft es auch meiner Ansicht nach ganz gut. Sie werden wissen, dass es sich um eine Schussverletzung handelt. Nach allem, was wir von außen sehen, mit letalem Schusskanal. Nach erstem Augenschein würde ich eher von einem Fremdverschulden als von einer Selbsttötung ausgehen. Aber Vorsicht: Nur aufgrund von Erfahrungswerten.«
Was mochten das für Erfahrungswerte sein, fragte sich Martin. Allzu lange konnte die Ärztin noch nicht in ihrem Fachgebiet tätig sein, oder er unterschätzte ihr Alter. Trotzdem musste er ihre Aussagen akzeptieren.
»Das Statement?«, erinnerte er sie an ihre Ausgangsaussage.
»Ach ja. Also zweierlei. Über die Brust verläuft diagonal eine Schärpe, wie Würdenträger sie tragen. Sieht aber so aus, als wenn sie nur aufgelegt worden sei. Nach dem Schuss, denn sie liegt über der Wunde, ohne dass das Projektil durch sie hindurchgegangen wäre. Durch die massive Blutung hebt sie sich kaum von der schwarzen Kleidung der Toten ab. Wenn ich das richtig sehe, gibt es auch eine Beschriftung, goldene Buchstaben, wenn mich nicht alles täuscht. Sagt Ihnen das etwas?«
Martin zuckte mit den Schultern. »Nein. Bei Würdenträgern stelle ich natürlich einen Zusammenhang her. Dass es sich bei der Toten vermutlich um unsere Bürgermeisterkandidatin handelt, wissen wir, aber sie war noch nicht gewählt. Außerdem trägt der Norderneyer Bürgermeister meines Wissens keine Schärpe.«
»Gut. Oder nicht gut. Könnte auf jeden Fall etwas zu bedeuten haben.«
Martin sah, wie Gert Schneyder mit einem Lächeln auf die Rechtsmedizinerin schaute. Sie hatte jedenfalls Ehrgeiz und schien neben ihrer originären Aufgabe die kriminalistische Fallarbeit miterledigen zu wollen.
»Du hast aber von zweierlei Dingen gesprochen«, versuchte Schneyder, die Ärztin auf die Spur zu bringen.
»Richtig. Das ist sogar noch eindeutiger. Auf dem Oberschenkel der Frau liegt eine Spielkarte. Sie könnte ihr aus der Hand gefallen sein.«
»Eine Spielkarte?«, fragte Martin nach. »So was wie eine Kreuz sieben oder ein Herz Ass?«
»Nein, nein.« Erneut wippte der Pferdeschwanz von einer Seite zur anderen. »Keine Skat- oder Canastakarte, oder wie man die nennt. Nein, so etwas Düsteres. Magisches. Ich glaube, es ist eine Tarotkarte. Ich kenne den Begriff, habe aber noch nie welche in der Hand gehabt.«
»Dass ich das noch erleben darf«, entfuhr es Schneyder. Martin sah ihn genauso erstaunt an, wie es Theresa Westerkamp tat.
»Was meinst du?«
»Dein Eingeständnis, etwas nicht zu wissen oder zu kennen.«
»Blödmann«, entfuhr es der jungen Frau, und Martin konnte nachvollziehen, warum den beiden eine Affäre angedichtet wurde. Sicherlich nicht allein wegen übereinstimmender Dienstpläne.
»Seltsam, wirklich seltsam«, bemühte er sich, wieder mehr Ernsthaftigkeit herzustellen. »Auf all das kann ich mir keinen Reim machen. Frau Mertens hat nun beileibe keinen Ruf, obskuren Ideologien anzuhängen. Im Gegenteil. Sie ist bekannt für eine sehr saubere und objektive Analyse und hat einen eher akademischen Stil. Sie war Naturwissenschaftlerin. Da fällt es mir schwer, einen Zusammenhang zu Tarotkarten herzustellen.«
»Eine Bedeutung wird es haben.« Gert Schneyders Miene verhärtete sich plötzlich. »Es ist doch so: Der Täter oder die Täterin hätte das Opfer einfach erschießen können.« Er hob die Hand. »Bitte nicht missverstehen. Einfach bedeutet hier, ohne dass er Hinweise hinterlässt. Also: Warum sollte ein Täter so etwas machen?«
»Um seine Visitenkarte zu hinterlassen«, kommentierte Theresa Westerkamp blitzschnell.
»Kann man machen«, antwortete Martin. »So etwas kommt vor. Allerdings erhöht der Täter mit jedem ausgelegten Hinweis das Risiko, dass er Spuren hinterlässt oder wir Verbindungen herstellen können.«
»Es sei denn, er fühlt sich intellektuell überlegen und möchte das in einem Katz-und-Maus-Spiel demonstrieren.« Frau Westerkamp blitzte ihn mit ihrem Lächeln an. Der Wortwechsel machte ihr sichtbar Spaß. So ein Täterprofil würde auch auf sie passen, dachte Martin einen winzig kleinen Moment gehässig.
»Vielleicht ist es eine politische Botschaft, die dahintersteckt. Wenn es um den Wahlkampf geht, bekommt das Ganze eine Dimension, die ich Ihnen nicht wünsche.«
»Ich glaube das nicht«, wandte Martin ein. »Politische Dimension! Was soll das sein? Wir sind auf Norderney. Hier geht es nicht um große Posten oder die Weltwirtschaft. Nein, nein. Ich glaube, da steckt was anderes hinter.«
Gert Schneyder sah wieder auf seine Finger. »Also absichtlich falsche Spuren statt offensichtlicher Statements?«
»Meine Herren, wir lassen die KTU ran. Ich liefere bis morgen Mittag Ergebnisse, dann sehen wir weiter. Bis dahin habe ich mich in die Materie der magischen Prophezeiungen eingearbeitet.«
Martin stöhnte auf und fing sich einen missbilligenden Blick von Schneyder und Westerkamp ein.
»Schon gut.« Er hob abwehrend die Hände. »Ich habe nichts gesagt. Ich kümmere mich währenddessen um die Kinder. Denn das ist das Tragischste an der Geschichte. Dass Frau Mertens zwei minderjährige Kinder hinterlässt. Ach ja. Meine Kollegen und unsere Wache stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung, Herr Schneyder. Also dann. Man sieht sich.«
*
»Sie sind sich sicher, dass es die Mutter der Kinder ist?«
Martin hatte den Namen der Mitarbeiterin vom Jugendamt, die ihm die Frage stellte, schon vergessen, so rotierten seine Gedanken, seit er in der Wohnung von Frau Mertens angekommen war. Eigentlich wäre es Schneyders Aufgabe gewesen, mit den Kindern und dem Amt zu sprechen. Aber da er nicht gleichzeitig überall sein konnte, hatten sie besprochen, dass Martin übernahm. Als die Kinder vor ihm gestanden und ihn mit Fragen überfallen hatten, ob er etwas über die Mutter wisse, hatte er die Angst in ihren Augen lesen können.
»Wir reden gleich«, hatte er zu den Kindern gesagt und dann zuerst mit seiner Kollegin Nicole gesprochen. Diese hatte Tränen in den Augen, als er den aktuellen Stand zusammenfasste.
»Glücklicherweise ist bisher nichts über die Handys der Kinder reingekommen. Davor hatte ich die meiste Angst. Wir werden es den Kindern sagen müssen, bevor das auf der Insel rund ist.«
»Bisher ist anscheinend nichts durchgedrungen. Wir haben den Planetenweg weiträumig abgesperrt. Sicher haben viele mitbekommen, dass etwas passiert ist, aber noch nicht, was und wer.«
»Darauf möchte ich mich nicht verlassen«, hatte Nicole erwidert, bevor sie zu den Kindern zurückgekehrt war. Die Kinderzimmertür hatte sie zu sich herangezogen und sich herumgedreht. »Die armen Kinder.« Den einen Satz nur, in dem alles lag. Das Leid, das nie mehr gutzumachen wäre.
Nun saß Martin der Sozialarbeiterin gegenüber und hörte ihre Frage, ohne den Inhalt zu verstehen.
»Ob es sicher ist, dass es sich um Frau Mertens handelt, Herr Ziegler.« Sie legte ihm die Hand auf den Arm, wohl, um seine Aufmerksamkeit zu gewinnen. »Ich kann nicht lauter reden. Die Kinder.« Sie deutete mit dem Kopf zur Tür.
Martin nahm sein Gegenüber jetzt erst bewusst wahr. Wie jung sie schien. Mitte 20 höchstens. Für ihn unverständlich, dass man in so einem Alter auf dem Jugendamt arbeitete und Eltern beriet. Aber das war anscheinend die sich verändernde Perspektive, die sich mit Fortschreiten des eigenen Alters verschob. Auch Annes Kollegen im Krankenhaus schienen ihm manchmal halbe Kinder zu sein. Und bei der Polizei – kaum vorstellbar, wie jung er in seinen Anfängen gewesen war.
»Herr Ziegler!« Er hörte, dass ihre Stimme panisch wurde.
»Ja. Ja. Anwesend. Und ja. Wir sind uns sicher. Das charakteristische Muttermal, das Frau Mertens neben dem Auge hatte, ist eindeutig. Und überhaupt.« Er deutete vage durch den Raum. »Was sollte das für ein Zufall sein?«
»Stimmt. Die Kinder haben mir erzählt, dass sie nie allein waren. Obwohl der Junge, Mattis, durchaus auf seine Schwester hätte aufpassen können«, sagte er. Die Sozialarbeiterin lächelte. »Aber entweder war die Nachbarin informiert oder eine Art Nanny engagiert. Anscheinend sogar ziemlich oft, gerade in der letzten Zeit. Jasmin Molitor. Sagt Ihnen das was?«
Ziegler überlegte, verneinte dann. »Aber das lässt sich rausbekommen.«
»Wäre nicht schlecht, wenn es jemanden gäbe, zu dem die Kinder Vertrauen haben. Wenn wir es ihnen sagen.«
»Das wollen Sie übernehmen?« Martin hörte den Zweifel in der eigenen Stimme. Es sollte nicht so abwertend klingen, wie es das tat.
»Ich überlege noch.« Die Sozialarbeiterin schien es ihm nicht übel zu nehmen. »Ich telefoniere gleich mit meiner Dienststellenleiterin.«
»Wie geht’s denn überhaupt weiter? Sollen wir nicht die Suche nach Angehörigen in die Wege leiten?«
»Schwierig. Der Vater scheint tot zu sein.«
»Tot?« Martin hatte den Eindruck, etwas falsch verstanden zu haben.
»Sie wissen nichts Näheres über den Familienstand von Frau Mertens?« Die Sozialarbeiterin hatte einen Block mit eingehaktem Kugelschreiber aus einer überdimensional großen Segeltuchtasche gezogen.
»Nein, wieso sollte ich?«
»Nun ja, so groß ist die Insel nicht.«
»Unterschätzen Sie das mal nicht. Die Norderneyer unter sich, die kennen sich. Aber Frau Mertens war zugezogen.«
»Mattis, der Sohn, erzählte, dass seine Mutter Bürgermeisterin werden will.« Sie stockte. »Wollte, muss ich sagen. Da wird doch einiges über sie bekannt gewesen sein.«
»Klar, das schon. Vor allem die Tatsache, dass sie als Alleinerziehende kandidiert, hat den Konservativen nicht gepasst. Übrigens waren in der Hinsicht beide Gegenkandidaten konservativ.« Letzteres hatte er leise vor sich hingemurmelt, weil es ihm plötzlich als etwas in den Sinn kam, dem nachzugehen sich im Rahmen der Ermittlungen lohnen würde. Was für verschwurbelte Gedanken, schalt er sich selbst. Manchmal dachte er im Beamtenjargon. Er versuchte, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. »Alleinerziehend, ja, das war ein großes Thema. Ich wäre allerdings nie auf die Idee gekommen, dass Frau Mertens verwitwet ist. Von so was geht man in dem Alter einfach nicht aus. Witwe – das ist was für alte Frauen.«
Die Sozialarbeiterin lächelte zum ersten Mal und sah dadurch erschreckenderweise noch jünger aus. Martin ärgerte sich, dass er ihren Namen vergessen hatte. Peinlich, später nachfragen zu müssen. Fürs Protokoll würde es sich nicht vermeiden lassen.
»Aber was viel schlimmer ist«, spann er den Gedanken an Frau Mertens weiter, »sie sind dann Vollwaisen.«
»So ist es. Leider.«
»Was machen wir nun mit den Kindern?«
»Wir –«, sie atmete aus, »das heißt, ich werde die Kinder wohl in Obhut nehmen müssen.«
»Aber es wird doch irgendjemanden geben, der beiden nahe steht.«
»Bestimmt.« Die Sozialarbeiterin schien nun ihn beruhigen zu wollen, so tief und nachdrücklich, wie sie dieses eine Wort aussprach. »Nur, wenn das niemand ist, der in den nächsten Stunden hier sein kann, wird es schwierig. Ich kann die Kinder ja nicht alleine zurücklassen.«
»Schon richtig. Haben denn die beiden nichts gesagt, wen wir verständigen können?« Alles in ihm wehrte sich, die Tatsachen anzuerkennen. Die armen Kinder – wie recht Nicole damit hatte.
»Sie ahnen ja noch nichts. Im Moment hoffen sie einzig und allein, dass ihre Mutter bald zurückkommt.«
Martins Magen zog sich schmerzhaft zusammen. Ein Gefühl, das er seit Kindertagen in bedrohlichen Situationen hatte. Wie gern würde er dem Jungen und dem Mädchen all das ersparen, was auf sie zukam.
»Aber mein vorsichtiges Herantasten hat eher gezeigt, dass es niemanden in der Nähe gibt. Außer der Nachbarin und dieser Nanny. Nichts, was uns im Augenblick helfen könnte.«
»Oh Mann!« Martin schlug die Hände vors Gesicht.
»Die Erfahrung zeigt, dass fast immer jemand da ist, der die Kinder auf lange Sicht wird nehmen können. Das klassische Waisenkind von früher, das elternlos und ungeliebt im Heim aufwächst, gibt es kaum noch. Meist finden sich Verwandte oder Paten. Aber dafür brauchen wir Zeit. Deswegen werde ich jetzt mit meiner Dienststellenleiterin sprechen. Sie muss versuchen, zwei Notfallplätze zu sichern. Danach werden wir es den Kindern sagen müssen.«
»Ja, sicher.«
»Sie helfen mir, Herr Ziegler? Sie lassen mich dabei nicht im Stich, hoffe ich.«
»Nein, nein, natürlich nicht. Ich muss nur den Leiter der Mordkommission verständigen. Vielleicht will er ja …«
Aber es war, wie er es sich schon gedacht hatte. Gert Schneyder wollte nicht. »Das ist bei Ihnen in guten Händen, Herr Kollege.« Martin legte fluchend auf. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als an einem weit entfernten Ort ein Leben fernab des Polizeidienstes führen zu können. Er würde darüber nachdenken. Und mit Anne reden. Heute Abend. Ganz gewiss.
*
»Das ist doch nicht wahr, was Sie mir erzählen. Bitte sagen Sie, dass es ein verdammter Albtraum ist, in dem wir uns befinden.«
»Dass es ein Albtraum ist, kann ich Ihnen gerne bestätigen.« Gert Schneyder war hinter dem Stuhl stehen geblieben, den der amtierende Bürgermeister ihm zugewiesen hatte. »Allerdings keiner, aus dem wir mal eben so aufwachen werden.«
Martin stand weit hinten in der Tür und hörte die beiden in dem überfüllten Raum mehr, als dass er sie sah. Er ließ seinen Blick über die Anwesenden schweifen. Die konkurrierenden Bürgermeisterkandidaten mit jeweils einem weiteren Parteimitglied, der engste politische Kreis aus der Zukunfts- und Umweltpartei von Frau Mertens, der Kurdirektor. Mühselig hatte man aus den Nebenzimmern Stühle herbeigetragen, nur seine Mitarbeiterin Nicole und er selbst hatten abgewunken.
»Wissen Sie denn nicht, was für eine Katastrophe das für die Insel ist?« Die Faust des Amtsinhabers fiel auf den Tisch. Martin konnte sich die Röte seines Gesichts vorstellen, ohne sie zu sehen, denn Schneyder nahm ihm die Sicht. Die cholerische Ader des Bürgermeisters war stadtbekannt, und keiner war böse darüber, dass er aus Altersgründen nicht erneut zur Wahl antrat. Im Gegenteil: Mit gleich drei Kandidaten hatte niemand gerechnet. Anfangs entstand fast eine euphorische Stimmung, ein demokratischer Aufbruch, ein Neuanfang. So hatte es von allen Seiten geheißen.
»Es tut mir leid, Herr Thies. Leider liegt es nicht in meiner Macht, das Ganze ungeschehen zu machen. Glauben Sie mir. Nichts wäre mir lieber angesichts der wirklich tragischen Umstände.«
Martin bewunderte, wie gelassen Gert Schneyder blieb. Anders als heute Morgen am Fundort, wo er sein Auftreten übertrieben fand. Überhaupt lag eine unheilvolle Ruhe in dem Raum, trotz der vielen Menschen. Nur die Heizung, die die drückende Stimmung zu forcieren schien, gab brummende und blubbernde Geräusche von sich. Zu Beginn der Zusammenkunft war das anders gewesen. Aggressiv und vorwurfsvoll waren die drei Parteien aufeinandergeprallt. Erst auf Schneyders Bitte, angesichts des Todes von Frau Mertens ein Mindestmaß an Pietät walten zu lassen, waren alle zurückgerudert. Nur Joseph Thies hielt sich nicht daran.
»Es ist ja wohl hoffentlich ausgeschlossen, dass es ein politisches Motiv gibt«, blaffte er.
Gert Schneyder setzte sich auf den Stuhl, hinter dem er bisher gestanden hatte. Martin konnte von seinem Platz aus sehen, dass sich an dessen Hinterkopf eine leichte Tonsur zu bilden begann. Was ihn irgendwie freute, wie er zugeben musste. Schneyder war doch bestimmt noch keine 40. Im gleichen Augenblick schämte er sich seiner Gedanken. Unfassbar, mit welchen Nebensächlichkeiten sich der Mensch doch unterbewusst beschäftigen konnte, selbst wenn das Grauen so nah war.
Das Stimmengewirr hatte als Reaktion auf die Frage wieder eingesetzt, allerdings deutlich abgeschwächter als zuvor. Prompt schoss Thies hinterher: »Wobei wir ja zwei Parteien von vorneherein ausschließen können – meine und selbstverständlich die ZUP. Letztere wird ja nicht ihre eigene Kandidatin auf diese Weise aus dem Verkehr gezogen haben.«
Augenblicklich war die Hölle los. Niemand im Raum saß mehr, auch Thies war nach seinen letzten Worten aufgesprungen, und Martin sah, wie er mit ausgestrecktem Arm auf Häusler zeigte, den Kandidaten der Fortschrittspartei.
»Ruhe! Verdammt noch mal, Ruhe!«, brüllte Gert Schneyder nun.
Martin hörte nur einzelne Sätze aus dem Sprachgetümmel, ohne sie zuordnen zu können: »Ist er jetzt komplett verrückt geworden?« – »Anzeige wegen Verleumdung« – »Grenzen der politischen Auseinandersetzung« – »Denken Sie doch an die Insel und ihr Ansehen«. Letzteres schien vom Kurdirektor zu kommen, der flehentlich mit den Händen rang und sich mit seinen Worten an alle wandte.
Gert Schneyder ging auf ihn zu. Martin konnte nicht verstehen, was die beiden besprachen, aber kurz danach traten sie an Thies heran und kamen dann gemeinsam zu ihm und Nicole.
»Wir haben kurz überlegt, wie wir am besten weitermachen.« Schneyder riss seine blauen Augen unnatürlich auf, wohl, um ihm mitzuteilen, dass er versuchte, die Situation zu deeskalieren. »Herr Ziegler, wären Sie so freundlich und würden mit den beiden Herren hier«, er zeigte auf den Kurdirektor und den Bürgermeister, »das Gespräch an einem ruhigeren Ort fortsetzen? Bitte nehmen Sie alles an Hinweisen auf. Alles könnte nützlich sein.«
Thies brummte zustimmend. Anscheinend fühlte er sich von Schneyder bekräftigt, aber Martin erkannte an dessen Miene, dass er vor allem jeden weiteren Eklat vermeiden wollte. Die Sache konnte brisant genug werden, ohne dass sich schon der innerste politische Zirkel zerfleischte.
»Klar. Übernehme ich«, antwortete er schnell.
»Wenn Sie mir Ihre Kollegin hierlassen würden? Sie kann mir behilflich sein, die anderen Meinungen einzuholen.«
Augenblicklich plusterte sich Thies wieder auf, die Röte seines Gesichts nahm weiter zu, obwohl das kaum möglich schien. »Sie wollen mich aus meinem Amtsbüro hinauskomplimentieren, damit diese«, er rang um Worte, »diese Kreaturen vernommen werden können? Ausgenommen natürlich meinen Parteikollegen Klaas Wilko.«
Martin schüttelte den Kopf. Er verstand Thies nicht, verstand ihn schon lange nicht mehr. Dabei hatte er seine Sache als Bürgermeister viele Jahre ordentlich gemacht. Die Insulaner mochten ihn, und er war über fast die gesamte Dienstzeit meist ein besonnener Erneuerer der Insel gewesen, dem die Meinung seiner Wähler nie egal war. Aber seit etwas mehr als einem Jahr war aus ihm ein hoffnungsloser Patriarch geworden, der sich für allwissend und allmächtig hielt. Hinter vorgehaltener Hand hatte es schon Gerüchte gegeben. Eine degenerative Erkrankung, mutmaßten die einen. Die anderen sahen es als normalen Verlauf eines Menschen, der zulange am Machthebel saß. Werden sie denn nicht alle so, wurde argumentiert. Deswegen kann man doch keinem von denen auf lange Sicht trauen, hatte manch einer gemeint. Das sollte ja jetzt ein vorläufiges Ende haben. Neue Besen kehren gut, und das konnte sich nach der Wahl beweisen. Mit dem heutigen Tag allerdings lagen die Dinge anders. Was für Voraussetzungen für den nächsten Amtsinhaber, egal, wer gewinnen würde. Was für eine Bürde.
*
»Und sie hat die Kinder wohin mitgenommen?«, fragte Anne, während sie die Lauchstangen putzte.
Martin stellte die Colaflasche zurück in den Kühlschrank und drehte sich mit dem gefüllten Glas zu ihr herum. Er mochte es, wenn sie ihre Stirn so konzentriert in Falten legte. Kochen war nichts, was sie gerne tat, das war fast immer sein Part, aber heute hatte sie ihm angeboten, zusammen die Suppe zuzubereiten. »In eine Inobhutnahmestelle. Man will so schnell wie möglich versuchen, Angehörige ausfindig zu machen.«
»Das kann doch nicht sein, dass es niemanden gibt, der sich für die Kinder verantwortlich fühlt, oder?«
»Soll ich die Zwiebeln übernehmen?«, fragte er statt einer Antwort, die er selbst nicht hatte, und griff in den Keramiktopf, der auf dem Kühlschrank stand.
Anne nickte. »Gerne. Und bitte die Möhren. Ich schäle die Kartoffeln.«
»Okay. Welche Toppings möchtest du? Paprika? Dann würfele ich sie schon mit.«
»Kannst du machen. Für mich ansonsten nur Sonnenblumenkerne.«
»Gut, dann heute das kleine Programm. Ich habe nichts dagegen. Mir ist das alles ziemlich auf den Magen geschlagen.«
»Kann ich mir denken.« Anne fuchtelte mit dem Messer in der Luft, als sie gestenreich ihre Worte unterstrich. »Peng. Und das war’s, dein Leben. Einfach so. Gerade noch voller Träume und Ziele, und dann kommt einer daher und löscht alles aus. Heftig. Was aber wirklich unfassbar ist, das alles passiert auf unserem kleinen Sandhaufen und nicht in einem drittklassigen, vorausschaubaren Hollywoodfilm.«
»Das trifft genau die Stimmung auf der Insel, nachdem sich die Nachricht verbreitet hat.« Martin strich sich vorsichtig mit dem Handrücken über die Wange. Die Zwiebeln brannten in den Augen, obwohl er erst die Schale entfernt hatte. »Die Tatsache, dass Frau Mertens erschossen wurde – und dass es wohl eine kalkulierte Tat mit Botschaft war.«
»Also doch politisch motiviert? Das geisterte sofort als Gerücht herum.«
»Das ist das Seltsame. Da hat jemand eindeutig versucht, die Tat mit einer Bedeutung aufzuladen. Aber noch ist unklar, in welche Richtung das geht. Erstens: Warum sollte uns der Täter einen Hinweis geben wollen? Also ist davon auszugehen, dass er uns an der Nase herumführt. Ablenken will.«
»Und zweitens?«, hakte Anne nach, als er nicht weitersprach.
Er wandte den Blick vom Küchenfenster ab. Eine grölende Gruppe Jugendlicher hatte für einen Augenblick die Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
»Ach so, ja, zweitens. Es ist doch beileibe nicht so, dass sich die drei Parteien im Wahlkampf bis auf das Blut bekämpft hätten. Du weißt doch selbst, was geredet wurde: Wen soll man denn da wählen? Pest oder Cholera? Die kümmern sich doch alle nur um den eigenen Vorteil. So ungefähr.«
»Schon.« Anne zog das Wort in die Länge, was Martin stutzen ließ.
»Es gibt also aus deiner Sicht ein Aber?«, wollte er wissen.
»Na ja, es gab schon Unterschiede.«
»Das habe ich nicht geleugnet. Aber die großen Themen waren doch mehr oder weniger bei allen gleich. Allein die Nuancen …«
»Da konnte sich der ein oder andere schon in Rage reden. Und hast du die Wahlplakate gesehen? Die sind alle verziert worden. Und zwar ziemlich übel, wenn du mich fragst.«
»Hm. Ja, habe ich mitbekommen, wenn auch nur am Rande. Nach dem Schock wollte keiner der Parteien mehr über beschmierte Plakate reden.« Er öffnete den Mülleimer und streifte die Zwiebelschalen vom Schneidebrett. »Die Möhren gewürfelt oder in Scheiben?«
Anne schaute ihn irritiert an. »Was?« Dann lachte sie. »Blödmann. Du willst mich bloß ärgern mit der Frage, wie jedes Mal. Wird doch nachher alles püriert.«
»Nicht ärgern. Nur prüfen, ob sich deine Kochkünste langsam verbessern.« Er gab ihr einen Kuss.
»Du lenkst mich ab. Lass uns weiterdenken. Die Plakate. Immerhin waren alle davon betroffen. Es war nicht so, dass sich jemand gezielt Petra Mertens herausgegriffen hätte.«
»Stimmt. Wobei man unterschiedlicher Meinung sein kann, wie bösartig diese Symbole zu bewerten sind. Kommt ja auf den eigenen politischen Standpunkt an.«
Anne zeigte diesmal mit dem Sparschäler auf ihn. »Genau. Ich persönlich finde, dieses Bärtchen geht gar nicht. Und du weißt, dass ich das nicht sage, weil ich auf einmal KWKs Politikstil gut finde.«
»Zumindest zuletzt nicht mehr, meinst du.«
»Egal. Was ich sagen will, ist, dass ich dieses eindeutig sexistische Geschmiere bei Petra Mertens am ekelhaftesten fand. Ja, ich hätte sie gewählt.« Anne hob beide Arme. »Das lässt mich parteiisch sein. Aber schon aus Frauensolidarität finde ich das Geschmiere zum Kotzen. Und ehrlich: ein paar Dollarzeichen in den Augen? Das ist doch eher zum Gähnen.«
»Okay.« Martin ließ die Zwiebeln in einem Topf mit heißem Öl aus. »Unterm Strich heißt das, unser dynamischer Politprofi soll auf die Verdächtigenliste. Deiner Meinung nach.«
»Du hörst dich so flapsig an.«
Martin schüttelte den Kopf. »Tut mir leid. So ist es überhaupt nicht gemeint. Ich bin genauso geschockt wie alle anderen. Kennst das doch, das mit dem Kompensieren. Zu Hause wirkt das alles, als wäre es nie geschehen. Als wäre es ein Krimi im Fernsehen und wir rätseln ein bisschen mit.«
»Ich bin schuld. Sorry. Ich habe es in die banalen Bahnen gelenkt.« Anne kam zu ihm und schmiegte sich an ihn.
»Quatsch.« Abrupter, als er wollte, löste er sich von ihr. »Mir hilft das ja. Wenn ich mit dir rede. Weil ich dann anders sortieren kann als auf der Dienststelle. Wo ich nach zwei Seiten zu schauen habe: um mit meinen Leuten weiterhin die Insel zu sichern und um gleichzeitig den Fallermittlern die Arbeit zu erleichtern.« Es zischte, als er das angeschmorte Gemüse mit einer Brühe ablöschte. »In einer Viertelstunde können wir essen. Was willst du trinken? Soll ich einen Wein öffnen?«
Anne winkte ab. »Nein, nur ein Wasser, bitte.« Sie lehnte sich mit dem Rücken an die Arbeitsfläche und beobachtete ihn. »Das ist schon alles sehr seltsam. Du hast recht. Es gibt nichts, was ein politisches Motiv wahrscheinlich macht. Keine Riesenaufreger. Keine Anschuldigungen. Keine Intrigen. Zumindest, soweit wir das wissen.« Anne kam zu ihm. Diesmal ließ er es zu, dass sie sich an ihn schmiegte. Er nahm sie in seine Arme. Wie schmal und zierlich sie doch neben ihm war. Er küsste sie auf die Haare und sog den vertrauten Duft ein.
Für einen Moment schwiegen sie beide und hingen ihren Gedanken nach.
»Ach, verdammt. Der Fundort.«
Martin schreckte zusammen, weil Annes Stimme unvermittelt schrill klang. »Was ist damit?«
»Du hast erzählt, es gab einen Koffer, eine Tarotkarte, eine Schärpe, aber du hast gar nichts zum Fundort gesagt.«
»Wieso? Doch, habe ich.« Martin verstand nicht, worauf Anne hinauswollte. »Am Planetenweg.«
»Ja, ja, das ist schon klar.« Sie wedelte ungeduldig mit der Hand, als wolle sie unnütze Bemerkungen vertreiben. »Aber wo da genau? Ich meine, an welcher der Stationen?« Sie schien aufgeregt und löste sich von ihm, um zum Fenster zu gehen. Dort drehte sie sich zu ihm. »An welchem Planeten genau wurde sie gefunden?«
*
»Ich freue mich so sehr, dass du bei mir bist.« Oskar erhob sein Glas und ließ es gegen ihres klingen. »Drei Tage – das ist fantastisch!« Seine Augen glitzerten, aber sein Gesichtsausdruck war so ernsthaft, dass Ruth laut auflachte. Irritiert schaute er sie an. »Was ist los? Habe ich etwas Falsches gesagt?«
Ruth prustete, je mehr sie sich bemühte, ihren Lachanfall in den Griff zu bekommen. Sie wusste, es war sinnlos. Einmal losgelassen, war die Lachsalve nicht so leicht zu stoppen, besonders nicht durch fragende Blicke. Erst als sie merkte, dass Oskar wirklich verunsichert war, konnte sie stotternd hervorbringen: »Es tut mir leid. Ich dachte wirklich, du kennst das schon von mir. Bitte, sei nicht böse. Es ist nichts gegen dich.«
»So ist es nicht. Hm, was dann? Ein unkontrollierbarer Tic? Oder lachst du über den Kellner? Verrate es mir.« Mit jedem Wort hatte sich der Schelm wieder in seine Augen geschlichen.
»Ein Tic, das trifft es gut.« Sie war kurz davor, erneut loszulachen. »Auf jeden Fall ist es meine Art, mit Situationen umzugehen, die mich beunruhigen.«
»Die dich beunruhigen?« Oskar sah sich im Restaurant um. Ruth folgte seinem Blick. Der Raum war nur knapp zur Hälfte gefüllt. Klar, sie waren spät dran und konnten froh sein, dass die Küche noch geöffnet hatte. »Stimmt. Ziemlich unheimliche Location«, frotzelte er und zog die Stirn kraus, was seine Brille ins Rutschen brachte. Mit einem Finger schob er sie wieder hoch.
Ruth legte für einen Moment den Kopf in den Nacken. Wie sollte sie bloß erklären, dass sie in manchen Situationen nicht die taffe Frau war, für die sie alle hielten? Es fiel ihr schwer, das zuzugeben, aber wenn sie sich hinter ihrer burschikosen Art versteckte, kam sie immer wieder zu kurz. Es gab nun mal keine zwischenmenschliche Nähe ohne Risiko. Wer sollte das besser wissen als sie selbst. Geschiedene Polizeipsychologin mit erwachsener Tochter, die um der Karriere willen die Familie geopfert hatte. So zumindest lautete die gekürzte, die vereinfachte Rechnung. Dass es komplexer war, konnte sich wahrscheinlich jeder denken, aber die meisten Menschen mochten lieber die einfachen Antworten.
Sie beschloss, weiter ehrlich zu sein. Oskar wusste, dass sie Zeit brauchte. Weil es zuletzt etwas gegeben hatte, was sie in ihrem Selbstverständnis und ihrer optimistischen Art vollkommen erschüttert hatte. Trotzdem konnte sie nachvollziehen, dass ihr Verhalten auf Oskar seltsam wirken musste.
Sie nahm seine Hände und schaute ihn an. Seine Augen waren etwas, dem sie sich nicht entziehen konnte. Sie spürte, wie die Verlegenheit weniger wurde. Ein warmes Ziehen im Bauch konnte sie nicht länger ignorieren. Verdammt. Sie mochte diesen Mann. So sehr, wie sie sich das nicht hätte vorstellen können.
Er schaute sie fragend an. Auch dafür war sie ihm dankbar. Dass er diese Pausen, diesen Stillstand aushielt. Nicht gern. Nicht ohne Zweifel. Aber er tat es.
»Du weißt, dass ich das nicht gut kann, oder?«, flüsterte sie.
»Was genau meinst du? Den Restaurantbesuch?«
Er machte es ihr einfach. Lockerte die Stimmung auf. Bot ihr Ausflüchte. Auf die sie aber nicht zurückgreifen wollte. Diesmal nicht.
»Ich bin nun mal nicht so die Romantikerin.« Sie hob kurz die Hand und deutete durch den Raum und auf das Fenster, hinter dem auf der anderen Seite des Rheins der Posttower mit wechselnden Farben auf sich aufmerksam machte. »Wenn du mit mir anstößt und dich auf drei gemeinsame Tage mit mir freust, dann …« Sie stockte.
»Dann?« Er drückte die Hände, mit denen sie ihn immer noch hielt.
»… dann bekomme ich Panik.«
»Ich weiß das doch. Du hast von Anfang an mit offenen Karten gespielt.«
»Ja. Nein. Schon. – Ach, es ist kompliziert.«
»Das muss ich aber nicht als Statusangabe wie auf Facebook verstehen, oder? Da bedeutet eine komplizierte Beziehung fast immer, dass noch jemand Drittes im Spiel ist. Muss ich da etwas wissen?«
Nun war es an Ruth, erschrocken zu sein. »Nein, nein, falsche Fährte. Das darfst du auf keinen Fall denken. Nein, es ist viel mehr, dass ich Panik im wortwörtlichen Sinne bekomme. So steinzeitmäßig. Hoher Puls, flache Atmung, Leere im Kopf und nur auf Flucht gepolt.« Sie hörte, dass sie witzig klang, obwohl sie jedes Wort genauso meinte.
»Du denkst an Flucht, weil wir zum ersten Mal drei ganze Tage miteinander haben?« Oskar schien sich nicht sicher zu sein, ob sie ihn hochnahm.
Ruth nickte. »Leider.«
»Tatsächlich kompliziert.«
Sie sah die Angst vor Zurückweisung in seinen Gesichtszügen. Alles zog ein wenig mehr nach unten: Die Augen, die Mundwinkel, selbst die Brille rutschte die Nase herunter.
»Zu kompliziert?«, fragte sie leise.
»Nein, auf keinen Fall.« Er zog seine Hände zurück, weil der Kellner einen Korb mit Brot und Besteck vor ihnen abstellte.
»Die beiden Dips sind unser kleiner Gruß aus der Küche.« So schnell, wie er aufgetaucht war, hatte er sich schon wieder zurückgezogen, aber ihre Hände lagen nun nicht mehr aufeinander.
Ruth griff nach einem Stück Brot. Oskar wickelte das Besteck aus der Serviette und reichte ihr ein Messer. »Hier, der Dip ist herrlich, den musst du probieren.«
»Es ist also dein romantisches Stammlokal«, neckte Ruth ihn, in der Hoffnung, dem Gespräch mehr Leichtigkeit zu geben. Sie könnten ja später noch intensiver reden. Vielleicht wäre es dann sogar gut, wenn sie ein Thema hätten, bevor …
»Einen Penny, um deine Gedankengänge nachzuvollziehen.«
Ruth lachte laut auf. »Nein, die willst du nicht wissen.«
»Doch, das will ich.« Seine Augen wurden noch dunkler, als sie sowieso schon waren. »Ich will, dass du das weißt. Ich lasse dir alle Zeit der Welt. Egal, was vorher war. Das spielt für mich keine Rolle. Ruth, du bist die beeindruckendste Frau, der ich seit Langem begegnet bin. Und ich bin nicht so naiv, dass ich nicht wüsste, dass wir alle unsere Macken davongetragen haben. Also, entspann dich bitte. Es werden drei großartige Tage.«
»Weißt du, wie lange es her ist, dass ich drei Tage am Stück mit nur einem einzigen Menschen in solcher Nähe verbracht habe?« Ruth griff sich in die Locken und stöhnte leise auf. »Das willst du nicht wissen.«
»Muss ich auch nicht.« Jetzt lächelte er sie an. »Vollkommen egal. Wir sehen, was passiert. Und wenn du es gar nicht aushältst, dann finden wir eine Lösung, okay?« Er reichte ihr ein Stück Brot, das er sorgfältig mit einem der Dips bestrichen hatte. »So, und jetzt probieren – ohne Widerworte.«
Ruth biss hinein und verdrehte gespielt entzückt die Augen: »Köstlich.«
»Du nimmst mich nicht ernst.«
»Doch. Aber das sind meine kleinen Fluchten.«
»Nun gut. Wir sind uns also einig. Wir versuchen das.«
»Ich versuche es. Komm mir nicht später damit, ich wäre anstrengend.«
»Ich liebe anstrengende Frauen. Wo bliebe sonst die Herausforderung? So und nun noch einmal.« Er stieß mit seinem Glas an ihres. »Auf uns. Auf unser Wochenende. Und da wäre übrigens noch etwas.«
Ruth war auf einen Schlag alarmiert. »Noch etwas?«
»Na ja«, druckste Oskar herum, »da war der Newsletter und das Angebot nur kurzfristig, und ich dachte, ich mache dir, also besser gesagt uns, eine Freude, obwohl ich mir da jetzt gar nicht mehr so sicher bin …«
»Oskar, was ist los?«
»Also, ich habe über Ostern ein Doppelzimmer auf Norderney gebucht. Für dich und mich. Ich dachte, das wäre doch was. Da, wo wir uns kennengelernt haben.«
»Du hast was?« Ruth merkte, wie ihr die Gesichtszüge entglitten.
»Okay, okay, war wahrscheinlich ein Fehler. Ich sehe es ein. Zu schnell. Viel zu schnell. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Stornomäßig, meine ich.« Oskar stotterte und verhaspelte sich immer mehr.
Und plötzlich war es, als sähe Ruth von außen auf sich und auf Oskar, und sie konnte es nicht fassen, wie kompliziert sie die Dinge machte. Oh Gott, dachte sie, er konnte einem regelrecht leidtun, sie hatte so etwas wie ihn gar nicht verdient. »Ach, Oskar«, sie nahm über den Tisch hinweg erneut seine Hände. »Da hast du dir mit mir was eingefangen. Du wirst es noch bereuen, mir begegnet zu sein.« Und zu seiner großen Verwunderung begann sie wieder, lauthals zu lachen.
*