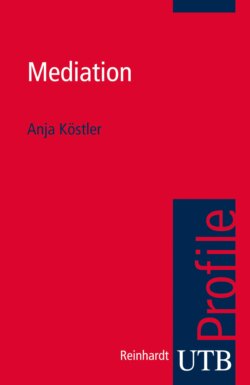Читать книгу Mediation - Anja Köstler - Страница 7
ОглавлениеEinführung
Überall, wo Menschen zusammenleben und/oder zusammenarbeiten, kommt es zu Konflikten. Und wir alle haben Sätze im Ohr wie, „Bleib sachlich“, „Kommen Sie doch mal zur Sache“ usw. Doch die wenigsten Konflikte sind nur auf der Sachebene zu befrieden. Wären sie es, hätte sich kein längerer Konflikt entwickelt.
Mediation als Verfahren zur konsensualen Konfliktklärung zeichnet sich im (psycho-)sozialen Bereich dadurch aus, dass sie – über die Klärung von Sachfragen hinaus – die Beziehungsebene und das innere Geschehen bei den einzelnen Beteiligten in den Blick nimmt. Dies unterscheidet Mediation in diesen Anwendungsfeldern von der klassischen Wirtschaftsmediation, in der es häufig „nur“ um die Lösung eines bestimmten Problems geht. Im (psycho-) sozialen Zusammenhang bedeutet Mediation im Wesentlichen, dass die Konfliktpartner – seien es zwei Menschen oder mehrere Gruppierungen – mit sich selber und mit ihren Kontrahenten wieder ins Reine kommen und sich weiterhin im gleichen Umfeld bewegen können. Die Konfliktparteien können z.B. Partner sein, die nach der Trennung noch Eltern ihres Kindes bleiben und sich in dessen Lebenswelt immer wieder begegnen werden; Einrichtungen, die nach wie vor im gleichen Stadtteil mit den gleichen Anwohnern arbeiten werden oder Mitarbeiter in Krankenhäusern, Kindergärten, Beratungsstellen, Nachbarschaftszentren, deren Zusammenarbeit im Team fortdauern wird und nicht durch schlechte Konfliktregelungen belastet sein sollte.
In diesen (psycho-) sozialen Bereichen kann man – anders als in rein geschäftlichen Beziehungen – den Kontakt zueinander selten völlig beenden, ohne dadurch weiteren Schaden in Kauf zu nehmen. Solch ein Schaden wäre z.B. nach einer Ehescheidung, wenn ein Mann künftig nicht mehr gleichzeitig mit der Ex-Frau auf die Feste von gemeinsamen Freunden gehen kann oder wenn ein Erzieher beim Schichtwechsel in einer Jugendwohneinrichtung wiederkehrend mit von Kollegen produzierten schwierigen Situationen konfrontiert ist.
Gelingt es nicht, trotz und nach Streitigkeiten gut miteinander umzugehen, vergiftet dies oft das gesamte bisherige Lebensumfeld – etwa Wohnung, Freunde, Nachbarschaft oder Arbeitsstelle. Und wenn dieser soziale Nahraum gefährdet ist, erleben Menschen dies oft als existenzielle Bedrohung. Viele schlagen dann schnell harte Töne an, um nur ja 8als Sieger aus dem Konflikt hervorzugehen. – Sie treiben damit aber die Eskalation des Konfliktes genau in die befürchtete Richtung voran. Diese Dynamik beschäftigt auch alle, die im (psycho-) sozialen Bereich Dienst- oder Hilfeleistungen für Menschen in besonderen Lebenssituationen erbringen. Dazu drei Beispiele:
Beispiel 1: Die bisher allein lebende 75-jährige Mutter wird pflegebedürftig. Die Krankenhaus-Sozialarbeiterin erlebt drei erwachsene Kinder, für deren Leben – teils mit Partnern, teils mit Familien – die eigene Welt aus den Fugen gerät bei der Vorstellung, die Mutter bei sich zu Hause aufzunehmen. Die Vorstellung, die Pflegekosten zu dritt zu übernehmen, ist für zwei der drei ebenso ein Horrorszenario. Forderungen und Anklagen kommen auf den Tisch: „Mutter hat dir sowieso immer Geld zugesteckt …“ „Du hast doch eh nur eine halbe Stelle und dir sowieso mal überlegt, ob du nicht wegen den Kleinen ganz zu Hause bleibst, aber ich müsste meine ganze Karriere aufs Spiel setzen …“ „Ja, so war es schon immer: Wenn es euch unangenehm wird, wälzt ihr so was auf mich ab! …“
Beispiel 2: Im ehrenamtlichen Vorstand des örtlichen Sportvereins hat der langjährige Vorsitzende aus persönlichen Gründen (zeitliche Entlastung) nicht mehr kandidiert. Er steht dem Verein seit einem halben Jahr stattdessen als Schatzmeister zur Verfügung. Seine Nachfolgerin und der konstant gebliebene Stellvertreter haben die Prioritätensetzung und den Arbeitsstil völlig verändert. Nach Ansicht des Vorgängers stehen nun die Rücklagen des Vereins auf dem Spiel. Die letzten beiden Vereinssitzungen sind total eskaliert, und die heftigen Vorwürfe – „Ihr ruiniert den Verein, nur um Eurer persönlichen Vorlieben willen!“ „Du warst schon immer unfähig, zusammenzuarbeiten. Die finanziellen Probleme, die wir jetzt haben, hast letztlich du durch deine unglaubliche Schlamperei verursacht!“ – sind bereits in den innerörtlichen Tratsch gesickert.
Beispiel 3: In die Familienberatungsstelle kommt ein Paar, das immer häufiger über Trennung nachdenkt. Die zwei Kinder werden von beiden Seiten mit unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert und erzogen, sodass nicht nur die Beziehungskonflikte untereinander groß sind, sondern auch der Kontakt zu den Kindern stark problembelastet ist. Der Alltag miteinander sei manchmal kaum auszuhalten. Die Frau hat große Sorge, dass ihr Mann bei einer Trennung die Kinder gegen sie aufhetzt, 9der Mann fürchtet, dass seine Frau die Kinder – wenn sie das Sorgerecht hätte –, völlig „verziehen“ würde.
In solchen Fällen kann Mediation zu einer guten und sinnvollen Lösung der Probleme beitragen.
Merksatz
Mediation ist ein Verfahren, das die Eskalationsspirale bei Konflikten unterbrechen und stoppen kann; sie geht mit den Beeinträchtigungen und Verletzungen, den starken Gefühlen und den dahinter stehenden Bedürfnissen aller Beteiligten auf wertschätzende Art um und schafft einen sicheren Rahmen, in dem gegenseitiges Verstehen möglich wird; erst dadurch wird der Blick frei auf die Gestaltung einer für alle Seiten langfristig wirklich guten Zukunft.
Wo steht Mediation heute in Deutschland?
Die Vorstellung, dass bei Konflikten, um sie zu lösen, nicht einer der Beteiligten niedergerungen werden muss, ist noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Es ist nach wie vor kaum denkbar, dass man Konflikte tatsächlich klären kann, ohne in Verteidigungsposition zu gehen, ohne den anderen anzugreifen, indem man Vorwürfe macht und Forderungen stellt. Unsere Sprache ist voller Begriffe, die dies widerspiegeln: Wir leben in einem Wirtschaftskampf, Kampf um Ressourcen, ständigen Verdrängungswettbewerb, einem Krieg der Kulturen und Religionen. Und beruflich werden Durchsetzung, Kampfgeist, Individualität etc. hoch geschätzt.
Dennoch: Auch in manchen Großkonzernen, denen man sicher nicht nachsagen kann, dass sie ihre Prioritäten im Zwischenmenschlich-Sozialen setzen, ist mittlerweile das Ende der Fahnenstange beim Einsparen von Produktionsmitteln und Arbeitskraft in Sicht, sodass eine Umorientierung einsetzt. Kostenminimierung durch gut gelöste und durch weniger Konflikte ist attraktiv geworden. Führungskräfte und Entscheidungsträger in Unternehmen erkennen höhere Mitarbeiterzufriedenheit und gesteigerte Effektivität in der Kommunikation inzwischen als für den Unternehmenserfolg bedeutende Faktoren an.
10
Mediation in Rechtsprechung und Gesetzgebung
Rechtsprechung und Gesetzgebung in Deutschland entwickeln zunehmend Offenheit für Mediation und fördern dieses Verfahren entsprechend. Im Bereich Trennung und Scheidung z. B. verstehen sich Familienrichter schon lange als Förderer eines fairen Ausgleichs.
In der sogenannten „Münchner Erklärung“ haben sich 2008 weit über 100 Familienanwälte verpflichtet, in Familien- und Sorgerechtsverfahren vorrangig mit Mediation zu arbeiten.
In dem ab 01.09.2009 geltenden „Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit“ ist neu geregelt, dass das Familiengericht ein Informationsgespräch zu Mediation und anderen außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren für die Ehepartner anordnen kann. Dies spiegelt wider, dass der Gesetzgeber den Mehrwert einer konsensualen Streitbeilegung erkannt hat und fördern möchte, wenngleich die Anordnung zur Information über Mediation auch die Gefahr birgt, dass der freiwillige Charakter von Mediation einen merkwürdigen Beigeschmack von Pflicht bekommt.
Darüber hinaus sind in den letzten Jahren an verschiedenen Orten Deutschlands Richter als gerichtsinterne Mediatoren ausgebildet worden, z. B. in der Sozialgerichtsbarkeit in München, in Mecklenburg-Vorpommern, in Schleswig-Holstein. In Bayern heißen diese Richter Güterichter.
Die drei großen Bundesverbände für Mediation in Deutschland (Bundesverband Mediation e. V., Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V. und Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.) und eine Expertenrunde streben in stetigen Gesprächen mit dem Bundesjustizministerium die Verankerung und Qualitätssicherung von Mediation in Deutschland an. Den großen gesetzlich abgesicherten Rahmen setzt dabei die Europäische Mediationsrichtlinie. Sie schafft zwar einerseits „nur“ die Voraussetzungen für die Anerkennung von Mediationsergebnissen bei grenzübergreifenden Konflikten, z. B. bei Familienstreitigkeiten oder in Wirtschaftsangelegenheiten. Andererseits nimmt sie ihre Mitgliedsstaaten in Artikel 4 der Richtlinie in die Pflicht, Voraussetzungen zu schaffen, die staatenübergreifend das nötige Vertrauen in die Mediation und in die Qualität ihrer Durchführung ermöglichen:
„(1) Die Mitgliedsstaaten fördern mit allen ihnen geeignet erscheinenden Mitteln die Entwicklung und Einhaltung von freiwilligen Verhaltenskodizes 11durch Mediatoren und Organisationen, die Mediationsdienste erbringen, sowie andere wirksame Verfahren zur Qualitätskontrolle für die Erbringung von Mediationsdiensten. (2) Die Mitgliedstaaten fördern die Aus- und Fortbildung von Mediatoren, um sicherzustellen, dass die Mediation für die Parteien wirksam, unparteiisch und sachkundig durchgeführt wird.“
In Artikel 12 wird weiterhin bestimmt: „Die Mitgliedsstaaten setzen vor dem 21. Mai 2011 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen; …“
Literatur
Greger (Hrsg.) (2008): Die Zukunft der Mediation in Deutschland
Mediation in Forschung und Ausbildung
Mediation gehört zu den sogenannten ADR-Verfahren. ADR steht für alternative dispute resolution, zu deutsch: Kooperative Konfliktlösung. Hierzu hat sich international ebenso wie an deutschen Lehrstühlen ein breites Forschungsspektrum aufgetan, in dessen Rahmen auch die Wirkungen von Mediation untersucht werden. Diese empirische Forschung und ihre eindeutigen Ergebnisse haben Mediation auch in eher sachorientierten Wissenschaften wie dem Rechtswesen und der Wirtschaft zur Akzeptanz verholfen. In (psycho-) sozialen Feldern wie Training, Beratung, Sozialarbeit und Kommunikationswissenschaften musste Mediation wegen ihrer inhaltlichen Nähe und ihres aus der (psycho-) sozialen Forschung kommenden Verständnisses vom Kommunikations-und Konfliktgeschehen zwischen Menschen nie in diesem Maß um Akzeptanz kämpfen. Inzwischen zeugt von der breiten Anerkennung der Mediation auch, dass sie als Masterstudiengang an verschiedenen Universitäten angeboten wird.
Merksatz
Mediation zu erlernen ist für eine Vielzahl von Personengruppen und Berufssparten interessant geworden; in den Ausbildungen finden sich Lehrkräfte neben Personalentwicklern, Architekten neben Vereinsvorständen, ehrenamtlich engagierte Rentner sowie Sozialpädagogen, Berater, Firmeninhaber und Führungskräfte aus Wirtschaft, Verwaltung, Kommunen und sozialen Einrichtungen.
12
Literatur zu Mediation
Die ersten Titel der mittlerweile umfangreichen Literatur zu Mediation entstanden in den 1970er Jahre in den USA. Das „Harvard-Modell“ von Ury und Fisher gilt nach wie vor als Klassiker der Grundlagenliteratur zur verhandlungsbasierten Mediation, wie sie auch heute noch die Basis für die Wirtschaftsmediation darstellt. Die folgenden Titel gelten als deutschsprachige Grundlagenliteratur zum Thema Mediation.
Literatur
Fisher et al. (2004): Das Harvard-Modell.
Besemer (1995): Mediation – Vermittlung in Konflikten.
Haynes et al. (2004): Mediation – Vom Konflikt zur Lösung.
Montada/Kals (2007): Mediation – ein Lehrbuch auf psychologischer Grundlage.
Noch Anfang der 1990er gab es in Deutschland jedoch noch kaum verfügbare Literatur jenseits des Themas Trennungs- und Scheidungsmediation. Von Schulmediation war nur in Skripten aus Neuseeland oder den USA zu lesen. Mittlerweile kann man auch auf dem deutschen Buchmarkt Fachliteratur zu fast jedem Anwendungsgebiet der Mediation finden, und die Anwendungsgebiete bilden alle gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Bereiche ab:
• Scheidung, Partnerschaft, Erziehung, Familie, Erbschaft
• Erziehung, Bildung in Kindergarten und Schule
• Hochschule, Forschung
• Nachbarschaft und Gemeinwesen, Vereine, Verbände, Sport
• interkulturelle, interreligiöse Konflikte
• Arbeitsplatz, innerbetriebliche Konflikte
• öffentlicher Dienst
• Medizin, Gesundheitssystem, Altenpflege
• Kirche
• Wirtschaft (zwischen Betrieben), Unternehmensnachfolge
• Planen und Bauen
• Umwelt, öffentlicher Raum
• Polizei, Sicherheitsdienst
• Politik, Internationale Beziehungen 13
Merksatz
Deutliche Indikatoren für die zunehmende Akzeptanz und Verbreitung von Mediaton sind: die Durchdringung aller Lebensfelder mit Mediation, die Entstehung von Mediationsliteratur für alle Lebensbereiche, die intensive Befassung und zunehmende Verankerung von Mediation im deutschen wie im europäischen Rechtssystem sowie der ansteigende Zulauf zu den Weiterbildungsmöglichkeiten in Mediation.
14