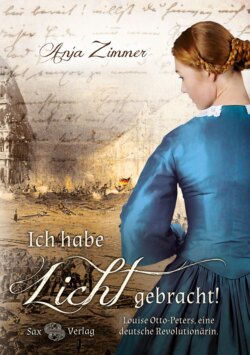Читать книгу Ich habe Licht gebracht! - Anja Zimmer - Страница 7
ОглавлениеPROLOG
Karlsbad 1819
In deutschen Fürstenhäusern ging Angst um. Ein bürgerliches Schreckgespenst schlich die Korridore entlang, lugte selbst bei fröhlichen Bällen durch die Fenster und hauchte jedem Adligen vor dem Einschlafen Eiseskälte in den Nacken: »Freiheit!«. Und in den finstersten Stunden hallte das Wort »Demokratie!« durch die Prunksäle.
Um dieses Gespenst ein für alle Mal in Ketten zu legen, trafen sich die Herrscher des Deutschen Bundes in Karlsbad. Ganz harmlos sah es aus, als sich die Herrschaften wie zufällig in dem beschaulichen Kurort begegneten.
Es waren heiße Tage im August, als die Fürsten, Diplomaten und Minister in Karlsbad anlangten.
»Ach, Sie auch hier?«, wird manch einer im Scherz gesagt haben, während er sich noch die Schweißtropfen von der Stirn tupfte.
Wie zufällig traf man sich im Park, an den Springbrunnen, tauschte Höflichkeiten aus. Die mitgeführten Gattinnen machten sich gegenseitig Komplimente zu ihrer Garderobe und verabredeten sich zu Einkaufstouren in der Stadt.
Nur sehr genaue Beobachter hätten ahnen können, dass diese Zusammenkunft so vieler hochrangiger Herrschaften einen Zweck hatte, denn abends sah man die Damen allein im Theater. Hatten die Herren nur beim Billard die Zeit vergessen? Hatten sie nach dem Abendessen so viel Cognac und Zigarren genossen, dass ihnen das Theater gestohlen bleiben konnte?
Die Herren saßen beisammen, waren jedoch vollkommen nüchtern und der Billardtisch blieb unbeachtet. Zu ernst war die Lage in den deutschen Ländern, die sich nach dem Sieg über Napoleon 1815 zum Deutschen Bund zusammengeschlossen hatten.
Fürst Metternich übernahm den Vorsitz, da er als führender Staatsmann die Versammlung einberufen hatte. Seine schneidende Stimme stieß auf keinerlei Widerstand. Allzu begierig wollten sie alle, was er wollte: strengere Zensur, mehr Befugnisse für die Polizei1, Überwachung der Lehre an den Universitäten, da diese immer gefährliche Brutstätten für neue Ideen waren. Außerdem ordnete Metternich eine neue Exekutionsordnung und ein Durchsuchungsgesetz an. Letzteres gab der Polizei die größtmöglichen Freiheiten, Wohnungen, Briefe, kurz, das gesamte Leben von Personen zu untersuchen, die sich durch ein zu freies Wort verdächtig gemacht hatten.
Mit den Karlsbader Beschlüssen wäre also Friedhofsruhe herzustellen. Erleichtert ging man auseinander, um sie nun in die Tat umzusetzen. Viele Freiheitskämpfer wurden verhaftet, Turnvereine verboten, da sich die jungen Männer dort nicht aufs Turnen beschränkt, sondern in ihren Zusammenkünften aufrührerisches Gedankengut ausgetauscht hatten. Professoren, die in dem Verdacht standen, demokratische Ideen an ihre Studenten weiterzugeben, wurden entlassen und mit Berufsverbot belegt. Was blieb ihnen anderes übrig als die Flucht in die Schweiz, nach Frankreich?
Ja, die Deutschen mussten nicht bis nach Amerika schauen, um zu sehen, dass ein freieres Leben möglich war, denn in ihrer direkten Nachbarschaft gab es Länder, in denen man nicht über die Missstände schweigen musste, und wo Herrscher sogar bereit waren, sie abzuschaffen.
Missstände gab es etliche in Deutschland. In vielen Ländern des Deutschen Bundes sehnten sich die Menschen sogar nach der Herrschaft der Franzosen zurück, unter denen sie mehr auf dem Teller gehabt hatten. Wenn die Zukunft wie ein düsterer Berg vor den Menschen liegt, dessen Ersteigung nur noch mehr Qual, Hunger und Elend bringt, dann sehnen sie sich zurück in eine Zeit, die sie gut und alt nennen. Vor allem, wenn der Fortschritt an ihren Hütten vorbeirauscht.
Meißen, im Frühjahr 1824
»Vater, was ist das?« Neugierig schaute Clementine auf die unscheinbare Schachtel, die der Vater mit großer Geste mitten auf dem Küchentisch platziert hatte. Nach einem langen Arbeitstag war er nach Hause gekommen, die Dämmerung lag schon im Raum.
»Das, meine Lieben, ist die Zukunft.« Bedeutungsschwer schaute er in die Runde. Die Frauen und Mädchen konnten seine Gesichtszüge nur schemenhaft erkennen, aber das geheimnisvolle Blitzen in seinen Augen war überdeutlich. »Ja, kommt nur alle her und staunt. Kommt, Antonie und Francisca und du, meine liebe Frau. Ja, auch Tante Malchen. Kommt und schaut euch das an.« Die Mädchen, zwölf und zehn Jahre alt, ließen ihre Strickarbeiten sinken, Mutter Charlotte trocknete ihre Hände an der Schürze ab und trat an den Tisch. Sogar Tante Malchen hielt inne im Kartoffelschälen, stellte die Schüssel zur Seite und kam dazu. Gerade wollte der Vater die Schachtel öffnen, da fragte die vierzehnjährige Clementine: »Wo ist Louise? Sie muss das auch sehen. Ich lauf schnell und hol sie.« Schon war sie aus der Tür. Man hörte ihre Rufe und Schritte in der Wohnung und schließlich durchs Treppenhaus hallen.
Unterdessen wurde die Schachtel von Tante Malchen misstrauisch beäugt. »Wenn das die Zukunft sein soll, dann bin ich traurig, nicht noch älter zu sein. Ich hoffe, dass meine Zukunft nicht in einer hässlichen Pappschachtel steckt.« Schon wollte sie sich wieder ihren Kartoffeln zuwenden, als Clementine mit Louise erschien. Die Kleine war fünf Jahre alt und tippelte an der Hand ihrer Schwester in die Küche.
»Wenn das, was unser Vater mitgebracht hat, die Zukunft ist, dann muss Louise es auch anschauen. Schließlich ist sie die Jüngste und wird hoffentlich am längsten von uns allen leben«, sagte Clementine.
Bei diesen Worten zog Tante Malchen unhörbar die Luft ein. Die Ottos hatten schon zwei ihrer sechs Kinder begraben. Und Louise, die schon immer so schwach und kränklich gewesen war, dass sie erst mit vier Jahren das Laufen gelernt hatte, versprach keineswegs so alt zu werden, wie Clementine es gerade prophezeit hatte. Dazu kam, dass sie nicht gerade wuchs, sondern schon als Kind einen kleinen Buckel mit sich herumschleppte und bei ihrem ohnehin unsicheren Gang leicht hinkte.
Die Mutter schenkte ihrer optimistischen Tochter einen dankbaren Blick und forderte sie stumm auf, Louise auf einen Stuhl zu heben. Still schaute Louise ihre Familie an.
Der Gerichtsdirektor und Stadtrat Fürchtegott Wilhelm Otto war ein Mann von klaren Worten und schlichten Taten, doch nun öffnete er die Schachtel wie ein Magier eine Schatzkiste. Den Inhalt stellte er auf den Tisch: eine kleinere Schachtel und ein Glas, das scheinbar Wasser enthielt. Die kleine Schachtel hielt er schüttelnd an sein Ohr, der Inhalt raschelte leise.
»Schwager, die Kartoffeln springen nicht freiwillig aus ihren Schalen.« Tante Malchen hatte für derlei Firlefanz weder Zeit noch Verständnis.
»Malchen, auch du wirst begeistert sein. Warte nur ab. Louise, du darfst die kleine Schachtel öffnen.«
Louise tat, wie der Vater sie geheißen hatte, schaute kurz hinein und leerte den Inhalt auf den Tisch. Zum Vorschein kamen Holzstäbchen, in etwa so lang wie die Finger der Frauen, die nun danach griffen.
Tante Malchen hielt sich eines der Stäbchen vor die Augen und schaute mit krausgezogener Nase dieses Ding an, das ihr Schwager angepriesen hatte wie das achte Weltwunder. Mit einem ärgerlichen Seufzer warf sie es zurück auf den Tisch und ging wieder an die Kartoffeln. Ihre Schwester hätte gut daran getan, einen anderen Mann zu heiraten.
»Was macht man damit?«, fragte Louise, die die Stäbchen eingehend untersuchte.
»Nun, ihr älteren Mädchen? Wisst ihr, was das ist? Habt ihr das noch nicht in der Zeitung gelesen?«, fragte der Vater. Auf den Gesichtern der Mädchen und der Mutter breitete sich ein Strahlen aus.
»Ich sehe, ihr ahnt es schon«, rief er. »In dem kleinen Gefäß hier ist Schwefelsäure.« Vorsichtig öffnete er es und legte den Deckel daneben auf den Tisch.
»Louise, du darfst ein Hölzchen vorsichtig hineintauchen, aber nur kurz. Warte, ich führe deine Hand.«
Louise schaute ihren Vater an. Sie spürte, dass jetzt ein ganz besonderer Moment war, denn so freudig gespannt hatte sie den Vater noch nie erlebt. Sie fühlte, wie sich die große warme Hand des Vaters um ihre legte, dann tauchten sie gemeinsam den Stab in das Glas. Ein scharfes Zischen – und eine Flamme loderte am Ende des Hölzchens. Louise war so erschrocken, dass sie es beinahe fallen gelassen hätte. Feuer! Sagten die Großen nicht immer, dass man damit vorsichtig sein müsse? Noch nie hatte sie selbst die mühselige Arbeit des Feuermachens bewerkstelligen müssen, nur immer der Tante, der Mutter und der ältesten Schwester zugeschaut. Manchmal dauerte es gar zu lange, bis endlich der Funken in dem Zunder glomm und zur Flamme wuchs. Und nun? Sie selbst, die Jüngste und Kleinste von ihnen, hatte einen Holzstab in ein Glas getaucht und Licht gemacht. Stolz richtete sie sich auf. Wie eine Fackelträgerin schaute sie ihre Familie an und rief triumphierend: »Ich habe Licht gebracht!«
Alle applaudierten. Francisca brachte eine Kerze, die Louise mit dem Streichholz entzündete, dann setzten sich alle an den Tisch, in dessen Mitte die Kerze gestellt wurde. Darum verstreut lagen die Zündhölzer.
»Und man taucht es einfach in diese Flüssigkeit?«, fragte Antonie ungläubig.
»Ja, in die Schwefelsäure. Aber damit muss man sehr vorsichtig sein, denn sie ist gefährlich«, erklärte der Vater. Natürlich wollte jede ausprobieren, ob sie es auch könne. Es war kinderleicht! Das Schlagen des Steins, das Pusten, das beschwörende Zureden, wenn der Funke nicht recht wollte, all das hatte jetzt ein Ende.
»Dann bin ich jetzt wohl überflüssig?«, knurrte die Tante.
»Malchen, ich denke, die Kartoffeln springen noch immer nicht freiwillig aus ihren Schalen. Aber du hättest Zeit gespart, in der du länger schlafen kannst – nur zum Beispiel.« Herr Otto zwinkerte seiner Schwägerin zu.
»Oder lesen!«, warf Francisca ein, wofür sie einen strafenden Blick ihrer Tante einfing.
»Lesen! Als müsste eine Frau lesen«, murmelte sie ärgerlich.
»Aber sie arbeiten doch während des Lesens. Immer wird etwas im Haushalt getan, wenn eine vorliest«, rechtfertigte die Mutter ihre Töchter. »Sie nähen, sticken und stricken, schnippeln Obst und Gemüse zum Kochen und Einmachen; selbst die Vorleserin hat ihren Strickstrumpf in der Hand. Auf meine fleißigen Mädchen lasse ich nichts kommen, Schwester.«
»Ich will, dass meine Töchter lesen«, stellte Herr Otto klar. »Clementine ist jetzt vierzehn Jahre alt, wird in diesem Jahr konfirmiert und muss die Schule verlassen. Da muss sie sich selbst weiterbilden und lesen. Ich bringe meinen Töchtern nicht umsonst die Zeitungen mit. Es wäre doch peinlich, wenn sie irgendwo in ein Gespräch verwickelt würden und wüssten dann nicht Bescheid über das, was in der Welt vor sich geht. Sie müssten sich ja schämen für ihre Ahnungslosigkeit.«
»Lieber Schwager, ich bin der Meinung, dass anständige Mädchen gar nicht in Gespräche verwickelt werden, wo sie über Politik und dergleichen Bescheid wissen müssten.«
»Die Mädchen werden nicht ewig hier in der Stube hocken bleiben, sondern auf Bälle gehen. Gut, bei Antonie und Francisca hat es noch etwas Zeit, aber in wenigen Jahren wird Clementine zu einem Ball gehen wollen. Unsere Töchter sind hübsch, und ich will nicht, dass man sie nur als hübsche Hüllen lobt. Sie dürfen und sollen auch für ihren Verstand gelobt werden.«
Tante Malchen schwieg zerknittert. Es hatte keinen Sinn, mit ihrem Schwager zu streiten. Er war und blieb ein unvernünftiger Mensch.
Trotz Tante Malchens schlechter Laune über derartig unnötige Neuerungen wurde es ein richtig ausgelassener Abend. Man hätte meinen können, im Hause Otto werde gefeiert. Tatsächlich feierte man – nichts weniger als den Fortschritt und den Anbruch einer neuen Zeit.
Nur Louise saß wieder ganz still dabei, schaute in die von ihr entzündete Kerze und empfand ein nie gekanntes Glück; eine Ahnung, dass dies erst der Beginn einer neuen, großartigen Zeit war.
Familie Otto besaß ein großes Eckhaus am Baderberg. Außer ihnen wohnten dort noch fünf weitere Familien zur Miete. Durch die gute Stelle als Gerichtsdirektor und die Einnahmen des Hauses hatte die Familie ein schönes Auskommen. Die Stellung des Vaters als Stadtrat brachte Ansehen. Trotzdem achtete die Mutter darauf, dass ihre Töchter alle Arbeiten im Haushalt lernten und selbst erledigten. Zu lebhaft stand ihr das schlechte Beispiel ihrer Schwägerin vor Augen. Ihr Schwiegervater, der alte Medizinalrat Otto, hatte es damals keineswegs gebilligt, dass sein Sohn Fürchtegott die arme Künstlertochter geheiratet hatte. Nicht genug, dass Charlottes Vater ein Porzellanmaler gewesen war, er hatte sich obendrein noch als Tanzmeister betätigt. Jahrelang waren sich Fürchtegott und Charlotte treu geblieben. Erst als die Treue Früchte trug und sich Charlottes Leib ein wenig zu wölben begann, willigte der Alte ein. In der Rosengasse hatte er ein kleines Haus übrig, das könnten sie haben, wenn sie ihn nur nicht mehr belästigten.
Nein, Fürchtegott und Charlotte belästigten den alten Herrn nicht mehr. Erst als die Ehe seines Sohnes Eduard das Elend einer reichen Erbin offenbarte, lenkte er ein. Während Eduards Frau bis mittags schlief, ihren Haushalt verlottern ließ und Eduard sich ins Wirtshaus flüchtete, dämmerte es dem Alten, dass allzu reiche Erbinnen für den Alltag oft wenig taugten. Sie hätte nicht einmal selbst anpacken, sondern lediglich die ihr zur Verfügung stehenden Dienstboten anweisen müssen, doch selbst das verstand sie nicht. Eduard genügten die Fluchten ins Wirtshaus bald nicht mehr, um ausreichend Abstand zwischen sich und seine Gemahlin zu bringen. Er trat beim polnischen Militär als Arzt ein, wohin ihn seine hagere Frau in Männerkleidern verfolgte.
Da erst ließ sich der Alte zu einem Besuch in der Rosengasse herab und fand alles sehr einfach, aber ordentlich bestellt. Charlotte war eine Frau, die mit geringen Mitteln ein behagliches Heim schaffen konnte. Das leckere Essen, nach welchem der Medizinalrat sich den Mund an einer handbestickten Serviette abwischte, überzeugte ihn vollends und er war voll des Lobes über seine Schwiegertochter, die er zuvor in seinem Haus an der Frauenkirche nicht einmal hatte empfangen wollen. Er schenkte den beiden das Haus am Baderberg und ließ sich von Charlotte pflegen, als er gebrechlich wurde. Er tat ihr sogar die Ehre an, ihr medizinische Rezepte zu übereignen.
Im Haus am Baderberg kam Louise am 26. März 1819 zur Welt. Sie war das jüngste der sechs Geschwister, von denen eines zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr lebte und der Tod bald ein weiteres zu sich holen würde.
Louise war von Anfang an kränklich, schmächtig und schien ihren Geschwistern bald folgen zu wollen. Doch sie lebte und brachte sogar Licht ins Haus ihrer Eltern. Sie blieb ein stilles Kind. Die Mutter beobachtete oft ihre Jüngste, wie sie schaute. Louise hatte eine sehr eigene Art, in die Welt zu blicken. Ihre großen blauen Augen schienen alles durchdringen zu wollen: Jeden Menschen, den sie auf der Straße sah, die Armen, die an die Tür kamen, um Brot und kleine Münzen zu erbetteln. Sie schaute der Mutter zu, wie sie einer armen Frau das Kind aus den Armen nahm, es wusch, speiste und in saubere Tücher gewickelt der dankbaren Frau zurückgab.
Louises Augen ruhten unverwandt auf den Damen, die sonntags ihre prächtigen Roben in die Kirche ausführten. Sie blickte scheu zu ihrem gestrengen Großvater auf, der alles darangesetzt hatte, die Ehe zwischen seinem Sohn und der Tochter eines Porzellanmalers zu verhindern. Wenn sie ihn in seinem Haus an der Frauenkirche besuchten, was selten vorkam, schaute sich Louise stumm in dem Haus mit seinen großen Zimmern und verwinkelten Treppen und Korridoren um. Man sah ihr an, dass sie all diese Erlebnisse, Menschen, Dinge auf eine intensive Weise in sich aufnahm, die der Mutter große Sorgen bereitete. Vor allem, weil Louise zuweilen ihren Blick nach innen zu kehren schien, als betrachte sie die gesammelten Eindrücke in ihrem Innersten.
Immer wieder versuchte die Mutter, allzu heftige Ereignisse von ihrer Tochter fernzuhalten, doch Louise hatte ihre Augen und Ohren überall. Jedes Wort, das die Erwachsenen, die so viel älteren Schwestern sprachen, schnappte sie auf. Vor allem wenn der Vater von seiner Arbeit berichtete, legte die Mutter oft den Zeigefinger auf die Lippen, damit Louise nicht die dunkle Seite seines Berufes kennenlernen musste.
Louise war zehn Jahre alt, als der Vater eines Abends mit schweren Schritten nach Hause kam. Wie immer begrüßte sie ihn schon auf der Treppe, wo er sie sonst nach ihren Schularbeiten fragte, aber an jenem Abend war es anders. Er legte ihr nur kurz die Hand auf den Kopf, ging an ihr vorbei, als sehe er sie gar nicht. In der Küche ließ er sich auf einen Stuhl fallen und stützte den Kopf in seine Hände. Louise sah, dass den Vater etwas schier Übermenschliches niederdrückte. Sie schlich ihm nach.
»Charlotte, meine gute Frau, bitte setz dich zu mir.«
Alarmiert schaute seine Frau ihn an. Rasch schob sie Louise aus der Küche, erteilte ihr einen Auftrag und schloss die Tür hinter ihr. Louise gehorchte ihrer Mutter üblicherweise, doch heute schaute sie durchs Schlüsselloch, schaute und lauschte, weil sie ihren eigenen Vater kaum wiedererkannte. Als sei er um Jahre gealtert, saß er zusammengesunken da. Louise sah nur seinen Rücken, ab und an das Gesicht ihrer Mutter, auf dem sich schon nach den ersten Worten des Vaters ein namenloser Schrecken ausbreitete.
»Charlotte, sag mir, kann es wirklich die Pflicht eines Christenmenschen sein, einem anderen Menschen das Leben abzusprechen und zu nehmen?«
Hastig nahm sie seine Hand. »Fürchtegott, musstest du wirklich …« Sie wagte nicht, es auszusprechen. Als er stumm nickte, schlug sie sich die Hand vor den Mund. »Der Himmel sei uns allen gnädig. Willst du … kannst du darüber sprechen?«, fragte sie sanft.
»Ich musste heute den Stab brechen über einem Mörder. Er sagt, er sei unschuldig, obwohl alle Beweise gegen ihn sprechen. Es gibt sogar Zeugen. Ich will dem Mann so gerne glauben. So gerne hätte ich Gnade walten lassen, aber ich entscheide es nicht allein. Allerdings bin ich derjenige, der dann den Stab brechen und das Urteil sprechen muss. Die anderen, die mir keine Wahl gelassen haben, die gehen schön nach Hause und waschen ihre Hände in dem Wasser, das Pilatus ihnen vererbt hat. Ich bin derjenige, der mit schwerem Herzen und einem noch viel schwereren Gewissen hier sitzt.«
Louise hielt den Atem an. Sie hatte genug verstanden, um zu wissen, dass ihr Vater, ihr gütiger Vater, einen Mann zum Tode verurteilt hatte. Sie kannte die Gebote. Du sollst nicht töten, hieß das sechste. Verstieß der Vater damit nicht gegen dieses Gebot? Manchmal gingen Louise und ihre Schwestern dem Vater entgegen, wenn er von der Arbeit kam. »Lauft bis zum Galgenberg. Dort wartet auf mich«, sagte er dann. An dem weithin sichtbaren Gerüst wurden schon lange keine Menschen mehr aufgehängt. Heutzutage wurden sie mit dem Schwert enthauptet. Konnte das alles richtig sein? Was waren das für Menschen, die Gesetze machten, die gegen göttliches Recht verstießen?
»Musst du bei der Hinrichtung anwesend sein?«, fragte Charlotte leise.
»Nein, das darf ich mir zum Glück ersparen. Es wird schon genug Gaffer geben, die sich eine Hinrichtung nicht entgehen lassen. Ich bin entsetzt, dass auch Leute aus unserem Freundeskreis, ja, sogar Frauen, sich eine Hinrichtung anschauen, als sei es ein Lustspiel.«
Charlotte schaute stumm vor sich hin. »Ich weiß nicht, was in diesen Menschen vorgeht. Als ich noch ein junges Mädchen war, da überredeten mich ein paar Freundinnen mitzukommen. Sechs Räuber sollten geköpft werden.« Fürchtegott legte seiner Frau eine Hand auf den Arm, doch sie schien diese alte Geschichte loswerden zu wollen. Mit schreckensstarren Augen blickte sie in ihre Vergangenheit. »So viel Volk hatte sich versammelt. Man hätte meinen können, es sei eine Kirmes und es gebe Freibier für alle, so dicht drängten sie sich auf der Richtstätte. Ich schaute mich um, sah in all diese geifernden Gesichter, die nur darauf warteten, dass der Henker endlich beginnen möge. Die sechs Räuber – Männer, die ganz offensichtlich die Not zu ihren Schandtaten getrieben hatte – standen gefesselt auf dem Podest. Leute drängten sich nach vorn, stießen mir ihre Ellbogen in die Rippen, nur um aus nächster Nähe sehen zu können, wie der Henker diese armen Teufel köpfte. Ich blickte mich nach meinen Freundinnen um, die mich überredet hatten, ich sah sie nicht mehr. Ich sah nur noch eine Welle von Fratzen, die über mich hinwegbrandete. Ich roch nur noch die Angst der Verurteilten und die Geilheit der Menge. Ja, verzeih mir dieses Wort, ich kann es nicht anders nennen. Ich fühlte mich, als käme ich aus einer anderen Welt. War ich denn die einzige, die Mitgefühl für diese Männer hatte? Der Blick des einen traf mich, bohrte sich in meine Augen, in meinen Verstand, so flehend, voller Angst. Da wurde ich ohnmächtig und wurde weggetragen. Wenigstens dazu war man fähig. Als ich die Augen aufschlug, lag ich etwas abseits des Platzes, hörte nur noch, wie einer der Männer, die mich hergebracht hatten, darüber schimpfte, dass sie mindestens einen der Räuber verpasst hätten. Ich schleppte mich davon, denn ich hatte Angst vor den Geräuschen, dem Schreien, dem Schlag des Schwertes, dem Grölen der Menge.
Oh, verzeih mir, ich wollte dich nicht quälen«, rief sie plötzlich aus, wie aus einem Albtraum erwachend. »Verzeih mir, du leidest ja genau wie ich darunter. Du warst gezwungen, den Stab zu brechen.« Sie schlang die Arme um seinen Nacken. An ihrem unregelmäßigen, heftigen Atmen erkannte Louise, dass sie weinte.
»Wie könnte ich meiner Charlotte böse sein?«, flüsterte Fürchtegott und streichelte den Rücken seiner Frau, die sich nur langsam wieder beruhigte.
Louise stand schreckensstarr vor der Tür. Die Erzählung ihrer Mutter, gestammelt nur, ließ Bilder in ihr aufsteigen. Überdeutlich sah sie den Richtplatz, spürte sich selbst inmitten der Menge und es waren ihre eigenen Augen, in die sich der flehende Blick des Verurteilten bohrte. Sie war es, die sich nun davonschleppte. Aber ihr gelang es nicht, vor den Geräuschen zu fliehen: In ihrem Kopf hallten die Schreie der Räuber und die Schläge des Schwertes wider.
Es dauerte nicht lange, und das Armesünderglöckchen läutete in Meißen. Die Mutter suchte sich eine Arbeit im Keller, wie sie es immer bei diesem Klang tat. Niemand aus dem Hause Otto ging auf die Straße, alle beschäftigten sich irgendwie in der Küche, konnten sich nicht auf ihre Arbeit konzentrieren, waren fahrig und schauten einander schließlich bange an. Louise hielt es nicht mehr in der Küche. Sie wollte hinunter zur Mutter. Auf dem Weg dorthin kam sie an einem der Fenster vorbei, die hinaus auf die Straße blickten. Da sah sie den Zug. Und sie konnte nicht anders, als ans Fenster zu treten und hinauszustarren. Wie unter einem Bann stand sie, der ihr nicht erlaubte, die Augen wegzuwenden von den Scharfrichtern, die auf schwarz und silbern gezäumten Pferden der Prozession voranritten. Alle Henker Sachsens hatten sich eingefunden, gekleidet ganz in Schwarz, die Schwerter an ihren Gürteln. Nur der erste unter ihnen, der den Verurteilten köpfen würde, hatte sein Schwert schon entblößt. Auf einem Karren folgte der Elende, dem all dieser Aufwand galt. Gefesselt, schmutzig wie ein Tier, kauerte er in dem Wagen und ließ den Hass der Menge, die ihn mit Schmutz bewarf, über sich ergehen.
Louise spürte seine Angst mehr als alles andere. Wusste er, dass er gerade an dem Haus vorbeifuhr, in dem sein Richter saß? Konnte er ahnen, wie viel Schmerz es dem Gerichtsdirektor bereitete?
Erst als die Straße wieder leer, die Glocke längst verstummt war, kam die Mutter aus dem Keller und fand ihre Jüngste bleich und zitternd am Fenster.
»Louise, hast du dir etwa den Zug angeschaut?«, fragte sie mit gerunzelter Stirn.
»Ich wollte zu dir, Mutter, da hab ich …« Ihre Worte gingen in heftigem Schluchzen unter. Charlotte legte ihrer Tochter eine Hand auf die Schulter. »Du hättest in der Küche bleiben und dort deine Arbeit tun sollen. Geh!« Louise schaute ihre Mutter fragend an. Durfte sie es wagen, sich an sie zu schmiegen, ihre Arme um sie zu schlingen, damit die Mutter sie tröstete?
»Geh jetzt!«, sagte die Mutter in ungewohnter Strenge, worauf Louise die Stufen hinauf und in die Wohnung rannte. Ihr Hals schmerzte, als würde etwas sehr Großes darinnen feststecken.
Während Charlotte noch auf das sonnenbeglänzte Kopfsteinpflaster schaute, sah sie einen Amtskollegen ihres Mannes heraneilen. »Was will der noch?«, fragte sie sich grollend.
Im nächsten Moment hörte sie ihn läuten und energisch an die Tür hämmern.
Die Fensterläden der Küche waren noch geschlossen, der Raum lag im Dämmerschein; nur hier und da malte die Sonne grelle Linien auf den Boden, wo sie durch die Ritzen der Läden eindrang. Die Schwestern und der Vater hatten sich noch nicht aus ihrer Entsetzensstarre gelöst, als draußen im Treppenhaus Schritte und Rufe näher kamen.
»Fürchtegott!«, rief Charlotte. Klang das nicht glücklich? Fürchtegott lief hinaus aus der Wohnung und sah seine Frau mit seinem Amtskollegen die Treppe heraufkommen. Auf ihrem Gesicht mischten sich Tränen und Lachen.
»Fürchtegott, stell dir vor!«, rief sie. »Der Mann wurde vom obersten Richter begnadigt«, ergänzte der Amtmann. »Es hat sich ein Zeuge gefunden, der den Mann entlasten konnte. Buchstäblich im letzten Moment. Ich weiß, wie schwer Sie darunter gelitten haben, Herr Otto. Deshalb wollte ich es Ihnen so schnell wie möglich sagen.«
»Danke. Ich danke Ihnen. Ich wäre nie wieder froh geworden.« Mehr brachte Fürchtegott nicht heraus. Charlotte lag mit Freudentränen in seinen Armen. Von diesem Bild etwas peinlich berührt, ging der Amtmann eilig davon. Er hatte die entscheidende Nachricht überbracht. Er musste dem Gerichtsdirektor Otto nicht mehr berichten, wie glückselig die Angehörigen den Mann in Empfang genommen hatten. Und erst recht nicht musste er erfahren, wie die Menge gemurrt hatte über das entgangene Schauspiel. Dass sie sich selbst schuldig gemacht hatten, weil sie einen Unschuldigen geschmäht und sein Blut gefordert hatten, kam ihnen nicht in den Sinn.
Nicht nur Erlebnisse hinterließen ihre Furchen auf Louises Seele, auch Schillers Werke brannten sich in ihr Gedächtnis. Die Monologe aus der Jungfrau von Orleans, Maria Stuart und vor allem der Satz aus dem Don Carlos: »Sire, geben Sie Gedankenfreiheit!« wurden von ihr sowohl zu passenden als auch unpassenden Gelegenheiten deklamiert. Passend waren ihre Auftritte, zu denen sie sich gerne verkleidete, im Kreis der Familie. Unpassend waren sie in einem Kurbad, wo sie sich nach langer Krankheit erholen sollte. Die feinen Damen machten der mitgereisten Tante Malchen schwere Vorwürfe, wie sie solche Schriften einem elfjährigen Kind zu lesen geben könne.
Tante Malchen, deren Bewunderung für feine Damen weitaus größer war als ihr Horizont, konfiszierte den Schiller. Aber es war zu spät: Louise kannte schon alles auswendig und nahm nicht nur Anteil an den Schicksalen der starken Frauengestalten, sondern zog zum großen Missfallen der Tante auch ihre Schlüsse daraus. Selbst wenn diese Stoffe in der fernen Vergangenheit angesiedelt waren: kam ihnen nicht heute, in ihrer eigenen Gegenwart, Bedeutung zu? In Sachsen wurde niemand von den Engländern bedrückt, aber Bedrückung und Elend gab es genug. Letztlich war es egal, wer die Not der Menschen verursachte; Gedankenfreiheit musste gewährt werden, wenn man die Herrschenden auf Missstände aufmerksam machen wollte, damit sie Abhilfe schafften.
Da erreichten Nachrichten aus Frankreich das beschauliche Meißen: In Paris hatte die Bürgerschaft den König zur Abdankung und Flucht nach England gezwungen, denn dieser hatte versucht, das Parlament aufzulösen. Nun gab es in Sachsen kein Halten mehr.2 König Anton, der im Greisenalter seinem Bruder auf dem Thron gefolgt war, hatte keineswegs die Reformen eingeführt, nach denen die Sachsen lechzten. Vielmehr hütete er den Scherbenhaufen, den sein Napoleon treu ergebener Bruder hinterlassen hatte. Zensur, Willkür, Bespitzelung waren an der Tagesordnung. Kurz, die Sachsen hatten genug gelitten unter ihren Königen, die ihnen nichts als Krieg, Elend und Hunger beschert hatten.
In Ermangelung einer Bastille erstürmte man in Dresden das Polizeihaus in der Scheffelgasse. Dies geschah in der Nacht vom 9. auf den 10. September 1830. Die Polizei stand in dem Ruf, arrogant, korrupt und gewalttätig gegen kleine Leute zu sein. Nur gegen die Obrigkeit katzbuckelte sie, denn sie war auf den Monarchen vereidigt und damit der Handlanger eines korrupten Staates, der sich selbst lähmte und die Interessen des Volkes längst aus den Augen verloren hatte.
Auch in Meißen waren Tumultuanten unterwegs, die die Häuser der Stadträte mit Steinen bewarfen. In dieser Nacht saßen Charlotte und Fürchtegott in der dunklen Stube und lauschten hinaus auf die Straße. Die Töchter hatten sie zu Bett geschickt, doch diese waren weit entfernt davon, zu schlafen. Louise hatte schon den ganzen Tag die Unruhe gespürt, aber nicht zu fragen gewagt. Die Gesichter ihrer Eltern waren so angespannt und verschlossen wie nie.
»Clementine, was sind das für Leute, die heute Nacht draußen unterwegs sind?«, flüsterte sie in die Finsternis. Eng hatte sie sich an ihre älteste Schwester geschmiegt, die sie in ihren Armen barg. Schemenhaft sah sie das Bett auf der anderen Seite des Raumes, wo Antonie und Francisca lagen. Die beiden schienen schon zu schlafen. Machte ihnen das alles keine Angst?
»Das sind Tumultuanten«, flüsterte Clementine. »Diese Leute wollen nichts anderes als nur Tumult. Sie machen die Straßen kaputt, reißen die Pflastersteine heraus und werfen sie in die Fenster.«
»In unsere auch?« Louise klang ängstlich.
»Ich denke nicht«, erwiderte Clementine nach kurzem Zögern. »Weißt du, Louise, wenn man Veränderungen will, dann muss das in friedlichen Bahnen verlaufen. In Dresden haben sie zwar die Polizeiwache gestürmt, aber was das letztlich bringen wird … Wir können nur hoffen und beten, dass alles ein gutes Ende nimmt.«
Dies war ein frommer Wunsch, denn seit Jahrzehnten gärte es in vielen deutschen Ländern. Nachdem die Franzosen anno 1789 ihren König geköpft hatten, war die revolutionäre Welle über die Grenze geschwappt. Französische Soldaten brachten Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zuerst in den Südwesten Deutschlands, wo die Mainzer 1793 den rheinisch-deutschen Freistaat ausriefen. Es gab eine demokratische Wahl, doch das Parlament ging unter im preußischen Kugelhagel.
Jahre später hatte Napoleon Europa fest im Griff. In Dresden wohnte König Friedrich August I. Mehr als ein Wohnen kann man seine Tätigkeit nicht nennen, denn seine Regierungstätigkeit beschränkte sich darauf, Napoleon zu huldigen. Viel zu eng knüpfte er sein eigenes Schicksal an das des Franzosen. Solange dieser glorreich war, ging es auch dem sächsischen König gut. Als die Trikolore zu sinken begann, hätte sich Friedrich August gerne bei seinen früheren deutschen Amtskollegen gemeldet, worauf diese begreiflicherweise keinen Wert legten. Nicht einmal zum Wiener Kongress, der 1815 ganz Europa neu ordnete, luden sie ihn ein. Der Fortbestand Sachsens war unsicher. Das Land musste Gebietsverluste hinnehmen und Reparationen bezahlen. Glücklicherweise räumte man dem ehemals so bedeutenden Land einen Platz im Deutschen Bund ein, der Staatenversammlung, die man auf dem Wiener Kongress ins Leben rief.
Viele Menschen in den deutschen Ländern hatten gehofft, dass ihr Leben nun besser würde, mussten aber erkennen, dass sich Zensur, Bespitzelung, ja sogar Hunger und Elend häuslich niederließen und nicht den Eindruck machten, als wollten sie Deutschland jemals den Rücken kehren.
König Anton von Sachsen war an sich kein schlechter Mensch. Er trug sogar den Beinamen »der Gütige« mit einer gewissen Berechtigung, denn in Einzelfällen war er bereit, seinem Volk große Zugeständnisse zu machen – wenn ihm diese Einzelfälle überhaupt zu Ohren kamen. So ließ er konsequent alles Wild in den Gegenden bejagen, aus denen sich die Bauern erfolgreich über Wildschäden beschwert hatten. Allerdings verfügten sich die Wildschweine unter dem massiven Druck der Jäger in die Nachbarschaft, um dort ungestört zu wüten. So lange, bis es auch den dortigen Bauern gelang, sich Gehör zu verschaffen.
Oder König Anton wollte auf seinen Reisen keinerlei Geschenke annehmen und sich auch nicht feiern lassen von den Städten, durch die er kam. Vielmehr legte er den Stadtvätern nahe, das gesparte Geld in die Verbesserung von Straßen, Krankenhäuser und eine bessere Bezahlung der Handwerker zu investieren.
Ja, für dergleichen Anekdoten sorgte der gute König Anton; allerdings fehlte ihm ein Überblick über das Staatswesen an sich. Er hatte lediglich sehr vage Vorstellungen davon, wie die einzelnen Kräfte in seinem Staat ineinandergriffen, wie der Staatsapparat aus Beamten funktionierte, woher Gelder kamen, wohin sie flossen, an welchen Stellen womöglich der Korruption die Türen offenstanden.
All diese Dinge waren Anton nicht wichtig. Er genoss das Leben mit seiner Gemahlin Therese, die beiden widmeten sich der Kultur und waren gerne und viel auf Reisen.
Freundlicherweise hatte Herr Detlev von Einsiedel die schwere Bürde der Regierungsgeschäfte auf sich genommen und versah seinen Dienst so gewissenhaft, dass er niemandem sonst erlaubte, ihm dreinzureden. Im Laufe der Zeit hatte er sich eine Machtfülle angeeignet, die selbst den Sonnenkönig in Staunen versetzt hätte. Er allein hatte das Recht, bei König Anton vorzusprechen; ihm allein unterstand die sächsische Polizei. Seine Bergwerke erhielten Staatsaufträge, und als Unterstützer des Pietismus und einer lutherischen Orthodoxie hielt er seine Hand über jede einzelne Pfarrstelle, die im Königreich zu besetzen war.
Einsiedel duldete keine Lockerung der Pressegesetze, jedes kritische Wort wurde auf die Goldwaage gelegt und brachte seinem Urheber oft Festungshaft ein.
Die Sachsen ächzten unter der »Einsiedelei«.
Einen weiteren Tiefpunkt erreichte König Anton, als er die Feiern zum dreihundertjährigen Jubiläum der »Confessio Augustana« absagte. Am 25. Juni 1530 hatten lutherische Fürsten auf dem Reichstag zu Augsburg dem Kaiser ihr Bekenntnis vorgelegt. Zwar hatten sie die Unterschiede zwischen ihrem Glauben und der katholischen Kirche dargelegt, aber auch Gemeinsamkeiten unterstrichen, um dem Kaiser die Anerkennung ihres Bekenntnisses so leicht wie möglich zu machen. Kaiser Karl V. hatte abgelehnt und die Fürsten verließen unter Protest den Reichstag und wurden fortan Protestanten genannt.
Seither wurde der 25. Juni in Sachsen groß gefeiert. Erst recht, als sich dieser Tag zum dreihundertsten Male jährte, bereitete man sich auf ein großes Fest vor. Wein- und Essensvorräte wurden angeschafft, Festkleider bestellt. Musik, Theaterstücke und Umzüge wurden vorbereitet. Zunächst gaben sich die Behörden dem vorfreudigen Treiben gegenüber aufgeschlossen, doch Detlev von Einsiedel blickte weiter: Er ahnte, dass dieser Festtag von den Sachsen dazu benutzt werden würde, politische Kundgebungen abzuhalten, denn schon lange bestand die Forderung nach Gewerbefreiheit, nach einem Haushaltsplan. Um jegliche Demonstrationen in dieser Richtung im Keim zu ersticken, wurde nicht einmal ein Umzug der Kinder gestattet. Außerdem bliesen die Jesuiten ihrem katholischen König ins Ohr, dass dem protestantischen Treiben Einhalt zu gebieten sei – ausgerechnet im Mutterland der Reformation.
Zu Recht waren die Sachsen empört und trafen sich trotzdem, um den Tag feierlich zu begehen. Was hätte man auch sonst tun sollen mit all den Weinvorräten und Festkleidern? Dies sah die Polizei als einen Verstoß gegen das Versammlungsverbot und schritt ein. Dabei wurde ein junger Mann getötet. Niemand konnte die Menschen daran hindern, zu dessen Beerdigung zu gehen, bei der man sich nicht auf fromme Grabreden beschränkte, sondern die Obrigkeit und vor allem die Polizei scharf kritisierte. Das Ganze artete zu einer regelrechten politischen Versammlung aus, doch kein Polizist wagte einzuschreiten.
Dies war nicht der einzige Vorfall, der die Menschen gegen die Polizei aufbrachte. Auch wenn die Geschehnisse in Sachsen harmlos waren im Vergleich zu Paris, drängten weise Berater König Anton von Sachsen, seinen Neffen, den überaus beliebten Prinzen Friedrich August, zum Mitregenten zu erheben. Das war die eleganteste Lösung, um die Hinrichtung eines Königs zu vermeiden. Wer konnte schon ahnen, wozu die Sachsen fähig waren, wenn sie nur fuchdch3 genug wurden! Allen Beteiligten war klar, dass damit eine Absetzung Einsiedels einhergehen musste. Der Mitregent nahm sein Amt auf, während sich Einsiedel ins Private zurückzog. Nun war der Weg frei für Reformen, die Prinz Friedrich August gemeinsam mit den Herren Lindenau, Könneritz und Falkenstein in Angriff nehmen wollte. Die Sachsen setzten all ihre Hoffnungen auf den Prinzen und seine ebenfalls jungen Berater.
Wie beliebt ein Herrscher sein kann, erlebte Louise im späten September 1830, als Prinz Friedrich August auf seiner Rundreise durch Sachsen auch nach Meißen kam.
Diesmal hielt Familie Otto nichts in ihrem Haus. Mit allen ihren Mitbewohnern liefen sie hinaus auf die breiten Straßen, wo die Kutsche des hübschen Prinzen vorbeikommen würde. Dicht drängten sich die Menschen an den Straßenrändern, um einen Blick auf den Mann zu erhaschen, auf den sie ihre Hoffnung setzten. Prinz Friedrich August war schon jetzt für seine Güte und Volksnähe bekannt. Was sollte erst geschehen, wenn er allein an der Macht war und seine Güte Gesetz wurde? Man traute ihm alles zu und feierte ihn wie einen Messias.
Wie in anderen Städten auch, hatten junge Männer am Stadtrand von Meißen die Kutsche des Prinzen angehalten und die Pferde ausgespannt, um die Kutsche selbst durch die Stadt zu ziehen. Jubel brandete ihm entgegen, Hüte und Taschentücher wurden geschwenkt, Vivat! und immer wieder Vivat!, rief die Menge.
Und Louise schaute.
Sie schaute von einer Treppe aus, auf die sich die Familie aus der Menschenbrandung geflüchtet hatte, auf dieses Meer aus fröhlichen Gesichtern. Hoffnung sprach aus ihnen. Hoffnung auf bessere Zeiten, auf Freiheit, auf Zeitungen, die wirklich schreiben durften, was in Sachsen geschah, oder einfach nur die Hoffnung auf einen vollen Magen. Kinder wurden der Kutsche entgegengehoben, als solle der Prinz sie segnen. Dicht und immer dichter drängten sich die Menschen zu der Kutsche hin. Sie schlossen einen undurchdringlichen Kreis aus großen Hüten, feinen Kleidern, Zylindern und Sonntagsstaat.
Nur ganz am Rand, dort, wo niemand sich mehr drängte, wohin der Glanz des Prinzen nicht mehr fiel, da hoben dürre Arme zerlumpte Kinder in die Höhe. Dann war der Prinz fort und die Schatten stahlen sich davon, wissend, dass ihr Los auch mit diesem Mann nicht leichter würde.
Aber Louise hatte sie gesehen. Sie kannte diese Schatten, die immer wieder an der Haustür ihrer Eltern erschienen wie eine Mahnung an die Vergänglichkeit auch des bescheidensten Wohlstandes. Ausgemergelte Frauenleiber, an deren schlaffen Brüsten vergeblich Kinder hingen. Ungenährt, ungewollt, ungeliebt. So viele waren es. So viele. Ihre ganze Hoffnung galt einem Stück Brot. Glück, Zufriedenheit und die Sicherheit eines Hauses waren nichts weiter als Versprechen, die das Leben selbst längst gebrochen hatte.
Im Hause Otto wurde noch lange gefeiert. Freunde und Nachbarn waren alle bei dem Gerichtsdirektor eingeladen, um auf das Wohl des Mitregenten zu trinken. Louise, in deren Kopf sich viel zu viele Bilder überschlugen, zog sich zurück in das Schlafzimmer, das sie mit den Schwestern teilte. Papier und Feder hatte sie schnell zur Hand und schrieb auf dem Fensterbrett ihr erstes Gedicht. Es dauerte nicht lange und Clementine schaute herein.
»Da bist du ja! Wir haben dich schon gesucht. Was machst du?« Sie trat hinter Louise und schaute ihr über die Schulter. Louise schaute kurz zu ihr auf, dann heftete sich ihr Blick wieder auf das Papier, auf dem schon ein paar Strophen entstanden waren. Wörter waren durchgestrichen, durch andere ersetzt, Pfeile deuteten an, wohin die Wörter gehörten.
»Dann lass ich dich lieber wieder alleine«, flüsterte Clementine und strich dabei ihrer jüngsten Schwester übers Haar. »Aber komm nachher und lies es uns vor, ja?«
In Louises Kopf arbeitete es fieberhaft. Kaum hatte sie wahrgenommen, dass Clementine bei ihr gewesen war. Das gerade Erlebte verdichtete sich zu Wörtern; Wörter versammelten sich zu Zeilen, fügten sich reimend ineinander, verdichteten sich zu Strophen. Sie las ihr Gedicht wieder und wieder durch, strich und ergänzte so lange, bis sie zufrieden war. Sie schrieb alles ins Reine und ging zurück zu ihrer Familie.
Wie erstaunt waren die Freunde und Nachbarn, als die Elfjährige mit einem Zettel in der Hand zu ihnen kam und Ruhe verlangte. Man wischte sich die Münder an den Servietten ab und drehte sich um. Der Nachbar mit der roten Nase fürchtete einen längeren Vortrag und versorgte sich mit einem vollen Glas Wein, seine Frau und die Söhne pickten Kuchenkrümel von den Tellern und stießen sich kichernd in die Seiten. Clementine klatschte in die Hände und brachte selbst die letzten Schwätzer zum Schweigen.
Und Louise trug ihr erstes Gedicht vor. Sie pries darin den Mitregenten, ermahnte ihn, für sein Volk zu leben, nur auf dieses sich zu verlassen, dann könnten ihm auch die Jesuiten nichts anhaben. Man applaudierte fröhlich, wobei sich die Nachbarn die berechtigte Frage stellten, woher die Elfjährige so gut über die Jesuiten Bescheid wusste.
»Sie schnappt alles auf!«, seufzte die Mutter, die mit ihrem Mann natürlich über die Hintergründe der abgesagten Feierlichkeiten im Juni gesprochen hatte.
Tatsächlich änderte sich mit Prinz Friedrich August mehr, als man zu hoffen gewagt hatte. 1831 bekam Sachsen sogar eine Verfassung, die Freiheit der Person, Freizügigkeit und Beschwerderecht einschloss. Die Pressefreiheit zählte nicht dazu – schließlich wollte man sich nicht auf eine Stufe stellen mit den Revolutionären auf der Straße.
Fürst Metternich reagierte prompt und ließ die sächsische Regierung wissen, man könne und wolle es nicht als möglich betrachten, dass die königlich sächsische Regierung sich Gesetze durch einen aufgeregten Pöbel oder durch irregeführte Bürger vorschreiben lasse.4
Auch aus Preußen kam keineswegs Lob. Der junge Lindenau war daraufhin nach Preußen gereist, um dort die Wogen zu glätten und um Verständnis für die sächsischen Reformen zu werben. Dies tat er mit dem Hinweis, dass König Anton de facto nicht mehr regiere. Diese Tatsache beruhigte den preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm und er schrieb am 3. Januar 1831 an den Mitregenten Prinz Friedrich August: »Wirklich, gnädigster Herr, wüsste ich nicht die Zügel der Herrschaft bey Ihnen in so frischen, kräftigen Händen, ich würde für uns als Nachbarn eine gewisse Besorgnis nicht unterdrücken können.«5
So unterschiedlich waren die Meinungen über die sächsischen Reformen. Die einen sahen darin den Untergang der gottgewollten Ordnung, die anderen ein laues Lüftchen, wo es einen Sturm gebraucht hätte.
Nach wie vor war es gefährlich, allzu laut seine Meinung kundzutun oder auch nur Tatsachen auszusprechen wie das Elend der Weber, der Klöpplerinnen oder des Industrieproletariats. Daher zog man sich zurück in die eigenen vier Wände, die im Laufe der Zeit immer heimeliger wurden. Allgemein waren die hellen Wände der Wohnstuben mit Blümchenmustern betupft, der Kaffee dampfte neben dem Kuchen, den die weißbeschürzte Hausfrau gebacken hatte, Schillerlocken wippten neben unwissenden Mädchengesichtern, die Biedermeier-Herren sprachen nicht mehr von Politik, sondern ließen leise Hausmusik erklingen. Selbst die Hirsche röhrten lautlos in ihren Ölgemälden. Lediglich die neumodisch kurzen Röcke, die nicht nur die Schuhe, sondern auch die Knöchel (Jawohl! Die Knöchel!) der Damen sehen ließen, sorgten eine Weile für Aufregung.
Fürchtegott Otto hatte die Leipziger Zeitung abonniert und las sie gerne mit seiner Frau und den Töchtern. Tante Malchen hörte dann und wann zu, behielt ihre Gedanken aber für sich, wenn ihr Schwager allzu modern wurde.
Einmal kam er mit den niedergeschriebenen Landtagsverhandlungen nach Hause, umarmte und küsste seine Frau, als wolle er ihr gratulieren, und rief: »Nun freue dich! In wenigen Jahren schon ist die Geschlechtsvormundschaft aufgehoben. Wenn ich sterbe, kannst du machen, was du willst und brauchst nicht erst einen Curator.«
»Das ist hoffentlich noch lange hin, mein lieber Mann, aber Gott sei Dank!«, erwiderte die Mutter. »Das wird auch gut sein für die Mädchen. Denkst du denn, dass die Änderung bald kommen wird?«
»Ich denke schon. Im Moment spricht man im Landtag nur darüber, aber wenn unsere Mädchen über einundzwanzig Jahre alt sind, wird dieses Gesetz sicher schon in Kraft getreten sein.«
Unter den älteren Töchtern brach ein wildes Geschnatter los. »Mündig! Jetzt dauert es nicht mehr lange, dann können wir selbst bestimmen.«
»Hört, hört! Haben wir euch denn so sehr geknechtet?« fragte der Vater belustigt.
»Ach, nein, Vater!« Clementine sprang von ihrer Arbeit auf. »Aber es ist doch ein anderes Lebensgefühl, wenn man weiß, dass man auch als unverheiratete Frau etwas gilt.«
»Was genau bedeutet das, Vater?«, fragte Louise und blickte von ihren Schularbeiten auf.
»Das, meine Liebe, bedeutet, dass unverheiratete Frauen über einundzwanzig Jahren und Witwen mündig sind. Man betrachtet sie vor dem Gesetz nicht mehr wie Kinder, sondern sie dürfen selbst bestimmen, wo und wie sie leben, wofür sie ihr Geld ausgeben – wenn sie welches haben. Sie dürfen selbst vor Gericht gehen, wenn ihnen Unrecht geschehen ist, und jemanden verklagen.«
»Nur die verheirateten Frauen stehen noch immer unter der Vormundschaft ihrer Ehemänner«, warf Charlotte ein. »Ich kann nur hoffen, dass auch das bald aufhört.«
Louise hörte schon nicht mehr, wie sich die Eltern scherzhaft stritten, wer denn hier im Hause mehr das Sagen habe. »Leben, wo und wie sie wollen.« Dies fiel tief in Louises Geist. Wie dankbar war sie, in dieser Zeit zu leben, in der so viel möglich war.
»Lernt nur fleißig, ihr Mädchen, dann braucht ihr nicht zu heiraten, wenn ihr nicht wollt«, schloss der Vater und setzte sich mit einem behaglichen Lächeln zwischen seine Töchter.
»Was wird es ihnen denn nützen, wenn sie noch so klug und gebildet sind?«, sagte die Mutter, worauf Tante Malchen zustimmend nickte: »Wenn sie zu klug sind, wird kein Mann sie wollen. Welcher Mann will schon eine Frau, die ihm vorschreibt, wo es langgeht? Die am Ende klüger ist als er! Und ganz aus ist es, wenn sie gebildeter ist als er. Wie kann in einem solchen Hause Frieden herrschen?«
»Liebe Tante, denkst du denn wirklich, dass häuslicher Frieden darin besteht, dass eine Frau weit hinaufschaut zu einem Mann, der ihr göttergleich überlegen ist? Auch Männer sind aus Fleisch und Blut und haben morgens beim Aufstehen strubbelige Haare und schlechten Atem.« Die aufkommende Empörung der Erwachsenen versuchte Clementine einzudämmen: »Aber«, rief sie mit erhobenem Zeigefinger, »ich werde einen Mann auch mit strubbeligem Haar lieben können, wenn er mich ebenfalls liebt, so wie ich bin. Ich werde ausschließlich der Liebe wegen heiraten.«
»Ein reicher Mann, der kann dich schön verhätscheln, aber mit einem armen Kerl, da ist die Liebe schnell vergranscht6. Ich werd dich dran erinnern, wenn du in einer Hütte haust und jeden Groschen dreimal umdrehen musst.« Tante Malchen sprach mit auffälliger Überzeugung. Sie gehörte zu den vielen Tausenden, die niemals geheiratet hatten und sich mit dem begnügen mussten, was verheiratete Geschwister ihnen zugestanden: einem Platz am Tisch, einem Bett. Dafür mussten sie sich nützlich machen, jeden Tag neu ihre Daseinsberechtigung verdienen.
Die Frage, ob Clementine aus Liebe oder für Geld heiratete, wurde nicht mehr beantwortet. Sie starb am 31. Dezember 1831 an Schwindsucht und wurde am Neujahrstag begraben. So traurig hatte die Familie Otto noch niemals ein neues Jahr begonnen. Am schlimmsten traf es Louise. Clementine, ihre Clementine war nicht mehr da. Clementine, die zwischen all der Arbeit doch auch Zeit für sie gehabt, sie umarmt und getröstet hatte, wenn die Bilder in ihrem Kopf gar zu heftig geworden waren. Wer sollte sie nun verstehen, wen konnte sie jetzt noch teilhaben lassen an der verworrenen Welt ihres Inneren?
Ihr kleiner, verwachsener Körper war ein einziges Schluchzen, als sie ihren Kopf in ihren Armen barg. Sanft fühlte sie die Hand der Mutter auf ihrem Kopf. »Ich weiß, Louise, Clementine stand dir am nächsten.« Mit einem Aufschrei umklammerte Louise ihre Mutter. »Ich will, dass sie zurückkommt. Sie soll wieder bei uns sein.« Dann brach sie in so heftiges Weinen aus, dass die Mutter all ihre Aufmerksamkeit ihrer Jüngsten zuwenden musste. »Louise, es tut uns allen unendlich weh.« Und leise, wie zu sich selbst sprechend, fügte sie hinzu: »Die ganze Welt steht auf dem Kopf, wenn Eltern ihre Kinder begraben müssen. Sie war meine Erste. Und sie war ein ganz besonderer Mensch. Ich weiß selbst nicht, wie ich ohne sie auskommen soll.« Seufzend ließ sie ihre Jüngste los. »Es muss weitergehen. Für uns alle, die wir noch da sind, muss es weitergehen. Hier, Louise, die Äpfel müssen zu Apfelbrei verarbeitet werden, bevor sie ganz verderben.« Die ruhige Stimme ihrer Mutter brachte sie kaum zu sich. Ganz mechanisch griff sie nach dem Küchenmesser, das die Mutter ihr hinhielt, und schnitt die Äpfel auf. Schnitt die faulen Stellen heraus, das Kerngehäuse; schnitt die Äpfel in kleine Stücke und ließ sie in den Topf fallen, in den auch die Mutter ihre Stücke fallen ließ. Mit einem scheuen Blick bemerkte sie, dass die Mutter mit dem Handrücken ihre Augen wischte, um dann mit versteinertem Gesicht desto emsiger zu arbeiten.
Louise schaute.
Ihre Augen ruhten unverwandt auf den Herrschaften der Stadt, die mit großartigen Garderoben durch die Straßen flanierten. Sie sahen gelangweilt aus, wie sie da an den Schaufenstern standen, die Auslagen betrachtend, die ihnen längst keinen neuen Reiz mehr verschafften. Sie saßen in den feinen Cafés, aßen Torten, die ihnen nicht bekommen würden, weil das üppige Mittagessen noch im Magen lag. Sie schienen keinerlei Zweck zu haben, sondern waren einfach nur da, bevölkerten die Straßen wie gierige Dämonen, die mit riesigen Händen alles an sich rissen. Nichts blieb für diejenigen, die wirklich Hunger hatten.
Dies war nicht nur in Sachsen der Fall, sondern in allen Ländern des Deutschen Bundes. Und diejenigen, denen der Hunger nicht jeden klaren Gedanken aus dem Kopf fraß, hungerten nach mehr: nach Freiheit! Zwar herrschte Friedhofsruhe in den deutschen Landen, aber es gärte …
Wieder einmal war es im Badischen, wo sich der Widerstand mit Vehemenz regte: Da politische Versammlungen verboten waren, rief ein gewisser Philipp Jacob Siebenpfeiffer dazu auf, die Jubelfeier für die bayerische Verfassung7 ganz besonders eifrig zu besuchen. Die bayerische Verfassung war nichts, das man hätte bejubeln müssen, aber eine große Menge Volkes kam in jenen späten Maitagen des Jahres 1832 auf dem Hambacher Schloss zusammen. Die Tatsache, dass Siebenpfeiffer, der sich bereits durch die Herausgabe kritischer Zeitungen verdächtig gemacht hatte, zu diesem Fest einlud, hätte die Behörden aufrütteln können. Doch allzu schnell rüttelte und regte sich nichts bei deutschen Behörden. Die Jubelfeier gestaltete sich also ungestört zu einem riesigen Volksfest, zu dem etwa dreißigtausend Menschen strömten. Zum ersten Mal wagte man, schwarz-rot-goldene Fahnen zu zeigen, die für ein vereinigtes Deutschland standen. Mit diesen zog man hinauf zum Schloss, wo Siebenpfeiffer seine Eröffnungsrede hielt:
»Es wird kommen der Tag, wo der Deutsche vom Alpengebirg und der Nordsee, vom Rhein, der Donau und Elbe den Bruder im Bruder umarmt, wo die Zollgrenzen und die Schlagbäume, wo alle Hoheitszeichen der Trennung und Hemmung und Bedrückung verschwinden.
Dann wird in strahlendster Gestalt sich erheben, wonach wir alle ringen und wozu wir heute den Grundstein legen – ein freies deutsches Vaterland.
Es lebe das freie, das einige Deutschland!
Hoch leben die Polen, der Deutschen Verbündete!
Hoch leben die Franzosen, der Deutschen Brüder, die unsere Nationalität und Selbstständigkeit achten!
Hoch lebe jedes Volk, das seine Ketten bricht und mit uns den Bund der Freiheit schwört! Vaterland – Volkshoheit – Völkerbund hoch!«
Ein geeintes Deutschland mit einer freiheitlichen, ja sogar demokratischen Verfassung wurde gefordert.
Aber die Männer, die dieses Leuchtfeuer deutschen Volkswillens entzündet hatten, waren nicht in der Lage, es am Brennen zu halten. Die Fackel verlosch in einem Sumpf aus Eitelkeit, Eigensinn und Kleinkrämerei. Bei der abschließenden Versammlung, bei der sich die führenden Köpfe der Opposition heißredeten, wurde lediglich beschlossen, das jeder auf eigene Faust handeln solle. Man war sich einig, dass man sich nicht einigen konnte. Die Behörden hielten sich nicht lange damit auf, sich darüber zu amüsieren, sondern handelten. Alle Forderungen, die man so kühn in den Hambacher Sommer gerufen hatte, kamen als ein hohnlachendes Echo zurück: Die Repressalien wurden verstärkt, Oppositionelle umso gnadenloser verfolgt, die Zensurschrauben noch enger angezogen. Denn natürlich sah die Obrigkeit in diesem Fest keinen Aufbruch in eine strahlende Zukunft, sondern den Untergang jeglicher Ordnung. Anarchie und Bürgerkrieg würde ihrer Meinung nach dieser Hambacher Skandal nach sich ziehen.
Tatsächlich berichtete die Presse in den umliegenden Kleinstaaten ausführlich über das Hambacher Fest, was die Menschen in den angrenzenden Gebieten zu Aufständen ermutigte. Pressefreiheit, Meinungsfreiheit mussten herrschen, wollte man der Obrigkeit die fatalen Missstände aufzeigen. Wie sonst sollte Abhilfe geschaffen werden, wenn man immer nur über den Hunger und das Elend der Menschen schwieg? Doch die Hoffnungen auf Freiheit und ein besseres Leben gingen unter im Kugelhagel der Soldaten.
Heinrich Heine, der selbstverständlich auch auf der schwarzen Liste stand, die von den Behörden geführt wurde, schrieb nur wenig später:
»Während den Tagen des Hambacher Festes hätte mit einiger Aussicht guten Erfolges die allgemeine Umwälzung in Deutschland versucht werden können. Jene Hambacher Tage waren der letzte Termin, den die Göttin der Freiheit uns gewährte.«
Aber die Menschen ließen nicht locker: Am 3. April 1833 stürmten die Frankfurter die Konstablerwache, in der Hoffnung, dadurch eine Revolution in allen Ländern des Deutschen Bundes auszulösen, doch auch sie scheiterten. Allerdings machten sie mit ihrer Aktion den Herrschenden nur allzu bewusst, wie brandgefährlich die Stimmung unter den Menschen war. Um die Friedhofsruhe weiter zu gewährleisten, versammelte Fürst Metternich seine Mitstreiter 1834 in Wien zu einer Ministerialkonferenz, bei der ganz im Geheimen alle Zugeständnisse, die man bisher gewährt haben mochte, wieder rückgängig gemacht wurden: Die Abgeordneten in den örtlichen Parlamenten, die ohnehin kaum gegen ihre Provinzfürsten ankamen, wurden weiter in ihren Rechten beschnitten, durften nicht einmal mehr beim Haushalt mitbestimmen, sondern nur noch zuschauen, wie ihre Fürsten immer mehr Geld für Prunk und Militär ausgaben, anstatt dem hungernden Volk die Steuerlast zu erleichtern. Das Militär sollte nur noch auf den Monarchen vereidigt werden, nicht einmal mehr auf eine Verfassung – und sei sie noch so rückständig. Und natürlich wurden Meinungs- und Pressefreiheit noch weiter eingeschränkt.
Überall waren Spitzel unterwegs. Die Polizei überwachte jeden, der auch nur im Verdacht stand, eigenständig zu denken, und auch diejenigen, die laut auszusprechen wagten, dass man die Arbeiter mit ihren Familien nicht verhungern lassen könne. Dass man den Kindern, die sich schon mit fünf Jahren ihre Knochen in den Fabriken kaputtschufteten, doch wenigstens abends ein wenig Schulunterricht gönnen solle. Dass man die Kinder nicht zwölf Stunden am Tag und an sechs Tagen in der Woche für Löhne arbeiten lassen sollte, die nicht ausreichten, um sie satt zu machen. Dass man den Webern faire Preise zahlen, den Klöpplerinnen im Erzgebirge wenigstens so viel geben sollte, dass sie sich und ihre Kinder vor dem Hungertod bewahren könnten.
Wer dies aussprach, wurde hart verfolgt und bestraft. Doch die Lage in den deutschen Ländern wurde für die Ärmsten der Armen immer prekärer. In den Fabriken standen moderne Maschinen, die in Windeseile schafften, wofür ein Mensch an seiner Werkbank Tage brauchte. Für diese Menschen war der Fortschritt geradezu tödlich. Konnte, durfte das sein, dass der Fortschritt über die Menschen hinwegschritt; sie niederwalzte und zermalmte? War unter diesen Umständen Fortschritt möglich? Musste der technische Fortschritt nicht zwangsläufig einhergehen mit einem neuen Menschenbild, einer neuen Gesellschaftsordnung? Konnte es auf lange Sicht gut gehen, wenn nur ein Teil des Volkes im 19. Jahrhundert angekommen war und der weitaus größere Teil noch lebte wie im Mittelalter? Würde sich die tödliche Seite dieser Entwicklung nicht irgendwann bitterst rächen, zerstörerisch wüten in den Villen und Palästen derer, die im Moment davon profitierten? Konnte man wollen, dass Arbeiter ausschließlich arbeiteten? Sechzehn Stunden am Tag? Ohne Absicherung bei Krankheiten, die bei der schweren Arbeit, die in vielen Fabriken verrichtet wurde, gang und gäbe waren? Konnte man zulassen, dass der Fortschritt abrupt zum Stehen kam vor der ärmlichen Behausung derer, die ihn mit ihrer Hände Arbeit schufen?
Unterdessen war der Tod erneut im Hause Otto eingekehrt. Nach Clementines Tod hatte sich Louise enger an die Mutter angeschlossen, doch eines Tages begann die Mutter, immer heftiger zu husten. Der Husten wurde immer stärker und schüttelte unbarmherzig ihren Leib, der zusehends schwächer wurde. Die Auszehrung oder Schwindsucht war nicht heilbar. Louise war sechzehn Jahre alt, als die Mutter im Oktober 1835 starb. Charlotte war erst 54 Jahre alt.
Der Vater versuchte nun, seinen Töchtern alles zu sein, Vater und Mutter. Vor allem um seine Jüngste machte er sich Sorgen, weil die größte Sorge der Mutter auf ihrem Sterbebett Louise gegolten hatte. Was sollte aus dem verträumten, verwachsenen Mädchen werden, dessen Augen bald intensiv in die Welt schauten, bald sich nach innen zu wenden schienen, wo sie das Gesehene kaum verarbeiten konnten? Louise war dankbar für ihren verständnisvollen Vater, der sie mit allem, was sie tat, gewähren ließ. Er redete ihr nicht drein, wenn sie las, schrieb oder einfach nur still vor sich hin blickte. Enger als jemals schloss sie sich an ihren Vateran, in dem sie einen Vertrauten und einen Verbündeten in ihrer Trauer fand. Doch im Februar 1836 starb er an einem Schlaganfall.
Louise hatte das Gefühl, in eine bodenlose Dunkelheit zu fallen.
Dresden im Frühjahr 1839
Es war ein schöner Frühlingsabend, als Louise und ihre Schwestern mit dem Schiff nach Dresden fuhren. Antonie und Francisca wurden begleitet von ihren Bräutigamen, die sie Tante Therese vorstellen wollten. Nach allen Erzählungen waren die beiden jungen Herren nicht erpicht darauf, aber irgendwann musste es sein.
Das Schiff passierte die letzte Flussbiegung und vor ihnen lag im Schein der Abendsonne die barocke Stadt mit ihren Türmen, der dunklen Kuppel der Frauenkirche. In der Nähe des Schlosses streckte eine Baustelle ihre Kräne in den Himmel.
Immer näher kamen sie, deutlicher hoben sich die Bauten aus dem Abenddunst hervor, bald sahen sie die Anlegestelle, an der schon viele Menschen auf das Schiff warteten.
»Antonie, siehst du schon unsere Tante Therese?«, fragte Louise und beugte sich an der Reling vor.
»Wie könnte ich Tante Therese übersehen? Schau, da drüben steht sie und schwenkt ihren Regenschirm, wahrscheinlich aus lauter Angst, wir könnten sie übersehen, uns in Dresden verlaufen und unter die Räder kommen.«
Bei diesen Worten wechselten Heinrich Burckhardt und Julius Dennhardt vielsagende Blicke. Sie würden sich und ihren beiden Bräuten sicher schöne Tage machen in der Stadt und den Argusaugen der Tante ausweichen.
Francisca und Louise kicherten, als sie die Tante sahen. Ja, die gute Therese Vogel gab sich immer sehr mondän, wenn sie ins beschauliche Meißen kam, und wurde nicht müde zu betonen, wie groß und weltstädtisch Dresden war. Allerdings führte dies dazu, dass sie übermäßig besorgt war, wenn die Meißener Mädchen nach Dresden kamen. Wie eine Glucke hatte sie gut acht auf die drei Schwestern. Louise winkte ihr zu, was noch heftigeres Tantenwinken zur Folge hatte. Die gute Therese Vogel war verwitwet, trug schwarze Kleider mit vielen Rüschen und immer einen Hut mit einem kleinen Schleier. Dadurch war sie zwischen all den frühlingshaft hell gekleideten Menschen gut zu erkennen.
»Gut, dass sie weiß, dass wir sie schon gesehen haben, sonst würde sie womöglich noch auf und ab hüpfen«, vermutete Francisca und nahm ihren Koffer.
»Aber Francisca, den Koffer musst du doch nicht nehmen. Gib ihn mir«, verlangte Heinrich und nahm seiner Braut die Last ab. Francisca lächelte ihn dankbar an, zumal das Gedränge an Bord des Schiffes so kurz vor der Ankunft in Dresden lästig wurde. Julius nahm seiner Braut ebenfalls das Gepäck ab und vergaß auch Louise nicht. So kam die kleine Reisegruppe ans Ufer. Dort standen sie vor der Tante und die beiden Herren sahen sich einem kritischen Blick unterzogen. Ein Militärarzt hätte nicht prüfender dreinschauen können.
»Da habt ihr euch zwei schöne, stattliche Männer ausgesucht«, waren die ersten Worte der Tante, noch bevor sie ihre Nichten begrüßt hatte. Die beiden Herren gaben der Tante die Hand und verneigten sich kurz, indem sie sich vorstellten.
»Burckhardt und Dennhardt. Und schöne Namen haben sie obendrein. Guten Tag, meine Lieben alle. Es muss eine angenehme Fahrt gewesen sein, von Meißen hierher, bei dem Wetter.«
Die drei Schwestern begrüßten ihre Tante mit einer Umarmung.
»Aber nun lasst uns erst einmal zu mir nach Hause gehen. Ihr seid sicher alle müde von der Reise, nicht wahr?« Louise musste neben der Tante gehen, die beiden Paare folgten.
»Was wird dort gebaut, Tante?«, fragte Louise, als sie die Baustelle passierten, deren Kräne sie schon vom Schiff aus gesehen hatten.
»Gottfried Semper baut dort ein Hoftheater. In zwei Jahren soll es fertig sein. So lange musst du dich noch gedulden, Louise.«
»Du musst mich unbedingt wieder einladen, wenn es fertig ist. Ich will alles sehen, was dort gespielt wird.«
»Am liebsten würdest du dort wohl selbst spielen? Tante Malchen hat mir erzählt, dass du den halben Schiller auswendig kannst.«
»Sie kann den ganzen Schiller auswendig, Tante«, rief Antonie belustigt. »Was Louise tut, das tut sie richtig gründlich.«
»Tatsächlich, bist du ein solcher Bücherwurm? Hier in Dresden gibt es so viel Unterhaltung, da wirst du nicht zum Lesen kommen, Louise.«
Louise schwieg dazu. Die Schwestern hatten schon angedeutet, dass sie sie in die Gesellschaft einführen wollten, wie es so schön hieß. Allein dieser Gedanke machte Louise Herzrasen. So viele ihrer Schulkameradinnen brannten darauf, endlich auf Bälle zu gehen, sich zu zeigen, nur zu dem einen Zweck, dass man sich einen möglichst reichen Bräutigam angelte. Louise schauderte. So sehr sie sich auch bemühte, sich streckte und aufrecht hielt, man sah ihr an, dass sie nicht gerade gewachsen war. Tanzen war für sie eine unendliche Qual, denn ihr Bein konnte niemals mithalten mit der Musik. Wer sollte sich also auf einem Ball für sie interessieren? Und sie hasste es, aus Mitleid aufgefordert zu werden.
Ihre Schwestern hatten beide Glück gehabt: Heinrich und Julius waren freundliche, fürsorgliche Männer, deren Liebe erwidert wurde. Die beiden beteiligten sich sogar an dem literarischen Zirkel namens »Bienenkorb«, den die Otto-Schwestern ins Leben gerufen hatten und der von ihrem Mieter Dr. Wilhelm Milberg geleitet wurde. Louise musste zugeben, dass die beiden Herren durchaus Brauchbares zu den Gesprächen beisteuerten. Aber waren solche Männer nicht die Ausnahme?
Noch während Louise ihren Gedanken nachhing, waren sie an der Wohnung der Tante angekommen. Sie lag im fünften Stock eines großartigen Hauses.
»Ach, wenn doch nur die Treppen nicht wären!«, stöhnte die Tante. »Aber um nichts in der Welt wollte ich auf die Aussicht verzichten.«
Von der rüschigen Garderobe der Tante auf eine plüschige Wohnungseinrichtung zu schließen, war durchaus berechtigt, aber tatsächlich war der Blick aus dem Wohnzimmerfenster grandios.
»Schauen Sie sich das an, meine Herren! Canaletto hätte es nicht schöner malen können, nicht wahr?«
»Die Blümchengardinen hätte Canaletto weggelassen«, dachte Julius, pflichtete der Tante aber höflich bei.
Die drei Schwestern hatten sich für einen Moment zurückgezogen. Die Tante vermutete, dass sie die Koffer auspackten. Dies taten sie tatsächlich. Allerdings nur, um ihre guten Kleider für die Stadt hervorzuholen und sich gegenseitig frisch zu frisieren. Louise beteiligte sich daran eher lustlos.
Unterdessen hatten die Herren mit der Tante im Wohnzimmer Platz genommen und ließen sich einen Sherry schmecken. Die Tante wusste, was gut war!
»Da die Mädchen keine Eltern mehr haben, bei denen Sie um ihre Hände anhalten müssten, haben Sie das wohl ganz unter sich ausgemacht, nicht wahr? Im letzten Jahr wurde endlich diese dumme Vormundschaft aufgehoben, so dass die beiden Ihnen selbst sagen konnten, ob Sie ihnen recht sind oder nicht. Aber trotzdem würde ich von Ihnen gerne erfahren, wen ich als meine angeheirateten Neffen hier in meinem Haus begrüße.«
Julius räusperte sich und schaute Heinrich an. Dieser gab ihm zu verstehen, dass er ihm den Vortritt ließ, und so begann Julius zu berichten: »Mein Name ist Julius Dennhardt, ich bin 33 Jahre alt und von Beruf Jurist. Antonie und ich werden in Oederan im Erzgebirge wohnen. Dort habe ich eine Stelle als Gerichtsdirektor in Aussicht.«
»In Aussicht?«, fragte die Tante eine Spur zu schrill und ließ ihr Sherryglas, das sie eben an ihre Lippen setzen wollte, wieder sinken. Beinahe hätte sie nach ihrem Lorgnon gegriffen, wenn Julius nicht eilig nachgelegt hätte: »Es ist schon alles unter Dach und Fach, Gnädigste. Der Vertrag ist unterschrieben, ich muss nur hinfahren und anfangen.«
»Und wann soll die Hochzeit sein?«
»Im November werden wir in Meißen im Dom heiraten. Solange arbeite ich noch als Jurist in Meißen. Aber in Oederan habe ich uns schon ein Haus gekauft und mit dem Nötigsten eingerichtet. Antonie wird sicher ihre eigenen Vorstellungen haben …«
»Nun, das klingt nicht schlecht. Sie verstehen sicher, dass ich nur das Beste für die Mädchen will, vor allem, da ihre Eltern nicht mehr leben. Und was gefällt Ihnen besonders an Antonie? Die großzügige Mitgift kann es ja schwerlich sein, aber ich will sehen, was ich machen kann.«
Die Frage der Tante ließ Julius verliebt lächeln, wie es sich für einen Bräutigam gehörte.
»Ich liebe einfach alles an ihr. Sie hat einen guten, festen Charakter, ist dazu fröhlich und immer gut gelaunt. Und sie gefällt mir mit ihrem blonden Haar, den blauen Augen …«
»Ja, so ist es recht, Herr Dennhardt. Und sie passt zu Ihnen, denn Sie haben dunkles Haar und dunkle Augen. Sie werden sicher einmal hübsche Kinder haben. – Und nun zu Ihnen, Herr …«
»Burckhardt, Heinrich Burckhardt. Ich bin dreißig Jahre alt und von Beruf Apotheker und Chemiker.«
»Oh, gleich zwei Berufe!«, rief die Tante anerkennend aus. »Und wo werden Sie wohnen?«
»Ich habe eine Apotheke in Mühlberg. Wir werden im nächsten Jahr heiraten und dann nach Mühlberg ziehen.«
»Mühlberg, Mühlberg. Kommt mir irgendwie bekannt vor. War da nicht einmal eine Schlacht?«
»Sehr wohl, Gnädigste. Die Schlacht von Mühlberg, im April 1547.«
»Ha!«, rief die Tante aus und zerstach mit ihrem Zeigefinger die Luft. »Die Schlacht von Mühlberg. Ging nicht gut aus für die Protestanten, aber da hätten Sie ein Vermögen machen können! Denken Sie doch nur an die viele Medizin, die Sie den Verwundeten hätten verkaufen können.«
»Ja, so betrachtet …«, erwiderte Heinrich gedehnt. »Aber die Mühlberger sind auch so genügend krank. Ich werde meine Familie sicher ernähren können.«
»Das freut mich zu hören – ich meine … nicht, dass ich den Mühlbergern Krankheiten wünsche, Sie verstehen … «
Heinrich verstand und schwieg. Er war erleichtert, dass diese Tante nicht ganz so fabelhaft war wie Tante Malchen, die weder ihm noch Julius zutraute, die Schwestern zu ernähren, und immer wieder nachfragte, ob man denn von »sowas« überhaupt leben könne.
»Und natürlich will ich auch von Ihnen wissen, weshalb sie sich in Francisca verliebt haben.«
»Wie ihre Schwester hat sie ein fröhliches Wesen. Und sie ist klug. Ich bin sicher, dass sie mir eine große Hilfe sein wird in der Apotheke. Und ihre braunen Locken, die bei jedem Schritt ein wenig mitwippen, haben es mir gleich angetan. Wir beide tanzen sehr gerne und bei einem Tanz haben wir uns kennengelernt. Und wir verstehen uns oft ganz ohne Worte. Als wir uns zum ersten Mal begegneten, da fühlten wir uns, als würden wir uns schon lange kennen …« Er wurde ein wenig rot und schwieg verlegen. Die Tante sah es mit Freude. Zu oft hatte sie schon Bräutigame erlebt, die nur eine Mitgift suchten, um ihr durch Verschwendung ruiniertes Geschäft wiederzubeleben. Diese beiden waren offensichtlich in ihre Bräute verliebt.
»Ja, Antonie und Francisca sind beide fröhliche Wesen, die in die Welt passen«, dachte die Tante. Aber Louise? Die Sorgen der Mutter auf ihrem Totenbett waren nur allzu verständlich gewesen. Wie sollte es mit Louise weitergehen, die immer so still und in sich gekehrt war? Sie konnte nur hoffen, dass die Kleine hier in Dresden ein wenig auftaute. Sicher würde sie Geschmack finden an Bällen und feinen Kleidern. Welches junge Mädchen hatte keine Freude daran?
In diesem Moment betraten Antonie und Francisca den Raum in schicken Kleidern und passenden Hüten. Hinter den beiden lugte Louise etwas skeptisch ins Zimmer.
»Wohin wollt ihr denn?«, fragte Tante Therese mit einiger Überraschung. »Seid ihr denn nicht müde von der Reise? Außerdem ist es schon so spät.«
»Wir wollen essen gehen und dann tanzen«, sagte Antonie und drehte sich, um ihren weiten Rock zum Schwingen zu bringen. »Du musst dir keine Sorgen machen, Tantchen. Wir haben unsere starken Beschützer dabei, die auf uns aufpassen.« Sie zwinkerte ihrem Julius zu. Die beiden Bräutigame hatten sich erhoben, um sich von der Tante zu verabschieden.
»Aber bringen Sie mir die Mädchen wohlbehalten wieder nach Hause! Ach, und eh ich es vergesse: Die beiden Herren können leider nicht in meiner Wohnung übernachten. Für Sie habe ich Zimmer reserviert in einem hübschen kleinen Gasthof, direkt um die Ecke. – Und nun habt viel Freude!«
Louise seufzte. Sie war müde und wollte, sie wäre schon wieder zu Hause.
Stunden später lag sie endlich in ihrem Bett. Sie war so übermüdet, dass sie nicht einschlafen konnte. An den gleichmäßigen Atemzügen der Schwestern hörte sie, dass die beiden längst träumten – wahrscheinlich von dem Ball, der Musik und ihren Bräutigamen. Für sie selbst war das alles eine einzige Tortur gewesen: der überfüllte Saal, die laute Musik, die Menschen, die alle durcheinanderredeten, sodass sie keiner Unterhaltung folgen konnte. Die Mühe, sich ständig krampfhaft gerade zu halten, damit man nicht auf den ersten Blick ihren Buckel bemerkte …
Natürlich verstand sie sich mit ihren Schwestern und war glücklich, dass sie viele ihrer Interessen teilten. Antonie und Francisca interessierten sich auch für Literatur, hörten genau wie Louise immer gerne zu, wenn während der Hausarbeit vorgelesen wurde. Und natürlich lasen sie selbst gerne. Sie nahmen Anteil am Tagesgeschehen, hatten sich gefreut, dass die Vormundschaft endlich aufgehoben war, nur um sich im nächsten Jahr in die Vormundschaft der Ehe zu begeben. In der Zeitung lasen sie zwischen den Zeilen – wohin die Zensur nicht schaute – von Missständen in Sachsen. Sie sahen ebenso die armseligen Schatten, die in den Straßen unterwegs waren, aber das alles schien sie nicht so tief zu treffen, wie es Louise traf. Woran lag das, dass sie so viel unbeschwerter durchs Leben gingen, fragte sich Louise oft. Würde sie ebenso werden, wenn sie im Alter der Schwestern war? Aber nein. Sie konnte sich noch gut daran erinnern, dass sie dieses Anderssein schon lange spürte, auch als die Schwestern noch wesentlich jünger gewesen waren – in einem Alter, das sie selbst schon überschritten hatte.
Würde sie jemals einen Mann treffen, den sie lieben könnte?
Louise sehnte sich nach einem Theaterabend und hoffte auf Caroline von Bonniot, die Freundin ihrer Mutter. Ihr hatte sie von ihrem Kommen geschrieben und angefragt, ob ein Theaterbesuch möglich sei. In der Hoffnung auf einen Abend, an dem sie wirklich Spaß hatte, schlief Louise endlich ein.
Beim Frühstück wurde besprochen, auf welchen Ball die beiden Paare abends gehen wollten. Sehr zum Missfallen der beiden Bräutigame war es für die Tante eine Selbstverständlichkeit, die jungen Leute zu begleiten. Die Tante bot Louise zwinkernd an, auf dem nächsten Ball ihre Beziehungen zu guten Familien spielen zu lassen, doch Louise lehnte dankend ab.
Erleichtert hörte sie Caroline von Bonniots Läuten und warf sich ihren Mantel um.
»Bis später, liebe Tante!«, rief sie noch und war schon aus der Tür. Die Tante hörte ihre fröhlichen Sprünge die Treppen hinunter.
»Lass sie nur, Tante Therese. Sie soll ihre Freude haben. Und das ist nun mal das Theater und nicht der Ballsaal.«
Unterdessen begrüßten sich Louise und Caroline herzlich.
»Na? Hat Tante Therese dir noch immer keinen Ehemann besorgt?«
»Dieser Kelch möge an mir vorübergehen«, grummelte Louise. Dann atmete sie einmal tief durch. In der Gegenwart Carolines fühlte sie sich deutlich wohler. Auch Caroline von Bonniot war verwitwet, aber dies schien die einzige Gemeinsamkeit zwischen ihr und Tante Therese zu sein. Caroline kleidete sich in eine schlichte, klare Eleganz, die Louise sehr bewunderte. Louise trug wie immer ein himmelblaues Kleid, darüber einen Mantel aus brauner Wolle. Handschuhe und ein kleiner Hut vervollständigten die Garderobe.
»Komm, jetzt gehen wir erst einmal durch die Stadt. Du willst sicher die Frauenkirche sehen.«
»Und ob! Denn unsere Frauenkirche in Meißen ist da wohl kein Vergleich«, rief Louise glücklich und hakte sich bei Caroline unter.
Im Café Français in der Waisenhausstraße stärkten sie sich für den Abend.
»Heiße Schokolade ist besonders hier eine Köstlichkeit. Du musst sie unbedingt probieren. Und dazu die Haustorte. Einfach himmlisch.«
Der Kellner brachte das Bestellte und die beiden, hungrig von ihrer Stadttour, aßen mit Appetit.
»Und? Ist es sehr schlimm mit Tante Therese?«, fragte Caroline, nachdem sie sich den Mund mit der Serviette abgewischt hatte.
Louise machte dicke Backen und ließ langsam die Luft entweichen.
»Nächstes Jahr werde ich einundzwanzig Jahre alt. Dann bin ich mündig. Dann darf ich über mich selbst bestimmen. Dann kann ich selbst entscheiden, was ich mit meinen Mieteinnahmen mache, mit wem ich mich wann und wo treffe, was ich lese. Gut, ich glaube nicht, dass Julius und Heinrich meinen Schwestern allzu viele Vorschriften aufbürden werden, aber es ist doch ein anderes Gefühl, wenn man wirklich auch vor dem Gesetz frei ist und nicht wie ein Kind einen Vormund braucht. Nachdem unsere Eltern gestorben waren, mussten wir einen Vormund haben. Nicht einmal Tante Malchen zählte. Eine gestandene Frau von über fünfzig Jahren! Ich muss zugeben, ganz so gestanden ist die Tante nicht. Sie hat sich gut eingerichtet in ihrer Unmündigkeit und fand es gar nicht wichtig, dass sie im letzten Jahr auch mündig wurde. ›Was soll mir das bringen?‹ hat sie gefragt. ›An meinem Leben ändert sich doch nichts.‹ Sie denkt tatsächlich so.«
Caroline stellte ihre Tasse mit einem Seufzer ab. »Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich gejubelt habe. Das allererste, was ich tat, war, den Vormund, den mein eigener Mann für mich bestimmt hatte, zum Teufel zu jagen. Glücklicherweise hat er nicht das ganze Vermögen verschleudert und einen guten Teil konnte ich vor Gericht zurückklagen. Ich fürchte, wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns. Weißt du, wenn Frauen selbst so denken wie deine Tante Malchen, wenn sie ihre eigene Unterlegenheit und Unmündigkeit bequem finden, dann wird sich niemals etwas ändern.«
»Es fängt schon damit an, dass man uns Mädchen aus der Schule hinauswirft, sobald wir konfirmiert sind. Ich habe mir von meinen Eltern zu Weihnachten gewünscht, ein Jahr später konfirmiert zu werden, damit ich ein Jahr länger in die Schule gehen konnte. Es ist doch eine Schande, dass man in einem Alter, in dem man so wissbegierig ist, zurückgeworfen wird auf Handarbeiten, Malen und ein bisschen Klavierspielen. Aber meinen Konfirmationsspruch, den hab ich mir zu Herzen genommen. ›Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des ewigen Lebens geben.‹ In diesem Moment lag das Leben vor mir wie ein großer, weiter Kampfplatz, und ich betete darum, dass der Kampf kommen möge, damit ich mich in ihm bewähre. Ein Kampf für eine bessere Welt. Für diesen Kampf muss auch eine Mädchenhand das Schwert aufnehmen.«
Louise hatte so enthusiastisch gesprochen, als wolle sie sich tatsächlich jeden Moment einem wilden Kampf stellen. Andere hätten in diesem Spruch vielleicht nur ein treues Festhalten am christlichen Glauben gesehen, für das man die Krone des ewigen Lebens erhielt. Für die wenigsten Konfirmandinnen wäre dies ein dramatischer Aufruf gewesen und würde sie nicht davon abhalten, ein allgemeines Leben mit Ehe, Kindern, Haus und Hund zu führen. Bei Louise war das so ganz anders: Bei diesen Worten lag ein schmerzlicher Zug um ihre Lippen, ihre Augen bekamen eine Tiefe, als blickten sie in eine finstere Schwere, viel zu schwer für so junge Augen. Caroline legte liebevoll ihre Hand auf Louises Arm. Jetzt erst verstand sie, wie verzweifelt Louise um ihren Bruder, ihre große Schwester, ihre Eltern trauerte. In so jungen Jahren hatte sie Verluste hinnehmen müssen, die gestandene Menschen kaum verkrafteten.
In ihrem Kindesalter, mit zweieinhalb Jahren, hatte sie ihr wenige Jahre älteres Brüderchen Heinrich verloren. Caroline erinnerte sich noch sehr genau, dass ihre Freundin voller Sorge berichtet hatte, wie sehr Louise ihren Bruder vermisste und lange nicht aufhörte, nach ihm zu fragen.
Diese Verluste waren schon schlimm genug gewesen. Nach Heinrichs Tod hatte sich Clementine rührend um Louise gekümmert. Clementine war ihr so viel mehr als eine große Schwester gewesen: eine Seelenverwandte, eine Trösterin, die sich Zeit für die außergewöhnliche Schwester nahm; die ihr zuhörte, sie umarmte. Dazu hatte die Mutter durch all die viele Arbeit wenig Zeit gehabt. Nach Clementines Tod hatte sich Louise inniger an die Mutter angeschlossen, als diese ging, blieb ihr der Vater als letzte Zuflucht der Sicherheit. Doch er folgte seiner Frau nur ein halbes Jahr später ins Grab. Wie musste es einem Kind, einem jungen Mädchen gehen, das nach und nach die Menschen verlor, auf die es sich verlassen wollte? Ihr ganzer Halt schien die Literatur, die Kunst zu sein. Aber konnte das genügen?
Caroline lächelte ihrer jungen Freundin warm zu. Sie wusste, dass sie kein Ersatz für Bruder, Schwester und Eltern war, aber sie wollte Louise so viel wie möglich mitgeben, auf sie aufpassen und behüten. »Schreibst du noch? Deine Mutter hatte mir erzählt, dass du ein so schönes Gedicht gemacht hast, als der Mitregent Meißen besucht hat.«
»Ja, ich schreibe noch, aber nur für die Schublade«, erwiderte Louise leise.
»Du zeigst deine Werke niemandem?« Caroline war überrascht, denn ihre Freundin hatte ihr berichtet, dass Louise viel und oft geschrieben habe.
»Wenn Clementine noch lebte, könnte ich mit ihr meine Gedichte sicher teilen.«
Caroline sah, wie sich ein Schatten über Louises Gesicht ausbreitete.
»Komm, Louise«, sagte sie sanft. »Ich habe noch eine Überraschung für dich. Ich bin sicher, es wird dir gefallen. Es ist mir eine große Ehre, meine kämpferische Jungfrau ins Theater zu geleiten. Dort wirst du deine Schwester im Geiste treffen.«
Wenig später saßen sie auf dem ersten Rang des Staatstheaters in der ersten Reihe. Caroline von Bonniot verfügte glücklicherweise über das Geld, sich solcher Annehmlichkeiten zu versichern. Louise liebte die Atmosphäre, die so kurz vor einer Vorstellung im Theaterraum herrschte. Diese aufgeregte Vorfreude, das Stimmengewirr und Wogen feiner Kleider …
Caroline zwinkerte Louise zu. Sie war froh, der Tochter ihrer verstorbenen Freundin eine solche Freude machen zu können und sie ein wenig unter ihre Fittiche zu nehmen. Sie konnte verstehen, dass Charlotte Otto sich besonders große Sorgen um ihre Jüngste gemacht hatte, aber da war etwas Besonderes an Louise, das sie noch niemals bei anderen jungen Mädchen beobachtet hatte. Ja, Louise war still und in sich gekehrt, aber Caroline sah ihr an, dass sie die vielen Eindrücke, die jeden Tag auf sie einstürmten, sehr gründlich verarbeitete. Anblicke, die von anderen weggewischt und sofort wieder vergessen waren, nisteten sich bei Louise ein, beschäftigten und quälten sie sicher oft genug. Das alles formte sich in ihrem wachen Geist aber offensichtlich zu einem Kampfplatz, auf dem sie bestehen wollte. Vorhin, als sie von ihrer Konfirmation erzählt hatte, da hatte ihr Blick – trotz oder gerade wegen ihrer enthusiastischen Rede? – eine zielgerichtete Klarheit bekommen. Louise wusste genau, was sie wollte.
Nun wurde es dunkel im Zuschauerraum. Der Vorhang hob sich und gab den Blick frei auf eine französische Landschaft. Louises Blick flog über die Bühne und fand befriedigt alles, was Schiller angeordnet hatte: eine ländliche Gegend, vorn zur Rechten ein Heiligenbild in einer Kapelle, zur Linken eine hohe Eiche. Thibaut d’Arc stand dort mit seinen drei Töchtern und deren Bräutigamen. Die beiden ältesten waren sehr glücklich, bald zu heiraten, nur die jüngste, Jeanette, sträubte sich. Der Vater sparte nicht mit Tadel, worauf Raimond, Jeanettes Bräutigam, Partei für seine widerspenstige Braut ergriff.
Ab und zu beobachtete Caroline ihre junge Freundin aus den Augenwinkeln. Wie begeistert hatte sie ihre Augen auf Johanna geheftet, als diese tatsächlich den Helm aufsetzte und zu dem Schwert griff. Und sie konnte das Stück tatsächlich auswendig. Ihre Lippen bewegten sich lautlos murmelnd, auf ihrem Gesicht lag Johannas Anspannung, ihr glühendes Verlangen, Frankreich zu befreien.
Wie glücklich strahlte sie, als Johanna nach der siegreichen Schlacht vor dem Dauphin stand, wie konnte sie bei den Worten Agnes Sorels verärgert mit den Augen rollen, als diese der Jungfrau anbot, sie in weiblicher Verschwiegenheit zu beraten, welchen der edlen Ritter sie heiraten wollte. Tief verfinsterte sich Louises Stirn, als der Erzbischof Johanna mahnte, dass das Weib zur liebenden Gefährtin des Mannes geboren sei.
In der kommenden Pause lud Caroline zu einem Glas Sekt ein. Während sie sich zuprosteten und ihre Blicke durch das prachtvolle Foyer des Theaters schweifen ließen, sagte Louise: »Ich muss mich nicht über Tante Therese wundern, wenn die Leute nicht einmal eine Jungfrau von Orléans mit ihrem Heiratsblödsinn in Ruhe lassen können.«
»Allein für diesen Satz muss ich dich herzlich lieben, Louise.« Und leise fügte sie hinzu: »Und Clementine hätte dich ebenso dafür geliebt.«
Louise lächelte wehmütig und schaute in ihr Glas. »Ich vermisse sie noch immer. Es gibt so vieles, das ich gerne mit ihr teilen, ihr sagen würde. Manchmal rede ich einfach so mit ihr, als sei sie noch da. Ich passe aber auf, dass niemand in der Nähe ist«, schob sie schnell nach, sich nach zufällig Mithörenden umdrehend.
»Weißt du Louise, ich bin sicher, sie wacht über dich als dein Schutzengel, dein guter Geist.«
»Es ist nicht nur, dass ich meine Freiheit behalten möchte. Die Verluste der Menschen, die ich so sehr geliebt habe, haben mich immer zutiefst erschüttert. Wenn ein Mann käme, den ich so sehr lieben könnte, bei dem ich wüsste, dass er mich so sein lässt wie ich bin, der mich schreiben lässt; wenn es einen solchen Mann gäbe, hätte ich immer noch Angst, mich an ihn zu binden. Ich fürchte, ich könnte einen solchen Verlust nicht noch einmal verkraften. Ich könnte es einfach nicht.«Die letzten Worte hatte sie kaum hörbar geflüstert.
Liebevoll fragte Caroline nun, ob Louise einen guten Freundeskreis in Meißen hatte, und sah glücklich, wie sich Louises Gesicht bei dieser Frage aufhellte. »Oh, ja! Ich habe viele Freundinnen und Freunde. Nicht nur in Meißen, sondern auch sehr liebe Verwandte in Leipzig, die ich gerne besuche. Nicht alle meine Freundinnen teilen meine Meinungen und Neigungen, aber mit den meisten kann ich mich über das unterhalten, was mich bewegt. Unser kleiner literarischer Zirkel, der ›Bienenkorb‹, ist immer eine schöne Abwechslung und ich stehe in Briefkontakt mit vielen Freundinnen, die nach der Schule aus Meißen fortgezogen sind.«
»Es freut mich sehr, dass du so viele Freundinnen und Bekannte hast.« Und leise fügte sie hinzu: »Auch wenn sie dir nicht die Menschen ersetzen können, die du schon verloren hast in deinem jungen Leben.«
»Gerade deswegen will ich dankbar sein für die, die ich habe. Man wird so unsicher und fragt sich manchmal, wie lange man eine gute Freundin, an die man sich eng anschließt, noch hat.«
Verrat brachte die Jungfrau in die Hände der Engländer. Gefesselt musste sie von den Zinnen aus mit ansehen, wie sich das Kriegsglück von den Franzosen abwandte. Als ein wichtiger Heerführer verwundet weggeführt wurde, riss die Jungfrau verzweifelt an ihren Ketten und schrie: »Und ich bin nichts als ein gefesselt Weib!« Caroline sah, wie sich Louises Hände in ihrem Schoß zu Fäusten ballten. Sie verstand ihre verstorbene Freundin nur zu gut. Louise wollte kämpfen, aber legte diese Zeit nicht allen Frauen Fesseln an? Louise war klug und hatte ein gutes Herz. Mit ihrem jugendlichen Elan wollte sie die Welt verändern, aber wann würde sie selbst einmal schreien »Und ich bin nichts als ein gefesselt Weib!«
Auf dem Heimweg wollte Louise durch eine der Gassen gehen, durch die sie auch ihr Hinweg geführt hatte, aber Caroline hielt sie zurück.
»Nein, Louise. Um diese Zeit wollen wir einen anderen Weg nehmen.«
»Wieso denn das? Schau, dort sind noch mehr Frauen unterwegs.«
Caroline atmete tief ein. »Das sind …«, begann sie langsam, »Frauen, die …« Konnte sie Louise wirklich diese Abgründe zumuten?, dachte Caroline. Ja, Louise musste es wissen. Es konnte nicht angehen, solche Dinge vor ihr zu verbergen. Leise fuhr sie fort: »Es sind Frauen, die sich selbst, ihren Körper verkaufen.«
Louise stand schreckensstarr. Sie hatte vage davon reden gehört, aber solchen Worten keinen Glauben geschenkt. Konnte eine Frau wirklich für Geld das Intimste mit einem Wildfremden teilen? Ihr Herz raste, wie in einem Bann starrte sie in die Straße, wo sich gerade ein Mann einer Frau näherte. Die beiden wechselten nur wenige Worte, dann stieß sich die Frau, die an der Hauswand gelehnt hatte, ab und folgte dem Mann. Louise schluchzte leise auf. Wie grauenhaft! Es war eine Sache, von solchen Ungeheuerlichkeiten zu hören und zu ahnen, dass es solche Frauen auch in Meißen gab. Aber hier in der Dunkelheit zu stehen und Zeugin eines solchen Grauens zu sein, das traf Louise wie ein Schlag. Caroline legte ihren Arm um Louises zitternde Schultern.
»Es sind die Ärmsten der Armen, Louise. Sie haben keine andere Wahl. Viele von ihnen haben Kinder zu Hause, die sie nur auf diese Weise vor dem Hungertod bewahren können. Sie tun es nicht aus Lust, sondern aus reiner Not. Wir können sie nicht verurteilen.«
Louise schwieg, aber Caroline sah, wie Louise wieder ihre Fäuste ballte. Nach einem tiefen Atemzug sagte Louise: »Du hast recht. Diese Frauen sind nicht zu verurteilen. Aber umso mehr die Umstände, die sie zu diesem Handeln zwingen. Wie kann eine Regierung zulassen, dass Frauen keine andere Wahl bleibt? Es muss einen Weg geben, diesen Frauen zu helfen. Ich meine nicht nur ein paar einzelnen, sondern allen. Niemand sollte gezwungen sein, sich selbst zu verkaufen. Oh Gott, ich bin so unendlich dankbar, dass ich diesem Schicksal nicht ausgeliefert bin. Alles könnte ich tun, alles, aber das …«
»Komm, Louise. Ich bringe dich nach Hause«, sagte Caroline sanft und zog sie mit sich fort. Bis sie am Haus der Tante angelangt waren, hatte sich Louise wieder so weit beruhigt, dass sie nicht mehr weinte.
Caroline schellte. »Erzähl Tante Therese besser nichts davon. Nicht, dass ich dich nicht mehr ausführen darf. Und morgen habe ich eine ganz besondere Überraschung für dich. Noch besser als Schillers Jungfrau.«
»Was denn?«, fragte Louise und schniefte ein letztes Mal.
»Wenn ich es dir jetzt schon erzähle, dann ist es keine Überraschung mehr. Aber ich verrate dir, dass du mit Sicherheit begeistert sein wirst.«
Da hörten sie die Schritte des Hausmädchens auf der Treppe, das ihnen die Tür öffnete.
»Gute Nacht, Louise.« Sie küsste sie auf beide Wangen, umarmte sie noch einmal herzlich. Louise schaute ihr kurz nach, hörte ihre klaren, festen Schritte auf dem Pflaster, dann ging sie ins Haus.
Der nächste Tag brachte tatsächlich eine sensationelle Überraschung: Louise stand zum ersten Mal in ihrem Leben an einem Bahnsteig. Um sie herum drängten sich die Menschen, die alle dieses Wunder bestaunen wollten. Eine Eisenbahn! Caroline hatte Mühe, ihren Schützling in der Menge nicht zu verlieren. Die Eisenbahn wurde jeden Moment erwartet. Louise wusste nicht, wie sie sich eine Eisenbahn vorstellen sollte. In der Zeitung hatte sie zwar schon ein Bild von einem Zug gesehen, aber wie war das in Wirklichkeit? Wie groß war eine Lokomotive? Ach, sie verwünschte wieder einmal ihre geringe Größe, die ihr nicht erlaubte, über die Menschen hinweg zu schauen. Sie sah nur direkt um sich die Rücken von Mänteln und Ärmel. Wenn sie den Blick hob, sah sie ausladende Hüte, deren Besitzerinnen sich gegenseitig zur Vorsicht mahnten, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass der Hut sehr teuer gewesen sei. Du liebe Güte! Musste man sich jetzt wirklich um Hüte streiten? Hatten diese Damen nichts anderes im Sinn, jetzt, wo jeden Moment der Fortschritt hier ankommen würde?
Zwei Herren waren äußerst skeptisch. Louise und Caroline tauschten belustigte Blicke: Der eine der Herren, der nicht müde wurde, seine Fähigkeiten als Arzt herauszustreichen, behauptete ganz fachmännisch, dass der menschliche Körper die Geschwindigkeit der Eisenbahn überhaupt nicht aushalten könne.
»Aber es sind doch schon Leute damit gefahren. Und außerdem steht ganz vorne der Lokführer«, entgegnete sein Gegenüber. Der Lokführer müsse dann wohl ein ziemlich grober Kerl sein; aber Damen könne man diese Strapaze auf keinen Fall zumuten. Louise wünschte sich nichts sehnlicher, als sich dieser Strapaze auszusetzen! Sie konnte nicht anders, sie musste sich nach vorn drängen, hin zum Rande des Bahnsteiges. Caroline mochte rufen und winken, wie sie wollte.
»He, he, junges Fräulein, nicht so stürmisch!«, rief ein Mann und fasste sie am Arm, denn beinahe wäre sie dem Abgrund zu nahe gekommen. Sie schaute hinunter in das Gleisbett, wo zwei eiserne Stränge nebeneinander lagen. »Schienen« wurden sie genannt. Wenn der Zug auf diesen Schienen kam, musste er sehr groß sein. Louise neigte sich vor; die Schienen verliefen sich in der Ebene, immer weiter und weiter, bis zum Horizont. Wohin mochten diese neuen Bahnen führen? Louise fühlte ihr Herz klopfen. Diese Bahnen waren viel mehr als nur eine eiserne Straße, auf der gleich ein Wagen vorbeifahren würde. Sie wiesen in eine Zukunft, die unabdingbar kommen würde. Eine Zukunft, in der alle Menschen am Fortschritt teilhaben würden. Ehern war dieser Weg vorherbestimmt, nicht eine Handbreit würde man ihn verändern können.
Plötzlich ging eine Bewegung durch die Menschenmenge, denn von ferne hörte man fauchenden Lärm. Alles drängte, reckte sich und rief aufgeregt durcheinander. »Der Zug kommt! Der Zug!« Und tatsächlich: Auf den Schienen rollte ein schwarzes Ungetüm heran, so riesig, dass Louise kaum glauben konnte, dass man einen solchen Riesen aus Eisen überhaupt bewegen könne. Zitternd vor Aufregung stand sie ganz am Rande des Bahnsteigs. Sie hörte nicht die Rufe der Menschen um sich, sah nicht ihre entsetzten Gesichter, hörte nicht mehr den Arzt, der nun ganz laut vor einer Fahrt mit dieser Höllenmaschine warnte. Sie sah nur die glänzend schwarze Lokomotive, ihre riesigen Räder, die durch Eisenstangen miteinander verbunden waren. Sie schaute hinauf, wo aus einem Fenster ein verrußtes Gesicht grüßte. Der Lokführer schwenkte seine Mütze. Oh, wie glücklich musste dieser Mensch sein! Er ließ seine Lok wie zur Begrüßung pfeifen. Der scharfe Ton hallte wider zwischen den Bergen, die die Elbauen säumten. Der Rauch der Lok hüllte die Menschenmenge ein, gab sie wieder frei, nur um sie gleich wieder in seinem dichten Nebel zu verwirren.
Und Louise, die sich sonst vor Menschenmengen und Lärm so sehr scheute, war glücklich wie lange nicht. Sie durfte Zeugin dieses Fortschrittes sein. Diese Eisenbahn war weit mehr als nur ein Gefährt, das die Kutsche ablöste, um Menschen und Dinge von einem Ort zum nächsten zu bringen. Es war der Beginn einer neuen Zeit. Umbruch, Aufbruch zu Neuem. Das war die Verheißung, die Louise im schrillen Pfeifen der Lokomotive hörte.
Januar 1840, auf dem Weg von Meißennach Oederan im Erzgebirge
Antonie hatte im vergangenen November Julius Dennhardt geheiratet. Auch wenn Tante Therese überzeugt war, dass Antonie mit Julius eine glückliche Ehe führen würde, hatte Louise ihre sehr eigene Meinung. Still hatte sie ihre Schwester in deren Brauttagen angeschaut. War das wirklich reine Liebe, offene, unvoreingenommene Herzlichkeit, die aus Antonies Lächeln sprach? War da nicht eine leise Furcht? Louise wollte ihre Schwester nicht direkt fragen, denn sicher wäre sie ärgerlich geworden. Natürlich freute sie sich auf die Ehe mit Julius. Aber waren das wirklich Gründe, die Louise nachvollziehen konnte? Sie hatte vielmehr das Gefühl, dass Antonie heiratete, um dem engen Leben mit Tante Malchen zu entkommen, einen eigenen Wirkungskreis zu haben an der Seite eines Mannes, von dem sie sich geliebt fühlte. Julius war ein geachteter Mann. An seiner Seite wurde Antonie ganz von selbst zur geachteten Frau. Die in Gedanken gestellte Frage, ob sie selbst so leben könnte, beantwortete Louise mit einem entschiedenen Nein! Stiller war es geworden, seit Antonie fort war. Das Weihnachtsfest hatte Louise nur mit Francisca und Tante Malchen gefeiert. Wie sollte das erst werden, wenn Francisca im nächsten Jahr auch noch ging?
Unter diesen Gedanken rumpelte Louise in der Postkutsche dem Erzgebirge entgegen. Bekannte aus Meißen waren ebenfalls den Weg bis nach Freiberg gefahren und hatten Louise dort einen Begleitschutz vermittelt, damit sie nicht allein reisen musste. Die Luft in der Kutsche war stickig, trotz der Kälte draußen, denn die Menschen drängten sich eng aneinander. Louise war froh, einen Platz am Fenster zu haben, sodass sie dann und wann die beschlagenen Scheiben mit ihrem Zeigefinger abwischen konnte, um ein wenig klare Sicht zu haben auf die schneebedeckte Landschaft. Hier und dort kündeten winzige Lichtpunkte von menschlichen Behausungen. Waren ein paar Lichtpunkte dichter beisammen, waren es wohl Dörfer. Gedankenverloren schaute sie in die Nacht, doch dann tauchte etwas aus der Finsternis auf, das ihre Aufmerksamkeit fesselte: Große, außergewöhnlich helle Lichter hoben sich hoch hinauf bis weit über den Erdboden, beglänzten die schneebedeckten Weiten, die sie umgaben. Louise hatte solches noch niemals gesehen und starrte fasziniert diese viereckigen Lichter an, die ganz gleichmäßig nebeneinander angeordnet waren. Sie kniff die Augen zusammen und erkannte Fenster. Ja! Es waren große Fenster, in denen Bewegung war. Feenpaläste! Das war ihr erster Gedanke. Sie schaute sich in der Kutsche um. Die meisten ihrer Mitreisenden schliefen. Aber eine freundlich aussehende, ältere Dame war wach. Louise nahm all ihren Mut zusammen und fragte: »Was ist das?«
Die Dame neigte sich vor, um aus dem Fenster zu schauen. Auch sie kniff die Augen zusammen, legte ihren Kopf schief und sagte im erzgebirgischen Dialekt: »Das ist die Baumwollspinnerei von Oberschöna.«
»Danke!«, flüsterte Louise und wandte sich wieder dem Fenster zu. Eine Baumwollspinnerei. Eine Fabrik. Julius hatte erzählt, dass es in Oederan viele Fabriken gibt. Die einzige große Fabrik, die Louise kannte, war die Meißener Porzellanmanufaktur, wo gebildete Herren in gesicherter Stellung arbeiteten. So ungefähr stellte Louise es sich vor. Sie war gespannt, ob sie eine Fabrik auch einmal besichtigen könnte. Zu verlockend war ein Besuch in einem solchen Feenpalast.
Louise musste für eine Weile eingenickt sein, denn sie schreckte auf, als der Kutscher laut »Oederan!« rief. Die Kutsche hielt mit einem Ruck, der Verschlag wurde aufgerissen, unbarmherzig schoss die Winterluft herein. Spätestens jetzt waren alle wach, streckten und erhoben sich, soweit es die Enge zuließ, und griffen nach ihren Gepäckstücken. Louises Reisebegleiter nahm ihren Koffer und reichte ihr die Hand, um ihr aus der Kutsche zu helfen. Erst als er sah, dass Louise von ihren Verwandten in Empfang genommen wurde, verabschiedete er sich nach Louises freundlichem Dank mit einem Nicken.
»Wie schön, dass du endlich da bist«, rief Antonie glücklich und umarmte ihre Schwester. »Julius konnte nicht kommen, er muss noch arbeiten. Deshalb habe ich Herrn Kropp, unseren Hausdiener, gebeten, mich zu begleiten. Louise begrüßte Herrn Kropp und gab ihm ihren Koffer. Auf dem Heimweg sprudelte Antonie los, wie schön es in Oederan, wie fabelhaft die Wohnung sei und wie gut man sie schon überall in der Gesellschaft aufgenommen habe. Louise hörte nur mit einem Ohr zu, schaute sich um und hatte bald wieder einen dieser Feenpaläste erspäht.
»Ist das dort auch eine Baumwollspinnerei?«, unterbrach sie den Redefluss ihrer Schwester.
»Das? Ach nein, das ist eine Weberei. Einige Leute, die in unserem Haus wohnen, arbeiten dort.« Die Menschen mussten wohl gutes Geld in der Fabrik verdienen, wenn sie sich eine Wohnung in demselben Haus leisten konnten wie ihr Schwager.
Doch Louise wurde bald eines Besseren belehrt. Zunächst musste sie erkennen, dass die von Antonie so hoch gelobte Wohnung weit weniger komfortabel war, als sie sich das vorgestellt hatte. Das Wohnzimmer, in dem sie so warm und gemütlich beieinander gesessen und ihr Wiedersehen gefeiert hatten, war mit Abstand das beste Zimmer. Der Raum, in dem Louise schlief, konnte nicht beheizt werden, wodurch Louise ihren ganz eigenen Feenpalast hatte: Als sie mit der Kerze in ihr Schlafzimmer ging, glitzerte es von allen vier Wänden und dem Fenster. Eisblumen wuchsen nicht nur auf den Scheiben, sondern hatten auch die Wände mit ihren kalten Ranken überwuchert. Louise hatte sich noch niemals so schnell für die Nacht umgezogen. Sie sah ihren Atem gefrieren, als sie die Kerze ausblies, dann zog sie die Decke bis zur Nasenspitze und versuchte vergeblich zu schlafen.
Die Kälte war so unbarmherzig, dass sie einfach nicht einschlafen konnte. Erst weit nach Mitternacht, als sie sich ein wenig warmgebibbert hatte, fiel sie in einen unruhigen Schlaf, aus dem sie viel zu früh wieder erwachte, denn sie hörte Schritte auf der Treppe. Müde, schlurfende Schritte. Von Männern, Frauen, Kindern, die hinaus in den Wintermorgen mussten. Es schlug vier Uhr. So früh? Wer um alles in der Welt konnte um diese Uhrzeit denn aus dem Haus müssen?
»Das sind Arbeiter. Sie wohnen in winzigen Zimmern unterm Dach. Oft teilt sich eine ganze Familie ein einziges Bett«, antwortete Antonie, als Louise am Frühstückstisch saß und ihre Hände um eine Tasse heiße Schokolade legte. »Sag nur, du hast gefroren? Du siehst ganz blass aus.« Louise konnte nur nicken, während sie die Schultern noch weiter nach oben zog. Antonie häufte sich Mus auf ihr dick mit Butter bestrichenes Brot und verteilte es mit dem Messer.
»Wieso hast du denn nichts gesagt, Louise? Wir hätten dir doch eine Wärmflasche machen können«, sagte Julius, indem er die Zeitung, hinter der er sich verschanzt hatte, zur Hälfte herunterklappte.
»Es war schon so spät und ich wollte euch keine Umstände machen. Aber wieso stehen die Leute so früh auf? Müssen sie so früh anfangen?« fragte sie, um das Thema zu wechseln.
»Sie fangen nicht so früh an, aber sie haben weite Wege vor sich«, erklärte Julius. Er legte die Zeitung beiseite, rückte seinen Stuhl näher an den Tisch, um endlich auch mit seinem Frühstück zu beginnen. Die Morgenzeitung war für ihn die Vorspeise, wie er zu sagen pflegte. »Manche von ihnen laufen stundenlang durch die Kälte, bevor sie an ihrem Arbeitsplatz sind.«
»Die Kinder auch?«
Julius nickte, ohne seine Schwägerin anzuschauen. Er ahnte, wie seine zartbesaitete Schwägerin das auffassen würde.
»Und in der Nähe der Fabriken sind keine bezahlbaren Wohnungen zu finden?«
»Das, was dort als Wohnung angeboten wird, ist oft eines Menschen nicht würdig. Hier in Oederan, in diesem Haus wohnen sie auch nicht gerade gemütlich, aber sie haben ein Dach über dem Kopf, durch das es nicht regnet, der Hausverwalter ist ein freundlicher Mensch und die Mieten sind moderat. Dafür nehmen die Menschen den weiten Weg in Kauf. Zumindest haben wir auch hier in Oederan eine Weberei. Die Leute, die hier wohnen und dort arbeiten können, schätzen sich glücklich.«
»Und die Kinder, mein Gott, die Kinder …« Louise war den Tränen nahe, sodass Julius seine Hand auf ihre legte. »Sie gehen folglich nicht zur Schule, sondern müssen auch schon arbeiten?« Louise konnte nur noch flüstern, als würde das laute Aussprechen dieser Zustände die Kinder verletzen.
»Wenn du die Fabrikbesitzer fragst, schicken sie alle die Kinder in die Schule. Aber das ist keine Schule, wie du sie aus deiner Kinderzeit kennst. Einmal in der Woche kommt ein abgedankter Offizier in die Fabrik, der mehr mit dem Rohrstock hantiert als mit der Kreide an der Tafel«, antwortet Julius, worauf Antonie ihm einen tadelnden Blick zuwarf. So viel Realismus wollte sie ihrer kleinen Schwester am frühen Morgen noch nicht zumuten.
Antonie hatte innegehalten und schaute Louise besorgt an. »Bist du sicher, dass du eine Fabrik von innen sehen willst, wie du gestern Abend noch gesagt hast?«
Louise straffte sich und sagte mit fester Stimme: »Es gibt Dinge, vor denen darf man nicht die Augen verschließen. Man darf sich nicht abwenden, sondern man muss hinschauen und es aushalten. Das ist unsere Pflicht.«
Mit emporgezogenen Augenbrauen widmete sich Antonie wieder ihrem Musbrot und zog es vor, Louise nicht zu antworten.
Nachdem Julius in sein Amt gegangen war, hüllten sich Antonie und Louise in warme Mäntel und Schleierhüte, um in die Stadt zu gehen.
»Ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Und hier in Oederan gibt es Fabriken, Fabrikanten und Arbeiter genug«, versprach Antonie, indem sie sich ihren Schal fest um den Hals zog und ihre Pelzhandschuhe überstreifte.
»Oh, Antonie, bitte sprich nicht so. Ich will die Menschen ja nicht bestaunen wie Kuriositäten in einem zoologischen Garten. Ich will nur … wissen, was wirklich vorgeht, was man nicht in den Zeitungen lesen kann, weil kein Redakteur es schreiben darf. Verstehst du mich ein wenig?«
»Ich denke schon«, erwiderte Antonie etwas geistesabwesend, während sie ihren Einkaufszettel prüfte. »Komm, wir sollten nicht trödeln.«
Mit klopfendem Herzen folgte Louise ihrer Schwester.
Draußen empfing sie ein schneidender Wind, der ihnen Schnee in die Gesichter blies. Louise fasste ihre kleine Handtasche fester und hakte sich bei ihrer Schwester unter.
»Wenn die Tage langen, kommt der Winter gegangen. So sagt doch immer Tante Malchen, nicht wahr?«, erinnerte sich Antonie mit einem Lachen.
»Tante Malchen und ihre Sprüche … Ich glaube, ich kann hundert Jahre alt werden, und sie wird immer noch einen neuen Spruch anbringen«, entgegnete Louise weit weniger belustigt. Antonie hatte gut lachen: Sie war hier in Oederan, weit weg von den Launen und düsteren Prophezeiungen der Tante.
»Guten Morgen, Frau Gerichtsdirektor!« So wurde Antonie immer wieder von Herrschaften begrüßt. Kein Zweifel! Man kannte und achtete sie schon nach so kurzer Zeit hier in dem kleinen Ort, was Antonies Stimmung weiter hob.
Antonie machte verschiedene Besorgungen in Geschäften, in denen Louise sich meist nur umschaute. Nur in einem außergewöhnlich gut sortierten Nähgeschäft erstand sie ein paar Kleinigkeiten, die in Meißen nicht zu haben waren: besonders schöne Knöpfe, Bänder und ganz feine Nadeln für eine Perlenstickerei.
»Sei nicht so schüchtern. Ich lade dich ein«, flüsterte Antonie ihr zu und bestand darauf, dass Louise ihren Einkauf zu ihrem legte, damit sie alles zusammen bezahlte. Beim Schneider und der Hutmacherin verbrachten sie viel Zeit, sodass sie bald eine kleine Stärkung brauchten.
»Und jetzt lad ich dich ins Café ein. Du wirst sehen, wir haben hier in Oederan ein sehr hübsches, wie man es wohl eher in Dresden vermuten würde.«
Nach wenigen Schritten hatten sie das Café erreicht, das Louise überaus gut gefiel. Es war sehr fein und gemütlich, Kristallleuchter glitzerten von der Decke und verbannten den fahlen Wintertag nach draußen. Die Kuchentheke war himmlisch, es duftete nach Kaffee und heißer Schokolade. Kurz: Es war ein Paradies.
Es gab mehrere Kaminöfen, in deren Nähe die Tische gut besetzt waren. »Schau, wir haben Glück. Dort wird eben eine Ofenbank frei«, sagte Antonie und bahnte sich einen Weg durch den Saal. Bei dem freien Tisch angekommen, schaute sie Louise an, als habe sie gerade ein Schiff gekapert. Die beiden legten ihre Mäntel und Hüte ab und setzten sich. Bald hatten sie Tee und Kuchen vor sich stehen. Antonie genoss all diese Annehmlichkeiten sichtlich. Auch hier hatte man sie ehrerbietig begrüßt und ausnehmend freundlich bedient. Die Herren am Nebentisch hatten ihr höflich zugenickt und nahmen ihr Gespräch wieder auf.
Während Antonie ihren Kuchen aß, war Louise sehr still geworden, denn ihr Blick war hinaus auf die Straße geschweift, wo das Schneetreiben zugenommen hatte. Dort draußen ging ein in Lumpen gekleideter Mann. Seine Jacke war zu dünn und löchrig, um ihn vor der Kälte zu schützen, seine Hosen hatten große Löcher an den Knien, an den Füßen trug er nicht mehr als Filzpantoffeln und auf seinem Kopf eine schäbige Mütze. Noch während Louise sich fragte, was diesem armen Mann wohl passiert war, dass er offensichtlich keine Arbeit hatte, merkte sie, dass auch die beiden Herren am Nebentisch auf den Mann aufmerksam geworden waren.
»Da läuft er ja, der Taugenichts«, sagte einer und machte eine verächtliche Bewegung mit seinem Kinn hin zu dem Mann.
»Ist das dieser Karl Schott, den du vor drei Wochen entlassen musstest?«
»Eben der«, bestätigte der erste. Louise rechnete nach. Vor drei Wochen – das war kurz vor Weihnachten. Wie grausam, einem Menschen eine solche Weihnacht zu bescheren!
»Hat nicht ordentlich gearbeitet, sondern nur noch gepfuscht. Ich musste ihm den Lohn halbieren. Und stell dir vor! Das hat er nicht eingesehen. Kam doch tatsächlich in mein Büro. In MEIN BÜRO! Hat mir vorgejammert von seinen kranken Kindern, die ihm so große Sorgen machen, dass er sich bei der Arbeit nicht konzentrieren könne. Er forderte nicht nur seinen vollen Lohn, sondern wollte sogar mehr haben. Hat behauptet, sein Lohn reiche nur für das Essen und die Miete. Wenn er mehr Geld habe, um den Arzt zu bezahlen, dann könne er sich auch wieder besser auf die Arbeit konzentrieren und würde gute Arbeit abliefern.«
Der andere blies verächtlich die Luft durch die Zähne.
»Ich hab ihn fristlos entlassen. Was für eine Unverschämtheit! Ob ich etwa schuld sei an der Krankheit seiner Kinder, hab ich ihn gefragt. Da zuckte er doch tatsächlich mit den Schultern und wies mich darauf hin, dass seine beiden Kinder in meiner Fabrik verunglückt seien. Sein Mädchen sei gestürzt und eine Lore sei ihr über die Hand gefahren. Was kann ich dafür, dass die dumme Trine nicht aufpasst, wohin sie ihre dreckigen Füße stellt? Und der Junge hat Husten. Schott behauptet, das käme von dem Staub in meiner Fabrik. Da ist mir der Kragen geplatzt. Meine Wachmänner haben ihn hinausgeprügelt.«
Er rührte in seiner Tasse und trank, setzte sie aber mit angeekelter Miene wieder ab. »Ach, es gibt doch nichts Schlimmeres als eine lauwarme Schokolade.«
Louise wurde übel.
»Was ist denn los? Du bist ja ganz blass und zitterst. Schmeckt dir der Kuchen nicht? Ist er am Ende verdorben?«, fragte Antonie, indem sie mit empörtem Blick nach dem Kellner schaute. Louise fürchtete schon, Antonie wolle sich tatsächlich beschweren, und gebot ihr leise Einhalt. Dann dämpfte sie ihre Stimme zu einem Flüstern und neigte sich zu ihrer Schwester: »Hast du das eben nicht gehört, worüber die beiden Herren am Nebentisch geredet haben?« Sie hätte gar nicht lauter sprechen können, so sehr drückten die Tränen in ihrem Hals.
»Nein, wieso?« Antonie strich mit ihrer Gabel die letzten Kuchenkrümel zusammen, besann sich dann eines Besseren und aß sie nicht. Ein zu sauberer Teller könnte aussehen, als könne man sich einen solchen Kuchen nur mit Mühe leisten. Sie lehnte sich zurück und blickte sich befriedigt um.
»Sie haben über den armen Mann dort draußen gesprochen.« Louise zeigte aus dem Fenster, der Mann war schon verschwunden.
»Meinst du den Mann in dem braunen Wollmantel? Der sieht gar nicht arm aus.«
»Nein, der Mann, den ich meine, hatte nur Lumpen an.«
Louise schwieg. Antonie sah ihre kleine Schwester besorgt an. Und nun hörte sie selbst, was am Nebentisch weiter gesprochen wurde. Es waren zwei Fabrikherren, die sich über ihre Arbeiter ausließen. Antonie kannte solche Gespräche zur Genüge. Wie faul und dumm die Arbeiter allesamt seien, wie unverschämt in ihren Forderungen nach mehr Lohn. Wie täppisch sich die Kinder oft anstellten, wie die Mütter zu keifenden Furien wurden, wenn ihren Kindern Leid geschah durch Maschinen.
»Ich hab keinen Hunger mehr«, flüsterte Louise.
»Du kannst die Leute nicht alle retten, indem du jetzt auf deinen Kuchen verzichtest. Iss auf, damit wir gehen können.« Sie winkte bereits dem Kellner, um zu bezahlen.
»Antonie, ich kann nicht«, flehte Louise.
»Die Rechnung bitte.«
Louise nahm all ihren Mut zusammen und bat den Kellner, das Stück Kuchen für sie einzupacken. Es sei ihr im Moment zu viel und sie wolle es später essen. Antonie rollte mit den Augen, sagte dann aber: »Ja, seien Sie so gut und packen Sie uns das Stück Kuchen ein.«
»Sehr wohl, Frau Gerichtsdirektor.« Der Kellner nahm Louises Teller und verschwand mit einer Verbeugung.
»Clementine hätte mich verstanden«, dachte Louise, als sie ihrer Schwester nach draußen folgte.
Am Abend desselben Tages saßen sie wieder in dem behaglichen Wohnzimmer zusammen. Julius hatte einen guten Tag gehabt, alles war zu seiner Zufriedenheit vonstattengegangen; ein Fall, der ihm zunächst Kopfzerbrechen bereitet hatte, war geklärt worden. Er war richtig aufgeräumt und holte zum Nachtisch sogar eine Spätlese aus seinen Weinvorräten. Wie goldenes Öl floss der Wein in die Kristallgläser. Mit ausdruckslosem Gesicht nahm Louise das Glas und nippte daran. Es schmeckte köstlich.
»Louise, was ist los mit dir? Hattet ihr keinen schönen Tag? Muss ich etwa deine Schwester tadeln, dass sie keine gute Gastgeberin ist und dich nicht gut unterhält?« Er zwinkerte seiner Frau zu, die ihren Ärger kaum verbergen konnte. »Es liegt sicher nicht an mir. Es liegt eher an den Umständen hier.« Und beim Anblick der hochgezogenen Brauen ihres Gatten fuhr sie fort: »Ich musste mit ihr noch Brot kaufen gehen. Aber erzähl doch selbst, Louise.«
Louise schaute die beiden an und begann dann leise zu erzählen: »Ja, wir haben Brot gekauft – ich habe aber darauf bestanden, dass ich es selbst bezahle. Ich habe auf die Menschen gewartet, die ich morgens so früh die Treppen herunterkommen höre. Ihnen habe ich das Brot gegeben.« Sie verstummte für eine Weile, in der sie sichtlich mit sich rang. Ihre Augen hefteten sich auf das Kristallglas vor ihr, und als erlebe sie das alles noch einmal, erzählte sie mit dumpfer Stimme: »Wie armselig diese Menschen aussehen. Wie tief ihre Augen in den Höhlen liegen. Selbst die Kinder sehen schon ganz abgehärmt aus. Das sind keine Kinder. Sie gleichen eher unheimlichen Kobolden als lebendigen Menschenkindern. Es ist nichts Helles, Fröhliches an ihnen, wie es sich für Kinder gehört. Was soll aus ihnen werden, wenn sie schon in diesem jungen Alter nichts als Mühsal und Elend kennen? Sie schienen nicht einmal zu verstehen, dass ich ihnen etwas Gutes tun wollte. Sie haben es gar nicht verstanden, weil sie es offensichtlich noch niemals erlebt haben, dass ihnen jemand etwas schenkt. Wie mag dort wohl eine Weihnachtsbescherung aussehen? Die Mutter der Kinder hat sich sehr bedankt. Sie hatte sogar Tränen in den Augen. Dann kam ein alter Mann. Aber ich kann gar nicht sagen, ob er wirklich schon alt war oder nur so aussah. Ich hielt ihm das Brot hin. Als er es nahm, sah ich, dass seiner Hand zwei Finger fehlten. Ich wagte nicht zu fragen, wie das passiert sei. Nach dem Gespräch der beiden Fabrikherren, die wir heute früh im Café belauscht hatten, kann ich mir denken, dass ihm eine Maschine die Finger abgerissen hat. Er schaute mich stumm an. Mit so brennenden Augen, dass ich nur meinen Blick senken konnte. Sein Gesicht sehe ich noch immer vor mir. Namenlose Verzweiflung sprach daraus, tiefste Resignation, Müdigkeit und Hunger. Wie können wir denn hier beim Wein sitzen, wenn die Menschen dort oben nichts haben? Nichts!« Sie brach in Tränen aus. Antonie und Julius wechselten Blicke. Sanft strich Antonie ihrer Schwester übers Haar. »Schau, Louise, wir haben nicht die Macht es zu ändern, so gerne wir es ändern würden.«
»Und diejenigen, die die Macht haben, die wollen nichts daran ändern. – Es ist eine Schande!«, rief Louise aus, indem sie ihre Tränen niederkämpfte. »Aber ich bestehe darauf, dass ihr beiden mir noch mehr von diesem Elend zeigt. Ich muss es sehen. Die einzige Waffe, die ich habe, ist meine Feder. Und ich weiß auch schon, was ich schreiben werde. Es muss ein Roman sein, damit das, was ich sagen will, von möglichst vielen Menschen gelesen wird. Ich weiß selbst, dass ich nicht allen diesen Menschen helfen kann. Ich kann nicht allen Brot kaufen. Aber ich will alles für sie tun, damit ihr Los irgendwann leichter wird. Ich will schreiben. Man muss das alles schreiben, in die Welt hinausschreiben, damit es die Menschen wenigstens vor ihren inneren Augen sehen, wenn sie schon nicht selbst hierher kommen und das Elend anschauen. Fast bin ich wütend auf mich selbst, dass ich so lange von diesen Dingen nichts gewusst habe. Ich habe die Augen verschlossen und gerne den neuen Stoff gekauft, der so schön gleichmäßig gewebt und dabei so günstig ist. Ich kann jetzt immerhin ahnen, wie er hergestellt wird. Alles hat seinen Preis. Auch dieser Stoff hat seinen Preis, nur muss nicht ich ihn bezahlen, sondern er wird von diesen armen Kindern bezahlt. Sie bezahlen mit ihrer Kindheit, die man ihnen raubt. Sie bezahlen mit ihrer Gesundheit, die man ihnen zerstört, und sie bezahlen mit ihrem Geist, den man von Anbeginn an abtötet.«
Julius atmete hörbar ein, als wolle er Louise etwas entgegnen, aber sie kam ihm zuvor: »Ich weiß, ich werde großen Ärger bekommen mit der Zensur. Deshalb will ich meine Kritik an diesen himmelschreienden Zuständen in einen Roman verpacken. Das ist wohl das Harmloseste. Romane werden von vielen Literaten noch immer nicht wirklich ernst genommen. Das könnte ein Vorteil sein.«
»Bist du sicher, dass du etwas schreiben willst, das man nicht ernst nimmt?«, fragte Julius skeptisch.
»Literaten müssen es nicht ernst nehmen, aber die Menschen, die es lesen, die sollen es ernst nehmen. Das ist mir viel wichtiger. Ich will den Menschen die Augen öffnen, sie sollen erfahren, was hier passiert. Es kann nicht angehen, dass die neue Zeit mit all ihrem Fortschritt nur für die Reichen anbricht.«
»Bei all deiner Sympathie für die Arbeiter vergiss nicht, dass diese Leute nicht vergleichbar sind mit unsereinem«, gab Julius sehr vorsichtig zu bedenken.
»Wie meinst du das?«, fragte Louise schärfer, als sie wollte.
»Louise, die wenigsten der Arbeiter sind so still und friedlich wie die Leute, die hier im Haus wohnen. Viele von ihnen vertrinken das bisschen Lohn, das man ihnen gibt, sie prügeln sich und führen schlimme Reden. Einem solchen Menschen wolltest du nicht begegnen. Glaube mir!«
»Sie sind nur so, weil man ihnen niemals die Möglichkeit gegeben hat, anders zu werden. Schon die Kinder werden zu niederer Tierheit herabgedrückt. Die heilige Taufe sollte eigentlich den Teufel austreiben, aber mit den armen Arbeiterkindern ist es umgekehrt. Der Engel, der die Seele des Kindes ins Leben begleitet, wird mit Gewalt aus der reinen Seele des Kindes gejagt. Und in der heißen Hölle, wo die Dampfmaschinen arbeiten, zu denen man die Kinder schickt, da kommen all die Teufel zu ihnen, die alle quälen, die zu ewiger Erniedrigung, zu ewiger Stumpfheit im Leben verdammt sind. Wenn diese Kinder zu Männern geworden sind und als Männer die gleiche stumpfe Arbeit verrichten und fluchen, trinken und rohe Worte haben, dann verachtet man sie. Erst schafft man diese Menschen und dann verachtet man sie. Kann man ihnen wirklich ihre Unbildung, ihre Rohheit vorwerfen? – Bitte, ich muss das alles sehen!«
»Was hältst du von Louises Plänen?«, fragte Julius, als er sich im Schlafzimmer entkleidete. Antonie lag schon im Bett, richtete sich aber noch einmal auf und schaute ihren Ehemann mit gerunzelter Stirn an.
»Louise war schon immer sehr verträumt. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass diese Weltverbesserungsideen so lange bei ihr anhalten. Normalerweise haben sich solche Dinge in ihrem Alter ausgewachsen. Was kann man denn schon tun als einzelner Mensch?«
Julius legte seine Sockenhalter sorgfältig über den Stuhl, streifte sein Nachthemd über und strich sich ein letztes Mal über seinen Schnurrbart, bevor er ins Bett schlüpfte.
»Ich kann sie mitnehmen auf eine kleine Dienstfahrt, die ich in zwei Tagen machen muss. Dann kann sie sich selbst ein Bild machen. Willst du nicht auch mitkommen?« Antonie kuschelte sich in seine ausgebreiteten Arme.
»Ich will nicht, dass sie Ärger bekommt. Sie ist noch immer so naiv und kann sich gar nicht vorstellen, wie schlecht manche Menschen sein können. Es ist sicher am besten, wenn ich mitkomme. Was sie sehen wird, könnte sie sehr verletzen. Dann ist es gut, wenn ich sie ein wenig auffangen kann. – Aber«, fuhr sie fort, indem sie sich enger an ihn schmiegte, »wenn sie erst einmal einen guten Mann hat, wird sie sich hoffentlich auf andere Dinge konzentrieren und sich nicht mehr in Gefahr bringen.«
Julius seufzte. »Ja, ich fürchte, man bringt sich in allen deutschen Ländern in Gefahr, sobald man ein zu wahres Wort zu laut sagt. – Lass uns schlafen.«
In der Kammer nebenan lag Louise noch lange wach. An diesem Abend hatte Antonie ihrer Schwester eine Wärmflasche gemacht, doch Louise fand erst recht keinen Schlaf. Mit welchem Recht lag sie hier in diesem warmen, weichen Bett, während nur wenige Stiegen über ihr Menschen froren, womöglich nicht einmal eine warme Mahlzeit vor dem Schlafengehen bekommen hatten? Wieso hatten so wenige Menschen fast alles und so viele fast nichts? Vor den bevorstehenden Ausflügen fürchtete sie sich und trotzdem wollte sie darauf bestehen, denn sie schämte sich für ihre Dummheit, dies alles nicht gewusst, nicht gesehen zu haben.
Ausflüge
Julius Dennhardt besaß eine eigene Kutsche, mit der er zu seinen auswärtigen Terminen zu fahren pflegte. Da ein scharfer Wind alle Wolken hinweggefegt hatte und an diesem Morgen sich ein blauer Himmel über der glitzernden Landschaft wölbte, lud er die Damen ein, ihn zu begleiten. Wie angenehm war es, ausschließlich mit der Familie zu reisen, mit Menschen, die man kannte und die einem lieb und wert waren, dachte Louise, als sie zur Stadt hinausfuhren. Gemütlich saßen sie beieinander in der geschlossenen Kutsche, die Damen hatten sich eine Decke über die Beine gebreitet und vor allem Antonie freute sich über die Abwechslung, denn sie verließ nur selten die Stadt. Da es bereits acht Uhr war und der Neuschnee zuvor von vielen Kutschrädern, Kufen, Hufen und Füßen festgetrampelt worden war, fuhr die Kutsche gleichmäßig und ruhig dahin. Beinahe hätte Louise über Antonies Plaudereien den Zweck ihrer Fahrt vergessen, denn Antonie berichtete von den Menschen, die sie besuchen würden. Einige von ihnen kannte sie schon und freute sich auf sie.
»Frau Hermsdorf wird dir gefallen. Sie ist eine Seele von Mensch und backt einen ganz vorzüglichen Apfelkuchen.«
»Aber zuerst werden wir in den Genuss ihres Rinderbratens kommen.« Julius machte sich nicht viel aus Süßem und freute sich mehr auf das Mittagessen. »Nach der langen Fahrt werden wir eine ordentliche Stärkung gebrauchen können. Außerdem – wenn wir Pech haben – setzt sie uns später den von Weihnachten übrig gebliebenen Striezel vor«, warf Julius noch ein, was Antonies Laune jedoch nicht dämpfen konnte.
»Das wird sie nicht wagen, dem Herrn Gerichtsdirektor Dennhardt und seiner Gemahlin alten Kuchen vorzusetzen.« Ereiferte sie sich mit verschränkten Armen. Louise lächelte bei Antonies zur Schau gestellter Entrüstung. Offensichtlich gefiel sich Antonie sehr in der Rolle einer Gerichtsdirektorengattin, der alle gefälligst die entsprechende Achtung entgegenzubringen hatten.
Kurz darauf staunte Louise über die festlich gedeckte Tafel, auf der Meißner Porzellan mit Silberleuchtern um die Wette funkelte. Und selbstverständlich prangte bald der von Julius erhoffte Rinderbraten auf dem Tisch.
Frau Hermsdorf wartete, bis sich das Hausmädchen, das alle Gäste mit Klößen, Rotkohl und Soße bedacht hatte, an die Tür zurückzog, dann entspannte sich ihr Gesicht zu einem wohlgefälligen Lächeln: »Es ist so schön, liebe Gäste zu bewirten. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Herrn Gerichtsdirektor begleitet haben, nicht wahr, mein Lieber?«, wandte sie sich an ihren Mann, der sich in einem leisen Gespräch mit Julius befand.
»Aber ja, mein Herz«, erwiderte er, indem er sich über seinen Vollbart strich. »Nun lasst uns beten und dem Herrn danken für die Speisen, die er uns so reichlich geschenkt hat.« Alle falteten die Hände und murmelten das »Amen« mit.
»Guten Appetit, Ihnen allen. Sehen Sie? Unser Hausmädchen musste extra das gute Meissner auflegen, damit sich die Damen richtig heimisch fühlen. Nicht wahr?«
Louise hätte diesen Hinweis auf das Porzellan nicht benötigt, denn sie hatte gleich das Geschirr mit dem Weinlaub erkannt, das sie bisher nur in Auslagen der Geschäfte bewundert hatte und sich niemals leisten könnte.
»Wie gefällt Ihnen unser Erzgebirge, Fräulein Louise?«, fragte Frau Hermsdorf. Louise zuckte ein wenig zusammen, denn gerade bildeten Rinderbraten und Rotkohl eine köstliche, vollkommen ausfüllende Einheit in ihrem Mund. An eine Antwort war in den nächsten Augenblicken nicht zu denken. Sie lächelte freundlich, kaute und nickte. Glücklicherweise genügte dies Frau Hermsdorf; sie bestätigte, wie sehr ihr selbst ihre Heimat gefalle.
»Wie lange werden Sie bleiben?«
»Meine Schwester kann bleiben, so lange sie möchte«, stand ihr Antonie nun bei. »Mindestens drei Wochen.«
»Und was möchten Sie besichtigen? Sie müssen wissen, wir haben hier viele Naturschönheiten und hübsche Städtchen.«
»Ich würde sehr gerne die Fabriken besichtigen«, sagte Louise leise, denn sie fürchtete Frau Hermsdorfs Reaktion.
»Die Fabriken?«, fragte Frau Hermsdorf mit einiger Verwunderung und setzte dabei ihr Weinglas mit etwas zu viel Schwung ab. Ihre Augenbrauen machten keinerlei Anstalten, sich wieder zu senken.
»Bitte, würden Sie mir das erlauben?«, wandte sich Louise an Herrn Hermsdorf.
»Wenn Sie unbedingt die Fabriken sehen möchten, kann ich sie Ihnen gerne zeigen. Aber wieso …?«
»Meine Schwägerin interessiert sich für alles. Seien es Naturwissenschaften, Literatur, Kunst. Da es hier überall Textilfabriken gibt, möchte sie nun auch diese sehen. Es gibt nichts, was sie verschmäht«, sagte Julius mit einem anerkennenden Lächeln.
»Ich kann nur hoffen, dass Sie nicht den Strickstrumpf verschmähen, Fräulein Louise«, mahnte Frau Hermsdorf.
»Aber nein, darum müssen Sie sich nicht sorgen, Frau Hermsdorf. Dafür hat schon immer unsere Mutter gesorgt, dass wir ständig etwas in der Hand haben, während wir lesen«, erklärte Antonie und begann, sich mit Frau Hermsdorf über Muster und die Qualität von Strumpfgarnen auszutauschen.
Louise war froh, dass sich das Gespräch einem anderen Gegenstand zuwandte und sie in Ruhe zu Ende essen konnte.
Während das Hausmädchen abräumte, um Raum zu schaffen für Likör und Gebäck, holten die Damen ihre Strickstrümpfe hervor. Louise wagte nicht, noch einmal auf ihren Wunsch hinzuweisen, doch als die Herren sich erhoben, um draußen Geschäftliches zu besprechen, bedeutete Herr Hermsdorf Louise, ihnen zu folgen. Erleichtert schob sie das Strickzeug wieder in ihre Tasche. Antonie war so sehr vertieft in ihre Handarbeit und ihr Gespräch mit Frau Hermsdorf, dass sie gar nicht merkte, wie die anderen aufbrachen.
Louise folgte den Herren ins Kontor. Es war ein großes Büro, in dem ein halbes Dutzend Männer an Schreibtischen saß. Stoffproben, Wollproben, Garne und dergleichen mehr lagen auf einem Tisch zur Prüfung bereit. Der Duft des Holzofens mischte sich mit der Tinte und der Wolle, die Federkiele kratzen unaufhörlich über das Papier, um in Listen und Tabellen Zahlen einzutragen, die Auskunft über den sich immer weiter mehrenden Reichtum gaben. War Herr Hermsdorf ein solcher Fabrikant wie die beiden Männer, die sie gestern noch im Café belauscht hatte? Aber er war doch so freundlich gegen sie! Würde er auch einen Arbeiter hinausprügeln lassen, wenn dieser nur zu berechtigte Forderungen stellte? Sie konnte es sich nicht vorstellen.
»Hier, Fräulein Louise, ist das Kernstück meiner Firma.« Stolz blickte er sich um. Louise konnte allerdings nur die Stirn runzeln. Papier und Tinte konnten nicht das Kernstück einer Textilfabrik sein! Höflicherweise zeigte sie sich beeindruckt. Nur Julius merkte, dass Louise etwas anderes erwartet hatte. Sie wollte die Maschinen sehen, Fabrikhallen; sie wollte sehen, wie es den Menschen ging, die dort arbeiteten.
»Du kannst sicher sein, Louise, dass es Herrn Hermsdorfs Arbeitern gut geht. Sehr viel besser als den armen Menschen, die du in Oederan gesehen hast«, versicherte ihr Julius leise.
»Ah, eine Menschenfreundin! Sie haben wohl ein sehr weiches Herz, Fräulein Louise, und möchten, dass es allen Menschen gut geht?«, fragte Herr Hermsdorf, indem er sich ein wenig zu ihr hinabneigte.
»Das wäre allerdings begrüßenswert für alle Menschen!«, erwiderte Louise und bemühte sich redlich, nicht zu scharf zu klingen. Mochte Herr Hermsdorf sie für ein harmloses Mädchen mit einem allzu weichen Herzen halten – vielleicht zeigte er ihr dann mehr von seiner Fabrik. Aber das geschah leider nicht. Julius und Herr Hermsdorf hatten ihre Geschäfte beendet, worauf sie sich verabschieden mussten.
»Zum Kaffee sind Sie wieder bei uns eingeladen«, fügte Herr Hermsdorf noch mit einer kleinen Verbeugung hinzu.
»Wohin fahren wir jetzt?«, fragte Louise, als sie mit Julius in die Kutsche stieg. Antonie war bei Frau Hermsdorf geblieben.
»Es ist nicht weit, nur ein paar Augenblicke mit der Kutsche. Der Fabrikant heißt Fechter. Ich fürchte, du wirst ihn sehr viel weniger mögen als Herrn Hermsdorf.«
»Von Herrn Hermsdorfs Fabrik habe ich ja nichts gesehen, was mich gegen ihn einnehmen könnte.«
»Aber ich war schon in seiner Fabrik und kann dir sagen, dass er sehr vorbildlich ist. Er ist einer der wenigen Herren, die den Kindern Unterricht geben lassen.«
»Tatsächlich, die Kinder dürfen in die Schule gehen?«, fragte Louise erstaunt.
»An zwei Tagen in der Woche, kommt nach der Arbeit ein richtiger Lehrer zu ihnen und bringt ihnen das Nötigste bei.« Julius klang sehr anerkennend. Louise war anderer Meinung: »Du meinst, nachdem die Kinder den ganzen Tag gearbeitet haben? Was sollen sie dann noch lernen und behalten können?« Louise war fassungslos. Sie wusste, dass Kinder in den Fabriken arbeiteten und dass man ihnen in der Regel jegliche Schulbildung vorenthielt, aber einen Fabrikherrn, der an zwei Tagen völlig übermüdete Kinder unterrichten ließ, musste man noch lange nicht zur Anbetung freigeben wie einen Heiligen.
»Es ist immerhin etwas«, rang sie sich schließlich ab. Nicht zuletzt, um ihren Schwager nicht gegen sich einzunehmen, denn sie war darauf angewiesen, dass er ihr noch mehr zeigte. Mit banger Vorahnung war sie gespannt auf Herrn Fechter, den Fabrikanten, den Julius jetzt treffen musste.
Sie näherten sich dem nächsten Ort. Schmutzige Hütten, deren Strohdächer unter der Schneelast schier zusammenzubrechen schienen, drängten sich an der Straße. Menschen waren kaum zu sehen; wahrscheinlich arbeiteten jetzt alle in der Fabrik.
Bald hatten sie das Dorf durchquert und standen vor einer Villa, hinter der sich das aus vielen Schornsteinen rauchende Fabrikgelände erstreckte.
Herr Fechter, der sie in seinem Kontor begrüßte, war ein kleiner, runder Mann, dessen Erscheinung nicht darauf schließen ließ, dass er einer der reichsten Fabrikanten der Gegend war. Aus seiner schäbigen Kleidung ragte ein zum Leib passender kleiner, runder Kopf hervor. Seine grauen, stechenden Augen, die unter wild wuchernden Brauen tief im Kopf steckten, schienen überall hinzublicken. Haupthaar war nur in Ansätzen vorhanden, während sein Gesicht von den spärlichen Büscheln eines Backenbartes eingerahmt wurde. Seine Jacke war schon fadenscheinig von vielen Bürstenstrichen, die abgetragenen Hosen schlackerten um dünne Beinchen herum, die in löchrigen Schuhen steckten. Wollte er durch seine Erscheinung zeigen, dass er sich selbst nichts gönnte, und dadurch seinen Arbeitern vermitteln, dass er ihnen noch viel weniger gönnen konnte? Louise empfand unwillkürlich eine herzhafte Abscheu vor diesem Menschen, der ihr wie ein Vortänzer um das Goldene Kalb erschien.
Julius wollte Louise vorstellen, doch Herr Fechter wischte derartige Höflichkeiten weg und begann, über seinen Nachbarn zu schimpfen, einen Grafen, der nicht in der Lage sei, seine Schulden bei ihm zu bezahlen, und der sich wiederholt Aufschub erbeten hatte.
Louise legte keinen Wert darauf, von einem solchen Menschen beachtet zu werden, sondern zog sich in sich selbst zurück, um genau zuzuhören. Herr Fechter breitete einen jahrelangen Streit vor Julius aus und vergaß auch nicht zu betonen, wie viel mehr er es sich leisten könne, auf großem Fuße zu leben als dieser Graf mit seinem alten Wappen und seinem noch älteren Namen. Ein angrenzendes Waldstück, das er als Bürgschaft von dem Grafen für einen Kredit angenommen hatte, wollte er nicht mehr hergeben. Vielmehr wolle er das Land mit weiteren Fabrikhallen bebauen. Der Graf dränge ihn jedoch, die Rückzahlung der Summe um ein paar Tage zu verschieben.
»Ich lass mich doch nicht an der Nase herumführen. Noch dazu von einem Grafen!«, rief er und breitete dabei die Hände aus, als sei ein Graf der letzte Mensch, vor dem ein Herr Fechter Respekt haben müsse. »Kommen Sie mit. Ich will Ihnen zeigen, um welches Gebiet es sich handelt. Es liegt so günstig, als sei es schon mein Eigentum.«
Er führte Julius nach draußen. Louise folgte still. Während Herr Fechter schimpfte – und er schimpfte eifrig – hatte Louise Zeit, sich umzuschauen. Sie blieb ein wenig zurück, als sie zwischen den Fabrikhallen entlang liefen. Selbst durch die geschlossenen Türen und Fenster drang ein ohrenbetäubender Lärm nach draußen. Im Inneren der Hallen musste er höllisch sein. Louise reckte sich ein wenig, um durch eines der Fenster hineinschauen zu können, aber die Scheiben waren zu schmutzig. Vergeblich reckte sie sich und nahm nur Bewegungen hinter den Scheiben wahr. Ob von Maschinen oder Menschen konnte sie nicht einmal sagen. Sie schaute sich um. Julius und Herr Fechter waren nicht mehr zu sehen; vielleicht in einer der Türen verschwunden? Jetzt bekam Louise die Gelegenheit, einen Blick hineinzuwerfen. Wenn man sie ansprach, konnte sie wahrheitsgemäß sagen, dass sie ihren Schwager suchte. Beherzt öffnete sie die Tür und fühlte sich von Lärm umbrandet. Vor Schreck atmete sie tiefer ein und fühlte mit noch größerem Schrecken, wie sehr die staubige Fabrikluft in ihren Lungen schmerzte. Sie sah sich in einer endlos erscheinenden Halle, wo in langen Reihen Maschinen die kostbaren Tuche für Herrn Fechter webten. Wie die Arme riesiger Insekten bewegten sich lange Stangen dicht an dicht. Eiserne Räder wurden heulend angetrieben von breiten Lederbändern, bewegten wiederum andere Räder, Maschinen, die knallend und fauchend jeden klaren Gedanken zertrümmerten, den hier ein Mensch fassen mochte. Zwischen den Maschinen sah sie Männer und Frauen in ärmlichster Kleidung. Kaum waren sie als Menschen zu erkennen, denn in ihren mechanischen Bewegungen glichen sie eher den Maschinen, die sie bedienten. Nur schreiend konnten sie sich verständigen; Louise hörte die groben Anweisungen, die man sich zubrüllte.
Neben einer der Maschinen sah sie einen Mann kauern, der sich schnell ein Stück Brot in den Mund stopfte, mit dem Daumen nachschob und hastig kaute. Dabei schaute er sich gehetzt um, als tue er etwas Verbotenes.
Und da waren sogar Kinder! Hohlwangige, verhärmte Kinder, deren Augen tief in dunklen Höhlen lagen. Höhlen, in denen Unheil schlummerte wie ein Drache. Wehe diesem Land, wenn der Drache nicht gezähmt wurde!
Sie standen auf Hockern, mussten sich recken, um in die Maschinen zu fassen. War das nicht zu gefährlich für die Kinder? Louise hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, da zerriss ein Schrei das Stampfen der Maschinen; ein Schrei, der gar nicht mehr aufhören wollte und in Louises Ohren umso lauter gellte, als man eine der Maschinen anhielt. Nur kurz stand der Schrei noch scharf wie eine Klinge in der Luft, dann riss er ab und ein anderer Schrei hub an. Kräftiger, tiefer und grollend. Louise sah, wie ein Mädchen ohnmächtig zusammensank und von einer der Arbeiterinnen aufgefangen wurde. Louise nahm ihren Mut zusammen und ging hinüber zu der stillstehenden Maschine, von wo sie das Schreien hörte. Sie wusste, dass sie hier rein gar nichts verloren hatte, dass die Arbeiter sofort erkennen mussten, dass sie keine von ihnen war, aber Louise konnte nicht anders. Sie musste schauen, welches Unglück die armen Menschen heimgesucht hatte. Sie drückte sich zwischen den Arbeitern hindurch. Ihr Geruch nach Schweiß und schmutziger Kleidung nahm ihr fast den Atem, aber schließlich konnte sie doch sehen, was passiert war: Auf dem Boden, der von Staub und Schmutz bedeckt war, kniete eine grobknochige Frau, die man auf den ersten Blick für einen Mann hätte halten können. Louise schauderte bei ihrem Anblick, aber noch mehr zitterte sie, als sie sah, dass die Frau ein kleines Mädchen in ihren Armen hielt, aus dessen Ärmel ein blutiger Stumpf hervorlugte. Vor der Frau lag die abgetrennte Hand des Kindes. Ein winziges Körperteil, das eher einer Tierklaue glich, so schmutzig war es. Die Mutter nahm es, und wie irre weinend hielt sie die Hand an den Stumpf, als könne sie ihr Kind so wieder heilen.
Das Mädchen mochte vielleicht fünf Jahre alt sein. Ihr dünnes Kleid war zerrissen, Schuhe trug sie nicht, unter ihrem Kopftuch schauten Zöpfe hervor, dünn wie Rattenschwänze. Aschgrau schien ihr Gesicht, selbst die Lippen waren fahl, nur um die Augen herum lagen finstere Schatten.
Hastig holte Louise ihr Taschentuch hervor, riss sogar den untersten Saum ihres Unterrockes ab, um der Frau sauberes Leinen anbieten zu können. Da war eine andere Frau, die sich ebenfalls zu der Mutter gekniet hatte, Louise für den Stoff dankte und den Stumpf des Kindes verband.
»Sie sind ein gutes Mamsellchen!«, sagte die Alte und nickte Louise freundlich zu, als habe Louise einem fröhlichen Kind ein Bonbon gereicht. Louise fragte sich, wie oft die Menschen hier wohl mit solchen Unfällen fertig werden mussten.
»Die verdammten Maschinen zerreißen unsere Kinder!«, schrie die unglückliche Mutter. »Schande! Sie machen uns und unsere Kinder zu Krüppeln! Der Teufel hat die Maschinen erfunden. Ich sage euch allen, der Teufel!«
»Zum Teufel kannst du dich gleich scheren, Lise, wenn du nicht dein dummes Maul hältst!«, herrschte eine befehlsgewohnte Männerstimme sie an. Die Leute schauten auf. Dort stand der Aufseher. Louise hätte sich am liebsten unsichtbar gemacht, aber der Mann war so zornig, dass er sie ohnehin nicht sah. Mit tief gesenktem Kopf kniete sie noch immer am Boden und wurde Zeugin der widerwärtigsten Grausamkeit, die sie niemals für möglich gehalten hätte:
»Den Ausfall ziehe ich dir vom Lohn ab, Lise. Du hast die Maschine angehalten, bist von deinem Platz weggelaufen.«
»Mein Kind! Mein Kind ist schwer verletzt! Ein Krüppel für alle Zeiten. Sie können von keiner Mutter verlangen, dass sie das ruhig hinnimmt«, schrie die Frau verzweifelt.
»Und du kannst nicht verlangen, dass Herr Fechter es ruhig hinnimmt, dass du seine Maschine anhältst. Und was sehe ich hier!«, schrie er nun noch wütender. »Das Tuch ist verdorben. Voller Blut! Das Stück Tuch werd ich dir auch vom Lohn abziehen.«
»Louise!«, hörte sie im nächsten Moment die Stimme ihres Schwagers und schaute auf. »Was tust du hier? Wir haben dich gesucht!« Julius half ihr auf und legte ihr seinen Arm um die Schultern, denn sie zitterte so heftig, dass er fürchtete, ihre Beine könnten jeden Moment wegknicken.
»Ich … ich habe euch gesucht. Ihr wart plötzlich weg«, stammelte sie, während ihr Blick noch immer an dem Kind haftete. »Julius, bitte, das Kind …!«
Aber Julius führte sie schon nach draußen. Noch im Weggehen hörte Louise Herrn Fechter höhnen: »Was kann ich dafür, dass dein Kind so ungeschickt ist?«
Louise wusste nicht mehr, wie sie in die Kutsche, wie sie nach Hause gekommen war. Noch viel weniger wusste sie, wie sie das Kaffeetrinken mit Apfelkuchen und Zimtsahne bei Hermsdorfs überstanden hatte. Welche Gegensätze! Sie hatten vielleicht eine halbe Stunde in der Kutsche gesessen, um von Herrn Fechter zu Hermsdorfs zu fahren. Aber was ihre Welt von der Welt der Arbeiter trennte, erschien ihr wie unzählige Meilen, sogar Jahrhunderte. Was sie gesehen hatte, zerriss ihre Seele. Die von harter Arbeit, Sorgen und Hunger gezeichneten Gesichter standen ihr noch immer deutlich vor Augen. Der Schrei des Kindes, dann der nicht enden wollende Schrei der Mutter, gellten noch immer in ihren Ohren. Inständig hatte sie Julius gebeten, sich nach der Frau und ihrem Kind zu erkundigen, damit die Kleine versorgt wurde. Aber selbst wenn sie überlebte – was dann? Als Krüppel hatte sie kaum eine Chance, wieder eine Anstellung zu finden. Und wenn Herr Fechter sie doch behalten würde, dann sicher noch für viel weniger Lohn. Es war so unfassbar grausam.
Louise verabschiedete sich früh in ihr Zimmer. Sie brauchte Ruhe, um die Bilder, die sich in ihrem Kopf überschlugen, zu ordnen. Das Chaos in ihrem Kopf tobte und zerfiel langsam zu einer Ordnung, denn Ideen für einen Roman huschten durch ihre Gedanken. So oft hatte sie Gedichte geschrieben, hatte sich von der Natur, ihrer Heimatstadt inspirieren lassen, hatte sich dann und wann auch einem gerüttelt Maß an Weltschmerz ergeben. Wie lächerlich erschien ihr das nun. Jetzt fühlte sie anders. Ihr eigener Körper schmerzte, wenn sie an den Schmerz der armen Menschen dachte, ihr Leid machte ihren Hals eng – und doch brach es einer Wortfülle Bahn. Figuren tauchten vor ihrem inneren Auge auf, bekamen Namen, Charakter, handelten gut oder verwerflich, waren intrigant oder ehrbar. Erste Fetzen von Dialogen schwirrten ihr durch den Kopf und in der eisigen Finsternis entzündete sie ihre Lampe erneut, um Notizen zu machen zu einem Roman, denn es brauchte schon etwas mehr Erzähl-Atem, um viele Menschen zu erreichen. Ja, sie wollte Menschen erreichen. Ihre Leserschaft sollte sich identifizieren mit den Arbeitern. Sie sollten mit ihnen fühlen, leiden und lieben. Ja, eine Liebesgeschichte war immer gut, damit man die Herzen der Menschen erreichte, dachte Louise mit einem Lächeln. Aber würde ihr eine Liebesgeschichte gelingen? Sie hatte noch niemals einen Mann geliebt und konnte sich nicht vorstellen, sich mit einem Mann zu verbinden, wie Antonie und Francisca es getan hatten.
»Liebe!«, dachte sie und schüttelte den Kopf.
Einer sollte unter den Arbeitern sein, an dem sie zeigen konnte, dass die Arbeiter nicht alle roh und verwerflich waren. Ein Mann mit guten Anlagen, der aus einer armen Familie stammte, in der das Geld nur für das Studium des älteren Bruders gereicht hatte? Ein Mann, der Geschichten schrieb, um das Elend der Arbeiter mitzuteilen? Ein schreibender Arbeiter! Das wäre eine unerhörte Neuerung, die allein schon für Furore sorgen konnte, denn kaum jemand vermutete unter den Lumpen eines Arbeiters ein für die Poesie schlagendes Herz. Ein kluger, besonnener Arbeiter, der seine Kameraden zu einem rechtschaffenen Leben anhielt. Und auf der anderen Seite könnte ein freundlicher Fabrikherr stehen? Nein! Lieber die freundliche Tochter eines harten, unbarmherzigen Fabrikherrn, der seine Arbeiter misstrauisch beäugte.
In Louises Kopf überschlugen sich schon jetzt die Gedanken …
Ende Januar 1840
Bald danach brach Louise nach Dresden auf. Ein Freund ihres Schwagers, der ebenfalls in Dresden zu tun hatte, begleitete sie auf ihrer Reise.
Die Erlebnisse in Oederan, bei Hermsdorfs und vor allem Herrn Fechter hatten sich tief in ihre Seele gegraben. Mit ganz anderen Augen sah sie nun die Fabriken an, die ihr zuerst wie Feenpaläste erschienen waren.
Überall lag noch viel Schnee. Offenbar hatte die Tante recht mit ihrem Spruch von den langenden Tagen. Mit einem Seufzer lehnte sich Louise in der Kutsche zurück; sie war froh, noch ein wenig Aufschub in Dresden zu haben, bevor sie wieder nach Hause musste, wo Tante Malchen ihr ständig im Nacken saß. Sie sehnte sich danach, zu schreiben, aber dafür brauchte sie Ruhe. Diese Ruhe hatte sie nur bei schönem Wetter, wenn die Tante ausging. Das konnte noch dauern …
In Dresden wohnte sie diesmal nicht bei Tante Therese, sondern bei Liddy Müller, einer Freundin, die sie lange nicht gesehen hatte. Sie und ihr Vater standen schon an der Poststation und winkten, als Louise ankam. Es war wenig Betrieb an der Station; die Pferde wurden ausgeschirrt und ließen sich willig in den Stall führen. Auf sie warteten volle Futterraufen. Louise dachte bitter an die Menschen in Herrn Fechters Fabrik, auf die am Ende des Tages wohl kaum gefüllte Teller warteten. Der Kutscher reichte das Gepäck vom Dach, das ein Gehilfe geschickt entgegennahm.
»Guten Tag, Fräulein Louise. Wie immer mit einem kleinen Koffer unterwegs?«, sagte Herr Müller, indem er Louise den Koffer abnahm.
»Danke, Herr Müller. Ja, wie immer wenig Gepäck. Da reist es sich leichter. Hallo Liddy! Schön, dich zu sehen.«
Die Frauen umarmten sich herzlich und strahlten einander an, als sie sich wieder losließen.
»Louise, wie lange haben wir uns nicht gesehen! Meine Mutter wird wahrscheinlich sagen: ›Kind! Wie bist du groß geworden!‹ Und dabei die Hände überm Kopf zusammenschlagen.«
»Na, Liddy, jetzt übertreib mal nicht«, sagte Herr Müller mit einem Lächeln. »Kommt, es ist kalt und deine Mutter hat einen warmen Punsch für euch.«
Frau Müller bemerkte tatsächlich, das Louise seit ihrem letzten Treffen gewachsen war. Allerdings schlug sie keineswegs die Hände über dem Kopf zusammen, sondern umarmte Louise herzlich und hieß sie, am Esstisch Platz zu nehmen.
Bald nach dem Essen zogen sich die beiden Freundinnen zurück, denn sie brannten darauf, sich ungestört unterhalten zu können. Louise berichtete von ihren Erlebnissen im Erzgebirge.
»Ich wusste gleich, dass dir etwas auf dem Herzen liegt. Schon, als du aus der Kutsche stiegst.« Liddy verstummte und nahm Louises Hand.
»Man muss doch etwas tun können. Das sind Zustände, die man nicht hinnehmen kann«, flüsterte Louise, denn allein schon diese Gedanken waren ungeheuerlich. Die Zustände ändern! Das war Aufruhr!
»Schreib, Louise! Schreib!«, sagte Liddy eindringlich. »Das ist das Beste, was du tun kannst. Schreibfedern sind mächtige Waffen.«
»Da hast du recht; auch in der Hand von Frauen. Ja, es brennt mir unter den Nägeln.« Und aufgeregt berichtete Louise ihrer Freundin von den Ideen zu ihrem ersten Roman.
»Vielleicht sind die Federn gerade in Frauenhänden mächtig. Uns lässt die Obrigkeit zwar nicht so viel tun wie die Männer, aber uns nehmen sie auch nicht so ernst. Das kann manchmal ein Vorteil sein. Ich denke, ein Roman ist eine gute Idee. Du kannst viel zwischen die Zeilen packen, das dir die Zensur nicht streichen kann. Wir können im Verborgenen handeln. Nach außen ganz harmlos, aber im Inneren ganz effektive Veränderungen vorantreiben.« An Liddys glänzenden Augen sah Louise schon, dass Liddy diese Gedanken nicht zum ersten Mal hatte.
»Was hast du vor?«, fragte sie gespannt.
»Bildung – ist das nicht der Schlüssel? Ich plane eine Pension für Mädchen, wo sie nach der Konfirmation noch weiter lernen können. Und zwar nicht nur Zeichnen, Französisch, Englisch und Musik, damit sie auf dem Parkett Konversation machen können. Nein, sie sollen wissenschaftliche Grundlagen haben in vielen Bereichen. Aber das ist im Moment noch Zukunftsmusik.«
»Wie willst du dir diese Kenntnisse aneignen?«
»Ich würde nicht alleine unterrichten, sondern noch andere Lehrerinnen und Lehrer einstellen. Wer mich jetzt schon unterstützt, ist mein Cousin Gustav. Du wirst ihn morgen kennenlernen, denn wir treffen uns mit ein paar Freundinnen in der hübschen Restauration im Großen Garten.«
Liddys Vater brachte die beiden Freundinnen am nächsten Mittag hinüber in den Großen Garten. Von weitem sahen sie schon die Restauration, in der sie im Sommer unter bunten Lampions gesessen hatten. Jetzt lag das Haus zwischen gleißenden Schneeflächen, beschirmt von schwarzen Bäumen.
Liddys Vater verabschiedete sich, als er die beiden Freundinnen zu dem Tisch gebracht hatte, der schon mit Liddys Freundinnen besetzt war. Die jungen Frauen unterbrachen ihre angeregten Gespräche, um die beiden Neuankömmlinge zu begrüßen.
Louise war noch viel zu sehr gefangen in ihren Oederaner Erlebnissen, als dass sie sich über eine Gesellschaft hätte freuen können. Sie war wie immer still und in sich zurückgezogen und bemühte sich, nicht allzu deutlich merken zu lassen, dass sie sich einfach nur nach Ruhe sehnte. Hier und da war ein kurzes Gespräch entstanden mit Frauen, die ähnlich dachten wie sie. Natürlich waren Liddys Freundinnen nicht die typischen jungen Frauen, die nur über Bälle, Kleider und brauchbares Heiratsmaterial schwatzten. Zu allem Unglück hatte sie sich ein Glas von dem Pflaumentoffelpunsch aufdrängen lassen, der zugegebenermaßen köstlich war, ihr aber sofort in den Kopf schoss. Sie beschränkte sich darauf, die Hände an dem Glas zu wärmen, während sie wie so oft in die Runde aus angeregt redenden Menschen schaute, wie auf ein Karussell, auf das sie nicht aufspringen konnte. War das vielleicht ihr Los als Schriftstellerin, dass sie immer nur zuschaute, um zu beschreiben, aber nicht selbst daran teilnahm?
»Ist hier noch frei?« Die Stimme riss sie aus ihren Gedanken.
»Ja, ja, bitte«, stotterte sie verlegen.
»Ich danke Ihnen. Erlauben Sie mir, dass ich mich vorstelle? Gustav Müller. Ich bin Liddys Cousin«, sagte er mit einer Verbeugung.
Nun kam doch ein wenig Leben in Louise: »Es freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen, Herr Müller. Mein Name ist Louise Otto.« Sie reichten einander die Hände, dann nahm Herr Müller neben Louise Platz.
»Auch der Pflaumentoffelpunsch?«, fragte er mit Blick auf Louises Glas und hob sein eigenes. »Ihr erster?«, wollte er wissen, worauf Louise ein wenig entrüstet war. »Selbstverständlich!«
»Lecker, aber ziemlich gefährlich, nicht wahr?«, lächelte er und nippte. Louise sah in seinem Gesicht ein wenig Ähnlichkeit mit Liddy. Er hatte die gleichen braunen Augen, den vollen Mund, doch seine Nase war sehr schmal und gerade. Sein leicht gewelltes, dunkles Haar trug er kinnlang und strich es manchmal hinter seine Ohren zurück.
»Liddy hat mir erzählt, dass Sie im Erzgebirge waren. Hat Ihnen die Reise gefallen? – Oh, verzeihen Sie! Ihr Gesicht spricht Bände. War es so schlimm?«
Mit einem heftigen Atemzug sagte sie: »Ach bitte, lassen Sie uns davon schweigen. Ich möchte Ihnen damit nicht den Tag verderben.«
»Sie verderben mir ganz sicher nicht den Tag, Fräulein Otto. Aber ich sehe, dass Sie das noch allzu sehr bewegt. Sie können mir gerne davon erzählen, aber nur, wenn es Ihnen gut tut.« Louise schüttelte den Kopf und schaute in ihr Glas.
»Ja, Reisen verändert uns. – Aber jetzt sind Sie ja hier in Dresden. Hier werden Sie bald auf andere Gedanken kommen. – Interessieren Sie sich für Literatur, das Theater?«
Mit dieser Frage hatte er ins Schwarze getroffen. Er sah Louises Gesicht aufleuchten und schon waren sie in einem regen Austausch über die neuesten Autoren. Louise war überrascht, in einem jungen Mann so viel Schwärmerisches zu finden. Ja, er teilte nicht nur ihr Interesse, sondern auch ihre Meinung über Byron, Bulwer und Shakespeare.
Als sie mitten im Hamlet waren und Herr Müller staunte, mit wie viel Geist Louise die Monologe der Ophelia rezitieren konnte, brach man auf. Die beiden hatten nicht bemerkt, dass der Kellner gekommen war, um zu kassieren. Liddy und ein paar andere Frauen wechselten schon belustigte Blicke, da Herr Müller und Louise alles um sich herum vergessen hatten.
Herr Müller wollte Louise einladen, doch sie bestand darauf, selbst zu zahlen. Gemeinsam verließ die kleine Gruppe die Restauration und machte sich in verschiedene Richtungen auf den Heimweg.
Solange sie gesessen hatten, war niemandem ihr Buckel aufgefallen, aber nun, als sie nebeneinander gingen, bemühte sich Louise sehr um eine aufrechte Haltung. Ihr Hinken konnte sie leicht auf die verschneite Straße schieben und hoffte inständig, dass Herr Müller weder ihr Hinken noch die Mühe sah, mit der sie sich kerzengerade hielt.
Gustav Müller blieb an Louises Seite und wieder vertieften sich die beiden so sehr in ihr Gespräch, dass sie kaum sahen, dass die Dämmerung hereinbrach und obendrein dunkle Gewitterwolken aufzogen. Erst als es von ferne grollte, schauten sie auf. Auch Liddy und eine andere Freundin, die ihnen ein paar Schritte vorausgegangen waren, blieben stehen und schauten sich um.
»Gewitter? Um diese Jahreszeit? Ist das nicht seltsam?«
»Haben Sie Angst vor Gewitter?«, fragte Herr Müller besorgt. Das wies Louise empört zurück.
»Aber wollen Sie trotzdem unter meinen Schirm?«
Im nächsten Moment setzte ein so heftiger Regen ein, dass alle vier nur noch unter den nächsten Hauseingang flohen. Gustav Müller stellte sich mit aufgespanntem Schirm vor die Frauen, um sie vor den stürmischen Böen zu schützen.
Es war ein sonderbares Schauspiel; eben noch waren sie durch die winterliche Stadt gegangen, nun suchten sie Schutz wie vor einem Frühjahrssturm. Blitze zuckten über einen bleigrauen Himmel, wurden gejagt von finsterem Donner, um nur heftiger zu leuchten. Immer schneller folgten Blitz und Donner aufeinander; das Gewitter war direkt über ihnen. Louise hatte noch niemals Angst vor einem Gewitter gehabt und stellte sich neben Herrn Müller, um alles sehen zu können. Selbst bei dem lautesten Schlag zuckte sie kaum zusammen, sondern hielt fasziniert Ausschau nach dem nächsten Blitz, als könne sie sich gar nicht sattsehen an der Vorstellung, die das Wetter gab.
Dabei ergoss sich eine wahre Flut über die Straßen; und wo der Regen auf die gefrorene Erde traf, wurde er sofort zu Eis. Nach wenigen Augenblicken war alles spiegelglatt. An jedem Geländer, jeder Laterne, an den Dachrinnen und Erkern bildeten sich eisige Bärte, als mahne der Winter, dass ein bisschen Regen ihn noch lange nicht vertreiben könne. Gebannt schaute Louise zu, wie sich die Stadt in eine mit Eis überzogene Feenlandschaft verwandelte. Die Nacht hatte nun endgültig Besitz ergriffen von Dresden. Die erleuchteten Fenster warfen ihren Schein hinaus, wo er in Prismen widerschien.
»Sieht das alles nicht wunderschön aus?«, flüsterte Louise, als das Gewitter nachließ.
»Wir sollten zusehen, dass wir schnell nach Hause kommen. Meine Eltern werden sich schon große Sorgen machen«, sagte Liddy.
»Ich fürchte, ›schnell‹ ist keine gute Idee. Schau mal dort drüben!« Herr Müller deutete auf die andere Straßenseite, wo Leute, die ebenfalls Schutz in einem Hauseingang gesucht hatten, sich jetzt mit sehr unsicheren Schritten auf die Straße wagten. Kreischen und Gelächter waren die Folge, denn die Straße bot wenig Halt und führte zu unfreiwilligen Umarmungen.
»Hier können wir nicht bleiben. Ich will mich nicht erkälten. Ihr wisst ja, dass ich morgen die kleine Abendgesellschaft habe. Da kann ich nicht mit einer Triefnase bei euch sitzen.«
»Es wird schon gehen, liebe Cousine. Wir werden einfach nur langsam und vorsichtig gehen, dann kommen wir gut an.«
Herr Müller trat auf die Straße und reichte Louise seine Hand. »Kommen Sie, Fräulein Otto.« Louise nahm seine Hand, dann hakte sie sich bei ihm unter. Liddy und ihre Freundin folgten den beiden.
»Ich habe leider nur zwei Arme. Wenn eine der Damen noch an meine Linke möchte?«, fragte Gustav, indem er sich umwandte.
»Nein, schon gut. Wir kommen zurecht«, war die Antwort. Also ging Louise alleine an Herrn Müllers Arm, wohl beschirmt und sicher.
»Wo waren wir stehengeblieben? – Ich denke, beim Hamlet!«, sagte er und schon nahmen sie ihren Faden wieder auf.
Louise ging wie traumverloren durch die Stadt. Sie spürte, wie Herr Müller auf die kleinste Unsicherheit, das leiseste Straucheln reagierte und fürsorglich seine Linke über ihre Hand legte. Als sie an der Frauenkirche waren, hatten sie schon Schiller und Byron abgehandelt und kamen leise auf ihre Familien zu sprechen. Louise erzählte ihm vom Tod ihrer Eltern, Herr Müller hatte vor kurzem seine Mutter verloren.
Sie fand in ihm so viel liebevolles Verständnis; sie hätte ewig so weitergehen können, sogar auf der glatten Straße. Mittlerweile hatte sie gespürt, dass er ihr Hinken und ihren Buckel sehr wohl registriert hatte, aber damit so rücksichtsvoll umging, dass sie es nicht einmal selbst als Makel empfand.
Das elektrische Fluidum des Gewitters hing noch immer in der Luft, ließ Louises Innerstes aufwallen und sie fühlte sich wie berauscht. Gerade, als sie ihren Kopf an seine Schulter legen wollte, rief Liddy: »Wir sind da! Dem Himmel sei Dank!«
Die kleine Abendgesellschaft des folgenden Tages bestand mehr oder weniger aus denselben Frauen, die sich zuvor im Großen Garten getroffen hatten. Louise fühlte sich etwas wohler, denn nun kamen die Frauen nach und nach, sie lernte sie alle kennen, unterhielt sich angeregt mit einzelnen und erfuhr, dass sie bei weitem nicht alleine stand mit ihren Sorgen um die Menschen, die in diesem Land keinerlei Fürsprache hatten. Und alle waren sich einig, dass Bildung ein wichtiger Schlüssel sei. Voller Vorfreude auf regen Briefwechsel tauschten sie ihre Adressen aus und versprachen einander, in Kontakt zu bleiben.
Endlich kam Gustav Müller. Louise hörte seine angenehm tiefe Stimme schon, als er im Hausflur Mantel und Hut ablegte. Als er eintrat, begrüßte er natürlich zuerst Liddy und ihre Eltern, aber dann huschte sein Blick durch den Raum – und blieb an Louise haften. Er zwinkerte ihr zu und sie verstand sofort: Der Stuhl, der neben ihr frei war, sollte ihm gehören.
Nachdem er sich mit zwei Tassen harmlosem Tee versorgt hatte, kam er auf Louise zu.
»Guten Abend, Fräulein Otto. Darf ich?« Als sie ihn lächelnd begrüßte, setzte er sich und reichte ihr eine Tasse. »Da Sie sich so sehr für das Theater interessieren, habe ich gute Neuigkeiten für Sie. Ich habe heute erfahren, dass demnächst Bellinis ›I Capuleti e i Montecchi‹ im Theater gespielt wird. Und die Schröder-Devrient gibt den Romeo. Was sagen Sie dazu?«
Louise strahlte ihn an. »Die Schröder-Devrient? Das sind fabelhafte Neuigkeiten. Ich hoffe so sehr, dass ich dann auch wieder hier in Dresden sein kann, um sie zu sehen.«
»Ich werde meine Cousine bitten, Sie wieder einzuladen, damit Sie diesen Genuss auf keinen Fall verpassen.«
»Werden Sie auch da sein?«, fragte Louise etwas zu eifrig. Dies wurde ihr im selben Moment bewusst, und sie wurde rot. Herr Müller ging jedoch darüber hinweg, als habe er es nicht bemerkt. Und er war froh, dass Louise die Augen niedergeschlagen hatte, denn so sah sie nicht das Lächeln, das durch seinen kurzen Bart huschte.
»Das kann ich noch nicht sagen, Fräulein Otto. Leider bin ich nur nebenberuflich Liddys Cousin; im Hauptberuf bin ich Jurist in Leipzig.« Sie lachten beide und merkten nicht, wie Liddys überraschter Blick zu ihnen wanderte.
»Wie kommt es, dass Sie sich in der Literatur so gut auskennen?«, fragte Louise und sah, wie eine seiner Augenbrauen kurz nach oben zuckte. Wahrscheinlich fand er es sehr befremdlich, eine solche Frage von einer Frau gestellt zu bekommen. Sie biss sich auf die Lippen, aber er war ihr offensichtlich nicht böse, wie sie erleichtert feststellte, denn er fuhr freundlich fort: »Ich habe das große Glück, neben meinem Beruf als Jurist noch Zeit zu finden für die Literatur. Ich bin sogar Mitglied in einem literarischen Zirkel, den ich in Leipzig ins Leben gerufen habe.«
Louise war begeistert und wusste nicht, welche der vielen Fragen, die ihr im Kopf umherschwirrten, sie zuerst stellen sollte, als Liddy plötzlich rief: »Gustav, bitte, du musst für uns spielen!« Schon war sie bei ihm, nahm ihn an der Hand, um ihn ans Klavier zu ziehen. Kaum hatte er Gelegenheit, seine Teetasse abzustellen.
Alle klatschten, als er sich neben dem Klavier verneigte. Und er spielte. Spielte meisterhaft die schwierigsten Stücke, sang zu seinem Spiel in einem weichen Bariton und hatte Louise mehr für sich eingenommen, als sie selbst es ahnte. Ihr Blick ruhte versonnen auf diesem jungen Mann, dessen Hände über die Tastatur flogen, der Melodien wie bunte Vögel im Zimmer schweben ließ.
Liddy musste Louises Blick bemerkt haben, denn sie setzte sich auf den freien Platz neben Louise und flüsterte: »Ist er nicht ein Goldstück?« Louise konnte nur nicken, denn sie sah, dass so ziemlich alle anwesenden Frauen ganz hingerissen waren von ihm. Sie standen am Klavier, hingen an seinen Lippen und strahlten ihn an, wenn er ihre Blicke erwiderte. Aber immer wieder suchten und fanden seine Augen Louise. Sie war die Einzige, der er zuzwinkerte.
»Das Stück kenne ich gar nicht. Weißt du, wer es komponiert hat?«, fragte Louise, als Herr Müller ein besonders schönes Lied anstimmte.
»Das hat er selbst komponiert«, antwortete Liddy stolz.
Louise konnte nur noch staunen, während Liddy ein Lächeln verbergen musste. Sieh an! Ihre Freundin Louise, die ihr mit voller Überzeugung versichert hatte, niemals zu heiraten. Da musste schon ein so fabelhafter Mann wie Gustav Müller kommen, um Louises Prinzipien ins Wanken zu bringen.
Ja, Louise fühlte sich wie in einem schönen Traum, denn sie war diejenige, der Gustav Müller seine Aufmerksamkeit zuteil werden ließ. Zu ihr kehrte er immer wieder zurück, um sich mit ihr zu unterhalten. Mit ihr ging er zu Tisch und war der aufmerksamste Tischnachbar, den Louise sich nur wünschen konnte.
»Darf ich Sie nun fragen, was Ihnen im Erzgebirge begegnet ist, dass sie so blass wurden, als die Sprache darauf kam?«, fragte er leise. Und Louise erzählte ihm ihre Erlebnisse. Von dem Gespräch der beiden Fabrikherren im Café bis zu dem Unfall des kleinen Mädchens und den Worten, die Herr Fechter darüber verloren hatte.
»Können wir es uns als Volk leisten, Tausende von Kindern auszuschließen von Bildung, von allem, was einen Menschen vom Tier unterscheidet? Es sind doch auch Menschen wie wir! Geschaffen nach Gottes Ebenbild. Aber was bleibt von Gottes Ebenbild übrig, wenn es täglich über zwölf Stunden in Lärm, Schmutz und Gefahr zubringt, wenn man ihm von frühester Jugend an jeden Funken, der Gedanken – gar Ideen! – entzünden könnte, zertrampelt?
Kann es sich eine Gesellschaft wirklich leisten, einen Großteil in vollkommener Dummheit zu halten? Kein Mensch kann so philisterhaft sein, anzunehmen, dass kluge Köpfe nur in reichen Häusern geboren werden. Auch in armen Hütten gibt es intelligente Kinder. Kann es sich ein Volk leisten, all diese vielen Kinder zu übersehen, ihnen niemals eine Chance zu geben?
Wie viele solcher Mädchen, das an jenem Tag seine Hand verloren hat, gibt es in ganz Deutschland? Wie viele Kinder wären gute Gelehrte, die uns allen neue Welten erschließen könnten? Wie viele Kinder wären gerechtere, weisere und vielleicht sogar weniger korrupte Richter als die, die jetzt richten über Menschen, die aus Unbildung oder einfach nur durch Hunger und Verzweiflung zu Verbrechern geworden sind?
Wie viele Mädchen wären gute Geistliche, Lehrerinnen, Ärztinnen oder Wissenschaftlerinnen? Wie viele von all diesen armen Kindern würden gerne schreiben, um unsterbliche Literatur zu schaffen, wenn man sie nur ließe?« Sie hatte mit einer Leidenschaft gesprochen, die Gustav Müller tief beeindruckte.
»Fräulein Otto, Sie müssen meinen literarischen Zirkel in Leipzig besuchen. Ich kenne dort Künstler, Musiker und«, hier senkte er seine Stimme zu einem Raunen, »Demokraten. Man würde Sie mit Ehren dort aufnehmen. Sie haben so vollkommen recht und sprechen mir mit Ihren Worten aus der Seele. So wie Sie denken gar manche meiner engsten Freunden. Es kann so nicht weitergehen. Man muss sich auch um die armen Menschen kümmern. Und …«, er zögerte, bevor er weitersprach, »ich muss Ihnen gestehen, dass ich ein Beispiel in meiner nächsten Verwandtschaft habe. Mein Vater hat durch einen Unfall seine Arbeitsstelle verloren. Ich weiß von ihm nur zu gut, wie ein Mann sich fühlt, der sich nicht mehr selbst ernähren kann. Er grämt sich, dass ich ihn erhalte, aber mir ist es eine selbstverständliche Pflicht, meinen Vater zu versorgen. Welcher Sohn täte das nicht?«
Louise spürte gerade bei diesen Worten eine warme Zuneigung für diesen Mann aufflammen und drückte seine Hand sehr liebevoll.
Es folgten zwei Tage, in denen Liddy immer wieder dafür sorgte, dass man mit Gustav Müller zusammentraf, mit ihm spazieren ging, in Cafés einkehrte und die Museen besichtigte. Dabei vermied sie tunlichst jegliche Neckerei, was Louises aufgeblühten Zustand betraf. So niedergeschlagen war sie aus Oederan gekommen und wie glücklich fuhr sie nun aus Dresden fort. Allerdings nach Meißen. Zu Tante Malchen. Das war weniger beseligend.
Meißen, Mitte Februar 1840
»Louise! Louise, wo bist du denn schon wieder?« Tante Malchens Stimme riss Louise aus ihren Gedanken. Verärgert legte sie ihren Federkiel zurück auf den Schreibtisch und verstaute die Blätter, auf denen sie nur wenige Zeilen geschrieben hatte, schnell in der Schublade. Der Roman musste warten. Mit einem Seufzer erhob sie sich. »Ja, Tante, ich komme. Was ist denn?«
»Du hast Post bekommen. Ein Brief von …«, Tante Malchen hob den Brief ganz nah an ihre Augen, »Liddy Müller. Ein ziemlich dicker Brief. Schau mal gleich, was sie alles schreibt. Ihr habt euch doch gerade erst in Dresden gesehen. Dass sie da so viel zu schreiben hat? In Dresden scheint allerhand los zu sein.«
»Ja, Tante. Kann ich jetzt bitte den Brief lesen?« Louise streckte ihre Hand danach aus, worauf die Tante ihr ihn reichte.
»Natürlich. Aber lies ihn laut vor, denn ich kann nicht mehr so gut sehen.«
Mit einem Blick zur Decke öffnete Louise den Brief und begann zu sprechen, als lese sie vor. Ausführlichst ließ sie Liddy das Wetter in Dresden beschreiben, ein neues Kleid ihrer Mutter, einen neuen Hut ihrer Mutter. Dazwischen überflog sie Liddys Zeilen und fand zuletzt ein Blatt mit einer fremden Handschrift. Konnte das sein? Sollte etwa Herr Gustav Müller dieses Gedicht geschrieben haben?
»Verlaßner Waldvogel an Louise Otto« stand in angenehm klaren Zügen darüber.
»Was zappelst du denn so auf dem Stuhl herum?«, fragte Tante Malchen streng. »So lustig ist es doch nicht, wenn sich Liddys Mutter neue Sachen kauft.« Sie murmelte noch etwas von unnötigem Tand, während Louise sich redlich bemühte, so ruhig wie möglich weitschweifige Berichte über Liddys verschnupfte Verwandte vorzutragen.
»Habt ihr jungen Leute euch denn nichts anderes mitzuteilen? So viel Papier zu verschwenden für solchen Unsinn.«
Louise zuckte nur mit den Schultern. »Da muss ich dich leider enttäuschen, liebe Tante, das war’s. Ich geh schnell wieder an die Arbeit. Die Wäsche macht sich nicht von alleine.« Schon war sie zur Türe hinaus und lief in den Keller, wo der Waschzuber stand. Dort las sie voller Vorfreude und Wort für Wort, was sie unter Tante Malchens strenger Aufsicht nur erahnt hatte: Liddy lud sie im April nach Dresden und ins Theater ein, wenn die Schröder-Devrient den Romeo gab. Außerdem nahmen ihre Pläne bezüglich der Pension für Mädchen konkrete Formen an. Aber worüber sich Louise am meisten freute, war das Gedicht, das tatsächlich Herr Gustav Müller mitgeschickt hatte und das den Titel »Verlaßner Waldvogel« trug.
Auf dieses Gedicht antwortete sie wiederum mit einem Gedicht und schickte es an Liddy – mit dem Hinweis, dass sie Herrn Müller gerne ihre Adresse weitergeben könne, denn sie freute sich schon darauf, mit ihm in einen lebhaften Briefwechsel zu treten, voller Lyrik und schöner Gedanken. Es gab viele Paare, die in der Literatur bekannt waren durch ihren regen geistigen Austausch. Das war es, was Louise sich vorstellte: Auf geistiger Ebene wollte sie sich mit Herrn Gustav Müller verbinden. Und schon schlich sich eine bange Ahnung an sie heran: Würde ihm das genügen?
In den folgenden Wochen kamen viele Briefe von Gustav Müller, die Louise zwischen der Hausarbeit unter strengen Tantenaugen als Briefe ihrer Freundin Liddy vorlas. Glücklicherweise verlor die Tante das Interesse, nachdem immer wieder nur vom Wetter und Husten, von neuen Handschuhen und Hüten die Rede war.
Louise antwortete Gustav mit Prosa und Gedichten. Natürlich merkte die Tante, dass Louise viel schrieb, worauf Louise ihr erklärte, sie schreibe Kochrezepte und Haushaltsratschläge für Liddy auf.
Dresden, im April 1840
Endlich, endlich war der März vergangen und Louise packte ihre Koffer, um Liddy in Dresden zu besuchen. Herrn Müller hatte sie nur mitgeteilt, dass sie kommt, aber von sich aus kein Treffen vorgeschlagen. Sie sehnte sich nach seiner Nähe, aber gleichzeitig machte sie ihr Angst.
Liddy empfing sie wieder mit ihrem Vater an der Station.
»Ich habe noch ein Billett für dich ergattert; im ersten Rang. Ein richtig guter Platz.« Von Gustav sagte sie nichts; und Louise fragte sich, ob sie darüber traurig oder erleichtert sein sollte. Natürlich war es viel leichter, von Angesicht zu Angesicht zu sprechen, so ganz unmittelbar die Empfindungen des Gegenübers im Gesicht abzulesen, so viel mehr zu lesen als ein Brief tragen konnte. Aber so nah bei ihm zu sein? Sie musste zugeben, dass er ihr gefiel. Noch niemals hatte sie einen solchen Mann erlebt, so bescheiden in seiner Art und doch so meisterhaft in all seinem Können. Aber wie würde mit ihm ein Alltag aussehen? Würde sich nicht alles, was ihr so lieb und wert war, verflüchtigen zwischen Kochen, Wäsche – und Tante Malchen?
Diese Gedanken waren weit weg, als sie am nächsten Abend schon mit Liddy im ersten Rang des Theaters saß. Sie hatten sich mit einiger Sorgfalt angezogen und gegenseitig frisiert, denn Louise wollte nicht auffallen zwischen all den eleganten Städterinnen. Wie immer trug sie Himmelblau; die langen dicken Zöpfe hatte Liddy ihr besonders kunstvoll aufgesteckt. Die beiden Frauen hatten sich ein Programm gekauft, auf dem in festlichen Buchstaben prangte: »I Capuleti e i Montecci – eine lyrische Tragödie von Vincenzo Bellini«.
Anders als in Shakespeares Theaterstück schilderte diese Oper nicht das Kennenlernen der beiden tragisch Liebenden, sondern den letzten Tag in ihrem kurzen Leben.
Louise liebte die Momente vor einer Vorstellung: diese flüchtige Zeit, wenn es im Zuschauerraum noch summte wie in einem Kirschbaum im Frühling, wenn die Kronleuchter noch alle brannten, Leute ihre Plätze suchten, ihre Freunde entdeckten und von weitem begrüßten. Natürlich hatten sich alle fein gemacht. Die Herren trugen ihre dunklen Anzüge, die Frauen schimmernde Kleider; Juwelen blitzten im Kerzenschein auf, Fächer wedelten und Pelzkrägelchen wurden zurechtgerückt. Manche der Damen hatten nicht auf einen üppigen Federschmuck auf dem Kopf verzichten wollen, was von den hinteren Reihen nicht geschätzt wurde. Darüber gab es gestenreiche Diskussionen, wie Louise schmunzelnd bemerkte. Ebenfalls amüsierte es sie, zu sehen, wie andere Leute ihre Mitmenschen beobachteten; wie hinter vorgehaltenen Fächern offensichtlich über das Kleid oder den Kopfputz einer Dame gelästert wurde, die man aber mit dem freundlichsten Lächeln bedachte, wenn sie sich näherte, nur um gleich wieder den Fächer zu heben und dahinter weiterzulästern.
Am meisten genoss Louise die Kakophonie des Orchesters, wenn die Instrumente gestimmt wurden. In dem Wirrwarr aus Tönen erkannte man hier und dort schon einzelne Sequenzen aus der Ouvertüre.
Endlich löschte man die Lichter, der prächtige Saal versank in der Dunkelheit, nur im Orchestergraben fiel Kerzenschein auf die Notenblätter. Der Dirigent erschien und bekam Applaus, dann hob er seinen Taktstock. Mitreißend, euphorisch, dann wieder melancholisch verströmte das Orchester Stimmungen und nahm auf diese Weise die Handlung des Stückes vorweg. Der Vorhang hob sich, der Männerchor, der die Verbündeten der Capuleti darstellte, versammelte sich, um die Montecchi zu verderben. Mit Säbeln bewaffnet sangen sie vom Untergang ihrer Feinde. Und dann betrat Romeo die Bühne. Wie ein Blitzstrahl traf es Louise, als sie endlich die von ihr so sehr verehrte Wilhelmine Schröder-Devrient sah und hörte. Konnte eine menschliche Stimme so überirdisch klingen? Jeder Ton schien wie ein Diamant aus ihrem Mund zu leuchten, ihre Stimme glänzte in den Höhen und hatte in den Tiefen eine überraschende Fülle, wie sie nur wenige Sopranistinnen haben. Klein und zart stand sie zwischen den Männern, perfekt den Jüngling Romeo verkörpernd, der durch sein tiefes Lieben so sehr verletzlich war. Unerkannt trat er vor seine Feinde, um ihnen Frieden anzubieten. Ja, er bat sogar um Giuliettas Hand für Romeo, um den Frieden zu besiegeln.
Harsch wurde er abgewiesen. Kampf und Blutvergießen waren unausweichlich. Obwohl Louise und Liddy wussten, wie das Stück enden würde, fieberten sie mit, bangten mit den beiden Liebenden. Romeo wollte Giulietta entführen, doch sie weigerte sich – aus Pflichtbewusstsein gegen ihren Vater, und schwor Romeo ewige Treue, im Leben wie im Tod. Eng umschlungen standen die beiden Liebenden auf der Bühne, der Vorhang fiel und ein so tosender Applaus brandete auf, wie ihn Louise selten gehört hatte. Schon nach kurzer Zeit taten ihr die Arme weh, sodass sie sich erschöpft in ihren Sitz zurückfallen ließ. Während Liddy im Programmheft blätterte, um die genauen Worte auf Deutsch nachzulesen und sich auf den zweiten Akt vorzubereiten, ließ Louise ihren Blick durch den Saal schweifen. Da fühlte sie sich plötzlich beobachtet. Wie magnetisch angezogen musste sie ihren Kopf wenden und sah – Gustav Müller, der sie intensiv anschaute. Sie atmete so kurz und heftig ein, dass sie schon fürchtete, Liddy könnte diesen Verlust von Contenance bemerkt haben, aber sie las zu aufmerksam in ihrem Heft. Louise spürte nur noch eine tiefe, innige Freude, diesen Mann zu kennen. Lächelnd schaute sie ihn an. Gustav bedeutete ihr mit einer Geste, dass er zu ihr kommen werde, aber schon verlosch wieder das Licht und sie mussten sich bis zum Ende gedulden.
Und während auf der Bühne das Schicksal seinen Lauf nahm und die beiden Liebenden im Leben nicht vereint sein konnten, spürte Louise einen Aufruhr in sich, wie sie ihn niemals für möglich gehalten hätte. Sie war wie in einem Rausch, denn so viel Schönes an einem Abend war deutlich mehr, als sie sonst erlebte.
Ewig schien der Applaus zu dauern, Wilhelmine Schröder-Devrient musste unzählige Male auf die Bühne kommen, aber auch Giulietta wurde mit Bravo-Rufen bedacht.
In Louises Innerstem flatterten wilde Vögel, als sie zwischen all den anderen Menschen beglückt und beseelt dem Ausgang zustrebte. Sie wagte kaum, sich umzublicken, aber Herr Müller hatte sie längst gesehen und kam zu ihr und Liddy.
Louise war ihm dankbar, dass er es bei einer kurzen Begrüßung beließ und das Erlebte im Schweigen nachwirken ließ. Stumm gingen sie durch das nächtliche Dresden, wo Straßenfeger die Hinterlassenschaften der vielen Kutschpferde beseitigten.
Mehr mit Gesten als Worten verabredeten sie sich für den kommenden Tag und verabschiedeten sich mit einem langen Händedruck.
Meißen, im Mai 1840
Louise musste sich immer wieder beherrschen, nicht zu viel Freude zu zeigen, wenn wieder ein Brief von Gustav kam. Es war so unendlich aufregend, mit einem solchen Mann im Briefwechsel zu stehen. Ja, er teilte ihre Meinung in vielen Dingen und war ein Mann, wie es noch viel mehr geben müsste, wie Louise fand. Er war besonnen, hatte einen klaren Blick auf die Welt und schätzte Klugheit und Talent; ganz gleich, ob es sich in einem Mann oder einer Frau fand. Nur hier und da leistete er sich Ausrutscher, wenn er behauptete, der große Publizist Börne sei keine Lektüre für Damen. Einmal meldete er leise Zweifel an, ob das Talent, das sich in einer Frau findet, mit dem Lärm eines häuslichen Herdes vereinbar sei. Und an dieser Stelle hatte seine Feder plötzlich über das Papier gekratzt und ein paar Kleckse hinterlassen. Im folgenden Satz brachte er die entschiedene Überzeugung zum Ausdruck, dass es wohl doch vereinbar sein müsse. Louise grinste in sich hinein. Erst hielt er es für unmöglich, dann aber doch? Da hatte er wohl gerade noch mal die Kurve gekriegt, der gute Herr Müller. Mit einem Seufzer schaute Louise aus dem Fenster, das sie vor drei Wochen schon putzen wollte. Kein Dichter dieser Welt hatte beim Anblick schmutziger Fenster ein schlechtes Gewissen, denn für ihn erledigten solche Banalitäten dienstbare Geister; oder die Fenster blieben schmutzig und wurden geöffnet, wenn der Herr Dichter wissen wollte, wie das Wetter war. Das war der große Unterschied. Die Hausarbeit blieb einfach immer an den Frauen hängen. Jeder wusste, was eine »Hausfrau« war. Aber ein »Hausmann«? Gab es das Wort überhaupt?
Louise antwortete Herrn Müller entsprechend: »Nein, mein lieber Freund, es ist nicht möglich, Muse und häuslichen Lärm zu vereinbaren. Ich habe mich der Muse verschrieben und keine Macht des Himmels und der Erde kann mich meinem Schwur untreu machen.«
Sie schloss und siegelte den Brief, dann hielt sie ihn lange in ihrer Hand. Die Freundschaft mit Gustav Müller war ihr teuer. Er war ihr teuer. Er war ihr Liedergefährte, den sie sich gewünscht hatte. Doch wenn er um sie würbe, müsste sie ihn ablehnen. Mit ihrem »Nein!« würde sie auch gleichzeitig die Freundschaft beenden. Nein! Er sollte gleich wissen, was sie von der Ehe hielt und gar nicht erst auf den Gedanken kommen, um sie zu werben. – Und sie selbst würde sich dann auch den Kampf ersparen, den sie mit sich selbst auszufechten hätte, bei der Aussicht, seine Frau zu werden.
So gerne hätte sie sich ganz und gar aufs Schreiben konzentriert, aber der Haushalt musste versorgt werden, die Mieter hatten immer wieder Anliegen, um die Louise sich kümmern musste. Da war die Hochzeit ihrer Schwester Francisca, die im Dom stattfand, eine kleine Abwechslung.
In all der Freude über die Hochzeit schaute Tante Malchen ihre jüngste Nichte skeptisch an.
»Und? Wirst du wohl am Ende die Nächste sein?«, fragte sie missmutig.
»Aber nein, Tantchen. Da musst du dir wirklich keine Sorgen machen. Ich hab dir doch gesagt, dass ich immer ledig bleiben will. Du liebe Güte! Ein Mann!«, sagte Louise und hob dabei die Hände, als sei ein Mann das Allerletzte, womit sie etwas anzufangen wüsste.
Louise konnte nur hoffen, dass Francisca glücklich würde. Gemeinsam mit den Frischvermählten zog sie nach Mühlberg an der Elbe, wo Heinrich Burkhardt eine Apotheke betrieb. Natürlich hatte sie Herrn Müller – besser gesagt: Gustav, denn seit ihrem letzten Treffen in Dresden benutzten sie ihre Vornamen – ihre Adresse in Mühlberg mitgeteilt, denn auf seine Briefe wollte sie nicht verzichten. Sie war zu gespannt, wie Gustav auf ihren letzten Brief reagieren würde. Gerade, als sie mit ihrer Schwester von einem Spaziergang an der Elbe zurückkehrte, fand sie seinen Brief vor. Er begann: »Wie sehr beschämen Sie mich, meine gute Louise, und wie schwach komme ich mir Ihnen gegenüber vor! Als ob der Einsturz einer schönen Hoffnung, das Erwachen aus einem lieblichen Traume, kurz, als ob die nüchterne Wahrheit den Mann kraftund mutlos machen dürfe!«8
Louise seufzte erleichtert. Offenbar hatte Gustav sie jetzt tatsächlich verstanden.
Francisca, die am 28. Mai 1840 im Meißener Dom Heinrich Burkhardt geheiratet hatte, schwebte so ganz in ihrem frischen Eheglück. Mit ihr teilte sie ein wenig ihre Freude, auch wenn Francisca selbstverständlich davon ausging, dass ein solches Verhältnis nur in einer Ehe enden könne.
Louise nutzte die Zeit redlich, um zu schreiben. Sie schrieb nicht nur Briefe an Gustav und Liddy und viele andere Frauen, die sie bei Liddy kennengelernt hatte, sondern auch an Caroline von Bonniot und ihre Freundin Aline in Naumburg, die dort mit dem Gymnasialdirektor Förtsch verheiratet war. Ebenso an Tante Therese in Dresden, die seit einiger Zeit kränklich war.
Außerdem machte Louise ausführliche Entwürfe zu einem Roman, in dem sie zeigen wollte, dass alle Menschen einen Zugang zu Bildung brauchten.
Einen Mann stellte sie in den Mittelpunkt und nannte ihn Ludwig. Er war gesegnet mit Geistesgaben, aber leider nicht mit hoher Geburt. Welcher Beruf ließ ihn wohl mit den unterschiedlichsten Menschen zusammentreffen? Vor wem hätten die Menschen so wenig Achtung, dass sie sich in seinem Beisein keine Mühe geben würden, ihre Schwächen und Bosheiten zu verbergen? Ein Kellner musste Ludwig sein!
Als Louise nach Meißen zurückkehrte, hatte sie schon einen ausführlichen Entwurf im Gepäck, sogar die ersten ausgearbeiteten Kapitel. Und Ludwigs Scheitern war beschlossene Sache.
Meißen, Ende Juni 1840
Sie hatte die drei Wochen in Mühlberg so sehr genossen, dass es ihr schwerfiel, sich wieder an Meißen zu gewöhnen. Da kam eine Einladung ihrer Freundin Aline aus Naumburg. Ihr Mann hatte im August in Meißen zu tun und konnte Louise dann mitbringen. Dadurch war das Problem des männlichen Begleitschutzes gelöst. Louise war selig und begann noch am selben Tag mit den Reisevorbereitungen, auch wenn es noch vier Wochen dauerte.
Es war ein sonniger Sonntagvormittag, als Tante Malchen nach Louise rief.
»Louise, hier ist Besuch für dich!«
»Schon gut, Tante, sag ihr, sie soll reinkommen!«, antwortete Louise, ohne aus ihrem Zimmer zu schauen, denn wer sollte sie jetzt besuchen, außer einer ihrer Freundinnen aus der Stadt?
»Sie?«, rief die Tante schrill.
Louise, die gerade Wäsche in ihren Koffer legte, schaute alarmiert auf.
»Ja, Tante, ich komme!«, rief sie und war auch schon an der Wohnungstür, wo Tante Malchen wie eine Felswand mit verschränkten Armen stand und mit dem Kinn auf einen Herrn deutete. Bei seinem Anblick blieb Louise wie angewurzelt stehen und war keines Wortes mehr fähig. Dort stand Gustav Müller. Seine städtisch-elegante Erscheinung bildete einen gewissen Kontrast zu Tante Malchen, deren Kopftuch schon jetzt auf Zoff saß. Sie warf Louise einen erbosten Blick zu, als Gustav seinen Zylinder abnahm und sich leicht gegen Louise verbeugte.
»Guten Morgen, Fräulein Louise!«, sagte er freundlich und wollte Louise die Hand reichen, doch Tante Malchen kam ihm zuvor: »Aha!«, knurrte sie bedrohlich. »Du hast ihm schon erlaubt, deinen Vornamen zu benutzen.« Und noch strenger fuhr sie fort: »Wer ist das?« Bei diesen Worten nagelte sie ihn mit ihrem Blick an den Türrahmen.
In zwei Schritten war Louise bei ihnen, wollte Gustav die Hand reichen, doch er hatte seine schon zurückgezogen.
»Tante, bitte! Das ist Herr Gustav Müller, der Cousin meiner Freundin Liddy aus Dresden. Herr Müller, das ist meine Tante, Fräulein Matthäi.«
Gustav räusperte sich: »Die Freude ist ganz meinerseits.«
Die Tante legte ihre Oberlippe in steife Falten: »Und demnächst fährst du nach Naumburg zu deiner Freundin Aline. – Hat die auch so geschniegelte Cousins?«
Louise sah, wie Gustav erbleichte und schluckte, wie sein ganzes Wesen sich plötzlich von ihr zurückzog, als sei plötzlich eine Wand zwischen ihnen gewachsen.
»Herr Müller, bitte verzeihen Sie, ich …«, stammelte Louise.
»Wie Sie sehen, Herr Müller, kommt Ihr Besuch recht ungelegen. Meine Nichte ist beschäftigt und hat keine Zeit für Sie.«
»Es tut mir sehr leid, Fräulein Otto; ich wollte Sie nicht stören. Leben Sie wohl, Fräulein Otto.« Und ohne ein weiteres Wort abzuwarten, wandte er sich um und ging eilig die Treppe hinunter. Louise lauschte seinen Schritten, bis die Haustür hinter ihm zugefallen war.
Mit einem verzweifelten Stöhnen lehnte sie sich an die kalte Wand und konnte ein Schluchzen nicht verbergen.
»Wer war das? Und wieso heulst du jetzt?«, fauchte die Tante.
»Lass mich, lass mich doch einmal nur in Ruhe!«, entgegnete Louise heftig und warf die Tür ihres Zimmers hinter sich zu.
Schon am nächsten Tag erhielt sie einen Brief von Gustav. Er musste ihn gleich hier in Meißen geschrieben und dann selbst bei ihr eingeworfen haben. Louise öffnete ihn mit zitternden Fingern und war wie vernichtet, als sie seine bitteren Vorwürfe las. Noch schlimmer als die Vorwürfe gegen sie war aber die Verzweiflung, die aus seinen Worten sprach. Sie hatte ihn zutiefst verletzt. Dass sie ihn nicht hineingebeten, kaum Worte für ihn gefunden und bei seinem Anblick das blanke Entsetzen in ihrem Gesicht gestanden hatte, ließen ihn glauben, dass sie keinen Wert auf seine Freundschaft lege. Nur wegen ihr war er nach Meißen gekommen, nur um sie zu sehen, mit ihr zu sprechen.
Wie betäubt setzte sich Louise an ihren Schreibtisch, nahm noch immer zitternd die Feder und begann, ihm zu erklären, was man kaum erklären konnte: Tante Malchen. Nur durch die Gegenwart der Tante war sie so versteinert gewesen. Mit liebevollen Worten versicherte sie ihm, dass ihre Gefühle für ihn unverändert seien, und bat ihn um ein Treffen in Dresden. Letzteres verstieß zwar ein wenig gegen die Schicklichkeit, war aber angesichts der Verletzungen, die sie ihm zugefügt hatte, nötig.
In den folgenden Tagen wurde sie misstrauisch beäugt von Tante Malchen. Glücklicherweise war das Wetter schön, sodass die Tante oft ausging und Louise ihre Ruhe hatte. Aber auch die Ruhe war quälend. Nichts, rein gar nichts brachte sie am Schreibtisch zustande, dabei hatte sie so viele Ideen für ihren Ludwig, den Kellner. Jeden Tag lauerte sie auf die Post, doch kein Brief kam. Nach fünf Tagen kam ein Brief von Liddy. – Immerhin. Hastig öffnete ihn Louise; es war wieder eine Einladung nach Dresden. Und zwar bald! Das war ein Lichtblick. Vielleicht konnte sie dort Gustav treffen, mit ihm reden, ihm alles noch einmal erklären? War ihr Brief an ihn am Ende verloren gegangen? Wieso schrieb er nicht?
Nach unsäglich langen zehn Tagen kam ein Brief; glücklicherweise unbemerkt von Tante Malchen. Wie einen Schatz trug Louise den Brief in ihr Zimmer und öffnete ihn wie ein Tabernakel: Ja, er liebte sie noch immer. Das war das erste, was sie in seinen Zeilen las. Noch immer. Unverändert. Und nun bekannte er in diesem Brief mehr als er ihr jemals zuvor gesagt oder geschrieben hatte.
Sie fieberte einem Treffen mit ihm entgegen, denn plötzlich wurde ihr bewusst, wie sehr sich ihre Gefühle für ihn verändert hatten …
Dresden, Juli 1840
Der Juli war so wunderbar warm, dass man am liebsten nur noch draußen war. Liddy und Louise gingen Arm in Arm an der Elbe entlang, die ihren ganz eigenen Duft verströmte. Friedlich zogen Lastkähne dahin, am anderen Ufer näherten sich zwei Reiter dem Fluss, um ihre Pferde zu tränken.
»Ich gönne euch beide einander. Keiner anderen Frau hätte ich meinen Gustav gegönnt und keinem anderen Mann dich«, sagte Liddy, indem sie stehenblieb und Louise in die Augen schaute. Louise errötete zutiefst. »Noch ist nichts passiert. Er hat mich noch nichts gefragt.« Sie atmete schwer auf. »Ich hoffe so sehr, dass ich ihm das alles erklären kann. – Du hättest Tante Malchen sehen sollen, wie sie mit verschränkten Armen in der Wohnungstür stand, wie eine Wächterin am Eingang zum Hades. Ich war so erschrocken. Erschrocken, ihn zu sehen. Darüber hätte ich mich unbändig gefreut, aber nicht in der Gegenwart meiner Tante. Ich will dir ihre Vorwürfe nicht wiederholen. Meinst du wirklich, dass er kommen wird?«
»Weshalb sollte er denn nicht kommen? Er ist ein so edler Mensch und wird zu seinem Wort stehen. Wir treffen uns später in der kleinen Restauration dort drüben mit meinen Eltern. Er wird uns am Nachmittag im Ostra-Vorwerk treffen.«
Louise brachte kaum einen Bissen hinunter. Wie geduldig war Papier? Hatte Gustav vielleicht nur freundliche Worte geschrieben, die er nicht wirklich fühlte? Wenn er ihr gegenüber nur noch von einer kalten Höflichkeit war, anstatt wie früher von warmherziger Zuneigung, würde sie keine halbe Stunde in seiner Gegenwart überstehen.
Endlich war das Essen beendet und man ging hinüber in den Park, wo auf den weitläufigen Wiesen Kinder spielten, deren Eltern es sich auf den Bänken im Schatten gemütlich gemacht hatten.
Louise schaute sich verstohlen um. Kam er schon? Dort drüben, der schlanke junge Mann mit dem Zylinder? Aber nein, das war nicht sein Gang. Oder dort? Da kam jemand … Nein, auch das war er nicht. Noch während sie spähte, hörte sie plötzlich seine Stimme ganz dicht bei sich: »Guten Tag! Würden Sie mir erlauben, für einen Augenblick Fräulein Otto zu entführen? Ich würde gerne mit ihr reden – allein.«
Louise schluckte. Er hatte sie wieder »Fräulein Otto« genannt. Hatte er ihr doch nicht verziehen, Sie nicht verstanden? Aber da stand er vor ihr, lächelte sie an und bot ihr seinen Arm, um mit ihr alleine zu sprechen. Derartige Wünsche wurden nur ausgesprochen (und gewährt) wenn es um einen Heiratsantrag ging. Liddys Eltern gaben ihm gerne die Erlaubnis, wobei ihr Vater seinem Neffen zuzwinkerte.
Louise war schon jetzt selig, als sie an seinem Arm durch den Sonnenschein ging. Eine ganze Weile schwiegen sie, dann begannen sie beide gleichzeitig zu reden, brachen ab und verfielen wieder in Schweigen. Der Weg führte sie in den Schatten alter Bäume, von wo aus sie die sonnendurchfluteten Wiesen wie ein Bild sahen und das Lachen der spielenden Kinder gedämpft zu ihnen herüberdrang. Gustav führte sie zu einer Linde, unter der eine Laube stand. Louise bemerkte etwas bange, dass diese Laube ein lauschiges Plätzchen bot, in dem man ungestört und unbeobachtet sein konnte. Aber sie folgte ihm in die Laube, wo er ihre Hände fasste und neben sich auf die Bank zog.
»Fräulein Otto, Louise! Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie erleichtert ich bin. An jenem Sonntag in Meißen, da stürzte für mich eine Welt zusammen.«
»Oh, bitte, erinnern Sie mich nicht an diese quälenden Momente. Meine Tante Amalie kann schon sehr … «
»Oh, wie gesagt, das Vergnügen war ganz meinerseits!«, rief er aus.
Louise musste ein wenig lächeln.
»Verzeihen Sie. Ich wollte damit nur sagen, wenn Sie mir weniger bedeuten würden, dann hätte mich dieses Erlebnis weniger verletzt. Da mich Ihre vermeintliche Kälte aber so aus meiner Bahn warf, wurde mir selbst erst klar, wie viel Sie mir bedeuten. Sie sind mir unendlich viel mehr als eine Liedergefährtin. Ich weiß, dass Sie sich der Muse verschrieben haben, aber ich kann nicht länger schweigen. Ich liebe Sie von ganzem Herzen. Wollen Sie meine Frau werden?« Er drückte ihre Hände und schaute fest in ihre Augen.
Louise konnte nur nicken. Tränen der Erleichterung standen in ihren Augen. »Ja, Gustav! Ja!«, stammelte sie und konnte endlich unter ihren Tränen lächeln.
»Und Sie sind mir nicht böse, dass ich Sie dazu bringe, Ihrem Gelübde untreu zu werden?«
»Was kann ich dazu sagen?
Wie sich Verwandtes zu Verwandtem findet,
Da ist kein Widerstand und keine Wahl,
Es löst der Mensch nicht, was der Himmel bindet!« Sie schaute ihn schwärmerisch an. Zärtlich wischte er die Tränen von ihrer Wange und neigte sich zu ihr. Ganz dicht sah sie sein Gesicht vor sich, so dicht, wie sie noch niemals das Gesicht eines Menschen vor sich gesehen hatte. Im selben Moment spürte sie seine Lippen auf ihren. Ein Kuss. Ihr erster Kuss. So oft hatte sie schon von Liebe, von Küssen und Leidenschaften gelesen. Gustavs Kuss war wie eine Offenbarung. Das also war es, worum unzählige Dichter ihren Genius rankten. – Recht hatten sie!
Ihre Verlobung wollten sie weder veröffentlichen noch verheimlichen. Wer davon erfuhr, konnte ihnen gratulieren, aber es musste nicht in der Zeitung stehen. Müllers fühlten sich geradezu geehrt, die Ersten zu sein, die davon erfuhren. Noch am selben Abend schrieb Louise an ihre Schwestern und engsten Freundinnen. An Tante Malchen schrieb sie einen besonders langen Brief …
Naumburg, im August 1840
Louise war schon seit zwei Wochen bei Aline in Naumburg, da kam ein Brief von Gustav Müller.
»Was schreibt er denn?«, flüsterte Aline aufgeregt, als Louise mit strahlendem Lächeln aus ihrem Zimmer kam.
»Er hält es nicht so lange aus ohne mich. Demnächst hat er beruflich in Jena zu tun und würde dann gerne einen Abstecher nach Naumburg machen.« Sie drückte den Brief mit einem seligen Seufzer an sich. Gemeinsam gingen sie nach draußen und setzten sich im Garten in die Sonne.
»So gehört sich das für einen Bräutigam. Ich freu mich so sehr für dich. Nach allem, was du uns von ihm erzählt hast, sind mein Mann und ich sicher, dass ihr eine sehr glückliche Ehe haben werdet.« Aline beobachtete zwei Schmetterlinge, die umeinander taumelten.
»Und ich bin so froh, an deinem Mann und dir schon zu sehen, wie glücklich man als Ehepaar sein kann.«
»Ich weiß, du wolltest niemals heiraten. Da hat dich wohl ein besonders guter Mann in einem schwachen Moment erwischt, dass du Ja gesagt hast.«
»Gustav ist so wundervoll, dass ich gar keinen schwachen Moment brauchte. Und ich bin sicher, dass es ihm hier bei euch auch gefallen wird. Bei euch herrscht eine so gute Atmosphäre. Man spürt, dass hier Ruhe und Harmonie wohnen. Er wird die Gespräche in eurem Haus, die Begegnungen mit gebildeten Menschen ebenso genießen, wie ich. – Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut es mir tut, bei euch zu sein.« Louise stieß einen Seufzer aus.
»Tante Malchen ist keine allzu anregende Gesprächspartnerin?«, vermutete Aline leise.
»Wenn es darum geht, wie man Wäsche am weißesten wäscht, schrumpelige Äpfel noch schnell verarbeitet oder wer in Meißen was über wen gesagt hat, dann ist sie unschlagbar. Es tut mir unendlich leid für sie, dass sie niemals die Möglichkeit hatte, sich zu bilden. Dass niemand ihre Interessen in andere Bahnen gelenkt hat, als immer nur Haushalt, Haushalt. Es ist eine Schande, dass es so vielen Frauen so ergeht. Sie machen sich nicht einmal etwas aus ihrer Unmündigkeit. Es war meiner Tante vollkommen egal, dass sie als unverheiratete Frau seit ein paar Jahren mündig ist.«
»Dein Gustav ist ein Mann, der eine mündige Frau neben sich haben will. Was sollte er mit einem Frauchen anfangen, das ihm sein Essen kocht und ihm die Pantoffeln hinterherträgt? Ich glaube, vor einer solchen Frau würde er Reißaus nehmen. Wir freuen uns auf ihn. Er wird uns sehr willkommen sein. Aber Louise, was ist denn los?«, fügte Aline besorgt hinzu. »Manchmal huscht ein Schatten über dein Gesicht, dass ich fürchte, du bist doch nicht so ganz glücklich.«
Louise schwieg und schaute hinüber zu den Eiben, die den Garten trutzig umgrenzten.
»Sag es mir, Louise«, flüsterte Aline. »Gibt es etwas, das dein Glück mit Gustav trübt? Hast du Zweifel an ihm und seiner Liebe?«
»Oh nein! Zweifel an ihm und seiner Liebe könnte ich niemals haben!«, sagte sie voller Überzeugung. Und leiser fuhr sie fort: »Ach, es sind alte Ängste. Du weißt, wie viele Menschen ich schon verloren habe. Als ich noch ganz klein war, mein Brüderchen Heinrich. Er war mein Spielgefährte und ich war untröstlich, als er plötzlich nicht mehr da war. Ich habe lange, lange nach ihm gesucht und wollte mich nicht damit trösten lassen, dass er jetzt im Himmel sei. Clementine hat sich in dieser Zeit besonders lieb um mich gekümmert. Aber dann begann sie, ständig zu hüsteln. Es wollte gar nicht mehr aufhören, sondern wurde immer schlimmer. Sie verlor an Gewicht, an Kraft, war ständig müde. Irgendwann hustete sie Blut. Da war den Eltern und den älteren Schwestern klar, dass es die Schwindsucht war. Wir beerdigten sie kein Jahr später. Ich schloss mich enger an die Mutter an. Nicht wenige Jahre danach begann auch bei ihr dieses Hüsteln. Sie versuchte, es vor uns zu verbergen, doch ich hörte sie, sogar nachts. Sie verschwand vor unseren Augen, so sehr nahm sie ab. Sie starb. Mein Vater versuchte, uns beides zu sein, Vater und Mutter, aber auch er …« Louise konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, und Aline nahm sie behutsam in ihre Arme.
»Und jetzt hast du Angst, dass der Mann, dem du dein Herz geschenkt hast, ebenso sterben könnte?«
»Wenn immer die Menschen sterben, die man am meisten liebt, verliert man den Boden unter den Füßen. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es Sicherheit gibt. Man verliert das Vertrauen in die Zukunft, in das Leben selbst.«
Aline nahm ihre Freundin bei den Schultern und drehte sie zu sich herum. »Dein Gustav ist ein gesunder junger Mann. Ihr werdet miteinander ein langes und glückliches Leben haben und viele Kinder, denen ihr unendlich viel mitzugeben habt auf ihren Lebensweg.«
Louise nickte unter Tränen. »Ja, du hast recht. Ich will nicht kleingläubig sein. Wir sind so jung. Wer soll denn Vertrauen in das Leben haben, wenn nicht wir?«
Aline zog ihre Freundin von der Bank hoch. »Komm! Jetzt mieten wir für deinen Gustav ein hübsches Zimmer im Gasthof.«
Gustav kam wenige Tage später in Naumburg an. Arm in Arm schlenderten die beiden durch die Gassen der alten Stadt, ließen es sich schmecken in den gemütlichen Restaurants und Cafés und besuchten natürlich auch Uta im Dom. Beide wunderten sich darüber, dass die kühle, unnahbare Uta so berühmt war, wo doch ihre Schwägerin Reglindis so wunderschön lachte, wie man es sonst niemals bei einer Statue sah.
Es war ein heißer Sommertag, als sie gemeinsam zur Rudelsburg im benachbarten Kösen aufbrachen. Louise wollte durchaus von Naumburg aus laufen, als wolle sie Gustav beweisen, dass sie jede Strecke bewältigen könne, doch er bestand darauf, dass sie wenigstens ein Stück mit dem Schiff fuhren.
Louise war selig, als sie in einem Kahn saßen und Gustav ihre Hand hielt. Überreife Felder und Weinberge, aus denen die Trauben golden leuchteten, zogen an ihnen vorüber. Auf der kühlen Saale glitten sie dahin, im Schatten der Erlen, umschwirrt von Libellen. Nur das Kräuseln der Wellen am Bug des Schiffes, Vogelgesang und das Summen von Insekten begleitete sie.
Ihre Fahrt endete in Saaleck, und nun begann ihr Aufstieg auf die Burg, deren Ruinen schon hier und dort durch die Wipfel der Bäume blickten. Eng, steil und steinig waren die Pfade, die hinaufführten, doch bald hatten sie es geschafft und standen schwer atmend, aber glücklich unterhalb der Burg.
»Komm, es gibt hier einen guten Wirt. Ich war schon öfter hier mit meinen Kommilitonen«, sagte Gustav. »Samiel hilf! So lautet das Losungswort, sollte das Tor einmal geschlossen sein. Ah, wir haben Glück! Samiel ist da und hat sicher einen frischen Trunk für uns.«
Im Burghof standen Tische und Bänke unter einer Linde, ein Verschlag aus Brettern mit einem Strohdach bot einem Schanktisch Schutz vor Regen und Sonne. Dahinter stand Samiel. Er war eine imposante Erscheinung mit Bart und störrischen Locken, die nach allen Seiten standen, aber er war Louise viel lieber als der Samiel, der in Webers Freischütz erscheinen sollte. Gemeinsam setzten sie sich unter ein Fensterkreuz, von dem aus sie einen herrlichen Ausblick auf die weite Ebene hatten, in der die Saale mäanderte. Nach einer Stärkung mit Bier und Brezeln machten sich die beiden auf, die Ruine zu erkunden. Immer neue Ausblicke auf die Landschaft ringsum, die Hügel, die Weinberge und die Ortschaften, eröffneten sich. Mauersegler führten ihre waghalsigen Flugmanöver vor, über den Feldern sah man Turmfalken rütteln.
Gustav war plötzlich müde und wollte für eine Weile im Schatten der Bäume unterhalb der Burg ruhen. Louise dagegen hatte sich von dem Aufstieg wieder erholt. Außerdem erschien es ihr höchst unschicklich, an seiner Seite zu ruhen, selbst wenn sie verlobt waren. So viele Blumen standen auf den Wällen, die die Burg umgaben, dass sie ging, um sie zu pflücken. Sie merkte nicht, wie die Zeit verging und wie weit sie sich von Gustav entfernte. Erst als sie aufschaute, gewahrte sie, dass sie jetzt einen ganz anderen Blick auf die Burg hatte als zuvor. Langsam ging sie zurück zu der Stelle, wo sie Gustav unter den Bäumen zurückgelassen hatte. Sein Gesicht sah im Schatten sonderbar bleich aus. So reglos lag er da, dass sie erschrak, doch im nächsten Moment schlug er die Augen auf und lächelte sie an.
»Hast du mir Blumen mitgebracht, meine Liebste?«
Schwungvoll erhob er sich und nahm sie in seine Arme.
»Ja, Gustav, sie sind alle für dich«, erwiderte sie errötend, denn es war das erste Mal, dass sie einander nicht nur beim Vornamen nannten, sondern auch »Du« zueinander sagten.
Meißen, im September 1840
Antonie und Julius waren zu Besuch gekommen. Louise hatte ihnen ein Zimmer hergerichtet, besonders liebevoll gebacken und gekocht, wie sonst nur für Gustav, der sie seit ihrer Verlobung an jedem zweiten Wochenende besuchte.
Etwas befremdet hatte Louise die nur widerwillig ausgesprochene Gratulation zu ihrer Verlobung gehört und sich vorgenommen, ihre Schwester in einem stillen Moment zu befragen, wieso sie ihr dieses Glück nicht gönne. Aber Antonie hielt nichts von Diskretion: »Wieso runzelst du die Stirn, Louise? Erwartest du tatsächlich, dass ich dir gratuliere, wenn du einen solchen Mann heiraten willst? Noch ist nicht alles verloren. Du kannst ihm immer noch sagen, dass du es dir anders überlegt hast.« Sie schob den halb leergegessenen Teller von sich und schaute Louise mehr ärgerlich als besorgt an.
»Wovon redest du? Alle Menschen, denen ich in Dresden oder hier in Meißen Gustav vorgestellt habe, sind begeistert von ihm. Menschen, die ihr alle schätzt. Die können sich nicht alle irren. Wieso sagst du so hässliche Dinge?«
Statt einer Antwort zog Antonie einen Brief aus ihrer Tasche. »Hier! Lies! Und Francisca hat auch einen solchen Brief bekommen.«
Unsicher faltete Louise den Brief auseinander und las in schlechten Worten, dass Gustav in Leipzig mehr mit Künstlern und liberalen Politikern verkehre als mit Juristen, ja, dass er sich während seines Studiums schon mehr mit diesem Pöbel abgegeben habe als mit seinen Fachgenossen. Er werde niemals Karriere machen, weil seine Verbindungen in diese Kreise äußerst schädlich für eine anständige Anstellung seien. Außerdem werde er niemals eine Familie ernähren können, da er seinen heruntergekommenen Vater unterstütze. Und schließlich sei er kein Kind von Traurigkeit. Vor seiner jetzigen Verlobung sei er schon einige Liebesverhältnisse eingegangen, habe sich mit leichtsinnigen Frauenzimmern abgegeben. Dadurch habe er für sich in Leipzig, wo man ihn kenne, eine Heirat mit einem anständigen Mädchen von vornherein verbaut.
»Wer hat das geschrieben?«, fragte Louise tonlos, als sie den Brief wieder auf den Tisch legte.
»Es stand kein Absender drauf«, antwortete Antonie schnippisch.
»Ich hab’s gleich gewusst und auch gesagt!«, rief Tante Malchen, die von Antonie bereits ins Bild gesetzt worden war.
»Da schreibt jemand einen anonymen Brief und ihr alle glaubt einem solchen Schmierfinken?« Louise war außer sich.
»Louise, wer sollte denn ein Interesse haben, eine vorteilhafte Verlobung zu hintertreiben?« Antonie hatte die Haltung einer Matrone eingenommen, die sich im Leben auskannte. Julius schaute etwas unsicher zur Seite.
»Julius, was sagst du dazu?«, flehte Louise.
»Ich kenne Herrn Müller nicht, aber ich habe bei meinen Kollegen in Leipzig Erkundigungen eingezogen über ihn.«
Louise schnappte nach Luft. »Ohne mir oder ihm etwas davon zu sagen?«
»Sie bestätigen alle, was in dem Brief steht.«
»Louise!«, sagte Antonie nun in einem Ton, als spreche sie zu einem Kind, »Du wirst darüber hinwegkommen. Es gibt andere Männer; Männer, die Karriere machen. Ein Mann, der ganz oben auf der Leiter steht, kann dir ein viel schöneres und vor allem sichereres Leben bieten. Du wärst versorgt – sogar als Witwe.« Antonie sah nicht das Zucken im Augenwinkel ihres Gatten.
Louise erhob sich. »Ich weiß gerade nicht, wen ich mehr bedauern soll, dich oder deinen Mann. Geht es denn in einer Ehe nur darum, dass man ein schönes Leben hat und versorgt ist? Alles, was dieser Schmierfink da schreibt, hat Gustav mir selbst schon gesagt. Alles. Auch von seinem Vater, der nach einem Unfall auf seine Hilfe angewiesen ist und ja, auch von Liebesverhältnissen, die er vor mir hatte. Er ist dreißig Jahre alt. Glaubt ihr denn wirklich, ich sei so naiv, zu erwarten, dass er sich unter einer Käseglocke für mich aufgespart hat? Gerade weil ich nicht seine erste Liebe bin, kann ich sicher sein, dass seine Gefühle kein unreifes Empfinden sind, sondern tatsächlich Liebe. Seine Vorgängerinnen mögen ihn enttäuscht haben, aber ich werde es nicht.« Sie ging hinaus und schloss die Tür still hinter sich.
Wenn ihre Schwester und die Tante auch nur geahnt hätten, dass es nicht nur liberale Politiker waren, sondern die noch viel schlimmeren, radikaleren Demokraten, mit denen sich Gustav traf!
Ja, es waren Künstler, Literaten, Demokraten und dergleichen lichtscheues Gesindel, das sich zwischen den biedermeierlichen Blümchentapeten zusammenrottete, um das friedhofsruhige Idyll, das allenthalben in den Ländern des Deutschen Bundes herrschte, zu erschüttern. Gustav und seine Mitstreiter waren nicht die Einzigen, die sich heimlich trafen und bald mehr wollten, als von einer Demokratie nur zu träumen. Es gärte noch immer; man wartete nur auf den rechten Zeitpunkt.
Antonie und Julius mussten bald einsehen, dass Louise sich nicht beirren ließ, und reisten unverrichteter Dinge wieder ab. Zur Hälfte konnte Louise ein wenig aufatmen, allerdings dauerte es bei Tante Malchen noch eine ganze Weile, bis auch sie in ihren Nörgeleien und spitzen Bemerkungen nachließ.
Es war schon Dezember. Louise und Tante Malchen hatten sich gut auf den Winter vorbereitet, Vorräte angelegt, besondere Genüsse für Weihnachten beiseitegeschafft und freuten sich auf das Fest. Louise wollte die Weihnachtsfeiertage bei ihrer Schwester in Mühlberg verbringen, Tante Malchen war bei Freundinnen eingeladen. Aber auch wenn sie beide nicht da waren, mussten die geschnitzten Engel im Fenster stehen, damit ihre friedlichen Gesichter in die Stube blickten. Lange konnte Louise einfach nur dasitzen und die beiden Holzfiguren anschauen, aus deren Gesichtern ein tiefer Friede sprach. So viele Weihnachten hatten die beiden schon gesehen, hatten schon auf Louises junge Eltern geblickt, auf Heinrich, auf Clementine, auf alle, die hier in dieser Wohnung gelebt hatten. Heute würden sie Gustav sehen und noch viele Weihnachten mit ihm. Auf wie viele Kinder würden sie wohl schauen?
Da läutete die Türglocke. »Ich mach auf!«, rief Louise und war schon aufgesprungen. Durch die Milchglasscheibe konnte sie schon erkennen, dass Gustav vor der Tür stand, und riss sie entsprechend schwungvoll auf. »Gustav! Wie schön, dass du da bist. Ich hab schon so sehr auf dich gewar …« – Louise verstummte.
»Guten Tag, Louise. Du bist ja auf einmal ganz blass. Ich dachte, du freust dich, mich zu sehen.« Er hüstelte.
»Gustav?«, flüsterte Louise. »Geht es dir gut?«
»Es geht mir gut, und es wird mir gleich noch viel besser gehen, wenn du mich reinlässt.«
Sie trat einen Schritt zur Seite und ließ ihn ein. Schon als er seinen Mantel auszog, sah Louise, dass er stark abgenommen hatte, denn die Weste, die er sonst ausgefüllt hatte, saß ganz locker. Er musste ihren Blick bemerkt haben. »Mach dir bitte keine Sorgen. Ich hatte nur sehr viel zu tun und noch mehr Sehnsucht nach dir. Da habe ich keinen Bissen runtergebracht. Aber jetzt plagt mich Hunger.« Lachend rieb er seine kalten Hände aneinander und warf einen Blick ins Wohnzimmer, aus dem es nach Kaffee und Kuchen duftete. Mittlerweile wurde er selbst von Tante Malchen wohlwollend empfangen, denn bei seinen vielen Besuchen hatte er dank seines stillen, freundlichen Wesens irgendwann auch ihr Herz gewonnen. – Nicht zuletzt, weil er damit einverstanden war, dass Tante Malchen nach der Hochzeit bei ihnen wohnen sollte, damit sie versorgt war.
»Louise hat einen besonders guten Striezel gebacken. Essen Sie den mit Verstand, denn Louise hat drauf bestanden, richtige Rosinen reinzutun«, sagte Tante Malchen, während sie die Kaffeegedecke zurechtrückte. »Nicht nur kleingeschnippelte Dörrpflaumen, sondern richtige Rosinen.« Ihr Tonfall machte klar, dass dieser Striezel nicht mit Gold aufzuwiegen war.
»Ich hab auch Lebkuchen gebacken, und natürlich kriegst du einen Pflaumentoffel.«
»Bin ich dafür nicht schon ein wenig zu alt?«, fragte er und dankte seiner Braut mit einem Lächeln, als sie ihm Kaffee einschenkte.
»Für liebevolle Geschenke ist man nie zu alt.« Louise sah glücklich, wie Gustav genüsslich kaute. Ja, es würde ihr Freude machen, ihn zu verwöhnen. Diese schönen Gedanken beendete Gustav abrupt mit einem Hüsteln, das er vergeblich zu verbergen suchte.
»Gustav?«, fragte Louise bange. »Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist?«
»Natürlich, Louise, ich hatte nur einen Krümel im Hals.«
Doch Gustavs Hüsteln hörte nicht auf, selbst als sie längst keinen Kuchen mehr aßen und der Tisch abgeräumt war.
»Louise, bitte, schau mich nicht so ängstlich an. Ich hab dir schon jetzt dein Weihnachtsgeschenk mitgebracht. Willst du es öffnen?« Er reichte ihr ein kleines Päckchen, dessen Schleife sie vorsichtig löste.
»Ein Medaillon mit deinem Porträt! Und wie gut es getroffen ist. Jetzt hab ich dich immer bei mir.« Selig drückte sie das Bild an sich. Dann sprang sie auf. »Aber ich hab auch was für dich. Warte, ich hole es gleich.« Und während sie in ihr Zimmer lief, um Gustavs Geschenk zu holen, hörte sie ihn husten. Es kostete sie unendliche Kraft, mit einem Lächeln ins Wohnzimmer zurückzukehren.
»Hier ist dein Geschenk. Ich bin so gespannt, was du sagst.«
Gustav öffnete das flache Päckchen mit sichtlicher Ehrfurcht. Zum Vorschein kam ein Wandkalender, auf den Louise die Rudelsburg und den Plauenschen Grund in Dresden gestickt hatte.
»Es ist wunderschön. – Die Orte, an denen wir so glücklich waren.« Sein Tonfall ließ Louise aufhorchen. Er ahnte also, dass ihr Glück der Vergangenheit angehörte. Mit unsicherer Stimme flüsterte sie: »Du musst wieder zu Kräften kommen, Gustav. Hörst du? Du musst unbedingt essen, dich ausruhen und wieder kräftiger werden.«
Gustav nickte schweigend und wagte nicht, sie anzuschauen, aber dann straffte er sich. »Es ist wirklich nur ein Husten. Ein Katarrh. Das wird schon wieder. Und so dünn bin ich nur geworden, aus lauter Sehnsucht nach dir. Wenn wir erst verheiratet sind und du immer bei mir bist, dann will ich schon wieder zunehmen.« Er drückte ihre Hand. So gerne hätte er sie geküsst, wenigstens auf die Stirn, aber Tante Malchen, die am Fenster saß, konzentrierte sich nur scheinbar auf ihre Stickerei. Sie sah genau, was auf dem Sofa vor sich ging.
»Verzeih mir meine dummen Sorgen, Gustav. Ja, lass uns zuversichtlich in die Zukunft schauen.«
Das gelang ihr nicht immer. Die Weihnachtstage in Mühlberg konnte sie kaum genießen; immerhin schrieb sie weiter an ihrem Roman und blieb natürlich auch in Kontakt mit ihren Freundinnen und Gustav.
Im Februar hatte Louise eine Einladung von Caroline von Bonniot bekommen. Überglücklich packte sie ihren Koffer, denn auch Gustav versprach, in Dresden zu sein. Gustavs Leiden war dergestalt fortgeschritten, dass er es nicht mehr verbergen konnte. Sein Husten war so schlimm, dass er seinen abgemagerten Körper schüttelte. Es war so offensichtlich, dass Caroline und Liddy alles versuchten, Louise zu trösten. Aber Louise kannte das Krankheitsbild der Auszehrung, das Verschwinden der Lebenskräfte. Sie hatte ihre Schwester, ihre Mutter daran sterben sehen. Es gab keinen Ausweg.
Beim Abschied schon spürte sie, wie kraftlos sein Händedruck war. Es kostete sie eine übermenschliche Anstrengung, auf dem Bahnsteig nicht in Tränen auszubrechen. Das Pfeifen des Schaffners erschien Louise wie ein grausames Fanal. Gustav musste einsteigen, ging durch den Waggon, während Louise ihm auf dem Bahnsteig folgte. Als er an einem leeren Abteil angekommen war und sich ans Fenster setzte, legte er seine flache Hand an die Scheibe. Louise legte ihre von außen dagegen, und als habe er auf diese kleine Geste nur gewartet, pfiff der Schaffner erneut. Der Zug ließ sein schrilles Pfeifen tönen, Louise wurde eingehüllt in eine Wolke aus Dampf, dann setzten sich die Stangen und Räder der Lokomotive in Bewegung. Louise lief so schnell es ihr verwachsener Körper zuließ, neben dem Zug her, doch schnell hatte der Zug den Bahnhof verlassen und Louise konnte nur noch zuschauen, wie er immer kleiner wurde und schließlich verschwand.
Bald nach ihrer Abreise aus Dresden war Gustav schon zu schwach, um sie in Meißen zu besuchen. Ein Brief kam. Louise erkannte kaum Gustavs Handschrift, so unsicher waren die Buchstaben.
»Das Schwert des Damokles hängt über jedes Menschen Haupt, und die Glücksgöttin wendet uns oft heimtückisch gerade da den Rücken, wo wir uns ihrer Gunst am sichersten glaubten. – Aber was bedürfen wir denn auch noch zu unserem Glück? Unsere Seelen sind so innig verschwistert wie unsere Herzen, und sie werden es bleiben über Zeit und Raum hinaus. Halte an dieser Gewissheit fest, sie wird dich mit Ergebenheit tragen lassen, was über uns beschlossen ist.«9
Weinend sank sie auf ihr Bett. Ja, es war schon beschlossen. Bilder stiegen in ihr auf. Die bleichen Gesichter ihrer Mutter, ihrer Schwester, ausgemergelt, mit tief in den Höhlen liegenden Augen. Sie sah Clementine vor sich, wie sie in ihrem Bett lag, vom Husten geschüttelt wurde und immer mehr Blut spuckte. Die Angst um Gustav schnürte ihr die Kehle zu, denn es war sein Gesicht, das ebenso bleich und eingefallen vor ihrem inneren Auge schwebte. Ihr war, als packe eine riesige Klaue aus Eis ihr Innerstes.
Francisca schrieb ihr einen sehr liebevollen Brief, um sie zu trösten. Selbst Antonie ließ sich zu warmherzigen Worten hinreißen, aber Louise hatte das Gefühl, als stehe zwischen Antonies Zeilen die Erleichterung, dass sich »diese Sache« nun auf diese Weise erledigte.
Tante Malchen schwieg, wofür Louise ihr dankbar war.
Dresden – Strehlen, im April 1841
Gustav hatte sich auf Anraten seines Arztes eine Sommerwohnung in Strehlen genommen; eine kleine Wohnung am Stadtrand gelegen, mit einem Garten und großen Fenstern, die die Sonne einließen.
Louise nahm sich eine Wohnung in der Nähe und war Tante Malchen wiederum dankbar, dass sie mitgekommen war, um sie bei der Pflege ihres sterbenden Bräutigams zu unterstützen. An den schönen Tagen saßen sie in Gustavs Garten, er eingehüllt in eine Wolldecke. Wenn kein Besuch da war – der Gustav mehr und mehr anstrengte – las Louise ihm mit leiser Stimme vor.
»Louise!«, flüsterte er und legte seine Hand auf ihren Arm. »Du wirst noch lange leben. Du musst leben. Du musst schreiben. Die Menschen werden dich und deine Schriften brauchen. Deine vielen Romane, die du noch schreiben wirst. Deine Gedichte und Artikel. Du musst sie alle veröffentlichen. Du bist die Stimme der armen Menschen. Sie haben keine außer dir.«
Louise konnte ihre Tränen nicht zurückhalten. »Gustav, so gerne wäre ich mit dir gemeinsam ihre Stimme.«
»Ich muss fort. Ich sollte trauern, dass ich dich verlassen muss, meine Braut. Fälschlicherweise sind es immer die Lebenden, die so sehr trauern. Weine nicht um mich. Mir wird es bald gut gehen. Freue du dich für mich, dass ich bald erlöst bin, und lass mich trauern, dass ich dich verlassen muss.«
Louise wollte ihn umarmen, doch Gustav verwehrte es ihr, denn zu groß war die Gefahr, dass er ihr mit seiner liebenden Umarmung auch den Tod brachte.
Am ersten Mai 1841 wurde Gustav auf dem Johannisfriedhof in Dresden beerdigt. Louise war bis zum letzten Atemzug bei ihm gewesen, hatte ihm eine ihrer Locken auf die Brust gelegt, bevor der Sargdeckel über ihm geschlossen wurde. Nun konnte sie nicht mehr. Während Gustavs Sarg in die Erde gesenkt wurde, kniete sie betend in ihrem Zimmer. Für sie gab es nichts mehr als den Gedanken an ihn.
Ihre Schwestern und Freundinnen wollten sie in dieser schweren Zeit auffangen, ihr beistehen, aber Louise wollte nichts und niemanden sehen und hören.
Das erste Gedicht, das sie veröffentlichte, stand auf seinem Grabstein:
In meinem Herzen steht Dein Bild,
Dein Name klingt durch meine Lieder!
Mit Bild und Tönen nah ich mild
Trotz Leid und Grab zu Dir mich wieder:
Denn zweier Seelen reine Harmonie
Verstimmt des Todes schriller Misston nie!
Deine Louise