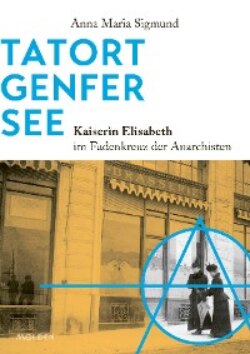Читать книгу Tatort Genfer See - Anna Maria Sigmund - Страница 8
EINE OBDUKTION IM GRAND HÔTEL
ОглавлениеDie sterbende Kaiserin wird vom Schiff getragen. Lithografie, 1898.
Ich weiß es mir auch nicht auszudenken, dass sie auf gewöhnliche Art aus dem Leben scheiden könnte, nachdem sie in das reale Leben nicht hineingehört. Ihre Lebensatmosphäre ist eine andere als diejenige, wo wir atmen.
Constantin Christomanos, Lehrer und Vorleser der Kaiserin Elisabeth, 1892
Am 10. September 1898 gelangte das berühmte Grand Hôtel Beau-Rivage in Genf durch eine Tragödie in das Blickfeld der breiten Öffentlichkeit. Diese war von der Art, wie sie jeder Hotelbesitzer fürchtet und zu verheimlichen sucht – der Tod eines Gastes im eigenen Haus. Geheimhaltung war im vorliegenden Fall allerdings unmöglich, da es sich um die Kaiserin von Österreich handelte.
Der Ort des Todes: das Luxushotel Beau-Rivage in Genf.
Bereits einen Tag später, am Sonntag, dem 11. September 1898, beherrschte das Drama am Genfer See die Schlagzeilen der Zeitungen. Es war die erste große Sensationsnachricht in der Geschichte, die mittels moderner Technologie, des neuen Telegrafen, in Blitzesschnelle um die ganze Welt ging: So las man im Wiener Tagblatt:
»Die Kaiserin ermordet! Kaiserin Elisabeth
verließ das Hotel Beau-Rivage, um sich nach dem
Landungsplatze des Dampfers zu begeben. Auf
dem Weg dorthin stürzte sich ein Individuum auf
die Kaiserin und führte einen heftigen Stoß gegen
dieselbe. Die Kaiserin fiel zu Boden, erhob sich
jedoch wieder und erreichte den Dampfer Genève,
wo sie in Ohnmacht fiel. Das Schiff … kehrte
zum Landungsplatz zurück. Die Kaiserin hatte
das Bewußtsein nicht wiedererlangt und wurde auf einer rasch hergestellten
Tragbahre nach dem Hotel Beau-Rivage gebracht.
Die Kleider der Kaiserin zeigten Blutflecken.
Der Thäter wurde festgenommen.«
Der Schaufelraddampfer »M/S Genève« verkehrte seit 1896 auf dem Genfer See und konnte 850 Passagiere transportieren. 1973 wurde er außer Dienst gestellt und liegt heute am linken Seeufer in der Nähe des Jet d’Eau verankert.
In Genf hatte sich das Gerücht von dem brutalen Überfall unmittelbar nach der Tat wie ein Lauffeuer verbreitet. Mit einem Schlag war es mit der noblen, stillen Atmosphäre in der exklusiven und sündteuren Luxusherberge, die bevorzugt von Adeligen, den Reichen und Schönen, gebucht wurde, vorüber. Trotz der mittäglichen Gluthitze fand sich auf dem Quai du Mont-Blanc eine gaffende, sensationslüsterne Menge ein, die sich durch neugierige Ausflügler, die auf der nahen Bootsstelle anlandeten, ständig vergrößerte. Man blickte zu den verhangenen Fenstern hinauf, hinter denen man die Verletzte vermutete, rätselte über das Motiv der Tat und quittierte mit Raunen das hektische Kommen und Gehen von Ärzten, Beamten, Polizisten und schließlich das Erscheinen eines Priesters. Noch hatte man nur spärliche Augenzeugenberichte. Vor allem, wer war die unbekannte Dame, die derartiges Aufsehen erregte? Tatsächlich eine Aristokratin? Man sprach von einer Gräfin von Hohenembs.
Um diese Zeit war das Verhör des Attentäters bereits in vollem Gang. Die Personalien waren rasch erhoben: Es handelte sich um einen gewissen Luigi Lucheni, wohnhaft in der Rue d’Enfer Nr. 8 in Genf und dies erst seit dem 8. September 1889. Sofort nach seiner brutalen Attacke hatten Passanten den vor Freude über das ganze Gesicht strahlenden und singenden Lucheni in der Rue des Alpes festgehalten und einem Gendarmen übergeben. Dieser schützte ihn vor der Wut einer empörten Menge, konnte aber nicht verhindern, dass Monsieur Mayer, der Direktor des Beau-Rivage, dem Übeltäter eine schallende Ohrfeige verpasste.
Das Bild des grinsenden Attentäters und Anarchisten ging um die Welt.
Zur selben Zeit bemühten sich in ihrer Hotelsuite zwei Ärzte um die in Agonie liegende bewusstlose, nur mehr schwach atmende Kaiserin. An ihrem Bett standen die Gattin des Hoteliers, eine Pflegerin und Gräfin Irma Sztáray, ihre 35-jährige Hofdame. Letztere wies den Arzt, Dr. Étienne Golay, auf die kleine Wunde in der Brust Elisabeths hin, die sie schon auf dem Schiff nach dem vermeintlichen Raubüberfall des Attentäters entdeckt hatte, als sie ihrer Herrin das Mieder öffnete, um ihr Luft zu verschaffen. Beim Anblick der kleinen blutenden Wunde wurde Sztáray von bösen Vorahnungen ergriffen. Der Arzt erkannte eine Stichverletzung, obwohl man keine Waffe in der Hand des Attentäters bemerkt hatte. Er versuchte mit einer Sonde in den Kanal einzudringen. Da sich die Wundöffnung jedoch bei Entfernung der Kleidung von ihrer ursprünglichen Stelle verschoben hatte, gelang ihm dies nicht. »Es ist keine Hoffnung mehr«, meinte er schließlich resignierend, als die kaiserliche Patientin rapide verfiel. Wiederbelebungsversuche lehnte er als sinnlos ab. Ein rasch herbeigerufener Priester erteilte der Sterbenden die Generalabsolution.
Während Kaiserin Elisabeth in Genf ihre letzten Züge tat, saß Kaiser Franz Joseph an seinem Schreibtisch im Schloss Schönbrunn in Wien und schrieb, wie er es jeden zweiten Tag zu tun pflegte, an seine Gattin in der Schweiz. Er hatte »der süßen, lieben Seele« nicht viel zu berichten, sein Tagesablauf war monoton. So erzählte er kurz Banales von der gemeinsamen Freundin Katharina Schratt und von seiner kargen Abendmahlzeit, die er tags davor, kurz nach 18 Uhr allein zu sich genommen hatte, um schließlich zu enden: »… um ½ 9 Uhr abends reise ich vom Staatsbahnhof zu Manövern ab.« Er zeichnet mit »Dich von ganzem Herzen umarmend, Dein K.(leiner)«.
»kaiserin gefaehrlich verwundet, bitte seiner majestaet mit vorsicht mittheilung zu machen«: Über Veranlassung von Irma Sztáray sendet Adolph Mansbach, der österreichisch-ungarische Honorarkonsul in Genf, dieses Telegramm an die österreichisch-ungarische Gesandtschaft in Bern. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Gesandtschaftsarchiv Bern, Karton 102.
Gräfin Sztáray weilte zutiefst ergriffen und erschüttert am Totenbett Elisabeths. Sie hatte die Kaiserin verehrt und war ihr drei Jahre lang, mehr Vertraute als Hofdame, zur Seite gestanden. In den folgenden alptraumartigen Stunden und Tagen bewies sie erstaunliche Haltung, Kompetenz und Organisationstalent. Kurz vor 15 Uhr sandte sie – über das österreichisch-ungarische Konsulat in Genf – eine Depesche an Generaladjutant Eduard Graf Paar am Wiener Kaiserhof, die sich durch besonderes Feingefühl auszeichnete: »Ihre Majestät die Kaiserin wurde schwer verwundet. Bitte dies Seiner Majestät dem Kaiser schonungsvoll zu melden.« Das ganze Ausmaß dieser neuerlichen Tragödie in seiner von Unglücksfällen heimgesuchten Dynastie sollte den 68-jährigen Kaiser Franz Joseph nicht ganz unvorbereitet treffen.
Zu diesem Zeitpunkt war die Kaiserin bereits tot. Um 14 Uhr 40 hatten die Ärzte bei ihr offiziell den Herzstillstand konstatiert, nachdem bei der Öffnung der Schlagader ihres linken Arms kein Blutstrom mehr festzustellen war.
Kurz danach meldete sich Karl Graf Kuefstein, der österreichisch-ungarische Gesandte in Bern. Er bot seine Hilfe an, informierte die Dienststelle in Bern und veranlasste die offizielle Benachrichtigung des Kaiserhofs in Wien.
»Es war ein erschütternder Eindruck, der die Vergänglichkeit alles Irdischen so recht vor Augen führte«: die Aufbahrung der toten Kaiserin im Ecksalon des Hotels Beau-Rivage. Illustration im »Interessanten Blatt«, 22. September 1898.
Um 16 Uhr sandte die Gräfin ein weiteres Telegramm: »Ihre Majestät die Kaiserin ist entschlummert.« Auf die Nachricht der Ärzte, dass die Monarchin ihren Verletzungen erlegen sei, eilten der Generalstaatsanwalt von Genf, Georges Navazza, sowie der Untersuchungsrichter Charles Léchet zu Fuß an den Tatort, der bereits von einem großen Polizeiaufgebot abgeriegelt worden war. Kurz darauf berief der Genfer Staatsrat eine Sondersitzung ein.
Es war Gräfin Sztáray, die die Aufbahrung vornahm. Sie schloss der Toten, deren Mund ein sanftes Lächeln umspielte, die Augen, legte einen Rosenkranz um ihre Finger und faltete ihr die Hände auf der Brust. Mithilfe einer Hotelbediensteten brachte sie das Sterbezimmer in Ordnung, stellte ein Kruzifix samt brennenden Kerzen auf, besorgte Blumenschmuck. Sie empfing auch den Totenbeschauer, der die Sterbeurkunde mit dem Todeszeitpunkt 14 Uhr 40 ausfertigte.
Elisabeths umsichtige Hofdame Irma Sztáray. Aufnahme des Budapester Hoffotografen Strelisky. Ihren Dienst bei der Kaiserin hatte die Gräfin 1894 als 30-Jährige angetreten, 1909 veröffentlichte sie ihr Buch »Aus den letzten Jahren der Kaiserin Elisabeth«.
Um 17 Uhr langte die Todesnachricht bei Graf Paar ein, der gerade die Abreise des Kaisers zu den Korpsmanövern bei Leutschau in der Slowakei vorbereitete. Zusammen mit Graf Agenor Goluchowski, dem Minister des Äußeren, informierte er den Monarchen. Die heroische Selbstbeherrschung des Kaisers überraschte seine Umgebung. Wortlos hielt er den Kopf in die Hände gestützt, bis er lapidar murmelte: »Mir bleibt doch gar nichts erspart auf dieser Welt.« An den großen Manövern, zu denen man auch Kaiser Wilhelm II. erwartete, wollte er trotz allem teilnehmen. Pflichterfüllung im Rahmen seines Amtes hatte für den Monarchen oberste Priorität. Aus Gründen der Staatsräson bewog man ihn zum Verbleib in Wien.
Zur selben Zeit unterzog Untersuchungsrichter Léchet die mit den Tränen kämpfende, unter Schock stehende Gräfin Sztáray einer ersten Befragung. »Sie erklären, dass die Tote Elisabeth, Kaiserin von Österreich und Königin von Ungarn, ist?«, fragte er misstrauisch. »Im Gästeregister steht allerdings Gräfin von Hohenembs!« »Ihre Majestät reiste inkognito«, lautete die Antwort, die später der Hoteldirektor Monsieur Mayer bestätigte. »Das ist bei privat reisenden gekrönten Häuptern nicht unüblich«, erklärte er. »Damit entgehen sie protokollarischen Verpflichtungen, brauchen keine Einladungen annehmen und auch keine aussprechen.«
Bei Kaiserin Elisabeth wäre es anders gewesen. Diese zurückhaltende, fast scheue Dame wollte tatsächlich von Fremden nicht erkannt werden. Aus diesem Grund hatte man auch nicht die schwarz-gelbe Flagge der Doppelmonarchie auf dem Hotel gehisst. Aber jeder wusste, wer die Dame war, es war kein Geheimnis. »Wir teilten dies auch den Zeitungen mit. Selbstverständlich wurde sie von uns mit ›Majestät‹ angesprochen und nicht mit ›Gräfin‹. Das wäre ein Fauxpas gewesen«, klärte der im Umgang mit Kaisern und Königen versierte Direktor die Polizeibehörden auf.
Irma Sztáray gab Léchet genaue Auskünfte über die Person der Kaiserin, ihren Kuraufenthalt in Caux bei Territet, ihren Besuch in Genf und den Ablauf der Schreckenstat. Man fertigte darüber gerade ein Protokoll an, als die noch anwesenden Ärzte den Untersuchungsrichter allein zu sprechen wünschten. Danach erklärte Léchet der Hofdame, dass nach Schweizer Recht gegen einen Täter Mordanklage nur nach Vorlage eines Autopsieberichts erhoben werde könne. Vor allem bei den mysteriösen Begleitumständen des vorliegenden Falls sei dies unumgänglich. Man bedauere, aber auch bei einer Kaiserin von Österreich könne man keine Ausnahme zulassen. Es sei Aufgabe der Schweizer Behörden, den medizinisch einwandfreien Nachweis der Todesursache zu erbringen, eventuelle Theorien von plötzlichem Herzversagen oder Schlaganfall zu widerlegen und alle haltlosen Gerüchte zu unterbinden.
Léchet bat die Gräfin, sich beim Wiener Hof – so rasch als möglich – für die Erlaubnis zu einer Autopsie einzusetzen. Die Hofdame lehnte entsetzt ab. Dies überschreite ihre Kompetenzen. Der insistierende Untersuchungsrichter betonte, dass aufgrund der hochsommerlichen Hitze Eile geboten sei.
Auch Graf Adam von Berzeviczy, der Haushofmeister der Ermordeten, suchte beim Wiener Hof um eine »innere Leichenschau« an, wurde jedoch brüsk abgewiesen. Danach versuchte er die Schweizer Polizei mit spitzfindigen protokollarischen Argumenten von der Obduktion abzubringen: »Die Leiche im Beau-Rivage ist jene der Gräfin von Hohenembs. Erst wenn die Tote die Grenze passiert, wird sie wieder zur Kaiserin von Österreich!«
Schließlich telegrafierte Graf Kuefstein am 11. September um 9 Uhr nach Wien:
»Die Professoren erklären, dass Öffnung des Herzens unbedingt notwendig ist, um die Tiefe des Stichs und unmittelbare Todesursache zu constatieren. Bitte dringend um Genehmigung, da nicht länger gewartet werden kann.« Schließlich lenkten die Schweizer Behörden ein. Aus Rücksicht auf die Gefühle des Kaisers sei man zu Konzessionen bereit. Drei angesehene Ärzte, Professoren und beeidete Gerichtsmediziner der Universitäten Genf und Lausanne, erklärten, sich auf eine sogenannte »partielle Obduktion« der Umgebung der Wunde und des Herzens beschränken zu wollen.
Feudaler Luxus für gut betuchte Gäste: die Empfangshalle des Beau-Rivage, das 1865 von Jean-Jacques Mayer gegründet wurde. In der Suite 119/120 verbrachte Elisabeth inkognito als »Gräfin von Hohenembs« ihre letzte Nacht.
Am 11. September gegen 12 Uhr traf dann die Zustimmung des Kaisers, der sich lange gegen eine derartige, ihm unverständliche Pietätlosigkeit wehrte, ein. Den Ausschlag hatte die Formulierung »partielle Obduktion« gegeben. Graf Kuefstein telegrafierte erleichtert nach Wien: »Tiefen Dank für die beiden Telegramme. Meine heute abgegebenen Berichte werden bestätigen, dass ich ganz im Sinne der Allerhöchsten Intentionen für die Beschränkung auf das unumgänglich Notwendige bereits eingetreten bin und dafür die sicherste Verbürgung erhalten habe. Morgen soll eine imposante Trauerkundgebung der Bevölkerung vor dem Hotel stattfinden.«
Noch um 14 Uhr des selben Tages fand dann bislang Unvorstellbares statt – die Obduktion einer Habsburgerkaiserin in der Hotelsuite eines Genfer Hotels. In dem hermetisch geschlossenen, heißen Raum herrschte eine dumpfe Atmosphäre. Die Tote verströmte bereits den typischen Leichengeruch. Die Professoren Auguste Reverdin, Hippolyte Jean Gosse und Louis Mégevand, alles renommierte Pathologen der Universitäten von Genf und Lausanne, banden Gummischürzen um und krempelten ihre Hemdsärmel auf. Dies geschah in Beisein zahlreicher Zeugen, unter ihnen Georges Navazza und Graf Berzeviczy sowie Graf Kuefstein als Vertreter der k. u. k. österreichisch-ungarischen Monarchie, aber auch die Hofdame Irma Sztáray. Anwesend waren auch noch zwei weitere Mediziner: der Genfer Arzt Dr. Étienne Golay und Dr. Mayor, Professor an der medizinischen Fakultät in Genf.
Amtierte seit 1897 als Generalstaatsanwalt in Genf: der brillante Redner Georges Navazza. Gemälde von Ferdinand Hodler, 1916. Der »Fall Lucheni« trug entscheidend zu seiner Popularität bei.
Die Kommission beginnt mit einer genauen Untersuchung des mit einem weißen Laken bedeckten, auf einem Hotelbett liegenden Leichnams. Man vermerkt die Daten der toten Kaiserin, die im 61. Lebensjahr gestanden war, misst sie ab und stellt eine Größe von 172 cm fest. Ihren linken Arm ziert ein Anker, den sich Elisabeth einst gegen den Protest ihres Gatten aus Liebe zum Meer hatte eintätowieren lassen. Ihr prächtiges, dichtes Haar ist kastanienbraun. Ob die im Hinblick auf das fortgeschrittene Alter ungewöhnliche Farbpracht echt oder künstlich ist, ist irrelevant und bleibt ohne Prüfung. Das entspannte Gesicht der Toten legt ein ruhiges Hinscheiden ohne schmerzhaften Todeskampf nahe. Keinerlei Ausfluss aus Nase und Mund. Der Teint weist eine blassgelbe Farbe auf, die Temperatur der Haut wird als »lauwarm« angegeben, Indizien kündigen die beginnende Leichenstarre an. Man stellt nur sehr geringes Unterhautfettgewebe fest), auf dem Unterleib sind Schwangerschaftsstreifen zu sehen, auf den Beinen der Toten finden sich geringe Zeichen von Ödemen, die nach Vermutung der Ärzte von Hungerkuren stammen.
Vierzehn Zentimeter unter dem linken Schlüsselbein, vier über der linken Brustspitze, zeichnet sich die Wunde in Form eines V ab. Aufgrund der Vereinbarung mit dem Kaiserhaus in Wien wird das Herz freigelegt, aber nicht geöffnet. Gräfin Sztáray, die angesichts der Prozedur eiserne Nerven beweist und Anflüge von Übelkeit unterdrückt, berichtet dazu später: »… und ich sah es in der Hand des Arztes, dieses Herz voll Liebe und voll Qual.«
Exakt fünfundachtzig Millimeter tief, so stellte die Kommission fest, war ein zu diesem Zeitpunkt noch nicht näher identifiziertes, spitzes Instrument in den Brustkorb der Kaiserin eingedrungen, hatte dabei die vierte Rippe zertrümmert, war dann durch den vierten Rippenzwischenraum weiter vorgedrungen, hatte den unteren Teil des oberen Lungenflügels durchbohrt und die vordere Fläche der linken Herzkammer getroffen, einen Zentimeter vor dem absteigenden Zweig der Arteria Coronaria, dem Koronargefäß. Die linke Herzkammer wurde vollständig durchstochen, die hintere Scheidewand zeigte eine dreieckige Öffnung in der Größe von ca. 1 mm. Der Herzbeutel wies einen großen Erguss geronnenen Bluts auf, Ursache des Herzstillstands. Den allgemeinen Zustand des Leichnams und seine Verletzungen dokumentierte man mit 69 fotografischen Aufnahmen, die man bei der Gerichtsverhandlung vorführte und anschließend vernichtete.
Noch während der Untersuchungen meldete sich die Portiersfrau eines Hauses nahe dem Hotel Beau-Rivage bei der Polizei. Sie hatte im Hausflur hinter der Eingangstür eine Feile gefunden und zuerst geglaubt, ein Handwerker hätte sie verloren, dann jedoch von dem Attentat auf die Kaiserin gehört. Sie übergab ihren Fund der Polizei. Für die Gerichtsmediziner gab es keinen Zweifel: Es handelte sich um das Mordwerkzeug.
Um 16 Uhr 10 telegrafierte Graf Kuefstein nach Wien, um den Abschluss der Obduktion »in den Grenzen des Allernotwendigsten« und die Einbalsamierung der Leiche mittels Injektionen von Formaldehyd zu melden, eine Prozedur, die für die dabei anwesende Hofdame Sztáray schwer zu ertragen war. Verbreitete sie doch im ganzen Hotel einen beißenden Gestank und machte eine Desinfektion der Räume vor weiterem Gebrauch notwendig.
Am 13. September 1898 verfassten fünf Ärzte den offiziellen und beglaubigten Bericht über die Obduktion. Er stellt auch heute noch für die Biografen Elisabeths eine wichtige Quelle dar, enthält er doch teilweise vollkommen neue Erkenntnisse. An der Objektivität und Integrität der Schweizer Pathologen besteht kein Zweifel, ebenso wenig an ihren beruflichen Qualifikationen. Für eine absichtliche Verfälschung der Untersuchungsergebnisse fehlte das Motiv – das Protokoll ist zweifellos ein wahrheitsgetreuer und exakter Befund über die körperliche Verfassung der Kaiserin von Österreich zum Zeitpunkt ihres Ablebens.
Der Obduktionsbericht vom 12. September 1898, unterzeichnet von den Professoren Hippolyte Jean Gosse, Auguste Reverdin und Louis Mégevand. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Österreichisches Staatsarchiv.
Der Zustand des kaiserlichen Herzens ist dabei besonders interessant. Es wies nur eine minimale, alterskonforme Vergrößerung auf, bis zuletzt verfügte es über eine ausgezeichnete Pumpfunktion. Es gab keinerlei Anzeichen für eine Erkrankung oder Schwächung des Organs.
Für ihr Alter besaß Elisabeth ungewöhnlich gute Zähne. Bonne dentition, ein »ausgezeichnetes Gebiss«, stellten die Professoren fest. Ihre Angaben werden durch Quellen bestätigt. Wie die im Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien verwahrten Rechnungen beweisen, gab Elisabeth große Summen für Zahnärzte aus. Drei Spezialisten bemühten sich um das kaiserliche Gebiss. Dr. Raimund Günther, seines Zeichens Hofarzt, wurde dafür sogar als Edler von Kronmyth geadelt. Daneben zählte auch Levi Spear Burridge, einer der berühmtesten amerikanischen Zahnärzte seiner Zeit, die Kaiserin zu seinen Patientinnen. Der 1887 verstorbene Burridge galt als sehr fortschrittlich, verfertigte bereits Kronen, wurde für ästhetische Zahnpflege geschätzt und führte bereits Mundhygiene durch. In ihren reiferen Jahren vertraute die Monarchin Dr. Otto Zsigmondy, dem damaligen Zahnarzt des Wiener Hofs.
Sie hatte es demnach, wie fälschlicherweise oft kolportiert, nicht notwendig, ihre Zähne hinter einem Fächer zu verstecken. Und bonne dentition schließt ein falsches Gebiss aus. Auch in den erhaltenen Honorarnoten der Zahnärzte finden sich keine Hinweise auf Prothesen. Trotzdem will die Schauspielerin und Zeitzeugin Rosa Albach-Retty, die Großmutter Romy Schneiders, die Kaiserin in einem Restaurant bei der heimlichen Reinigung ihrer falschen Zähne in einem Wasserglas beobachtet haben.
Auf jeden Fall lautete das aufgrund der Untersuchung des Leichnams gezogene Resümee: »Die Kaiserin erfreute sich bis zuletzt bester körperlicher Gesundheit.« Ihre Probleme waren demnach nicht physischer, sondern psychischer Art.
Im Todesjahr der Kaiserin, 1898, kursierten viele Gerüchte, dass diese chronisch krank sei, sich nur mehr mühsam fortbewege. Nur wenige Personen haben damals den Zustand der Monarchin richtig eingeschätzt. So meinte ihre Hofdame Irma Sztáray: »… mit ihrem stählernen Optimismus und ihrer zähen Natur könnte die Kaiserin 100 Jahre alt werden.« Und der berühmte Internist und Neurologe Professor Carl Nothnagel konstatierte nach einer Untersuchung der kaiserlichen Patientin: »Eine partielle Nervenentzündung, nicht ungewöhnlich, sehr schmerzhaft, aber ungefährlich.«
Der Pathologe Louis Mégevand, Mitglied der Obduktionskommission. 1910 nahm er auch die Autopsie an der Leiche Luigi Luchenis vor.
Tatsächlich hätte Elisabeth unter günstigen Bedingungen sehr alt werden können. Dies war die logische Folge ihrer – nach modernen Begriffen – gesunden Lebensweise: Die Kaiserin war eine der kühnsten Springreiterinnen ihrer Zeit. Jahrelang trainierte sie täglich viele Stunden, oft unter Anleitung einer Dressurreiterin vom Zirkus »Krone«. Sie nahm an tollkühnen, anstrengenden Parforcejagden teil. Daneben turnte und schwamm sie gern. Bewegung in frischer Luft fehlte nie, denn sie unternahm lange und ausgedehnte, mit großer Geschwindigkeit zurückgelegte Wanderungen. Training und eiserne Kondition ermöglichten stundenlange Touren. Es freute sie, wenn ihre Bergführer aus Erschöpfung aufgaben. Die Hofdamen wurden im Hinblick auf ihre körperliche Belastbarkeit ausgewählt und aufgenommen.
Immer wieder eingeschobene Hungerkuren schwächten die Kaiserin nicht, modernes Dinner cancelling gehörte zu ihrem Tagesprogramm und ersparte ihr langweilige Abendgesellschaften. Sie konnte sich aber durchaus, wie die Aufzeichnungen ihrer Entourage beweisen, an einer guten Mahlzeit erfreuen, liebte Eis, Konfekt und vor allem frische Milch. In Bayern nahm sie gern die schweren Speisen im Hofbräuhaus zu sich, auf Reisen kehrte sie auch in einfachen Gaststätten ein. Elisabeth hatte, wie alle ihre Schwestern, einen überaus zarten Knochenbau und achtete wie diese auf ihr Gewicht: Sie war stolz auf ihre schlanke Figur und ihre Widerstandskraft. So waren Schifffahrten auf stürmischer See für die Kaiserin ein wahres Lebenselixier – ganz im Gegensatz zu ihrer meist seekranken Begleitung.
Aus Elisabeths Leben ist keine einzige schwere Erkrankung bekannt, auch keine einzige Operation. Trotzdem klagte die Monarchin selbst seit früher Jugend über schlechtes Befinden und schwache Gesundheit. Beides diente ihr als Anlass zur Absage offizieller Verpflichtungen und für häufige Kuren, die erste davon bereits im Alter von 23 Jahren. Damals litt sie unter starkem Husten, man befürchtete Lungenschwindsucht. Es folgte ein mehrmonatiger Genesungsaufenthalt in Madeira. Danach wurden Kuren – oft mehrmals im Jahr – zum festen Bestandteil im Jahresablauf der reisefreudigen Kaiserin. Elisabeth war Stammgast in den bekanntesten Heilbädern Europas. Zur Linderung ihrer Beschwerden fuhr sie unter anderem sechs Mal nach Bad Kissingen und vier Mal nach Meran, weiters in das Seebad von Biarritz, zu den Schwefelquellen in Aixles-Baines und an die Riviera. Hof- und Kurärzte wurden konsultiert. Sie diagnostizierten »matte Herztätigkeit«,«ein geschwächtes, vergrößertes Herz, »wässrige« Blutbeschaffenheit, dazu Ischias und erschlaffende Nerven«, verordneten warme Bäder, Massagen und Trinkkuren.
»Welch schmerzlich der ganze Eindruck ist, den sie macht«, schreibt ihre Tochter Marie Valerie besorgt in ihrem Tagebuch. »Sehr erschrocken über ihr schlechtes Aussehen, die sichtliche Müdigkeit.« Die von Elisabeths Ärzten festgestellte, angebliche Herzschwäche beunruhigte ihre Familie zutiefst. Besonders Franz Joseph und die jüngste Tochter Marie Valerie lebten angesichts des vermeintlich bedrohlichen Gesundheitszustands der Kaiserin, der größte Rücksichtnahme erforderte, in ständiger Sorge.
Wie stellt sich der Tod Elisabeths aus heutiger medizinischer Sicht dar? Dr. Hildegunde Piza-Katzer, Spezialistin für plastische Chirurgie, hat die Ereignisse um das Attentat analysiert:
»Die über 60-Jährige befand sich zum Zeitpunkt der Tat in für ihr Alter ungewöhnlich guter Verfassung. Sie muss auch über eine fast übermenschliche Disziplin verfügt haben. Nur so ist es zu erklären, dass sie nach der tödlichen Attacke, die sie als furchtbaren Schlag verspürte, auf dem Quai du Mont-Blanc zu Boden fiel, sich aber aus eigener Kraft erhob, den zu Hilfe eilenden Passanten in verschiedenen Sprachen höflich dankte, ruhig ihre Frisur ordnete und sich mit festem, raschem Schritt auf das zur Abfahrt bereitstehende Schiff begeben konnte.
Aus dem Bericht der Hofdame wissen wir, dass sie sogar mehr verwundert als empört, auf jeden Fall aber mit normaler Stimme sprach: ›Was glauben Sie, wollte der Mann von mir? Vielleicht meine Uhr?‹
Dies ist bei unter schwerem Schock stehenden Personen durchaus möglich. Elisabeth verspürte trotz zertrümmerter vierter Rippe – eine Verletzung, die im Allgemeinen bei jedem Atemzug ungeheure Schmerzen verursacht – zu Beginn nicht viel. Sie war der Meinung, nur einen heftigen Stoß erhalten zu haben. Auf die Frage ihrer Hofdame erklärte sie ruhig: ›Ich glaube, die Brust schmerzt ein wenig.‹ Das enganliegende Mieder erwies sich als Stütze. Nur so erklärt sich, dass sie noch 120 Schritte zurücklegen konnte. Dann jedoch wurde sie blass, erbat den Arm ihrer Begleiterin und sank nieder. Man labte sie mit einem Zuckerstück. Bei der Öffnung ihres Mieders noch bei Bewusstsein, versuchte sie sich mit eigener Kraft nochmals aufzurichten. Sie atmete schwer. Mit den letzten Worten: ›Was ist nur mit mir geschehen?‹, sank sie in eine Ohnmacht, aus der sie nicht mehr erwachte. Auf Grund der Art der Verletzung verlief ihr Tod schmerzlos. Sie ist nach ca. 90 Minuten, als die Pumpfunktion des Herzens das allmählich eindringende Blut nicht mehr bewältigen konnte, ohne Todeskampf still verschieden.«
Die Tatwaffe: eine scharf zugeschliffene Dreikantfeile. Den Holzgriff ließ Lucheni von einem Freund, dem Lausanner Kunsttischler Benito Martinelli, anfertigen.
Zur Art und Weise von Luchenis Angriff meint Dr. Piza-Katzer: »Dieser ist nicht nur mit enormer Wucht, sondern auch sehr zielgerichtet erfolgt. Auf jeden Fall hatte der Täter für einen ungebildeten Laien ungewöhnlich große anatomische Kenntnisse. Die, wie sich später herausstellte, von ihm selbst dreikantig messerscharf zugeschliffene Feile war ein ideales Mordinstrument. Die sehr kompakte Kleidung des Opfers aus schwerem Stoff – Jacke, Seidenkleid, Mieder, darunter ein Batisthemd – barg das Risiko des Abgleitens der Waffe. Der Anschlag selbst gelang jedoch beim ersten Versuch, er hätte effizienter nicht durchgeführt werden können.«
»Nach Mittheilung des eben hier gewesenen Staatsanwalts von Genf ist man einem weitverzweigtem Complott auf der Spur, welches wahrscheinlich in London angezettelt und dann nach Zürich übertragen wurde. Es soll ursprünglich gegen Seine k. und k. Apostolische Majestät geplant gewesen sein, wovon man aber abgegangen sei, da man den Coup in der Schweiz ausführen wollte und gegen die Kaiserin einen ebenso schweren Schlag zu führen meinte. Das Attentat wäre also von langer Hand vorbereitet gewesen, die Action durch den von London hergeschickten Ciancabilla in Fluß gesetzt und die Ausführung dem Lucheni anvertraut worden.« Telegramm von Graf Kuefstein an das Informationsbüro des Außenamtes in Wien, 30. September 1898.
Dr. Piza-Katzer beantwortet auch die Frage, ob die Kaiserin nach heutigem Stand der Medizin hätte gerettet werden können: »Das ist sehr unwahrscheinlich. Dazu hätte die Tat in einer Spezialklinik stattfinden müssen. Denn ein Hubschrauber braucht Zeit. Die Vorbereitung der Operation braucht Zeit und auch die Öffnung des Sternums. Eine Herzbeuteltamponade führt meistens zum Tod.«
Die Chirurgin kommt dann zu einem interessanten Schluss: »Wir wissen, dass der Täter, ein 25-jähriger junger Mann, im Straßenbau schwere körperliche Arbeit verrichtete und über die entsprechende Kraft verfügte. Wir wissen aber auch, dass er als fanatischer Anarchist von Hass gegen die herrschende Klasse erfüllt war, in Genf unter Gleichgesinnten um Anerkennung rang und sich zu beweisen suchte. Die Möglichkeit, dass man Luigi Lucheni systematisch auf seine ›Propaganda der Tat‹ hintrainierte, ihn sozusagen einschulte, ist nicht auszuschließen.«
Diese These erhärtet sich durch erst in jüngster Zeit zugängliche Dokumente des Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien. Meldete doch Graf Kuefstein, der österreichisch-ungarische Gesandte in Bern, dem Informationsbüro des Ministeriums des Äußeren, der damaligen Geheimpolizei, am 30. September 1898 die Angaben eines Spitzels nach Wien: »… dieses Attentat wäre also von langer Hand vorbereitet gewesen, die Action durch … Ciancabilla (einem führenden Anarchisten) in Fluß gesetzt und die Ausführung Lucheni anvertraut worden.«
Luigi Lucheni selbst hat dazu eisern geschwiegen. Er wollte seinen Ruhm mit niemandem teilen: »Ich bin stolzer Anarchist. Den Mord habe ich ganz allein geplant. Ich bin froh, dass sie tot ist«, betonte er.