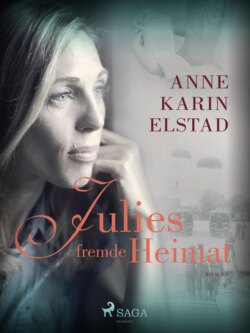Читать книгу Julies fremde Heimat - Anne Karin Elstad - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеSie hatten für die Reise so große Pläne geschmiedet. Am sechzehnten Mai wollten sie hier losfahren, am siebzehnten zu den Feierlichkeiten des Nationalfeiertages in Kristiansund sein und am achtzehnten dann nach Molde weiterfahren. Obwohl Jørgen nun nicht mitkommt, will Julie nichts daran ändern.
Krister hatte sie ziemlich ernst angeschaut, als sie ihm sagte, daß der Papa und der kleine Bruder hierbleiben würden.
»Das ist ja traurig, Mama, wenn unser Papa nicht mitkommt.«
»Aber uns beiden wird es trotzdem Spaß machen, meinst du nicht?«
»Ja, aber ich will wieder nach Hause.«
»Natürlich fahren wir wieder nach Hause. Wir bleiben vierzehn Tage, und dann geht es zurück.«
Zum Glück hat Jørgen es nicht geschafft, dem Onkel in Kristiansund zu schreiben und um Unterkunft für sie zu bitten. Alleine mit dem Jungen hat sie keine große Lust, dort zu wohnen. In dem vornehmen Haus hat sie immer Beklemmungen und kommt sich verloren vor. Seit sie weiß, daß sie nur zu zweit fahren werden, will sie Randi schreiben und anfragen, ob sie bei ihr unterkommen können. Sie haben Kontakt gehalten, schreiben sich, aber es ist nun schon lange her, seit sie sich zuletzt sahen. In die Stadt kommt sie höchstens ein- oder zweimal im Jahr.
Randi und Yngvar sind in eine neue Wohnung in Clausengen gezogen. Vor ein paar Jahren hat Yngvar als Böttcher aufgehört, nachdem er eine neue, bessere Arbeit bei der Mechanischen Werkstatt in Storvik gefunden hatte, deshalb meinten sie, sich das leisten zu können. Die neue Wohnung hat auch zwei Zimmer, ist aber neu und modern. Diese Wohnungen wurden während des Krieges gebaut, sie haben fließend Wasser, Gasanschluß und elektrisches Licht. Die Zimmer sind größer als in der winzig kleinen Wohnung, die sie vorher auf Innland hatten. Sie ist zentral gelegen, befindet sich sozusagen mitten in der Stadt.
Die Freundschaft zwischen ihr und Randi wird hier nicht besonders gern gesehen. Vor allem nicht, seitdem Yngvar begonnen hat, in Zeitungen scharfe Leserbriefe zu schreiben, in denen er den Arbeitern das Wort führt oder die Arbeitgeber kritisiert und jene, die für das öffentliche Wohl und Wehe der Stadt verantwortlich sind oder für die Mißwirtschaft, wie er das nennt. Durch diesen Einsatz hat er sich in der Arbeiterbewegung in der Stadt hervorgetan, so allmählich beginnt sein Name auch über die Stadtgrenzen hinaus bekannt zu werden. »Ein Aufwiegler«, sagt Synnøve und versteht nicht, daß Julie sich mit solchen Leuten wie Randi und Yngvar Thorsen abgibt.
Was diese Sache betrifft, hat ihre Mutter dieselbe Auffassung wie Synnøve. Ihr Vater war es, der ihr beigebracht hat, daß man die Qualität eines Menschen nicht nach seinem Stand oder seiner Stellung beurteilen soll. Und nach und nach wurde Randi ihre beste Freundin, die sie je hatte. Eine Freundin, der sie in allen Dingen vertrauen kann.
Hier im Haus abonnieren sie alle Zeitungen, die in Kristiansund erscheinen. Es ist ungewöhnlich, daß jemand auf einem Bauernhof die Arbeiterzeitung Tidens Krav hält, doch Kristoffer meint, das sei notwendig, wenn sie in der Politik an allen Fronten Bescheid wissen wollen. Tidens Krav druckt die Leserzuschriften von Yngvar Thorsen am häufigsten ab, während die linksorientierte Zeitung Romsdalspost und die konservative Møre Dagblad sie nur sporadisch bringen und dann oft mit Verdrehungen, die ihn lächerlich machen sollen. Aber nicht einmal diese Zeitungen können ihn übergehen.
Jørgen und Kristoffer sind sich nicht einig, was Yngvars politische Ansichten betrifft, aber sie bewundern ihn beide, Jørgen wegen seines Weitblicks, seines Mutes und seiner spitzen Feder, Kristoffer wegen seines politischen Gespürs.
»Er kann es weit bringen, wenn er sich in seinem Eifer nur nicht versteigt«, sagt Kristoffer. »Ich würde es gut finden, mit diesem Menschen einmal ins Gespräch zu kommen.«
»Das könnte ich ohne weiteres für dich regeln«, sagt Julie.
»Aufwiegler und Querulant«, schnaubt Synnøve, und Julie kommt es fast vor, als höre sie ihre Eltern über solche Sachen diskutieren.
Es ist nun schon länger her, seit Julie etwas von Randi gehört hat, aber in ihrem letzten Brief schrieb sie, daß sie Angst habe, Yngvar könne zu weit gehen und müsse dafür bezahlen. Er hat eine gute Arbeit auf der Werft, ist unter den Arbeitskollegen beliebt, und sie haben ihn zum Vertrauensmann gewählt. Konflikte am Arbeitsplatz hat er abgewendet, sich aber doch für andere eingesetzt. Das bereitet Randi Kummer, denn es sei noch immer so, wer das Geld habe, habe die Macht. Und bei dem Elend, zu dem die Rezessionszeit in der Stadt führe, mit Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot und nackter Armut derer, die ganz unten sind, könne sich niemand sicher fühlen, meint sie. Auch sie selbst hat ihre Arbeit in der Goma Fabrik verloren und versucht nun, ihr Einkommen durch Gelegenheitsarbeiten aufzubessern. Sie verdingt sich in privaten Haushalten als Reinemachefrau, und dann hofft sie darauf, wenn die Saison beginnt, bei der Fischverarbeitung unterzukommen. Die Wohnung ist märchenhaft, doch die Miete hoch, und seit sie ihre Arbeit verloren hat, ist es knapp für sie geworden.
Seitdem hat Julie von Randi nichts mehr gehört, aber sie ist sich sicher, daß Randi und Yngvar mit ihrem Optimismus und mit dem Elan, den sie immer an den Tag gelegt haben, auch über diese schwierigen Zeiten kommen werden. Wie ihr Vater das ja auch immer getan hat und tut mit seiner bodenständigen Vorsicht, wenn es um Geld und Geschäfte geht. Noch immer steuert er seinen kleinen Betrieb mit festem Kurs und sichert unverändert das Auskommen.
Die Verhältnisse in der Stadt sind kritisch, jeden Tag sind die Zeitungen voll davon. Menschen, die vorher Arbeit hatten, die sich früher ein einigermaßen anständiges Leben leisten konnten, haben ihre Arbeit verloren, mußten Heim und Herd verlassen, mit der Armenfürsorge als einzigem Ausweg, damit sie über die Runden kommen. Kürzlich las sie in der Zeitung, daß dreiundzwanzig Prozent der vorjährigen Steuereinnahmen in die Fürsorge geflossen sind. Was die Kommune rettete, war der Umstand, daß der Anteil der Steuereinnahmen, die für Zinsen und Tilgungen aufgebracht werden mußten, in den letzten Jahren von fünfzig auf vierzig Prozent gesunken sind. Doch der Zulauf auf die Armenfürsorge ist seit der Zeit vor dem Weltkrieg um mehrere hundert Prozent gestiegen, und er wird mit jedem Tag, der vergeht, größer. Die Menschen beantragen Zuschüsse für Miete, Heizung, Kleidung und Schuhe, für Konfirmationen und Beerdigungen. Das ist wie eine Lawine, die man nicht mehr aufhalten kann. Und die Stadt ist so verletzbar, mit den schwierigen Verkehrsverbindungen, abhängig von der See, der Schiffahrt und der Fischerei.
Auch hier auf dem Lande bekommen sie die Rezession zu spüren, auch wenn sie sich nicht ganz so schlimm auswirkt wie in den Städten. Sie haben ebenfalls dieses beklemmende Gefühl von Angst vor der Zukunft, das sich im Schatten der vielen Zwangsversteigerungen, von denen die Zeitungen berichten, breitmacht. Noch hat es hier niemanden getroffen, trotzdem schaffen die Geschehnisse ringsum im Land Verunsicherung bei den Menschen. Auf Storvik schränken sie das Personal ein, obwohl jetzt immer mehr billige Arbeitskräfte zu haben sind. Von den Produkten, die sie auf dem Hof erzeugen, verkaufen sie alles, was sie erübrigen können; gute Butter zum Brot gibt es nur manchmal an den Wochenenden und wenn sie Gäste haben; ansonsten geht alles an den Händler. Genauso verhält es sich mit dem Geschlachteten. Jørgen ist ein passionierter Fischer, dadurch haben sie für den eigenen Gebrauch ausreichend Fisch aus dem Meer und aus dem See auf der Alm. Für die Arbeiter sieht es schlechter aus. Solange sie überhaupt eine Arbeit haben, geht es, doch es gibt welche, denen der schwere Gang zur Armenfürsorge nicht erspart bleibt. Dieses Elend geht Julie nahe. Kristoffer ist Sprecher der Armenfürsorgeverwaltung, und jede Woche kommen Leute, die in Not geraten sind. Ein entscheidender Unterschied zur Stadt besteht darin, daß es auf dem Lande mehr auffällt. Alle kennen die häuslichen Verhältnisse ringsum, und sobald bekannt wird, daß eine Familie nackte Not leidet, findet sich jemand, der hilft. Doch hier wie anderswo auch haben die Menschen ihren Stolz und wollen allein zurechtkommen, solange es irgend geht, denn die Armenkasse, wie sie die Fürsorge hier nennen, ist für eine Familie die größte Schande, die es nur gibt.
Was Industrialisierung und Arbeitsplätze angeht, war dieses Dorf nach der Jahrhundertwende die Gemeinde in Nordmøre, die am meisten expandierte. Anfang der neunziger Jahre im vorigen Jahrhundert wurde in Øra das Sägewerk errichtet und in Betrieb genommen. In seinen besten Zeiten fanden siebzig Arbeiter in dem Betrieb Lohn und Brot. Die meisten davon waren Zugezogene, aber auch mancher aus dem Dorf fand dort Beschäftigung. Jugendliche, die früher gezwungen gewesen wären fortzugehen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, wurden im Heimatort ansässig. Darüber hinaus gab der Betrieb auch den Bauern, die Wald besaßen, zusätzliche Arbeit, ihre Fuhrwerke wurden für den Transport und für andere anfallende Arbeiten benötigt. In der Saison, wenn sie Faßdauben schnitten, kamen auch Frauen und Kinder der Arbeiterfamilien in dem Betrieb unter, ein willkommener Extraverdienst für alle.
Mit dem Bau der Holzschleiferei wurde 1912 begonnen, und im Winter 1913 nahm sie den Betrieb auf.
Vom Staudamm am Ende des Almsees, aus dem man auch die Wasserkraft für das Sägewerk gewinnt, wurde durch das steil abschüssige Tal eine Druckrohrleitung verlegt, um die Wasserkraft für die Schleiferei zu nutzen, aber gleichzeitig um die Familien in Øra mit elektrischem Licht zu versorgen. Auf diese Weise hatten die Leute dort viel früher Strom als der einfache Mann in Kristiansund, während der Rest des Dorfs nur davon träumen konnte.
In der ersten Zeit, nachdem die Holzschleiferei ihren Betrieb aufgenommen hatte, war es schwer, genügend Hilfskräfte zu finden. Die Arbeit wurde als gesundheitsschädigend angesehen, doch die gute Bezahlung lockte. Das führte zu einer neuen Welle von Zuwanderungen in die Gemeinde. In Øra und im Umkreis wurde Bauland freigegeben, und nach und nach entstand ein dichtes Siedlungsgebiet mit einem Milieu, das eher an eine Stadt als an eine Landgemeinde erinnerte. Sägewerk und Schleiferei verschafften auch vielen Menschen von den Bauernhöfen zusätzliche Arbeit. Sie wurden hinzugezogen, wenn der Holzschliff auf Schiffe verladen wurde. In dieser Zeit gab es genügend Arbeit für alle.
Dieser Aufschwung hielt bis in die ersten Nachkriegsjahre an. Dann ging es mit dem Sägewerk bergab, und 1921 wurde dieser Teil des Unternehmens geschlossen. Das war ein Schlag für die Kommune, die sich auf einmal mit Arbeitslosigkeit als einem neuen und großen Problem konfrontiert sah. Daß es junge Leute traf, war schon schlimm genug, aber viel schlimmer war es für die Familienväter, für alle Haushalte, deren Verhältnisse plötzlich Kopf standen.
In Øra weiß jeder, daß es unmöglich ist, in der Schleiferei unterzukommen. Dieser Betrieb beschäftigt sechzig Mann, die in drei Schichten arbeiten, die Arbeitsplätze in der Schmiede und in den Werkstätten mitgerechnet.
Nun wird jedesmal gemurrt, wenn Bauern zusätzlich für Verladearbeiten am Kai eingestellt werden. Die Arbeiterpartei, die sich im Dorf explosionsartig entwickelt hat, setzt sich eisern in der Gemeindeverwaltung für ein Verbot ein, daß Bauern solche Arbeiten übernehmen dürfen, statt dessen sollen Arbeitslose genommen werden. Das ist eine der Angelegenheiten, die den Streit zwischen Bauern und Sozialisten auf die Spitze getrieben hat. Øra gilt als der röteste Fleck in ganz Nordmøre, und die Bewohner der angrenzenden Siedlungen fürchten nun, daß die Arbeiterpartei demnächst auch die Mehrheit in der Gemeindeverwaltung haben wird.
Nach der Stillegung des Sägewerkes hat sich Mißmut breitgemacht. Es werden verschiedene Notstandsprogramme gestartet, aber das ist nicht besonders hilfreich. Die jungen Leute gehen wieder fort. Seit 1923 sind schon viele aus dem Dorf nach Amerika ausgewandert, aber in letzter Zeit hat das wegen der schlechten Verhältnisse, die auch da drüben eingekehrt sind, nachgelassen.
Auf Storvik wie auf den anderen Höfen hat man feste Milchkunden aus Øra, der Ortschaft, die im Umfeld des Sägewerkes und der Fabriken am Fjord liegt. Abends kommen sie mit ihren Milchkannen. In der Regel schickt man die Kinder vor, vor allem, wenn es an Bargeld fehlt und die Milch angeschrieben werden soll.
Hier zeigt sich Synnøve von einer ganz anderen Seite, von einer Generosität und Wärme, für die Julie sie schon von Anfang an, seit sie hier ist, respektierte. Wenn Synnøve weiß, daß es einer der Milchkunden ganz besonders schwer hat, nimmt sie es nicht so genau und mißt reichlich ab, und wenn sie anschreiben soll, schreibt sie weniger an, als verkauft wurde. Nicht selten kommt es vor, daß sie den Kindern einen Butterklumpen zusteckt, ein Stück Speck oder Nikkjefett, wie sie die gesalzenen und getrockneten Rollen des Bauchfettes vom Schaf nennen, die in kleinen Mengen zu Herings- und zu Kartoffelbällen gegessen werden.
»Das braucht niemand zu wissen«, sagt sie, wenn sie dem Kind die Dinge gibt, die sie in Zeitungspapier eingewickelt hat. Sie weiß, daß man es dort, wo es hinkommt, gut gebrauchen kann.
Im Dorf wird von Synnøve Storvik gesagt, daß sie warmherzig und gütig sei, streng, aber gerecht, sie ist ein Mensch, dem man Respekt zollt. Anders, der Knecht, wird als lebendiger Beweis dafür angesehen. Er hatte das harte Schicksal, ein uneheliches Kind zu sein. Seine Mutter stammte von einem kleinen Gehöft im Dorf. Dort besorgte sie ihrem Vater, der Witwer war, den Haushalt, während sie ein paar Kronen dazuverdiente, indem sie auf Bauernhöfen Schwerstarbeit verrichtete. Solange Anders klein war, nahm sie ihn mit. Als er zwölf, dreizehn war, starb sie an Lungenentzündung, und der Junge wurde zu Verwandten ins Nachbardorf gebracht. Synnøve kam zu Ohren, wie schlecht es ihm ging, daß er wie ein Erwachsener arbeiten mußte, zerlumpt herumlief und fast nie zur Schule ging. Da gab sie nicht eher Ruhe, bis sie ihn zu sich auf den Hof geholt hatte. Sie kleidete ihn ordentlich, schickte ihn in die Schule, richtete seine Konfirmation aus. Seitdem ist er auf dem Hof. Hier hat er ein Dach über dem Kopf, Essen und Kleidung, und ein paar Kronen als Lohn bekommt er auch. Er ist jetzt fast vierzig, eine Frau hat er nicht. Es heißt, er sei vom Verstand her etwas minderbemittelt, doch Synnøve sagt, so wie er in der Schule und sonst überall geschunden worden sei, habe ihn die Kindheit zugrunde gerichtet. Die beiden haben eine seltsame Zuneigung füreinander. Versucht jemand, Anders hochzunehmen, lernt er eine Synnøve kennen, mit der nicht gut Kirschen essen ist, und niemand darf etwas Schlechtes über Synnøve sagen, wenn Anders das hört. Julie hat er auch gern, und er versteht es unglaublich gut, mit den Kindern umzugehen.
»Du mußt dich nicht daran stören, was Synnøve sagt. Sie meint es nicht böse. Sie ist halt so«, sagt er zu Julie und beweist wahrlich genügend Sinn und Verstand.
Oft denkt Julie, wenn Synnøve nicht ihre Schwiegermutter wäre, wenn sie nicht gezwungen wären, die ganze Zeit auf engstem Raum miteinander auszukommen, würde sie sie besser leiden können als manch anderen, den sie kennt. Wenn sie in sich geht, stellt sie fest, daß es der unglückselige Kampf um die Macht ist, der ihr Verhältnis zerstört. Dann weiß sie, daß sich der Teil ihrer Persönlichkeit, der aus Trotz, Reserviertheit und der Fähigkeit besteht, andere auf Abstand zu halten, noch verstärkt hat, seit sie hierher kam. Wenn sie unglücklich ist, läßt sie niemanden an sich heran, zeigt niemals, wie schlecht es ihr geht. Und das wiederum hat zur Folge, daß Synnøve scharfe und oft auch verletzende Bemerkungen fallen läßt, die sie selbst, wenn sie ihr zu weit gehen, dazu veranlassen, mit derselben Münze zurückzuzahlen, meistens in Form einer knappen, eiskalten Antwort. Deswegen ist sie so darauf aus, mit Jørgen den Hof zu übernehmen. Wenn sie und Synnøve nicht mehr die Küche und die Verantwortung teilen müßten, wäre es besser für sie beide. Nach dem Gespräch mit Astrid hat sie viel darüber nachgedacht, und sie versucht, die Sache mit Synnøves Augen zu sehen. Wenn sie nur einmal darüber miteinander reden könnten. Aber wie sich die Dinge jetzt zwischen ihnen entwickelt haben, glaubt sie, daß es sinnlos ist.
Der Brief von Randi ist kurz. Sie schreibt, daß Julie mit dem Kind mehr als willkommen sei, daß sie sich riesig darauf freue, sie wiederzusehen. Doch einiges hat sich bei ihnen verändert. Das ist der Grund, warum sie sich bei Julie so lange nicht gemeldet hat. In letzter Zeit habe sie kaum etwas abknapsen können, schon gar nicht für einen Brief. Yngvar habe seine Arbeit auf der Werft verloren. Nachdem er eine Zeit arbeitslos gewesen sei, sei er nach Gylstrand zu sogenannter Notstandsarbeit einberufen worden. Über all das solle Julie mehr erfahren, wenn sie da sei. Yngvar komme am siebzehnten Mai nicht nach Hause, so daß für sie und Krister ausreichend Platz sei. Allerdings sei es momentan gerade nicht so gut bestellt um sie, deshalb müsse Julie mit dem Einfachen vorliebnehmen, was sie haben.
Julie hält es für ausgeschlossen, mit leeren Händen zu Randi zu fahren, so wie die Dinge bei ihnen stehen, doch sie traut sich nicht, einfach ins Vorratshaus zu gehen und sich zu bedienen. Das wäre fast so, als würde sie stehlen, obwohl es gar keinen Grund gibt, so zu denken. Am Tag vor der Abreise geht sie mit bangem Herzen zu Synnøve, um sie um einige Lebensmittel für Randi zu bitten.
»Randi hat es nicht gerade leicht«, setzte sie an.
»Yngvar hat seine Arbeit verloren und ...«
»Ja, ich beneide keinen, der in diesen Zeiten in der Stadt wohnt.«
»Ich sollte wohl vielleicht ein bißchen was für sie mitnehmen?«
»Natürlich mußt du was mitnehmen, wenn du dich bei Fremden einquartierst«, antwortet Synnøve schneidend. »Ich will sehen, was ich finde.«
Synnøve kommt aus dem Vorratshaus mit einem Tablett voller Lebensmittel. Mehrere Stücke Pökelfleisch, Eier und Butter, Speck und Schmalz, sie hat ein mächtiges Stück vom Schinkenspeck abgeschnitten, und sie bringt eine ganze geräucherte Hammelkeule mit, die noch nicht angeschnitten ist.
»Aber das ist doch viel zuviel«, sagt Julie überwältigt.
»Die werden das bestimmt gut gebrauchen können, denke ich. Und außerdem darfst du nicht vergessen, Julie, daß wir hier auf Storvik niemandem etwas schuldig bleiben. Außerdem möchte ich, daß deine Freundin sieht, woher du kommst.«
Die letzten Worte hätte sie sich sparen können, doch sie wäre nicht Synnøve, wenn sie nicht eine solche Bemerkung fallenlassen würde.
Ein ganzer Pappkarton ist voll, als alles eingepackt ist.
»Für Storviks sollte ich dir vielleicht auch was mitschikken, aber ich habe ja Ivar schon etwas mitgegeben, als er letztes Mal hier war. Außerdem leidet der Bankchef bestimmt keine Not, nehme ich an.«
Ivar wird im Hause des Onkels in der Stadt wie ein Sohn behandelt. Er hat das Abitur gemacht, die Handelsschule besucht und arbeitet als Kassierer in der Bank des Onkels. Ansonsten hat es ihm die Musik angetan. Obwohl er noch so jung ist, gilt er als versierter Geiger und spielt im Symphonieorchester der Stadt bei Edvard Bræin. Wenn Synnøve von ihm spricht, hört man Stolz, aber auch Verletztheit in ihrer Stimme.
»Ja, Ivar hat es geschafft, er hat jetzt sein Auskommen«, sagt sie. »Aber er gehört nun nicht mehr hierher.«
So etwas läßt sie innerhalb der eigenen vier Wände verlauten, aber sie hütet sich peinlichst davor, daß es einem Fremden zu Ohren kommt.
Julie ist das auch nicht entgangen. Mit seiner eleganten städtischen Kleidung und seinen städtischen Manieren wirkt Ivar fast wie ein Fremder auf dem Hof, wenn er zu Besuch kommt. Er hat etwas Weiches und Verfeinertes an sich. Etwas von derselben Weichheit, die sie manchmal auch an Jørgen feststellt. Doch Jørgen ist zäh und stark, wenn er arbeitet, Ivar würde sich als Bauer nicht eignen.
Beide Töchter des Onkels sind von zu Hause ausgezogen. Die jüngere der beiden, Sigrid, ist unverheiratet. Sie hat in Kopenhagen Gesang studiert und ist jetzt dort im Opernchor. Nichts deutet darauf hin, daß sie zurückkommen möchte. Anne, die Älteste, war verlobt mit einem jungen Mann aus Kristiansund, doch sie hat die Verlobung gelöst und ist nach Berlin gegangen, wo sie Klavier studierte. Dort hat sie einen deutschen Orchestermusiker geheiratet. Mit dem Klavierspielen hat sie es nicht weiter gebracht als bis zur Lehrerin, die ihre Schüler zu Hause empfängt, genau wie sie es zuvor in Kristiansund getan hat. Kinder hat sie noch nicht. Daß beide Töchter sich im Ausland niedergelassen haben, bereitet Selma und Erling Storvik großen Kummer. Deshalb ist es sicher nicht verwunderlich, daß sie Ivar wie an Kindes Statt angenommen haben. Er wohnt bei ihnen, seit er auf der Mittelschule anfing. Dann ist es nicht verwunderlich, daß Synnøve das Gefühl hat, in gewisser Weise ihren jüngsten Sohn verloren zu haben. Vergangenen Sommer war Ivar in Berlin, dort wohnte er bei Anna und ihrem Mann, er nahm in dieser Zeit Geigenunterricht bei einem Freund der beiden. Julie weiß nicht, ob Kristoffer oder Erling Storvik für diesen Spaß aufgekommen ist. Doch davon spricht Synnøve gern, denn nicht viele Jugendliche hier aus dem Dorf haben Gelegenheit, so etwas zu erleben.
An einem strahlend blauen Maimorgen, so zeitig, daß die Luft noch in den Wangen beißt, fährt Jørgen Frau und Kind mit der Kutsche zum Kai.
»Ich habe Ivar angerufen. Er holt dich am Kai ab und fährt dich zu Randi. Du kannst das ja nicht alles allein schleppen«, sagt er.
»Das hast du gemacht? Das wußte ich gar nicht.«
»Nein, ich habe vergessen, es dir zu sagen. Ich hatte die letzten Tage den Kopf voll.«
Er läßt sich viel Zeit, um das Pferd anzubinden, weiß nicht, was er ihr in der kurzen Zeit, bis der Dampfer am Kai anlegt, sagen soll.
Krister schaut ihn ernst an: »Wir kommen wieder mit dem Schiff. Mama auch.«
Jørgen ist von dem Ernst in den Augen des Jungen, von den Worten aus seinem Munde unangenehm berührt und hebt ihn hoch auf seinen Arm.
»Natürlich kommt ihr nach Hause zurück«, sagt er bestimmt und drückt das Kind fest an sich.
Er hilft ihnen mit dem Gepäck an Bord, verstaut alles ordentlich. Dann gibt er ihr zum Abschied die Hand, tut dasselbe mit Krister.
»Du mußt jetzt ein großer Junge sein und gut auf die Mama aufpassen.«
»Das mache ich, Papa«, sagt Krister erwachsen, während er vor ihm steht und ihn mit seinen ernsten Augen anschaut und mit einem Gesicht, das vor Anspannung blaß ist.
Er steht am äußersten Ende des Kais und winkt ihnen zu. Sie steht da mit dem Jungen auf dem Arm. Schlank und rank wie eine Säule, denkt er, und so unglaublich stark. Ihr schwarzes Haar, zu einem Kranz geflochten, glänzt in der frühen Morgensonne, während ihr Gesicht im Schatten liegt. Sie hat denselben blauen Mantel wie damals an, als sie zum ersten Mal hierher kam, doch sie hat ihn umgeändert, hat ihn ein wenig gekürzt und der Mode angepaßt, wie sie das nennt. Darunter trägt sie einen engen, wadenlangen Rock. Für Krister hat sie aus einem alten Mantel, der ihm einmal gehörte, einen kleinen Mantel genäht mit einer passenden Schirmmütze dazu. Sie ist sehr geschickt, sie kann nähen, versteht, aus wenig etwas zu machen. Das ist es auch, geht ihm durch den Kopf, wie er so dasteht, was sein Schuldgefühl, das ihn plagt, ständig plagt, noch verstärkt. Sie hätte etwas Besseres verdient. Wenn er es sich leisten könnte, dürfte sie sich kaufen, was immer sie sich wünschte. Dann müßte sie keine alten Sachen umändern, wenn sie oder die Kinder ein neues Kleidungsstück benötigen. Aber was soll er machen, wenn er um jedes bißchen Geld, das er braucht, zu den Eltern gehen muß, bevor er darüber verfügen kann? Und er muß über jede Øre, die er ausgibt, Rechenschaft ablegen. Ein solches Leben ist kaum auszuhalten. Früher hatte er Muße, um auf die Jagd zu gehen, konnte ein bißchen Feuerholz machen, um es zu verkaufen und damit ein paar Groschen extra zu verdienen. Jetzt reicht die Zeit für so etwas nicht mehr aus. Er bleibt stehen und schaut dem Dampfer so lange hinterher, wie er meint, daß es kein großes Aufsehen erregt. Er fühlt sich elend, hier so zu stehen. Auf diese Reise hatte er sich genausosehr gefreut wie sie. Und jetzt muß er dableiben und zusehen, wie sie allein fährt, sie und der Junge. Ja, der Junge, der ihm einen Schreck eingejagt hat mit seinen verständigen Worten. Versichern mußte er ihm, daß sie wieder nach Hause kommen werden, alle beide.
Nach dem häßlichen Streit, den sie miteinander hatten, haben sie darüber gesprochen, wieviel Krister davon gehört haben mochte, wieviel ein Kind von knapp vier Jahren überhaupt verstehen kann. Nach diesem Abend hat er so viele merkwürdige Dinge gesagt, daß man sich darüber wundern muß.
»Deine Frau ist verreist?« fragt einer der Männer laut, die vor der Tür zum Kaufmannsladen herumlungern.
»Ja«, sagt Jørgen, und manövriert den Postsack, den er abgeholt hat, vorsichtig in die Karriole.
»Es handelt sich wohl nicht bloß um eine Kurzreise, soviel Reisegepäck, wie sie mitgenommen hat?«
»Nein, sie wird ein paar Wochen bei ihren Eltern bleiben.«
»Ein paar Wochen, mitten in der arbeitsreichsten Zeit? Na ja, wer hat, der hat.«
»Ihr Vater ist krank, deshalb muß sie fahren«, lügt Jørgen.
»Krank? Es wird doch hoffentlich nichts Ernstes sein«, setzt der Alte sein Verhör neugierig fort, offensichtlich dankbar für jeden Tratsch, den er mit nach Hause nehmen kann zu seiner ebenso neugierigen Frau, die dort wartet.
»Nein, was Ernstes scheint es nicht zu sein, aber sie hielt es für besser, selbst nach dem Rechten zu sehen.«
»Na, das versteht sich. Ein kleiner Urlaub möglicherweise?« fragt der Greis in einem Ton, als hätte er etwas Unanständiges gesagt.
Jørgen schäumt vor Wut, weil er der Versuchung zum Lügen erliegen muß, nur um die Neugierde dieser Menschen zu befriedigen.
Als er die Anhöhe hinauffährt, sieht er die Rauchfahne über dem Fjord. Bereits jetzt verspürt er ein nagendes Gefühl von Sehnsucht nach ihr in seiner Brust. Soweit ist es gekommen, eine solche Macht hat sie über ihn gewonnen.
Seit sie an Bord sind, ist die Reise für Krister ein einziges Abenteuer. Er zerrt die Mama überall hin, wo Passagiere auf dem Schiff Zugang haben. Er bohrt und fragt und will alles wissen.
»Warum gibt es auf diesem großen Schiff kleine Schiffe?«
»Rettungsboote sind das.«
»Warum heißen die so?«
»Weil man sie benutzen kann, wenn mit dem großen Schiff irgendwas Schlimmes passiert.«
»Kann denn mit dem großen Schiff was Schlimmes passieren?« fragt er erschrocken.
»Nein, bei dem schönen Wetter heute brauchen wir keine Angst zu haben.«
»Warum verreisen denn die Kühe auch?« will er wissen und zeigt auf die Tiere, die in einem Verschlag auf dem Vordeck stehen.
»Die hat vielleicht jemand gekauft, verstehst du.«
»Aber warum muhen die denn so fürchterlich? Ob sie Angst haben, was meinst du?«
»Ich weiß nicht, ob es ihnen auf See gefällt.«
»Aber mir gefällt es. Dir auch, Mama?«
»Ja, heute schon«, sagt sie und ist froh, daß die Sonne bereits so warm ist, daß sie an Deck bleiben können und es ihnen erspart bleibt, in dem stickigen Salon sitzen zu müssen.
Die Tür zum Maschinenraum steht offen. Sie hat sich mit Krister so hingestellt, daß er hinunter zu den lärmenden Maschinen sehen kann. Warme Luft und der Geruch von Öl schlägt ihnen durch die offene Tür entgegen.
»Oh«, sagt Krister andächtig, »was es hier nicht alles gibt, mein lieber Junge!«
Einer von der Mannschaft, der im Vorbeigehen hört, daß das Kind Fragen stellt, bleibt stehen und nimmt sich Zeit zum Zeigen und Erklären. Krister sieht ihn erst ernst an, taut dann aber bald auf, deutet auf vieles und fragt.
»Du bist mir vielleicht der Richtige«, lacht der Matrose, »vielleicht wird aus dir einmal ein richtiger Seemann, wenn du groß bist!«
»Nein, das geht nicht, denn ich werde einmal Bauer, ganz bestimmt.«
Krister wird es auch nicht leid, vom Achterdeck aus auf die schaumigen Streifen des Kielwassers zu schauen, aber er klammert sich dabei fest um den Hals der Mutter.
An einem windgeschützten Plätzchen auf Lee, gleich bei dem Schornstein, setzen sie sich auf eine Bank und holen ihren Proviant hervor. Danach schläft Krister auf ihrem Schoß ein.
Gute sieben Stunden dauert die Reise. Der Dampfer schlängelt sich in die Fjorde hinein und wieder hinaus, läuft die Inseln draußen an. Zum Schluß schläft auch sie ein, den Kopf nach hinten gegen den warmen Schornstein gelehnt, sie wird von Kristers schneidender Kinderstimme geweckt. Da hebt und senkt sich der Dampfer unter ihnen.
»Sieh nur, Mama, was für große Wellen.«
Sie zeigt in die Ferne.
»Sieh nur, Krister, das ist das Meer. Talgsjyn heißt das hier.«
Das ist der Teil der Überfahrt, auf dem sie bei schlechtem Wetter jedesmal seekrank wird. Doch heute scheint sie drumherum zu kommen, auch Krister sieht aus, als würde ihm die See nichts ausmachen.
Als der Dampfer in Kristiansund anlegt, steht Ivar am Kai und nimmt sie in Empfang. Er hilft ihnen mit ihrem Gepäck, und dann erwartet Krister ein neues Abenteuer, denn Ivar führt sie hinüber zu dem glänzenden schwarzen Ford des Onkels.
Das Kind vergißt alle Verlegenheit.
»Sieh nur, Mama, wir fahren mit dem Auto!«
»Ja, ich muß schon sagen, das ist ein königlicher Empfang«, bemerkt Julie lächelnd. »Das wäre doch nicht nötig gewesen.«
»Jørgen meinte, ihr hättet viel Gepäck zu tragen, und da habe ich gedacht, es ist am besten, wenn ich mir das Auto leihe«, erwidert Ivar. Aber als er sich hinter das Lenkrad setzt, kann er nicht verbergen, wie stolz er ist.
»Du bist mir vielleicht ein ausgekochter Bursche, Ivar!«
»Das, nicht ...«, sagt er und ist noch nicht so erwachsen geworden, daß er nicht mehr rot wird.
»Der Onkel und die anderen sind hoffentlich nicht beleidigt, weil ich bei Randi wohne?«
»Darüber mußt du dir keine Gedanken machen.«
»Tue ich auch nicht, denn Randi bekomme ich sehr selten zu Gesicht, und euch sehe ich ja im Sommer, wenn ihr in den Ferien zu uns kommt.«
Krister kniet auf dem Rücksitz des Autos und schaut mit großen Augen auf das Treiben der Stadt. Das vorige Mal, als sie ihn auf die Reise mitgenommen hatte, war er noch zu klein, um sich daran erinnern zu können.
»Sieh nur, Mama, wie viele Häuser es hier gibt und wie viele Menschen.«
Er jauchzt vor Vergnügen, als Ivar wegen Pferdefuhrwerken und Fußgängern, die mitten auf der Straße gehen, hupt.
»Bitte noch mal, Onkel Ivar!«
Julie kommt während der kurzen Fahrt nicht mehr dazu, sich mit Ivar zu unterhalten. Sie fahren an den Kaianlagen entlang und den Kaibakken hinauf, wo sie links abbiegen, und schon sind sie im Fløiveien, wo Randi wohnt.
Randi hat sich verändert, seit sie sie das letzte Mal gesehen hat. Sie ist dünner geworden, ihr Gesicht gezeichnet und ausgemergelt, sie sieht mitgenommen aus, aber sie freut sich über das Wiedersehen. Die beiden Mädchen, das eine in Kristers Alter, das andere ein paar Jahre älter, schauen interessiert auf den Ankömmling, der sich verlegen an die Mutter schmiegt. In der geräumigen Küche riecht es nach gebratenem Essen und gekochtem Kohl. Auf einer kleinen Herdplatte stehen Schüsseln übereinander gestapelt. Der Küchentisch ist für zwei gedeckt.
»Ja, wir haben schon gegessen, ich habe aber versucht, das Essen warm zu halten. Es ist kein Festtagsmahl, das nicht gerade, aber ihr habt bestimmt Hunger«, sagt Randi und bittet sie, am Tisch Platz zu nehmen, während sie Fischbuletten in brauner Soße, Kartoffeln und Kohl auftut. Dazu serviert sie rote Obstsuppe.
»Ich hoffe, es schmeckt euch, auch wenn es nur ein einfaches Gericht ist.«
»Es schmeckt wunderbar, Randi.«
»Wo ist der Junge hin?« flüstert Krister.
»Du meinst Hallvor?« fragt Randi. »Er ist in der Schule, aber er kommt bestimmt bald nach Hause.«
»Ich schäme mich fast, es zu gestehen«, sagt Randi, »aber ich muß euch für ein paar Stunden allein lassen.«
Eigentlich ist sie jetzt bei der Arbeit, aber sie hat sich ein paar Stunden frei geben lassen, um den Besuch in Empfang nehmen zu können. So leid es ihr auch tut, sie muß zurück und ihre Arbeit verrichten. Sie hat in einem Haus oben im Langvei zu tun, wo sie bis morgen alles in Ordnung bringen muß. Ob Julie so nett sein und darauf achten könnte, daß Hallvor etwas ißt, wenn er nach Hause kommt. Er ist es zwar gewohnt, allein zurechtzukommen, aber es passiert schon manchmal, daß er vergißt, die Kochplatte abzuschalten, und obwohl die niedrigste Stufe eingestellt ist, kann das Essen dann ungenießbar sein.
»Aber was ist mit deinen beiden Kleinen, läßt du sie immer allein?«
»O ja, sie haben gelernt, sich selbst zu versorgen.«
Oder sie kann die Kinder bei dem schönen Wetter mit auf einen Spaziergang nehmen.
Die drei Kinder schauen sich gegenseitig forschend an:
»Kommst du mit nach draußen zum Spielen?« fragt Kari, das ältere der beiden Mädchen.
»Ja, geh nur«, sagt Julie, »aber paß auf, daß du deine neuen Sachen nicht schmutzig machst, Krister.«
»Ich passe auf ihn auf, ich persönlich«, sagt Kari altklug.
Julie schaut sich die Wohnung an. So sauber und aufgeräumt überall, im Verhältnis zu dem aber, wo sie herkommt, doch sehr armselig. Im Schlafzimmer stehen zwei Betten, Randis und Yngvars Ehebett und eines, das für die Kinder sein muß. Außerdem steht hier ein Kleiderschrank, gleich neben den Wandhaken, an denen Sachen hängen. Dort sind auch schon die Trachten der Kinder für morgen aufgereiht, frisch gebügelt und fertig zum Anziehen für die Feier zum 17. Mai. Im Wohnzimmer stehen ein Sofa, eine Vitrine und in der Mitte ein runder Tisch mit Stühlen. In den Fenstern mit den weißen Häkelgardinen stehen Topfpflanzen. Randi versteht es, Gemütlichkeit um sich herum zu schaffen. Das Beste von allem jedoch ist die blau angestrichene Küche. Ein großer Küchentisch, Kochplatte und Gasherd neben dem kleinen handlichen Ofen, der mit Holz geheizt wird. Neben dem Küchenschrank ein Wasserhahn, darunter ein Eimer auf einem Hocker. Der Ausguß befindet sich draußen auf dem Flur. All das ist ein Luxus für Julie, der ihr völlig fremd ist. Am sonderbarsten an diesen Häusern sind die Toiletten, die draußen vor jeder Wohnung wie Starkästen an der Wand hängen. Sie muß dieses Örtchen aufsuchen, und es ist ihr ganz peinlich, als sie alles, was nach unten in den Sammelbehälter im Hof fließt, wie einen Wasserfall rauschen hört, und es kommt ihr so vor, als können dies alle im Haus hören. Randi hat erzählt, daß die Toiletten nachts bis in die frühen Morgenstunden hinein geleert werden. Der Elfuhrzug wird das Gefährt in der Stadt genannt, und wenn es kommt, steht ein fürchterlicher Gestank in den Straßen, in denen es Außentoiletten gibt. Es bleibt nicht aus, daß Ratten und anderes Ungeziefer angezogen werden, aber das kann man alles nicht mit dem vergleichen, wo sie vorher wohnte.
Hallvor kommt nach Hause. Er ist ein unbekümmertes und artiges Kind, das nach der ersten Verlegenheit auftaut und ihr von der Schule erzählt und was er so macht. Aus der Hinterstraße von draußen ist das Gejohle von spielenden Kindern zu hören, und sie bittet Hallvor, nach draußen zu gehen und seine Schwestern und Krister hereinzuholen, denn sie wollen zum Stausee wandern und sich die Schwäne ansehen.
Julie ist erstaunt, wie erwachsen und tüchtig Randis Kinder sind. Die Mädchen binden die Schürzen ab, und Kari holt für sich und die kleine Solveig saubere Strickjacken hervor.
»Wir müssen uns fein machen, wenn wir in die Stadt gehen«, sagt sie. »Aber du, Hallvor, mußt daran denken, daß du dich umziehst, wenn wir wieder zu Hause sind, damit die Mama nicht mit dir schimpft. Hast du daran gedacht, die Tür abzuschließen?« fragt sie ihn, als sie unten auf dem Bürgersteig stehen.
»Ich bin doch auch nicht ganz dumm.«
»Hast du den Schlüssel unter die Matte gelegt?«
»Ja, nun ist aber Schluß.«
Kari ist erst sechs Jahre alt, aber sie kümmert sich schon um alles.
Es ist ein schöner Tag mit einem strahlend blauen Himmel über dem blauen Meer. Die Luft ist scharf und klar, aber die Sonne scheint so warm, daß Julie den Mantel aufknöpfen muß. Die Bäume im Park sind mit einem frühlingsgrünen Schleier überzogen, auf den Beeten blühen Frühlingsblumen, Krokusse, Lilien und Tulpen. Zu dieser Jahreszeit kann sie nicht hier sein, ohne an die erste richtige Begegnung mit Jørgen zu denken. Wie stolz er war, als er sie in der Stadt herumführte, wie glücklich sie war. Wie sie voller Träume und großer Erwartungen an das Leben und an eine helle Zukunft waren. Wie sie nach Hause kam und heimlich verlobt war! Sie erinnert sich an ihre kindliche Begeisterung, als sie hier am Staudamm zusammen mit ihm gestanden hatte, die schönen Vögel beobachtete, die majestätischen Schwäne und die Pfauen. Die Erinnerungen an diese Tage, die sie sich immer ins Gedächtsnis ruft und an denen sie sich aufrichtet, wenn ihr das Leben allzu schwer erscheint. Erinnerungen, die sie aufmuntern, die sie aber auch wehmütig stimmen und mit einer Sehnsucht erfüllen, die schmerzt.
Jetzt erlebt Krister dasselbe wie sie damals, er jauchzt über die Pfauenhähne, als sie sich mit ihren prächtigen Schwanzfedern aufplustern.
»Sieh nur, Mama, sieh!«
Wenn doch Jørgen hier wäre und das gemeinsam mit ihnen erleben könnte.
Krister ist Hallvor den ganzen Tag über auf Schritt und Tritt gefolgt, auch während er seine Hausaufgaben machte, saß er neben ihm. Hallvor geht in die zweite Klasse, und Krister schaut mit grenzenloser Bewunderung zu ihm auf. Deshalb protestiert er auch nicht, als er zusammen mit Hallvor in das aushilfsweise auf dem Fußboden des Schlafzimmers gemachte Bett muß. Die Kinder sind wegen morgen so aufgeregt, daß Randi und Julie energisch werden müssen, bevor die Kinder da drinnen zur Ruhe kommen.
Randi bricht fast in Tränen aus, als Julie ihr den Karton mit den Lebensmitteln überreicht.
»Was für ein Segen«, sagt sie überwältigt, »wenn du wüßtest, wie gut wir das gebrauchen können. Aber ist das nicht viel zuviel?«
»Das hat mir meine Schwiegermutter mitgegeben. Von mir bekommst du außerdem noch etwas extra dafür, daß wir uns bei dir einquartiert haben.«
»Na, das wäre ja noch ein Ding, Julie, wenn ich von dir als Besuch Geld nehmen würde. Kein Wort mehr davon, aber grüß deine Schwiegermutter von mir und sag ihr vielen Dank.«
»Ich hoffe, du bist mir nicht böse?«
»Wie werde ich denn, wo es mir gerade so gutgeht.«
Randi sagt, sie werde Yngvar vieles von dem, was sie mitgebracht hat, schicken. Er hat in der letzten Zeit kaum ein Fleischgericht zu Gesicht bekommen. Und wenn sie das alles für die Wochenenden aufheben wollte, würden sie hier lange Zeit wie die Made im Speck leben.
Randi macht Frikadellen und Soße und stellt alles für den nächsten Tag fertig vorbereitet in die Speisekammer. Julie kann nicht umhin, sich zu fragen, was sie dieses Mahl gekostet haben mag.
»Du hättest doch nicht bloß unseretwegen ein solches Essen zubereiten müssen.«
»Ich bitte dich, Julie«, sagt Randi mit einem scharfen Ton in der Stimme. »Ich habe den Kindern zum 17. Mai Frikadellen versprochen.«
Sie sitzen am Küchentisch, beide eine Tasse Kaffee vor sich, wie schon so viele Male im Laufe der Jahre.
»Jetzt mußt du aber erzählen, was mit Yngvar passiert ist.«
Wie Julie wohl verstehen werde, ist Yngvar nicht bei allen sozialen Schichten in der Stadt gleichermaßen beliebt, sagt Randi. Aber beide haben sie sich Mühe gegeben, »gute Kristiansunder« zu werden, sie haben ihren Dialekt abgelegt und haben das Gefühl, sich gut in dem Milieu, zu dem sie gehören, den Arbeitern, ihrer Klasse, wie Randi sagt, eingelebt zu haben. Sie hat ihn in fast allem unterstützt, aber er kann es ja nicht lassen und engagiert sich für alles, für die großen Dinge genauso wie für die kleinen, und manchmal, meint Randi, weiß er nicht, wo die Grenzen sind. In erster Linie betrifft das die Politik. Er nutzt jede Gelegenheit, sich zum Fürsprecher der Arbeiter zu machen. Bei der nächsten Kommunalwahl hätte er die Chance gehabt, auf einen vorderen Listenplatz der Arbeiterpartei zu kommen, aber wer wird für jemanden stimmen, der Notstandsarbeiter ist? Er ist auch in der Vereinsarbeit engagiert und nicht zuletzt im Sport. Als sie ihn in Kristiania kennenlernte, war er Mitglied in einem Ringerklub. Die Sportvereine, die es hier in der Stadt gibt, hält er für zu bürgerlich. Eine Weile war er mal Mitglied und Trainer in der Ringerriege des Sportvereins Braatt, aber aus diesem Grunde ist er wieder ausgetreten. In letzter Zeit hat er sich für die Gründung von Arbeitersportvereinen in der Stadt eingesetzt, worüber Julie bestimmt etwas in den Zeitungen gelesen habe. Niemand kann bestreiten, daß Yngvar tüchtig ist, zudem hat er Ausstrahlung und Feuer, weswegen er in der politischen Landschaft der Stadt wahrgenommen wird. Auch wenn er viele Anhänger besitzt, so ist es doch kein Wunder, daß er sich auch Feinde gemacht hat, und das sind Menschen mit Macht.
Yngvar ist ein tüchtiger und zuverlässiger Arbeiter gewesen. Doch als gewählter Vertrauensmann hat er keinen Fingerbreit nachgegeben, wenn er Unrecht gegen Arbeiter aufgedeckt hat. Mehr als einmal hat sie ihn gebeten, etwas leiser aufzutreten und daran zu denken, daß er nicht nur für sich selbst verantwortlich ist, sondern eine Familie hat. Doch er hat sie nicht für voll genommen und gesagt, er hat so viele hinter sich. Er räumte allerdings ein, daß man ein wachsames Auge auf ihn hat. Dann, gleich nach Weihnachten, passierte etwas auf der Werft, was man einen Fast-Unfall nennen kann. Ein Arbeiter fiel bei der Ausführung einer Arbeit, für die Yngvar verantwortlich war, vom Gerüst. Der Unfall ging glimpflich aus, er kam mit einem gebrochenen Arm und einer leichteren Gehirnerschütterung davon, doch für die Betriebsleitung war das der Anlaß, auf den sie gewartet hatte, um Yngvar Thorsen loszuwerden. Als Yngvar an diesem Tag nach Hause kam, schäumte er vor Wut und Verzweiflung, am schlimmsten war dabei seine Enttäuschung darüber, daß seine Arbeitskollegen es nicht wagten, für ihn einzutreten. Er meldete die Kündigung bei der Gewerkschaft, doch bis jetzt konnte man ihm noch nicht helfen. Ein Trostpflaster ist es gewesen, als eine Delegation von Arbeitskollegen zu ihm nach Hause gekommen ist und sie ihm versichert haben, daß sie alles tun würden, damit er seine Arbeit so schnell wie möglich wiederbekäme. Sie sagten, man müsse in dieser Angelegenheit taktisch denken, denn sie dürften sich nicht der Gefahr aussetzen, wie Yngvar rausgeschmissen zu werden, und das ist ein Argument, das Yngvar versteht, wenn es um andere geht. Wie er sich auch immer selber verhält, von anderen erwartet er nie die gleiche Kompromißlosigkeit.
Die Zeit im Winter nach Weihnachten ist grauenhaft gewesen. Zum ersten Mal hat sie erlebt, daß auch Yngvar allen Mut verlieren kann. Er saß hier nur herum. Eine Zeit sah es schon so aus, als hätte er zu nichts mehr Lust. Sie jagte ihn hinaus. »Sieh zu, daß du etwas unternimmst«, sagte sie. »Schreib für die Zeitung, irgend etwas. Du kannst nicht herumsitzen und dich hängen lassen.«
Mitten in all dem hatte sie eine Fehlgeburt. Sie hatte sich mit der Arbeit übernommen, hatte mehr angenommen, als sie schaffen konnte. Sie verlor das Kind im dritten Monat der Schwangerschaft. Das Ganze hätte sie fast umgeworfen. Zuerst wurde sie schwanger, beide wollten sie keine Kinder mehr, sie glaubten, alle Verhaltensmaßregeln zur Verhütung beachtet zu haben, und dann verlor sie das Kind und wurde von Schuldgefühlen geplagt. Merkwürdigerweise bewirkte das nun wieder, daß Yngvar Boden unter die Füße bekam. Nun war er es, der trösten und stark sein mußte. So kamen sie beide gemeinsam darüber hinweg.
»Ach, Randi, meine Liebe, was mußt du gelitten haben. Warum hast du mich nichts davon wissen lassen?«
»Ich war in dieser Zeit einfach nicht imstande dazu, Julie. Und du hast wohl genug mit dir selber zu tun, denke ich. Dann wurde ihm die Arbeit an der Trasse zwischen Gyl und Treekrem angeboten. Vom Staat finanzierte Notstandsarbeit. Die Bezahlung ist schlecht, aber noch immer besser, als gar nichts zu haben. Seit dem ersten Mai war er nun schon nicht mehr zu Hause.«
»Das ist aber traurig für euch, wenn er morgen nicht hier sein kann.«
»Traurig? Nein, nicht für Yngvar. Er hat den 17. Mai schon seit Jahren nicht mehr gefeiert.«
»Was sagst du? Den 17. Mai nicht gefeiert?«
»Nein, hier bei uns im Haus ist der 1. Mai der eigentliche Festtag. So halten es nicht wenige in der Stadt. Viele verbieten den Kindern, am siebzehnten rauszugehen, aber ich nehme unsere immer mit. Ich will nicht, daß sie deshalb gehänselt werden, und später, wenn sie groß sind, können sie selber entscheiden, was sie tun wollen. Yngvar und ich, wir haben so manchen Streit ausgefochten, das kann ich dir sagen. So gesehen ist es fast besser, daß er nicht nach Hause gekommen ist.«
Julie ist schockiert. Jetzt sieht sie, welche Kluft es zwischen ihrem und Randis Leben gibt, und das betrifft nicht nur das Milieu und die Lebensweise, sondern auch die Einstellungen. Wenn sie darüber nachdenkt, fällt ihr ein, daß es in Øra Leute gibt, die den 17. Mai nicht feiern, die Gegner der Monarchie und des Königshauses sind, aber sie hat noch nie gehört, daß jemand seine Kinder an diesem Tag zu Hause läßt. Wie Yngvar halten sie sich von der Kirche und vom Christentum fern. Sie hat in solch einem Zusammenhang nur nie an Randi gedacht.
«Was meinst du, ob der Sozialismus eine Art Religion ist?«
»Für Menschen wie Yngvar auf alle Fälle«, erwidert Randi.
»Und du, wie denkst du darüber?«
»Na, ich stimme mit ihm in vielem überein, aber auf alle Fälle glaube ich an Gott. Damit muß er sich abfinden.«
Randi sagt, daß Yngvar das sozialistische Milieu in Julies Heimatgemeinde, in Øra, beeindruckend finde. Kurze Zeit hätte er tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, dorthin zu ziehen. Aber das hätte sie ihm wieder ausreden können.
»Das hätte durchaus zu einer zu großen Belastung für unsere Freundschaft werden können, Julie.«
»Ach, letzten Endes hätten wir selber darüber bestimmt, aber leicht wäre es nicht geworden.«
Allein schon bei dem Gedanken daran wird es Julie heiß. Aber Randi sagt, Julie könne das gleich wieder vergessen, denn soweit sie verstehe, können Auswärtige nicht mehr einfach in das Dorf kommen und auf Arbeit hoffen. Und sie und Yngvar seien in der Stadt fest verwurzelt. Wenn sich nur alles ordnete und Yngvar seine Arbeit wiederbekäme und sie nur nicht zur Armenfürsorge gehen müßten. Der Gedanke daran bereite ihr nachts manchmal Alpträume.
Vor ein paar Jahren hat Randi beide Eltern innerhalb kurzer Zeit verloren. Eine Brustfellentzündung, die die beiden gleich nach dem Krieg bekamen, wuchs sich bei ihnen zur Tuberkulose aus.
»Begreifst du das, Julie, stark und gesund, wie sie waren?«
Randi hat einen älteren Bruder, der verheiratet ist und den Hof, auf dem sie ihre Kindheit verbrachten, übernahm. Die jüngste Schwester ist noch nicht konfirmiert und wohnt bei dem Bruder. Bevor der Vater starb, konnte er noch regeln, daß der Bruder die Geschwister, die den Hof verlassen hatten, ausbezahlen mußte. Für sie waren das ein paar Hunderter, die sie auf der Bank hat. Ihr Traum war es gewesen, sich dafür eine Dreizimmerwohnung anzuschaffen, sobald hier jemand ausziehen würde. Aber es wird jetzt wohl lange Zeit bei dem Traum bleiben. Denn nun ist das Geld ihre Versicherung gegen die Armenfürsorge, und sie versucht, solange es geht, einen Ausweg zu finden, ohne die Rücklagen anzurühren, aber in diesem Winter ist ihr das nicht gelungen.
»Du mußt denken, es ist hoffnungslos mit mir, Julie. Ich habe bestimmt den ganzen Abend nur von mir geredet. Aber es gibt ja sonst niemanden, mit dem ich über solche Dinge sprechen kann. Aber nun zu dir, wie geht es dir?«
»Im Verhältnis zu dir habe ich es sicher so gut, wie es nur jemand haben kann. Außerdem können wir über mich auch ein anderes Mal sprechen.«
»Geht es dir gut, Julie? Fühlst du dich wohl als Hausfrau und Mutter?«
»Ja, o ja, das tue ich. Mutter zu sein, das ...«
»Yngvar und ich, wir denken, wir haben nun genug mit denen zu tun, die wir haben. Es ist ja nicht damit getan, Kinder zu bekommen, man muß sie aufziehen, und aus ihnen soll auch was werden. Aber du möchtest wohl noch mehr haben, stimmt’s?«
»Ich hätte zu gern eine Tochter.«
»Dann müßt ihr euch halt eine anschaffen«, sagt Randi und lächelt.
»Ich werde nicht so leicht schwanger. Du erinnerst dich bestimmt, wie es mit Krister war?«
»Aber nun hast du doch zwei. Außerdem kannst du auch froh darüber sein. Wir müssen jedesmal, wenn wir miteinander schlafen, aufpassen. Trotzdem ging es schief, wie ich dir erzählt habe. Doch wenn wir erst anfangen, über solche Dinge zu reden, dann bleiben wir bestimmt die ganze Nacht hier sitzen.«
Randi hat für Julie das Sofa im Wohnzimmer hergerichtet. Sie hätte auch bei ihr im Ehebett schlafen können, aber dann hätten sie bestimmt die ganze Nacht ununterbrochen geredet. Und jetzt ist es am besten, wenn sie schlafen gehen, denn morgen haben sie einen langen und anstrengenden Tag vor sich.
Julie liegt wach und lauscht auf all die fremden Geräusche, Türenschlagen, Gejohle von Leuten, die bestimmt schon mit dem Feiern begonnen haben, ein weinendes Kind. Sie muß daran denken, was Randi ihr erzählt hat. Wie verschieden das Leben ist, das sie beide führen, trotzdem gibt es, von ihren engsten Angehörigen abgesehen, keinen Menschen, dem sie sich so verbunden fühlt.
Die Kinder wachen in aller Frühe auf und sind blaß vor Erwartung und Spannung. In den frühen Morgenstunden liegt Nebel vom Meer über der Stadt, doch bevor sie gefrühstückt und sich fein gemacht haben, schlägt das Wetter um, und der Wind kommt von Südost. Über der Kirchturmspitze und den Dächern stößt die Sonne mit scharfen Pfeilen durch den Nebeldunst, und ein frischer Wind bläst den Nebel fort. Über den Grünflächen und in der geschmückten Stadt flattern Fahnen im Wind, Blasmusik, die zu hören ist, läßt die Erwartungen der Kinder noch höher steigen.
Als erster verläßt Hallvor das Haus, er geht in seiner Schulhose, hat aber die neue Jacke an, die ihm Randi zum 1. Mai genäht hat. Er geht in die Schule, wo sich seine Klasse zur Aufstellung für den Kinderumzug trifft. Die beiden Mädchen haben zum 1. Mai auch neue Sachen bekommen. Sie sind gleich angezogen, haben blaue Kleider aus Barchent an, und obwohl der Stoff billig ist, hat Randi als Schmuck weiße Schnüre und Biesen aufgesetzt, dazu noch eine lange Leiste mit Knöpfen, und zwar aus demselben weißen Stoff wie die großen Kragen über den Schultern. Dazu weiße Strickjacken, weiße Strümpfe und weiße Stoffschuhe mit Riemen über dem Spann, riesige blaue Seidenschleifen in den hellblonden Haaren, die sie die Nacht über zu Zöpfen geflochten trugen und jetzt in einer Wolke von gekräuselten Locken bis zum Rükken reichen. Hallvor hat Randis rotblonde Locken geerbt, die Mädchen Yngvars helles, glattes Haar, aber ansonsten haben sie mehr Ähnlichkeit mit Randi. Dasselbe runde, freundliche Gesicht, dasselbe Sommersprossengesprenkel über der Nase. Wie sie so fertig angezogen und steif in ihrer Festkleidung dastehen, sind sie der Beweis für Randis Tüchtigkeit, und sie sind ihr Stolz.
»Wie es auch immer steht, die Kinder müssen wie Menschen aussehen«, meint sie.
Sie habe überlegt, sagt sie, ob sie den Mädchen die Haare kurz schneiden solle, aber bisher habe sie es noch nicht übers Herz gebracht.
»Das solltest du lieber bleiben lassen«, sagt Julie.
»Willst du dir nicht die Haare abschneiden, Julie. Dir würde das stehen.«
»Die Haare abschneiden? Du, das würde ein Spektakel geben.«
Randi hat kurze Haare, eine modische Frisur, im Nacken kurz geschnitten und zum Gesicht hin länger werdend. Über den Ohren trägt sie Haarspangen, um die wilden Locken zu bändigen.
»Ihr seht aber schön aus«, sagt Julie zu den beiden Mädchen.
»Ja, aber der Krister auch«, erwidert Kari.
»Für einen Jungen sieht er ja beinahe zu schön aus«, flüstert Randi Julie heimlich zu.
Krister trägt den Matrosenanzug, den sie ihm zu Weihnachten genäht hat, dunkelblau mit Kniehose, an einer roten Kordel die Signalpfeife in der Brusttasche, dunkelblaue Strümpfe und schwarze Lackschuhe. Unter der Bluse hat er einen Wollpullover an, damit er nicht friert. Mit Randis Worten im Ohr bleibt sie stehen und betrachtet ihren Sohn. Die schwarzen Haare fallen in dicken Locken über die Stirn, die golden schimmernde Haut, diese reinen Gesichtszüge, die kurze, gerade Nase, Grübchen, die Andeutung einer Kinnspalte, aber in erster Linie sind es die Augen, braun und ernst dreinschauend, umrahmt von dichten, dunklen Wimpern, die fast zu lang sind für einen Jungen. Ja, Randi hat recht, ihr Junge ist hübsch, und für einen kurzen Augenblick der Angst durchfährt sie der Gedanke, was das Leben für dieses Kind wohl bereithalten mag.
Vor Ungeduld treten die Kinder von einem Bein auf das andere. Randi bindet ihnen die Maischleifen um und gibt ihnen die frisch geplätteten Fahnen.
»Gehen wir nicht bald los?«
»Hört auf zu quengeln, wir haben noch viel Zeit, wir müssen uns auch noch zurechtmachen, wir Erwachsenen«, schimpft Randi und beordert sie in die Küche, wo sich jeder auf einen Stuhl setzen muß. Und wehe, wenn sie sich schmutzig machen, noch bevor es losgeht.
Randi trägt einen olivgrünen, knielangen Mantel, dazu einen Rock in derselben Farbe, der bis an die Wade reicht. Eine weiße Bluse und einen weißen Leinenhut in Eimerfasson mit einer Stoffrose auf der Krempe, an den Füßen weiße Leinenschuhe mit halbhohen Absätzen und Riemen über dem Rist. Julie erkennt den Mantel wieder. Jetzt sieht sie, er ist umgenäht wie ihrer auch. Sie hat denselben Rock und Mantel an wie auf der Reise, aber eine neue weiße Bluse mit Rüschen am Hals. Schwarze Lederschuhe in derselben Art wie Randi. Aber sie geht ohne Hut. Sie hatte keinen passenden gefunden; die Hüte, die sie besitzt, sind unmodern, die kann sie nicht mehr tragen. Sie ärgert sich jetzt ein bißchen, daß sie sich gestern hier keinen neuen gekauft hat, aber ihre Überlegung war, daß sie damit warten kann, bis sie nach Molde kommt. Der Vater hatte etwas von einem Kleidereinkauf angedeutet.
Die Stadt ist festlich geschmückt. Heute erinnert nichts daran, wie schwer die Zeiten sind. Keine roten Fahnen und kämpferischen Demonstrationsschilder, an diesem Tag soll dergleichen vergessen sein. Die Boote und Schiffe im Hafen haben geflaggt und sind mit farbenprächtigen Wimpeln geschmückt. Die Schaufenster sind mit Fahnen und Birkengrün dekoriert, das um die Rahmen der Bilder der Königsfamilie gesteckt ist. Den Kaibakken und den Langveien entlang bilden Flaggen eine zusammenhängende Fahnenburg. Getünchte Gräber, würde Yngvar sagen, bemerkt Randi, und daß die Kommune nicht mit Geld spare.
Die Straßen füllen sich mit Menschen, die sich entlang der Bürgersteige versammeln, um auf den Umzug der Kinder zu warten. Julie läßt sich von der fröhlichen Stimmung anstekken. Sie verdrängt die innere Unruhe, die sie verspürt, wenn ihre Gedanken zu Jørgen und dem kleinen Jostein wandern.
Sie gehen dem Umzug entgegen und halten Ausschau nach einem Platz, von dem aus sie Hallvor abfangen können. Da sieht Julie Familie Storvik auf dem Bürgersteig auf sie zukommen. Da, wo sie gehen, ragen sie aus der Menge heraus. Erling Storvik mit Filzhut, Jackett und gestreifter Hose dazu, Ivar im dunklen Anzug und mit Studentenmütze, Selma in einem hellen, eleganten Frühlingskostüm und mit einem ebenso eleganten Hut. All das bewirkt, daß Julie sich unpassend angezogen und unförmig vorkommt, aber sie kann dieser Begegnung nicht ausweichen. Sie sieht, daß sie sie schon bemerkt haben. Sie begrüßen sie lächelnd mit Handschlag und wünschen ihr viel Spaß am heutigen Tag. Als sie ihnen Randi vorstellt, verzieht keiner von ihnen eine Miene, und sie sagen ihr genauso lächelnd guten Tag.
»Dann sind Sie Julies Freundin?« fragt Selma. »Wie schön, Sie kennenzulernen. Und dort ist der kleine – Kristoffer.«
»Krister«, sagt das Kind ernst.
»Ja, das stimmt, du nennst dich Krister. Wie groß du geworden bist, seit wir dich zuletzt gesehen haben«, sagt Selma und streicht ihm über das Haar. »Und Jørgen und der Kleine, die konnten dich nicht begleiten?« fragt sie, an Julie gewandt.
Julie spürt, daß ihre Wangen heiß werden.
»Nein, Jørgen hat keine Zeit, und der Kleine ist halt noch zu klein für eine so lange Reise, wenn ich allein unterwegs bin.«
»Ja, ich hab’ das von Jørgen gehört.«
Nach dem Festtagsgottesdienst in der Kirche, sagt Storvik, habe er ein paar Freunde zu sich nach Hause zu Kaffee und zu einem Gläschen Portwein eingeladen. Ob Julie nicht kommen und ihnen Gesellschaft leisten wolle.
»Ja, Sie sind auch herzlich willkommen«, sagt er zu Randi.
Die Storviks wissen, was sich gehört, aber Randi hätte er bestimmt nicht eingeladen, wenn er davon ausgegangen wäre, daß Julie die Einladung angenommen hätte. Denn selbstverständlich lehnt Julie dankend ab, sagt, sie müssen sich um die Kinder an diesem für sie so wichtigen Tag kümmern. Selma sagt, Julie müsse auf dem Rückweg auf jeden Fall bei ihnen wohnen.
»Ja, denn du weißt doch, daß du uns jederzeit willkommen bist?«
»Was für einen komischen Hut der Onkel Erling aufhatte!« sagt Krister, als sie gegangen sind. »So einen Hut hat der Großvater auch, er hat ihn bestimmt noch, aber er setzt ihn nicht mehr auf.«
»Jedenfalls nicht bei uns im Dorf«, sagt Julie.
»Daß du bei mir wohnst, ist wohl nicht so gut aufgenommen worden?«
»Ach, das ...«
»Portwein in feiner Gesellschaft beim Bankchef. Wenn ich mir vorstelle, ich in diesen Kreisen. Das wäre was für Yngvar gewesen«, sagt Randi kichernd.
Der Kinderumzug kommt auf den Markt marschiert. Krister jubelt in heller Freude über die Musikkorps, über die vielen Kinder, Julie muß ihn auf den Arm nehmen, damit er alles sehen kann.
»Sieh nur, dort ist Hallvor«, kreischt er.
Wer nach dem Kinderumzug in der Kirche keinen Platz findet, geht zum Kaffeetrinken nach Hause oder in ein Café oder Restaurant. Julie und Randi gehen mit den Kindern nach Hause, um zeitig Mittag zu essen, so daß sie den Rest des Tages für alles, was noch kommt, zur freien Verfügung haben. Es rührt Julie, die Freude der Kinder über das gute Essen zu sehen.
»Das ist ja hier fast wie Weihnachten, Mama«, sagt Kari.
Der Tag vergeht wie im Flug. Sie eilen von einer Veranstaltung zur nächsten. Der Umzug der Einwohner ist ein festlicher Anblick mit all den Verbänden und Vereinen, die unter ihren Fahnen aufmarschieren. Hier sind die Turner und die Krankenpfleger in ihren verschiedenen Trachten. Julie und Krister, die so etwas noch nicht gesehen haben, verschlägt es fast den Atem. In Vågen veranstaltet der Ruderclub eine Regatta. Dort gibt es ein Wettrudern mit Vierriemen- und Geitbooten rund um Innlandet. Daran nehmen auch Gäste aus der Umgebung teil. All das sind große Erlebnisse für Krister, doch den Höhepunkt bilden die Veranstaltungen für groß und klein auf dem Sportplatz. Den meisten Spaß gibt es beim Stangenklettern.
Die Stange, an der die Jungen ihre Kletterkünste zeigen können, steht mitten auf dem Platz. Sie ist mit Kernseife eingeschmiert, und an der Spitze hängen verlockende, tolle Preise. Es sind geräucherte Dauerwürste dabei und Leckerbissen der verschiedensten Art, Kochtöpfe und andere Haushaltsgeräte. Wer es bis nach oben schafft, kann versuchen, etwas davon zu erhaschen. Vor der Stange steht eine lange Schlange. Einige schaffen es lediglich ein kleines Stück hinauf und rutschen dann wieder herunter, manche kommen bis ganz nach oben, ohne daß es ihnen gelingt, etwas von den Herrlichkeiten zu ergattern. Andere lassen sich mit der Beute, die sie geholt haben, souverän heruntergleiten. Einer, der das schafft, ist Hallvor; mit einer Wurst in den Händen kommt er zu seiner Mutter.
»Du lieber Himmel, das ist ja ein erfolgreicher Tag«, sagt sie überwältigt. Hallvor läuft schnell wieder zu der Schlange hin, kommt jedoch gleich wieder zurück. Er durfte es nicht noch einmal versuchen, weil er bereits einen der Preise gekapert hat.
Nach den Spielen für die Kinder führt der Turnverein etwas vor, und zum Abschluß kommt das große Ereignis des Tages, die Ringer veranstalten Schaukämpfe. Mehrere Ringkämpfer aus Kristiansund haben international Erfolg und sind die Helden der Stadt. Ein ohrenbetäubender Jubel bricht aus, als Arne Gaupseth das Podium betritt. Er hat Norwegen bei den Olympischen Spielen 1924 vertreten und erreichte einen achtbaren fünften Platz.
An Randis Küchentisch lassen sie den Tag mit Kakao und selbstgebackenen Brötchen ausklingen. Die Kinder, die nach den Erlebnissen an diesem Tag müde sind, gehen ohne Protest ins Bett. Und schon nach wenigen Minuten ist es an diesem Abend im Schlafzimmer still.
Randi und Julie sind auch erschöpft. Nachdem Ruhe in das Haus eingekehrt ist, sitzen sie noch zusammen bei einer Tasse Kaffee.
Randi sagt, Julie hätte wohl eigentlich an der Abendveranstaltung im Festsaal teilnehmen müssen, Ivar spiele dort im Symphonieorchester, und Erling Storvik halte die Festrede.
»Wenn du Lust hast hinzugehen, dann mußt du dich beeilen. Krister ist hier gut aufgehoben, wie du weißt.«
»Ich weiß, daß Storvik die Rede hält, aber sie müssen mich entschuldigen. Heute kann ich nicht mehr.«
»Ich hoffe, ich habe dich heute nicht beleidigt mit dem, was ich zu der Einladung von Storviks gesagt habe? Du weißt ja, wie ich bin, ich rede, bevor ich denke.«
»Beleidigt? Nein, überhaupt nicht.«
Es sei ja auch so, sagt Randi, sie könne über Storviks überhaupt nichts Schlechtes sagen. Sie kennt Frauen, die dort im Hause arbeiten, und die sagen über Frau Storvik nur Gutes. Sie selber aber, die bei den vornehmsten Familien in der Stadt saubermacht und auch zu festlichen Anlässen kocht, hat das Storviksche Haus vermieden. Da sie Julies Freundin ist, wäre das schwierig geworden.
Julie sagt, es sind angenehme Menschen, nett und gastfreundlich, daran hapert es nicht. Aber sie führen ein so anderes Leben als sie, von Randis Leben ganz zu schweigen.
Als Randi sie weckt, hat sie das Gefühl, gerade eben eingeschlafen zu sein.
»Auf Nordlandet ist die Fahne bei der Fischverarbeitung hochgezogen worden«, flüstert sie. »Das bedeutet, Fisch ist angekommen. Ich muß mich beeilen, daß ich hinkomme.«
Die beiden kleinen Mädchen stehen schlaftrunken und fröstelnd hinter ihr in der Tür.
»Nimmst du sie mit?«
Ja, sagt Randi, Kari habe schon gelernt, sich nützlich zu machen, das gäbe noch ein paar Øre extra pro Tag. Und auch die Kleine wisse, daß sie nicht im Weg herumstehen dürfe, und deshalb nimmt sie die Mädchen mit. Julie müsse sich selbst versorgen, bevor sie abfahren, und so tun, als ob sie hier zu Hause sei. Und ob sie, bevor sie losgehe, darauf achten könnte, daß Hallvor aufsteht, damit er rechtzeitig in die Schule kommt? So ist Randis Alltag.