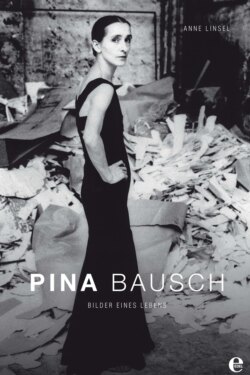Читать книгу Pina Bausch - Anne Linsel - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ZWEI
STUDIUM IN ESSEN
ОглавлениеDie Folkwangschule für Musik, Tanz und Sprechen – heute Folkwang-Universität der Künste – wurde 1927 vom damaligen Direktor der Essener Oper, Rudolf Schulz-Dornburg, dem Bühnenbildner Hein Heckroth und dem Choreographen Kurt Jooss gegründet. Der Name »Folkwang« geht zurück auf die germanische Mythologie: Folkwang hieß der Saal der Freya, der germanischen Göttin der Liebe und Schönheit. Karl Ernst Osthaus (1874–1921), der Hagener Kunstsammler und Mäzen, hatte diesen Namen für die neue Kunstschule und für das Museum seiner Heimatstadt ausgesucht. Später übernahm auch das Essener Kunstmuseum diesen Namen.
Von Anfang an verfolgte die Folkwangschule besondere Ziele: Die Ausbildung der jungen Studierenden sollte spartenübergreifend sein. So kamen beispielsweise Schauspieler und Musiker in den Tanzunterricht, Tänzer in den Musik- und Schauspielunterricht. Nach dem Krieg wurde das Studienangebot um die Abteilung Gestaltung (bildende Kunst, Fotografie, Grafik, Design) erweitert. Das Konzept der gegenseitigen Durchdringung blieb bestehen.
Diese Schule zu besuchen und dort eine solide Tanzausbildung zu machen, das hatte die Lehrerin des Solinger Kinderballetts Pina Bausch nach Abschluss der Grundschule dringend geraten. Die Eltern bestanden zunächst darauf, dass ihre Tochter eine Eignungsprüfung ablegt: bei Erich Walter in Düsseldorf. Damals konnte niemand ahnen, dass er einmal einer ihrer Vorgänger am Wuppertaler Theater sein würde. Natürlich bescheinigte Walter das große Talent von Pina Bausch: So hatten ihre Eltern keine Einwände mehr, ihre Tochter zur Tanzausbildung zu schicken. Nach bestandener Prüfung kam Pina Bausch mit 14 Jahren nach Essen.
»Ich hatte damals furchtbar viel Angst«, erinnerte sie sich, »die übervolle Mensa, die vielen Studenten, die Hektik auf den Fluren.« Pina Bausch kam mitten im Semester an, konnte deshalb keine Aufnahmeprüfung machen (die eigentlich vorgeschrieben war), durfte aber bleiben und mittanzen. Auf dem Lehrplan mit einem breiten Spektrum standen klassischer und moderner Tanz, europäische Folklore, Komposition, dazu theoretische Fächer wie Tanz- und Kunstgeschichte. Pina Bausch hatte Sprechunterricht und sang – das war Pflicht – in einem Chor. »Wir haben Modell gestanden bei den Malern oder Bildhauern und stellten uns zur Verfügung, wenn sie Gesichtsmasken brauchten.« Studenten der Fotografie kamen, um die Tänzer zu fotografieren. Es war ein ständiger Austausch, ein voneinander lernen. So entstanden viele kleine gemeinsame Projekte. An Tanzabenden – manchmal mit kleineren Choreographien der Studenten – gehörten Musiker, Schauspieler oder Fotografen zum Publikum, wie an den Theaterabenden die Tanzstudenten.
Man konnte ein pädagogisches Examen machen oder die Bildungsreifeprüfung ablegen. Pina Bausch entschied sich für beides. Und sie hat längere Zeit mit Kindern gearbeitet. Für die Bildungsreifeprüfung lernte sie immer abends; sie hat dafür eine Weile in einem Bootshaus gewohnt und noch spät mit einem Tee und vielen Büchern allein gesessen und gelernt, zum Beispiel »alles über Ameisen«.
Im ersten Ausbildungsjahr wohnte Pina Bausch noch zu Hause in Solingen. Sie musste immer früh aufstehen, um pünktlich in Essen zu sein. Wenn sie verschlafen hatte und die Straßenbahn weg war, weckte sie ihren Vater oder Bruder. »Die sind dann wirklich im Schlafanzug ins Auto gestürzt und haben mich nach Essen gefahren.« Diese Hilfsbereitschaft habe sie immer gerührt. Mit 15 Jahren durfte sich Pina ein Zimmer in Essen nehmen, zusammen mit einer Freundin.
Die Folkwangschule in Essen mit allen Künsten unter einem Dach war ein Glücksfall für Pina Bausch. Oft schwärmte sie vom Geist der Schule und von der Atmosphäre im ehemaligen Klostergebäude: Überall auf den Fluren habe man Klänge, Melodien und Texte gehört, es habe nach Farben gerochen, und in allen Ecken hätten Musikstudenten gesessen und geübt. »Wahrscheinlich ist hier der Grundstein für meine Arbeit gelegt worden«, sagte sie, »wo sich ja auch Tanz, Musik, Spiel, Sprechen auf der Bühne miteinander verbinden.« Entscheidend wurde für sie die Begegnung mit Kurt Jooss – der charismatische Choreograph und Pädagoge war ihr erster Lehrer. 1901 im schwäbischen Wasseralfingen (heute ein Stadtteil von Aalen) geboren, studierte Jooss Klavier und Gesang, Schauspiel und schließlich Tanz. Er war Schüler von Rudolf von Laban, dem Tanztheoretiker und -reformer. 1924 gründete Jooss in Münster die Neue Tanzbühne, die Vorläuferin all seiner späteren Tanzkompanien. 1927 ging Jooss als Mitgründer der Folkwangschule nach Essen. Zusammen mit Sigurd Leeder gelang es ihm, die Folkwangschule zur führenden Ausbildungsstätte für modernen Tanz in Deutschland zu etablieren. 1933 beendete Jooss seine Lehrtätigkeit in Essen und emigrierte nach England, weil er sich von seinen jüdischen Mitarbeitern und Tänzern, unter anderem dem Komponisten Fritz Cohen, nicht trennen wollte. Ein Jahr zuvor hatte Jooss das Antikriegsballett Der grüne Tisch kreiert und damit den Pariser Choreographiewettbewerb gewonnen. Es sollte eines der meistaufgeführten Tanzstücke des 20. Jahrhunderts werden. 1949 kehrte Kurt Jooss aus dem Exil zurück nach Essen, um wieder die Leitung der Folkwang-Tanzabteilung zu übernehmen. Damit begann eine neue Ära. Er setzte sich (erneut zusammen mit Sigurd Leeder) für ein besonderes Ausbildungskonzept ein und holte qualifizierte Dozenten, Tänzer und Choreographen dorthin. Außerdem erweiterte er die bestehende Fakultät: ein Ballettmeisterseminar für Theatertanz, Tanz für das Objektiv (Film und Fernsehen), eine Ausbildung in Dramaturgie, ein Institut für vergleichende Tanzwissenschaft, ein Seminar für Tanzkritik und ein Tanzgymnasium mit angegliedertem Internat.
1986 schrieb Pina Bausch: »Das Besondere an ihm [Kurt Jooss] war, dass er etwas öffnete. Folkwang ist keine Schule, die eine bestimmte Technik lehrt. Es waren verschiedene Techniken, klassisch, modern, europäische Folklore. Aber nicht nur Tanztechniken beeinflussen einen. Vieles, wovon wir beeinflusst sind, lernen wir indirekt kennen. Was mich mit Jooss verbindet, sind menschliche Dinge, ist seine Humanität.«
Diese Humanität spürten wohl alle, die bei Jooss studierten. Es herrschte eine fast familiäre Atmosphäre. »Papa« nannten ihn die Studenten – mit allem Vertrauen und aller Zuneigung, aber auch mit Respekt und der nötigen Distanz. Es blieb jedoch immer beim »Sie«. Für Jooss hieß Unterrichten auch: Er übernahm Verantwortung für seine Schüler. Ganz besonders, von Anfang an, für Pina Bausch. Sie, die jüngste Studentin in Essen, wurde in der Familie Jooss aufgenommen wie eine dritte Tochter (Jooss, verheiratet mit der Tänzerin Aino Siimola, war Vater zweier Töchter). Hier erlebte Pina Bausch bürgerliche Kultur: Die Bücherschränke standen für sie offen, zum ersten Mal hörte sie klassische Musik, denn aus dem Solinger Elternhaus und der Kneipe kannte sie nur Schlager, die im Radio gespielt wurden. Auch anregende Gespräche am Esstisch, oft mit interessanten Gästen, erlebte Pina Bausch hier. »Was für ein Glück, dass ich ihm begegnet bin in einem entscheidenden Alter«, sagte sie später.
Irgendwann während der Studienzeit holte Jooss ein kleines Bändchen aus seinem Bücherschrank und überreichte es Pina Bausch: Briefe an einen jungen Dichter von Rainer Maria Rilke. Pina Bausch las dieses Buch mit Erregung, wie sie später sagte, denn hier standen Sätze, die auch an sie gerichtet schienen. Rilke schreibt zehn Briefe an einen jungen Mann, der Gedichte verfasst und Rat des älteren Meisters sucht. Darin heißt es: »Niemand kann Ihnen raten und helfen, niemand. Es gibt nur ein einziges Mittel. Gehen Sie in sich. Erforschen Sie den Grund, der sie schreiben heißt; prüfen sie, ob er in der tiefsten Stelle Ihres Herzens seine Wurzeln ausstreckt, gestehen Sie sich ein, ob Sie sterben müssten, wenn es Ihnen versagt würde zu schreiben. Dieses vor allem: fragen Sie sich in der stillsten Stunde Ihrer Nacht: muss ich schreiben? Graben Sie in sich nach einer tiefen Antwort.«
Das hat Pina Bausch getan, sich ernsthaft gefragt, ob sie tanzen muss, nicht nur will oder möchte, nein, muss. Und habe, so sagte sie später, zunächst keine Antwort gefunden. Dann passierte es, dass sie eines Morgens mit heftigen Rückenschmerzen aufwachte. Sie rannte von Arzt zu Arzt, keiner konnte ihr helfen. Bis einer ihr den Ratschlag gab, sofort mit dem Tanzen aufzuhören, sonst würde sie in einem halben Jahr an Krücken laufen. Da fand sie in vielen schlaflosen Nächten endlich Antwort auf die quälende Frage: »Ich muss tanzen.« Und wenn es nur noch für ein halbes Jahr sei. Jooss gegenüber sagte sie damals, sie hoffe so sehr, dass es ihr eines Tages gelingen möge, dem »unbeschreiblichen Empfinden«, das sie in sich verspüre, Gestalt zu geben.
Julliard School, New York, 1960
Julliard School, New York, 1960
Probe zu Doris Humphreys »Passacaglia and Fugue«, Julliard School, New York, 1960
Jooss holte immer wieder Tänzer und Choreographen aus Amerika zu Sommerkursen oder für eine längere Zeit nach Essen: Antony Tudor, José Limón, Lucas Hoving, Paul Sanasardo oder Donya Feuer – Lehrer, denen Pina Bausch in New York wiederbegegnen sollte. Auf diese Weise lernten die Studenten zahlreiche unterschiedliche Techniken kennen, zum Beispiel die Grahamoder die Limón-Technik oder auch den Jazztanz.
Und Jooss erweiterte das Lernen: Die Studenten sollten auch Lehren lernen. So erhielt jeder von ihnen die Möglichkeit, Laien zu unterrichten. Pina Bausch meldete sich für Kinderklassen an, die die Folkwangschule eingerichtet hatte. Mit Freude und Engagement ließ sie sich auf diese Arbeit ein. Ihre Erfahrungen flossen in eine schriftliche Arbeit ein, die sie für Jooss zu schreiben hatte: »Ein- und Ausdrehung der Füße im Laienunterricht«. Sie breitet da ausführlich ihre »pädagogischen Karten« zum Thema aus, und zwar in Form eines Briefes an einen »lieben jun gen Freund«, einen fiktiven ehemaligen Schüler. So heißt es: »Ich kann mich noch gut erinnern, als Du zum ersten Mal in meine Stunde kamst. Damals gingst Du trotz Deiner Jugend – ich sehe es noch genau vor mir – schon etwas gebückt. Die Schultern hingen nach vorn, der Kopf war gesenkt und Deine Füße waren immer leicht eingedreht. Auch Dein ganzes Verhalten drückte, wie Deine Haltung, Zaghaftigkeit und Schüchternheit aus. – Ich weiß, an all dem ist Dein schweres Schicksal schuld: der Krieg und die Umstände in Deiner Familie. Du glaubst nicht, welche Freude ich hatte, als ich Deine allmähliche Umwandlung bemerkte. Es erschüttert mich direkt, dass ich es gewesen sein soll, der zu dieser Verwandlung den Anstoß gegeben hat. – Wie hast Du Dich verändert! Dein Gesicht und Dein ganzer Körper tragen einen anderen Ausdruck.«
Und sie erläutert ihre Gedanken zum Eindrehen der Füße. Sie schreibt: »Mit dieser Fußstellung ist meistens ein gewisses Sichhängenlassen verbunden, was in allen Gliedern sichtbar wird. Diese Bodenschwere ist ein Zeichen von Trauer, des Leids und der Resignation. Schauen wir uns einmal ein Kruzifix an. Alles hängt nach unten und ist völlig nach innen gerichtet: die Schultern, der Kopf, die Füße, sogar der Mundwinkel und die Augenbrauen.« Jooss schrieb unter diese Arbeit: »Sehr gute, sehr persönlich erlebte Darstellung.«
In einer anderen Arbeit mit dem Titel »Warum liebt der Mensch sich rhythmisch zu bewegen, und was soll und kann er im Tanz finden?« schrieb Pina Bausch etwa: »Rhythmus finden wir nicht nur in der Musik, sondern in allem. In unseren täglichen regelmäßigen Arbeiten, der Hast in einer Stadt, in dem Bild einer Landschaft, in dem Baustil eines Hauses, in der gewölbten Krone eines Baumes, überhaupt in allen kleinen, großen, wichtigen und unwichtigen Dingen des Lebens. Überall herrscht der Rhythmus vor.«
Wichtig vor allem für Pina Bausch war, dass Jooss seine Schüler ausprobieren ließ. Alles, was ihnen in den Sinn kam, Eindrücke und Gefühle, denn, so Jooss: »Jedes Gefühl findet seinen Ausdruck in einer ganz bestimmten Bewegung.« Dieses Ausprobieren führte dann zu den existenziellen Fragen: Was will und muss ich ausdrücken? Was ist mein Eigenes? In welche Richtung will ich gehen?
Am Ende ihrer Ausbildungszeit, 1958, stiftete die Gesellschaft der Freunde und Förderer der Folkwangschule den ersten Folkwang-Leistungspreis. Aus jeder Abteilung wurde ein Student für diesen Preis vorgeschlagen, der eine kleine Präsentation seiner Arbeit zeigen musste. Jooss hatte Pina Bausch vorgeschlagen – übrigens gegen den Willen einer anderen Lehrkraft, die der Meinung war, Pina Bausch sei viel zu jung dafür.
Pina Bausch entwickelte also ein kleines Programm aus klassischem Tanz und Folklore. Dann kam der Tag der Präsentation. Pina Bausch ging auf die Bühne, stellte sich in Position, das Licht ging aus – und es passierte gar nichts. Der Pianist für die Musik war nicht da. Im Zuschauerraum herrschte Aufregung und Unruhe, der Pianist kam nicht, niemand wusste, wo er war – man begann, ihn zu suchen. Pina Bausch nahm das alles zwar wahr, ließ sich aber nicht irritieren. »Ich wurde immer ruhiger und blieb einfach stehen. Ich weiß nicht mehr, wie lange. Aber es war eine ziemlich lange Zeit, bis man den Pianisten gefunden hatte.« Er war in einem anderen Gebäude gewesen. »Ich glaube, die Menschen unten im Saal waren sehr verblüfft, dass ich dort oben mit so großer Überzeugung und Ruhe so lange stehen geblieben bin.« Als endlich die Musik anfing, tanzte Pina Bausch ihr Programm. Und gewann den ersten Folkwang-Leistungspreis. Damals, in dieser schwierigen Situation, so Pina Bausch, habe sie gemerkt, wie eine große Ruhe über sie gekommen sei und sie daraus Kraft geschöpft habe – eine Fähigkeit, die sie später im Theater noch oft habe einsetzen müssen.
In der Neuen Ruhr Zeitung stand damals über diese Vorstellung: »Pina Bausch brachte ein kleines Tanzprogramm von meist eigener Erfindung: Etüden im klassischen und modernen Stil, von denen Am Boden gefesselt, Völlerei und Melancholie durch ihre originelle Choreographie besonders auffielen. Darauf schottische und spanische Folklore und zum Schluss Kompositionsstudien. Über das ungewöhnliche Talent hinaus verrieten die Darbietungen auch persönliche Eigenart.«
Wenig später bewarb sich Pina Bausch um ein Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD). Sie hatte in Düsseldorf ein Gastspiel der José Limón Dance Company gesehen und war tief beeindruckt. Das wollte sie auch lernen und vertiefen, was sie von den amerikanischen Gastlehrern gelernt hatte. Jooss unterstützte Pina Bausch aus voller Überzeugung. Er wusste, dass ihre besondere Begabung weitere Herausforderungen brauchte und dass es in Amerika hervorragende Tänzer gab, die auch lehrten. Und dass sich der moderne Tanz in Amerika weiterentwickelt hatte, während er in Deutschland während des Nationalsozialismus in seiner Entwicklung unterbrochen worden war. Jooss schrieb 1958 in einem Empfehlungsschreiben für Pina Bausch an den DAAD: »Gerne und mit besonderer Freude bestätige ich, dass PINA (PHILIPPINA) BAUSCH einer der lautersten und liebenswertesten Charaktere ist, die mir in längeren Jahren als Schüler begegnet sind. In ihrem Wesen mischen sich aufs glücklichste eine feine Sensibilität und reiche Phantasie mit einfacher Denkungsart, innerer Bescheidenheit und einem tief eingewurzelten Pflichtgefühl, bedenkenlose Opferbereitschaft mit einem zielbewußten Willen zu vollem Einsatz und höchster Leistung im Dienste der Kunst […] Man muß und darf wohl hoffen, daß dieses vom Leben noch nicht stark berührte Wesen sich auch in harten und anspruchsvollen Situationen bewähren wird.«
Pina Bausch erhielt das beantragte Stipendium. Vor ihrer Reise nach Amerika durfte sie noch in einer besonderen Opernaufführung mittanzen: Die Feenkönigin von Henry Purcell nach William Shakespeares Sommernachtstraum feierte als deutsche Erstaufführung im Juni 1959 bei den Schwetzinger Festspielen Triumphe. Jooss hatte den Auftrag erhalten, die Tänze zu choreographieren. Mit dabei waren Erich Schumacher (Regie), der Intendant des Essener Theaters, und der junge Jean-Pierre Ponnelle (Bühnenbild und Kostüme).
1959, kurz vor ihrem 19. Geburtstag am 27. Juli, ging Pina Bausch in Cuxhaven an Bord der Hanseatic. Um die Reise antreten zu können, hatten ihre Eltern sie vorzeitig für mündig erklären lassen. Am Ufer spielte eine Blaskapelle, alle Leute weinten. Auch Anita und August Bausch, die mit weißen Taschentüchern winkten. Pina Bausch winkte weinend zurück. Sie hatte das Gefühl, es wäre ein Abschied für immer.
Mit Koert Stuyf, Julliard School, New York, 1960
Mit Koert Stuyf, Proben zu Anthony Tudors »A Choreographer Comments«, Julliard School, New York, 1960
Proben zu »Lilac Garden« von Anthony Tudor in den Sechzigerjahren, Essen