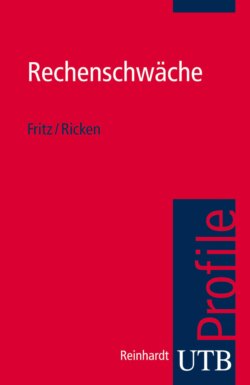Читать книгу Rechenschwäche - Annemarie Fritz - Страница 6
ОглавлениеEinleitung
Im Zuge der Teilnahme Deutschlands an den internationalen Bildungsgangstudien verständigte sich die erziehungswissenschaftliche, psychologische und fachdidaktische Diskussion auf ein neues Paradigma: den Begriff der Kompetenz. Als Kompetenzen bezeichnet man die Leistungsfähigkeiten einer Person in einem bestimmten Gegenstandsbereich (Domäne). Sie werden definiert als die spezifischen kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um Probleme in dem jeweiligen Gegenstandsbereich erfolgreich zu lösen. Damit geht der Kompetenzbegriff weit über das abprüfbare curriculare Wissen hinaus, da er vor allem die Anwendung des Gelernten auf „lebensweltliche“ Bezüge bzw. auf nicht im Unterricht behandelte neue Situationen impliziert. Das bedeutet, Kompetenzen zeigen sich darin, dass spezifische Kenntnisse zur Bewältigung unterschiedlicher Anforderungen und in unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden können.
Um den Umfang, in dem jemand über spezifische Kompetenzen (z. B. im Bereich Mathematik) verfügt, einzuschätzen, werden die Leistungen der Schülerinnen und Schüler mit einer Skala (bisher meist nur mit einer) nach Kompetenzstufen oder -niveaus unterschieden. Eine hohe Kompetenz steht für umfassende Kenntnisse im jeweiligen Wissensbereich, entsprechend bedeutet eine geringe Kompetenz, dass nur grundlegende „erste“ Kenntnisse vorhanden sind, um Anforderungen des Gegenstandsbereichs zu bewältigen.
Auf diese Weise kann einerseits die Leistungsfähigkeit des Bildungssystems abgebildet und ein konzeptueller Rahmen für Bildungsstandards geschaffen werden. Andererseits ermöglicht die Einteilung von Leistungen in Kompetenzniveaus auch eine Abbildung individueller Unterschiede zwischen Kindern nach qualitativen Aspekten. Damit lassen sich auch rechenschwache Kinder hinsichtlich ihrer Fähigkeiten in ein Kompetenzraster einordnen, sodass auf das Niveau ihrer aktuellen Kompetenzentwicklung geschlossen werden kann. Da Kompetenzniveaus zugleich auch als Entwicklungsniveaus zu interpretieren sind, ist sodann der aktuelle Kenntnisstand mit der Zone der nächsten Entwicklung in Beziehung zu setzen. Damit steht ein individueller Bezugsrahmen für die Bewertung der Entwicklung, die Begründung von Förderzielen und die Bewertung von Veränderungen zur Verfügung.
Die Kompetenzperspektive ist im vorliegenden Buch für die Einordnung und Interpretation von „Rechenschwächen“ leitend und soll Rechenschwächen als unterschiedlich stark ausgeprägte Entwicklungsrückstände verstehbar machen: Rechenschwache Kinder bleiben im Prozess der Entwicklung von Konzepten und Kompetenzen auf bestimmten Niveaustufen „stehen“.
Ausgehend von frühen Kompetenzen steht die Frage im Mittelpunkt, wie diese aufeinander aufbauen, welche Niveaus sich unterscheiden lassen und ob „Nadelöhre“ oder „Meilensteine“ auszumachen sind, die eine besondere Bedeutung für die Entwicklung von Rechenkompetenzen bzw. Rechenschwächen haben. Wir verstehen Rechenstörungen also aus einer entwicklungsorientierten Perspektive heraus. Unter dieser Perspektive werden schließlich diagnostische Ansätze systematisiert und hinsichtlich ihrer Aussagen bewertet sowie Fragen der Entwicklung von Förderkonzepten diskutiert.
Dafür werden zunächst Ansätze, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit der Erkennung von Rechenschwierigkeiten bzw. mit der Förderung rechenschwacher Kinder befassen, ausgewertet. Über eine rein additive Darstellung der unterschiedlichen Perspektiven hinaus wird dann in diesem Buch der Versuch unternommen, ein einheitliches Konzept zu entwickeln, mit dem ein Bogen von den wesentlichen Meilensteinen der Entwicklung zu diagnostisch brauchbaren Aufgaben geschlagen wird, deren Auswertung zugleich Ansatzpunkte für die Konzipierung der Förderung liefert. Diagnostik und Förderung werden in einen gemeinsamen entwicklungstheoretischen Bezugsrahmen gesetzt.
Diese theoretische Orientierung soll Lehrerinnen und Lehrern einen Zugang bieten, eigene Beobachtungen und Kenntnisse einzuordnen und als Basis für das eigene pädagogische Handeln zu nutzen.