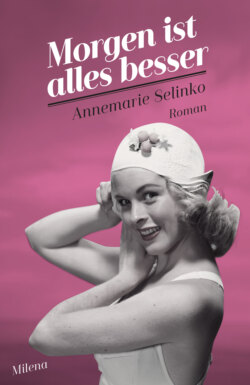Читать книгу Morgen ist alles besser - Annemarie Selinko - Страница 6
3
ОглавлениеDER FRIEDL IST dann doch nicht zur Mikula in die Sprechstunde gegangen. Wirklich – er wollte sich Zeit nehmen, er wollte sogar den Direktor in der Versicherungsgesellschaft ersuchen, ihn übernächsten Montagvormittag auf eine Stunde zu beurlauben, er wollte mit der Mikula reden und verbindlich lächeln, er wollte seinen kleinen Kameraden herausreißen, er wollte – und dann ging es doch nicht. Er hatte keine Zeit mehr, er wurde abberufen, der oberste Chef griff ein, der alleroberste Chef aller kleinen und großen Angestellten, der Tippfräuleins und der Generaldirektoren. Der alleroberste Chef entschied, dass Rittmeister Friedl Huber keine Zeit mehr haben sollte.
Entscheidende Ereignisse beginnen so klein und nebensächlich. Das erste Anzeichen dieses unfassbaren Geschehens, das Toni niemals ganz begriffen hat, zeigte sich Donnerstagmittag. Friedl kommt nach Hause, die Küchentür ist wie immer offen, das ganze Vorzimmer riecht wieder wie ein Gasthaus. Da tobt der Friedl, er schreit so laut, wie er nicht einmal in der Kaserne geschrien hat, behauptet der Fekete. Friedls Gesicht wird dunkelrot vor Wut und sein Antlitz – furchtbar und großartig, wie bei einem jähzornigen Gott, denkt die Toni. Das Grinsen des einfältigen Fekete erstarrt vor Schreck, behutsam schließt er die Küchentür, zerknirscht und vollkommen vernichtet. Bei Tisch wagt die Toni kein Wort zu sprechen, Friedls Hände zittern, er hat sich wirklich aufgeregt. Und er regt sich doch sonst niemals wirklich auf, er hat sich längst an die Schlamperei gewöhnt.
»Abends bin ich zu Hause«, sagt Friedl zwischen Suppe und Fleisch. Toni ist sehr erstaunt: Montag und Donnerstag sind nämlich Friedls »freie Abende«, da ist er immer »besetzt«. Das hängt mit den freien Abenden zusammen. Früher gehörten diese Abende einer Frau Charlotte, jetzt gehören sie einem Fräulein Clarisse.
»Heut ist doch Donnerstag«, erinnert Toni diskret.
»Jawohl«, brüllt Friedl, er brüllt grundlos, er scheint nur auf eine Gelegenheit zum Weiterwüten gewartet zu haben. »Ich weiß, heut ist Donnerstag. Ich kann ausgehen, wann es mir passt. Verstanden? Ist es dir vielleicht nicht recht? Heut ist Donnerstag und ich werde zum Nachtmahl zu Hause sein.«
»Wir werden einen gemütlichen Abend haben«, murmelt Toni und denkt, dass der Friedl heut sehr sonderbar ist.
Nach der Mehlspeise kommt ihr eine Idee.
»Du bleibst am Donnerstag zu Hause«, beginnt sie schüchtern, »Friedl, bist du vielleicht krank?«
»Nein, ich bin nicht krank, ich kann es mir nicht leisten, krank zu werden«, fährt der Friedl auf.
Abends ist der Friedl noch viel sonderbarer. Er wollte um acht Uhr nach Hause kommen. Um viertel sieben wird die Wohnungstür dröhnend zugeschlagen: Friedl ist schon da. Im Vorzimmer rieche es gerade wie in einem Unterseeboot, behauptet Toni. Sie war zwar noch nie in einem Unterseeboot, aber nur in einem Unterseeboot kann es derart nach Fisch und Meer riechen wie im Vorzimmer. Die Küchentür ist sperrangelweit offen: Fekete kocht Seefisch zum Nachtmahl.
»Im Vorzimmer stinkt es wie immer«, sagt Friedl. Ganz leise sagt er es, müde, apathisch. Fekete erscheint im Vorzimmer: Der Krach ist fällig. Friedl schlägt keinen Krach. Wie sonderbar, dass Friedl den Seefisch ruhig stinken lässt. Er geht wortlos in sein Schlafzimmer, lässt sich aufs Sofa fallen und beginnt seine Schuhe aufzuschnüren.
»Du bist ernstlich krank«, sagt die Toni, die zu ihm ins Zimmer kommt. Keine Antwort. Das Schuhband am linken Schuh ist zu fest verknotet, ungeduldig zerrt Friedl daran, angestrengt und nervös. Da kniet Toni nieder und zieht dem Vater die Schuhe aus. »Lass doch«, murmelt Friedl, aber gleichzeitig lehnt er sich erschöpft zurück und ist froh, dass jemand anderer sich mit seinen Schuhbändern herumbalgt.
»Leg dich gleich nieder«, sagt Toni und wird sehr energisch: »Du gehst ins Bett, der Fekete kocht heißen Tee, du nimmst Aspirin und Abführmittel, du bist nämlich krank!«
Aspirin und Abführmittel. Seit Toni denken kann, gibt man ihr gleichzeitig Aspirin und Abführmittel, wenn sie sich krank fühlt. Eines von beiden hilft immer, denn Toni hat entweder Schnupfen oder verdorbenen Magen. Aber Friedl? Friedl war noch nie krank, Toni kann sich nicht erinnern, dass er krank gewesen wäre.
Etwas später, als sie mit dem Tee in sein Zimmer kommt, liegt er schon im Bett, hat die Augen geschlossen und atmet hastig.
»Mach die Augen auf, der Tee«, mahnt Toni.
»Ja, ja, der Tee, ja, ja«, flüstert Friedl, schlägt die Augen auf und starrt zur Zimmerdecke.
»Schau, Friedl, der Tee wird kalt«, bettelt Toni. Aber der Friedl starrt weiter zur Zimmerdecke empor.
»Fekete, der Herr Rittmeister gefällt mir nicht«, sagt die Toni. Sie ist in die Küche gelaufen, um mit Fekete zu beraten. Nein, Friedl gefällt ihr nicht. Toni hatte einmal ein Fräulein, das rief immer: »Das Kind gefällt mir nicht«, wenn die kleine Toni alle Symptome eines verdorbenen Magens hatte.
»Herr Rittmeister, habe ich vorige Woche gesagt, Herr Rittmeister, Schuhe müssen neue Sohlen bekommen, Sohlen sind schon schlecht. Ich habe Herrn Rittmeister gleich Meldung gemacht, aber Herr Rittmeister hat gesagt: Fekete, das hat noch Zeit, Schuhsohlen kosten sieben Schilling, wir müssen sparen. Joj mama, habe ich mir gedacht, so sehr spart der Herr Rittmeister, no – und jetzt ist er krank, es regnet, nasse Füße, hätten wir die Krawattennadel eben gelassen, was braucht man Krawattennadel mit Perle und Brillant, wenn man nasse Füße hat und –«
»Was ist mit der Krawattennadel, Fekete?« Toni ist sehr aufmerksam geworden. Der Fekete wundert sich, dass der Herr Rittmeister dem gnädigen Fräulein nichts erzählt hat. Langsam kommt es heraus: Der Herr Rittmeister hat vor längerer Zeit den Fekete ins Dorotheum geschickt, damit er dort die goldene Krawattennadel mit der rosa Perle und dem großen Brillanten versetzt. »Jo, hab ich sie versetzt«, berichtet Fekete. Und neulich habe ihn der Herr Rittmeister hingeschickt, er musste Zinsen bezahlen, damit die Krawattennadel nicht verfällt.
Toni nagt an ihrer Unterlippe, sie hat das Gefühl, dass sie weinen möchte, weil der Friedl solche Sorgen hat, weil er die Krawattennadel vom Großpapa versetzt hat, weil er ihr nichts davon sagte und ihr sogar die rosa Satinbluse kaufte, die sie so gern haben wollte. Die rosa Satinbluse. Mein Friedl, mein Friedl, denkt sie und spürt, dass die Tränen kommen, obwohl jetzt kein Grund zum Weinen ist.
Etwas später steht sie am Telefon. Sie hat den Doktor Honig angerufen, den Hausarzt. Ein süßer Name, denkt sie jedes Mal, wenn sie mit dem Doktor Honig spricht.
»Hallo, Herr Doktor, hier ist Toni, Toni Huber, Herr Doktor – bitte, kommen Sie zu uns, der Friedl – ja, ich glaub schon, dass er krank ist, er gefällt mir gar nicht –«
Sie macht eine tiefe Stimme, sie handelt selbstständig und erwachsen, es ist ein sehr ernstes Gespräch, sie ruft den Hausarzt an, das tun sonst nur die Familienoberhäupter.
Der Doktor Honig ist nicht sehr jung und nicht sehr alt, sehr unscheinbar, klein, er hat ein glatt rasiertes Gesicht und einen gold-gerahmten Zwicker auf der Nase. Er spricht leise und gütig, und es ist ganz gleichgültig, was einem der Doktor Honig sagt: Es wirkt sehr beruhigend. Friedl nennt ihn »einen Freund der Familie«, er kommt aber nur, wenn jemand krank ist. Damals, als Tonis Mutter starb, da saß er die ganze Nacht an ihrem Bett, und seitdem ist er der Freund der Familie.
Toni legt neben das Waschbecken ein sauberes Handtuch, das gehört sich so, wenn der Doktor ins Haus kommt. Die Fräuleins haben immer eines vorbereitet, wenn Toni Grippe oder Magenweh hatte und Doktor Honig gerufen wurde. Der Doktor kommt gerade aus Friedls Zimmer, jetzt beugt er sich über den Waschtisch, Toni steht neben ihm und wartet angstvoll auf seine Worte.
»Fast neununddreißig Grad«, sagt der Doktor und trocknet sich die Hände ab. »Ich hoffe, dass das Fieber bis morgen früh zurückgeht.«
Toni nickt. Die Stimme des Doktors ist beruhigend. »Eine starke Verkühlung«, spricht der Doktor weiter, sanft und liebevoll ist die Stimme, »in der Lunge ein Geräusch, nein, nichts von Bedeutung, Fräulein Toni, Sie müssen nicht so erschreckt dreinschauen, ich hoffe, wir werden die Lungenentzündung verhüten …«
Toni hat überhaupt nicht an die Möglichkeit einer Lungenentzündung gedacht. Nun spricht sie der Doktor aus, aber bei ihm klingt alles sehr tröstlich.
»Fräulein Toni, möchten Sie nicht auf jeden Fall eine Tante verständigen, dass Ihr Vater krank ist?«
Da steht Toni neben dem Doktor, sie hat die kindlich schmalen Schultern etwas zusammengezogen, sie spürt jetzt alle Verantwortung. Sie hat ganz selbstständig dem Doktor telefoniert, und zum ersten Mal sagt ihr der Doktor »Fräulein Toni«. Sie ist stolz darauf, dass sie das saubere Handtuch nicht vergessen hat, sie muss sich jetzt zusammennehmen und gar nichts vergessen.
»Eine Tante?«, fragt sie erstaunt.
Doktor Honig hat das Gefühl, dass irgendein Erwachsener herbeimüsste. Das kleine Mädel ist doch nicht erwachsen, irgendjemand muss doch die Verantwortung übernehmen und wissen, dass der Herr Rittmeister Huber schwer krank ist.
»Eine Tante – oder einen Onkel«, beharrt Doktor Honig.
»Wir haben nur eine richtige Tante, die Florentine Tante, die wollen wir nicht«, sagt der Fekete. Er steht in der offenen Badezimmertür, der Doktor hat ihn gar nicht bemerkt.
»Nein, die wollen wir nicht«, bestätigt die Toni, »und der Onkel, der Mann von der Tante Florentine, den darf man jetzt vor Friedl nicht einmal erwähnen. Sonst regt er sich auf. Er kann den Onkel Theodor nicht leiden. Mit Recht, ganz mit Recht.«
»Fräulein Toni, gestatten Sie, dass ich dem Herrn Fekete erkläre, wie man einen kalten Wickel macht«, wechselt Doktor Honig das Gesprächsthema. Feketes dummes Gesicht spannt sich in höchster Aufmerksamkeit. Jeden Satz des Doktors wiederholt er, man muss sich alles gut merken. Also: zwei Tücher, eines mit lauwarmem Wasser getränkt, um die Brust des Herrn Rittmeisters legen, das trockene Tuch darüberwickeln, mit Sicherheitsnadeln befestigen, damit nichts rutscht …
»Ich komme morgen Vormittag wieder vorbei«, verabschiedet sich der Doktor. Toni hat ihn bis zur Eingangstür begleitet. Ihr Gesicht ist ganz klein vor lauter Kummer, ihre Augen sind weit aufgerissen, als könnte sie nicht fassen, dass der Friedl krank ist, sie bemüht sich krampfhaft, höflich und erwachsen zu lächeln.
»Wie wird das Zeugnis werden, Fräulein Toni?«, fragt der Doktor noch, um etwas Gleichgültig-Liebenswürdiges zu sagen.
»Das Zeugnis? Danke, sehr schlecht, Herr Doktor. Wie lang soll der Friedl den Wickel umbehalten?«
Der Fekete wechselt die Wickel und verstreut riesige Sicherheitsnadeln in der ganzen Wohnung. Einen Vormittag lang bleibt Toni zu Hause und versucht, sich nützlich zu machen. Aber Friedl liegt mit geschlossenen Augen da, von Zeit zu Zeit stöhnt er, manchmal spricht er zusammenhangloses Zeug, einmal schreit er: »Melde gehorsamst, Herr General«, und dann flüstert er wieder: »Kaiserliche Hoheit, bitte, Kaiserliche Hoheit, ich muss gehorsamst erinnern …« Und es passt gar nicht zur Kaiserlichen Hoheit, dass der fiebernde Versicherungsbeamte, Rittmeister a. D. Friedrich Huber, Seine Kaiserliche Hoheit mit Versicherungspolizzen in Zusammenhang bringt. Im Fieber flüstert er sehr ungereimtes Zeug, aber das Leben des Rittmeisters, der von Versicherungen anderer Leute sehr mittelmäßig lebt, ist eine ungereimte Angelegenheit geworden. Manchmal schlägt Friedl die Augen auf, sein Blick gleitet an Toni vorbei und hängt ausdruckslos in der Zimmerecke. Am nächsten Vormittag sitzt Toni wieder beim Unterricht, sie kann ihrem Friedl nicht helfen. Aber sie muss immerfort an die Dunstumschläge denken, die Fekete dem Friedl machen soll, und an das Geräusch in Friedls Lunge, von dem der Doktor Honig sehr beruhigend und geradezu aufmunternd gesprochen hat.
»Sie haben mir für Ihr gestriges Ausbleiben keine Entschuldigung gebracht, Huber«, bemerkt die Mikula, Klassenvorstand der Achten.
»Mein Vater ist krank«, meldet die Toni, ihre Stimme kräht triumphierend, die Mikula soll zerspringen, sie kriegt doch keine Entschuldigung, der Friedl ist krank und konnte keine schreiben.
»Ach, und da haben Sie Ihren Vater gepflegt?«, meint die Mikula und versucht, in ihre Stimme einen süßlichen Unterton von »das arme Kind« zu legen. Die Klasse horcht gespannt zu. Privatangelegenheiten sind interessanter als die unwahrscheinlich läppischen Abenteuer des Herrn Aeneas, der jede Unfallversicherungsgesellschaft durch seine konstanten Unfälle Bankrott gemacht hätte.
»Nein, ich habe ihn nicht gepflegt, ich bin zu ungeschickt dazu«, antwortet die Huber in der letzten Bank und fügt hinzu: »Ich bin nur zu Hause geblieben.« Und zum Ärger der Mikula beginnt sie laut kratzend Bleistifte zu spitzen.
Nächsten Dienstag kommt die Toni mittags nach Hause und läuft, wie immer in den letzten Tagen, gleich in Friedls Zimmer. Sonderbar: Die Tür steht weit offen. Toni schließt behutsam die Tür hinter sich, macht noch ein paar Schritte, und dann setzt sekundenlang ihr Herzschlag aus.
Das Bett ist leer.
Zurückgeschlagen die Decke, als ob Friedl eben aufgestanden wäre.
Sie geht zum Bett hin. Leer. Die Bettdecke zurückgeschlagen, die Polster zerknittert.
Da stürzt sie in die Küche. »Fekete, Fekete!«
Am Herd steht das Fräulein Anna. »Der Herr Fekete ist mitgefahren«, berichtet das Fräulein Anna und rührt weiter in einem Kochtopf.
»Das – das Bett ist leer –«, stößt Toni hervor. Sie hält noch immer die Schultasche in der Hand, schief sitzt die Pullmankappe auf den glatten Haaren. Die Anna steht am Herd und sieht nicht auf. Sie zuckt nur mit den Achseln: »Der Doktor hat vormittags gesagt, dass der Herr Rittmeister ins Spital muss. Dort hat er bessere Pflege. Dann hat der Doktor um ein Krankenauto telefoniert, und vor einer halben Stunde sind sie weggefahren.«
»Weggefahren …«, wiederholt die Toni, ohne zu verstehen. »Wo – wo ist denn jetzt der Friedl?«
»Na, im Spital. Der Herr Fekete wird bald zurück sein und dem Fräulein dann genau sagen, wo der Herr Rittmeister liegt und wann Besuchsstunde ist«, sagt die Anna und kostet mit dem Kochlöffel, ob genug Salz im Kochsalat ist. Sie kann die Toni nicht leiden, die Toni hält zum Fekete. Sie hört, dass die Toni aus der Küche geht, es sind sonderbar langsame, schleppende Schritte, und ruft ihr nach: »Das Essen ist gleich fertig!«
Die Toni kommt in ihr Zimmer, lässt die Schultasche auf den Boden fallen, zieht die Kappe vom Kopf und wirft den Mantel irgendwohin. Dann geht sie wieder in Friedls Zimmer, macht ganz leise die Tür auf, vorsichtig, damit die Tür nicht knarrt, und schließt sie behutsam hinter sich. Leise nähert sie sich dem Bett. Zieht einen Stuhl heran und setzt sich. Breite, zurückgeschlagene Decke, ganz zerknitterter Kopfpolster. Sie beugt sich vor und streichelt die Decke.
Es ist so still im Zimmer. So grauenhaft still ist es jetzt. Friedls fiebrige Atemzüge fehlen, sie fehlen entsetzlich. Das Bett ist leer, sie haben Friedl fortgetragen, hastig haben sie die Decke zurückgeschlagen, und dann haben fremde Leute ihn angefasst und weg – weggetragen haben sie ihn.
Da fällt die Toni auf die Knie, sie presst das Gesicht auf den Polster, auf den zerdrückten Friedl-Polster. Und dann muss sie in den Polster beißen, um nicht laut aufzuschreien. Sie hat auf einmal das Gefühl, dass sie ihr den Friedl nicht mehr zurückbringen werden. Nein – nein – sie werden ihn nicht wieder herbringen, Spital muss etwas Schreckliches sein, ins Spital kommt man nur, wenn man sehr krank ist, sie haben ihr den Friedl weggenommen, das Bett ist leer, lieber Gott – das Bett bleibt leer –
»Vater«, stöhnt sie in den Polster.
»Vater!«