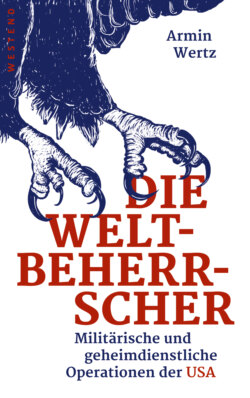Читать книгу Die Weltbeherrscher - Armin Wertz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»Mehr, mehr, mehr! … Bis der ganze grenzenlose Kontinent unser ist«
ОглавлениеDer Souverän der westlichen Hemisphäre (1794–1945)
Es ist schon seltsam, wie lange sich die Legende von der amerikanischen Isolationspolitik in der offiziellen Geschichtsschreibung halten konnte. Selbst ein oberflächlicher Blick auf die Geschichte der US-Außenpolitik zeigt, dass diese Mär in völligem Widerspruch zu den historischen Fakten steht. Die imperiale Politik der USA setzte eben nicht erst mit der Machtergreifung der Bush-Dynastie ein, sondern bereits weit früher, keine zwanzig Jahre nach der Unabhängigkeit.
Schon die Gründung der Vereinigten Staaten und die spätere Ausdehnung über den nordamerikanischen Kontinent wurden nur mit der Zerschlagung zahlreicher indianischer Nationen erreicht, deren Herrschaftsgebiete oftmals durchaus der Definition eines Staates entsprachen. Die Einheimischen wurden die ersten Opfer amerikanischer Machtansprüche. Um sich ihr Land anzueignen, schlossen die USA 800 Verträge mit den verschiedenen indianischen Nationen. Rund 430 davon wurden vom Kongress nicht ratifiziert. Dennoch wurde von den Indianern erwartet, dass sie sich an die Bestimmungen dieser Verträge hielten. »Noch tragischer jedoch war, dass die USA von den 370 Verträgen, die ratifiziert wurden, nicht einen einzigen einhielten«, schrieb Daniel K. Inouye, der Vorsitzende des Senate Select Committee on Indian Affairs im Vorwort zu Oren Lyons’ Exiled in the Land of the Free1. Als die ersten Europäer an der Ostküste eintrafen, lebten zwischen zwanzig und fünfzig Millionen Indianer in dem Land, das heute die Vereinigten Staaten sind. Ende des 19. Jahrhunderts waren gerade noch 250 000 übrig. Es hatte ihnen nicht geholfen, dass die sogenannten Gründerväter die Indianer durchaus nicht als die Wilden sahen, die sie in den Augen der Pelztierjäger, Abenteurer, Goldgräber, Viehzüchter und Farmer waren, die sich das Land aneigneten. Sonst hätten sie wohl kaum die föderale Regierungsform der Sechs Nationen der Irokesen-Konföderation so genau studiert und sogar empfohlen, sich an diesem Modell zu orientieren. »Die Liga der Irokesen inspirierte Benjamin Franklin, sie zu kopieren, als er die Staatenföderation plante«, notierte John F. Kennedy im Vorwort zu William Brandons »American Heritage Book of Indians«2.
Spätere Generationen folgten wieder den Vorstellungen der bigotten Pilgrim Fathers, die nur zwanzig Jahre nach ihrer Ankunft in einer Resolution ihre Ansprüche sehr klar formuliert hatten: »1. Die Erde und alles darin ist Gottes. 2. Gott mag die Erde oder irgendeinen Teil davon seinem auserwählten Volk geben. 3. Wir sind sein auserwähltes Volk.«3 Schon die Vorstellungen der bescheidensten Unabhängigkeitskämpfer um George Washington beschränkten sich nicht nur auf die 13 Ostküstenstaaten, sondern sahen die Westgrenze ihres neuen Staates viel weiter im Westen, am Mississippi. Dreißig Jahre später träumte Thomas Jefferson schon von weiteren Eroberungen und von den Rocky Mountains als Westgrenze. Weitere vierzig Jahre später, 1845, schrieb der Essayist John L. O’Sullivan in seinem Hausblättchen, The Democratic Review: »Mehr, mehr, mehr! … Bis unsere nationale Bestimmung erfüllt ist …und der ganze grenzenlose Kontinent unser ist.«4 Amerika müsse »bald die ganze Hemisphäre von der eisigen Wildnis des Nordens bis zu den fruchtbaren Regionen des lächelnden Südens«5 umfassen, eiferte ein anderer Kolumnist zur gleichen Zeit im New York Herald. Und im Kongress wurde von einer zukünftigen Ausdehnung »vom Isthmus von Darien (Panama) bis zur Behringstraße«6 schwadroniert. 1912 stellte Präsident William Howard Taft klar: »Der Tag ist nicht fern, wenn drei Stars and Stripes an drei gleichweit entfernten Punkten unser Territorium markieren werden: am Nordpol, am Panamakanal und am Südpol. Die ganze Hemisphäre wird uns gehören, tatsächlich gehört sie uns aufgrund unserer rassischen Überlegenheit moralisch schon heute.«7
Expansionismus und eine vermeintlich schicksalhafte Bestimmung (Manifest Destiny) beherrschten das Denken und Handeln der Siedler wie der Präsidenten. Staaten wurden annektiert, die seit Jahrtausenden dort ansässigen Indianer mit Feuer, Hunger und Pocken-infizierten Decken ermordet, ausgerottet oder in Reservate gesperrt. Noch vor dreißig Jahren lebten über zwanzig Stämme in den USA, deren Angehörige nicht die amerikanische Staatsbürgerschaft besaßen. In einer Art Salamitaktik eigneten sich die USA über die Jahrzehnte große Gebiete an, die zum spanischen Kolonialreich gehörten. Beinahe prophetisch lesen sich O’Sullivans weitere Ausführungen: »Wir sind die Nation des menschlichen Fortschritts, und wer wird, was kann uns auf unserem Marsch vorwärts Grenzen setzen? … Für diesen gesegneten Auftrag an die Nationen der Welt, die ausgeschlossen sind vom lebenspendenden Licht der Wahrheit, ist Amerika auserwählt … Wer kann daran zweifeln, dass unser Land dazu bestimmt ist, die große Nation der Zukunft zu sein?«8
Zwar beschrieben die Kolonialherren schon im 19. Jahrhundert ihren militärischen Expansionismus manchmal als Terrorismusbekämpfung. Häufiger jedoch bezeichneten sie Völker, die keine Lust hatten, kolonisiert zu werden oder unter einer Kolonialherrschaft zu leben, schlicht als »Wilde«, Regierungen, die auf ihrer staatlichen Souveränität beharrten, waren »Banditen«, »islamische Fanatiker« oder (vor allem im asiatisch-pazifischen Raum) »Piraten«.
Präsident Theodore Roosevelt etwa sprach und schrieb häufig über diese »verachtenswerten, kleinen Kreaturen in Bogotá«, »diese Bande von Hasen in Bogotá« oder den »abgefeimten Affen«, denen Washington wohl »eine Lektion erteilen muss«.9 Die »verachtenswerten Kreaturen«, »Hasen« oder »Affen« waren der venezolanische Präsident Cipriano Castro oder die kolumbianische Regierung und der kolumbianische Senat, die zwar den Franzosen eine Lizenz zum Bau eines Kanals durch Panama erteilt hatten, sich aber weigerten, diese Lizenz nach dem Scheitern Ferdinand de Lesseps’ auf die USA zu übertragen. (Panama war bis 1903 eine kolumbianische Provinz.) In Lateinamerika geschah nichts ohne das Einverständnis Washingtons. Schon 1829 schrieb Lateinamerikas Unabhängigkeitskämpfer Simón Bolívar aus Guayaquil in einem Brief an den britischen Chargé d’Affaires in Kolumbien, Oberst Patrick Campbell: »Die Vereinigten Staaten scheinen von der Vorsehung dazu ausersehen zu sein, im Namen der Freiheit Elend über Amerika zu bringen.«10 Und der US-Außenminister Richard Olney erklärte 65 Jahre später offen: »Tatsächlich sind die USA praktisch der Souverän auf diesem Kontinent, und ihre Anweisungen sind Gesetz in allen Angelegenheiten, wo sie intervenieren.«11
»Unsere Botschafter bei den fünf kleinen Republiken zwischen der mexikanischen Grenze und Panama … waren Berater, deren Rat in den Hauptstädten, wo sie residierten, praktisch als Gesetz akzeptiert wurde«, notierte Robert Olds, Staatssekretär im State Department, 1927 in einem Memorandum: »Wir kontrollieren die Geschicke Mittelamerikas, und wir tun das aus dem einfachen Grund, dass das nationale Interesse einen solchen Kurs diktiert … Bis heute hat Mittelamerika immer verstanden, dass Regierungen, die wir anerkennen und unterstützen, an der Macht bleiben, während jene, die wir nicht anerkennen und unterstützen, scheitern.«12
Gleichzeitig operierten amerikanische Verbände zunehmend auch in entfernteren Regionen, im Mittelmeer, in Afrika, in Asien, im Pazifik und besonders im Nahen und Mittleren Osten. Eine Reihe von Übereinkünften, die die USA in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts schlossen, um die Ölförderung zu begrenzen und sicherzustellen, dass die bedeutendsten (zumeist amerikanischen) Firmen den Ölpreis auf den Weltmärkten kontrollieren konnten, kulminierte 1928 im sogenannten Red Line Agreement, das bis in die 40er Jahre die Ölförderung und -politik im Mittleren Osten bestimmte. Standard Oil und Mobil erhielten Teile an der bislang rein britischen Iraq Petroleum Company. 1944 schlossen Washington und London das Anglo-American Petroleum Agreement, in dem die beiden Regierungen das Öl dieser Region unter sich aufteilten. »Das persische Öl gehört Ihnen«, überließ US-Präsident Franklin D. Roosevelt gegenüber Londons Botschafter in Washington, Lord Halifax, den Iran großzügig Großbritannien. »Das Öl im Irak und Kuwait teilen wir uns. Und was das saudische Öl angeht, das gehört uns.«13
Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs betrachteten die USA den Mittleren Osten als »die strategisch wichtigste Weltregion« und »einen der größten materiellen Preise in der Weltgeschichte«14. Auf dass es niemand vergesse, verkündete Präsident Jimmy Carter 1980 in seiner Rede zur Lage der Nation die sogenannte Carter-Doktrin und wiederholte noch einmal, wem das Öl gehört: Die strategische Bedeutung des Persischen Golfs liege in »der überwältigenden Abhängigkeit der westlichen Demokratien von den Öllieferungen aus dem Mittleren Osten … jeder Versuch einer anderen Macht, die Kontrolle über den Persischen Golf zu gewinnen, wird als Überfall auf die lebenswichtigen Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika angesehen … und mit allen notwendigen Mitteln einschließlich militärischer Gewalt zurückgeschlagen werden.«15
Zwar haben die USA in ihrer langen Geschichte nur in elf verschiedenen Fällen (in fünf Kriegen) formal einer anderen Nation den Krieg erklärt. Doch militärische Interventionen, grobe, aber auch subtilere Einmischungen in die Angelegenheiten anderer Staaten haben eine lange Tradition in der amerikanischen Außenpolitik und begannen schon kurz nach der Unabhängigkeit der USA. Verglichen mit Paris, London oder Berlin war Washington jedoch sehr oft verblüffend ehrlich und sprach nicht von einer action civilisatrice oder von edlen Zielen, den Eingeborenen den rechten Glauben, Fortschritt oder eine höhere Kultur bringen zu müssen, sondern nannte oft frank und frei den Schutz amerikanischer Interessen, amerikanischen Besitzes und amerikanischer Staatsbürger als Grund für sein militärisches Eingreifen.
1794–1795: Ohio (unabhängiges Indianergebiet)
George Washingtons »Northwest Ordinance« öffnete das sogenannte Nordwestterritorium weißen Siedlern, die daraufhin in die bislang nur von Indianern bewohnten Gegenden strömten. Die Indianer widersetzten sich diesem Vordringen, woraufhin Washington die Armee schickte, um den Widerstand zu ersticken. Doch eine Konföderation diverser Stämme, geführt von dem Shawnee Blue Jacket, dem Miami Kleine Schildkröte, dem Lenape-Häuptling Buckongahelas sowie dem Ottawa Egushawa schlug die Invasionsarmeen unter Führung der Generäle Josiah Hamar und Arthur St. Clair vernichtend. Nach dieser Niederlage strebten die USA eine Verhandlungslösung an. Die Allianz unter Blue Jacket bestand jedoch auf einer Grenzziehung, der die USA keinesfalls zustimmen wollten. Also schickte Washington eine neue Armee unter General Anthony Wayne, die Blue Jacket und seine Alliierten in der »Battle of Fallen Timbers« schlug, an der auch der spätere Präsident William Henry Harrison teilnahm. Die Indianer hatten auf britische Unterstützung gehofft. Als diese nicht eintraf, sahen sie sich gezwungen, 1795 den Vertrag von Greenville zu unterzeichnen, in dem sie das heutige Ohio und Teile des heutigen Indianas an die USA abtreten mussten.
1795: Florida (spanisches Territorium)
Amerikanische Truppen annektierten Teile Westfloridas.
1798–1800: Santo Domingo
Über ausstehende Kriegsschulden Washingtons in Paris und die Handelstätigkeit der USA mit Großbritannien, das sich mit Frankreich im Kriegszustand befand, kam es zu einem »unerklärten Seekrieg mit Frankreich«. In diesem sogenannten Quasi-Krieg ging es jedoch weit mehr darum, die Sklaven an dem ihnen gebührenden Platz zu halten. US-Truppen landeten in Porto Plata im damaligen Santo Domingo, wo sie unter den Kanonen des Forts ein französisches Schiff kaperten, um zu verhindern, dass dieses Schiff in die Hände rebellierender afrikanischer Sklaven fiel.
Der Hintergrund: Der Sklave Toussaint Louverture führte in der einträglichsten französischen Kolonie, dem heutigen Haiti, den einzigen erfolgreichen Sklavenaufstand der Geschichte, der 1804 schließlich zur Unabhängigkeit Haitis führen sollte. Seine Truppen hatten den Hafen eingenommen. Der Tabakpflanzer und US-Vizepräsident Thomas Jefferson, der selbst 187 Sklaven besaß, fürchtete den Einfluss, den eine erfolgreiche Sklavenrevolution unter den eigenen Sklaven haben könnte, und verhandelte darum mit Frankreich und Großbritannien über Möglichkeiten, die Insel in eine Art Protektorat der USA, Frankreichs und Großbritanniens zu verwandeln, »um diese Krankheit (die Abschaffung der Sklaverei) auf diese Insel zu beschränken. Solange wir den Negern verbieten, über eigene Schiffe zu verfügen, können wir ihnen erlauben, als Freie zu leben und sogar lukrative Handelskontakte mit ihnen pflegen.«16
1801: Texas (spanisches Territorium)
1796 hatte Philip Nolan für eine Vermessungsgruppe der US-Grenzkommission, die den Missouri kartographierte, später als Buchhalter und Pferdehändler gearbeitet. Im Oktober 1800 führte er eine Expedition von dreißig Mann in die nördlichen Provinzen des spanischen Vizekönigreichs Mexiko, um dort ein eigenes Königreich zu gründen. Am 21. März 1801 unterlagen er und seine Männer einer 120 Mann starken spanischen Einheit. In dem Gefecht oberhalb der Mündung des heute nach ihm benannten Nolan River in den Río Brazos wurde er erschossen.
1801–1805: Regentschaft Tripolis – Erster Berberkrieg
Ende des 18. Jahrhunderts hatten sich die Länder westlich Ägyptens weitgehend von der osmanischen Herrschaft gelöst. Die Herrscher der Berberstaaten von Tunis, Tripolis oder Algier handelten unabhängig vom Sultan im fernen Istanbul und verlangten von fremden Staaten und Schiffen Tributzahlungen für das Recht, in ihrem Herrschaftsbereich Handel zu treiben. Verweigerten die Fremden diese Zahlungen, wurden ihre Schiffe beschlagnahmt und die Besatzungen nur gegen Lösegeld freigelassen oder in die Sklaverei verkauft. Wie Großbritannien oder Frankreich leisteten auch die USA bis 1800 jährlich bis zu 80 000 Dollar Tribut- und Lösegeldzahlungen. Als der Pascha von Tripolis jedoch eine Extrazahlung von 225 000 Dollar forderte, weigerte sich Präsident Thomas Jefferson, dieser Erpressung nachzugeben. Nachdem der Pascha daraufhin am 10. Mai 1801 den USA den Krieg erklärt hatte, dem sich auch Algier, Tunis und Marokko anschlossen, entsandte Jefferson ein Fregattengeschwader unter Commodore Richard Dale. Das US-Geschwader blockierte die nordafrikanischen Häfen. Als die Philadelphia bei einem Angriff vor Tripolis auf Grund lief, nahmen die Verteidiger der Stadt die Besatzung gefangen (Oktober 1803). Unter Führung des Leutnants Stephan Decatur jun. setzten Marines die Philadelphia in Brand. Im Frühjahr 1805 nahmen die US-Fregatten Tripolis unter Beschuss, während eine Gruppe von Marineinfanteristen, unterstützt von 500 ägyptischen Söldnern, nach einem 800-Kilometer-Marsch durch die Wüste die Stadt einnahm. Daraufhin stimmten die Berberfürsten einem Waffenstillstand und Gefangenenaustausch zu.
1803: Louisiana (französisches Gebiet)
Durch den Dritten Vertrag von San Ildefonso gelangte Frankreich in den Besitz des sogenannten Louisiana-Territoriums, das, weit über die Grenzen des heutigen Bundesstaates hinaus, westlich des Mississippi hoch bis an die Grenze zu Kanada reichte und seit 1762 spanische Kolonie war. Der Vertrag wurde jedoch geheim gehalten. So blieb Louisiana nominell unter spanischer Kontrolle. Erst am 30. November 1803 übernahm Frankreich die Verwaltung des Gebiets, nur drei Wochen vor dem Verkauf an die USA. Dem widersetzten sich die USA. Die Südstaatenpflanzer fürchteten, die Franzosen könnten die Sklaven in die Freiheit entlassen und so Sklavenaufstände auch anderweitig auslösen. Vor allem New Orleans, durch das die »Produkte aus drei Achteln unseres Territoriums auf den Markt gebracht werden müssen« (so Präsident Thomas Jefferson in einem Brief vom 18. April 1802), könne »nie in den Händen Frankreichs« bleiben. Mit der Behauptung, eine vertragliche Annäherung mit England stünde bevor, erschreckte die US-Regierung Napoleon, der die Invasion Großbritanniens plante. Nach der Niederlage seiner Truppen in Haiti und dem Verlust der reichen Kolonie sah Napoleon keinen Gewinn mehr im Besitz des Gebiets von Louisiana. Der französische Kaiser war bereit, die Gebiete westlich des Mississippi zu einem Preis von weniger als drei Cent pro Morgen an die USA zu verkaufen. Die Gesamtsumme, die Washington für die 2 144 520 qkm zu bezahlen hatte, belief sich auf 27 267 622 Dollar. Der sogenannte Louisiana Purchase war der größte aller Landkäufe in der amerikanischen Geschichte und verdoppelte seinerzeit die Größe der USA. Das Territorium umfasste neben Louisiana die heutigen Staaten Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, Nebraska, Wyoming, Minnesota, South und North Dakota und Montana.
1806: Mexiko (spanisches Territorium)
Präsident Jeffersons Auffassung, wonach der Louisiana-Kauf alles Land östlich der Rocky Mountains und nördlich des Río Grande einschließe, somit auch Westflorida, Texas und das Gebiet von Illinois, führte zum Konflikt mit Spanien, das darauf bestand, dass Louisiana nur bis zum Städtchen Natchitoches (im Nordwesten des heutigen Bundesstaates) reichte. Der Disput wurde erst 1819 beigelegt, als Spanien gegen die amerikanische Anerkennung des Río Sabine als östlicher Grenze von Texas Florida den USA überließ. Auf Befehl General James Wilkinsons drang Captain Zebulon Montgomery Pike mit einer kleinen Einheit im Quellgebiet des Río Grande auf mexikanisches Gebiet vor, um die umstrittenen Gebiete zu erforschen und zu kartographieren. Am Río Grande nahmen spanische Truppen die Eindringlinge fest, brachten sie nach Natchitoches zurück und zerstörten das Fort, das Pike im heutigen Colorado gebaut hatte. Zwar hatten die Spanier seine Karten und Notizen konfisziert, doch Pike konnte die meisten Aufzeichnungen aus dem Gedächtnis wiedergeben. Seine begeisterten Berichte über Texas heizten das amerikanische Verlangen an, das riesige von gerade einmal 4 000 Spaniern und einigen entlaufenen Sklaven und Indianern bewohnte Gebiet zu besitzen.
1806: Texas (spanisches Territorium)
Kaum waren die beiden Wissenschaftler und US-Agenten William Dunbar und George Hunter mit ihrer Expedition ins Gebiet westlich des mysteriösen Red River gescheitert und nur bis in die Region des heutigen Hot Springs in Arkansas gelangt (1804), ordnete Präsident Thomas Jefferson, der besessen war von der Idee einer möglichst großen Ausdehnung der USA, eine weitere Expedition an: die Red River Expedition. Thomas Freeman und Peter Custis – Astronom und Landvermesser der eine, Naturkundler und Arzt der andere – stellten eine Flotte flacher Boote und Kanus zusammen und fuhren im Frühjahr den Red River aufwärts. Beim heutigen Spanish Bluff, einer Flussklippe an der Grenze zwischen Texas und Arkansas, wurde die Expedition am 28. Juli jedoch von einem überlegenen spanischen Truppenverband unter Francisco Viana gestoppt und zur Umkehr gezwungen. Freeman und Custis hatten allerdings schon 615 Meilen des Flusses katographiert.
Zwar kam es in der Folge der Expedition zu diplomatischen Spannungen, der von General James Wilkinson erhoffte Krieg brach jedoch nicht aus. Um die Situation nicht noch weiter anzuheizen, unterband Jefferson eine für 1807 geplante Expedition zum Arkansas River. Dennoch drangen kaum sechs Wochen nach Freemans und Custis’ Rückkehr sechs Amerikaner unter der Führung von John S. Lewis erneut in das Gebiet des Red River vor, hissten in den Dörfern der Taovaya-Indianer die US-Flagge und versuchten, die Comanchen gegen die Spanier aufzuwiegeln.
1806–1810: Golf von Mexiko
Amerikanische Kanonenboote operierten von New Orleans aus (das mit Napoleons Verkauf von Louisiana 1804 an die USA gegangen war) gegen spanische und französische Piraten, die das Mississippi-Delta unsicher machten.
1808: Texas und Kalifornien (spanische Territorien)
Die USA entsandten zwei Expeditionen, um die Gebiete zu »erforschen«. Hauptmann Anthony Glass drang bei einem Alabama-Coushatta-Dorf nach Texas vor, folgte dem Sulphur River bis in die Gegend des heutigen Paris, Texas, und erreichte schließlich die Taovaya-Dörfer am Oberlauf des Red River. Von dort stieß Glass mit seinen Begleitern tiefer in die Rolling Plains vor und fuhr den Colorado River wieder hinunter, ehe er zurückkehrte. Einige Mitglieder seiner Expedition machten sich 1809 auf den Weg an den Mittellauf des Río Brazos.
1809: Kuba (spanisches Territorium)
»Ich gestehe ganz offen, dass ich Kuba immer als eine äußerst interessante Ergänzung unseres Staatensystems angesehen habe«, schrieb Thomas Jefferson seinem Nachfolger James Madison. »Wenn wir uns Kuba schnappen, kontrollieren wir die Karibik.« Mit Kuba und Kanada »hätten wir ein Reich der Freiheit, wie es die Welt seit der Erschaffung nicht gesehen hat«. Deshalb schickte er seinen General James Wilkinson zu Kaufverhandlungen nach Madrid, doch vergeblich. Nicht einmal die anhaltenden spanisch-französischen Spannungen konnten den spanischen König dazu bewegen, seine wertvolle Kolonie abzugeben.
1810: Westflorida (spanisches Territorium)
Auf Befehl Präsident Madisons besetzten US-Truppen unter dem Kommando von Louisianas Gouverneur William C. C. Claiborne das Gebiet östlich des Mississippi bis zum Pearl River, der heute die Ostgrenze Louisianas bildet.
1812: Amelia Island und andere Teile von Ostflorida (spanisches Territorium)
US-Truppen besetzten die Gebiete auf Befehl Präsident Madisons und mit der Zustimmung des Kongresses, angeblich um einer Besetzung durch andere Mächte zuvorzukommen.
1812–1813: Texas (spanisches Territorium)
Nach Miguel Hidalgos (1810) und Juan Bautista de las Casas’ (1812) gescheiterten Versuchen, die Unabhängigkeit Mexikos von der spanischen Krone zu erlangen, flohen die überlebenden Rebellen in die USA. Durch die Vermittlung des Gouverneurs von Louisiana gewann der Schmied Bernardo Gutiérrez de Lara die Unterstützung des US-Oberstleutnants Augustus W. Magee, mit dessen Hilfe er eine Truppe von 130 Mann rekrutierte. Im August 1812 nahmen die Rebellen den texanischen Ort Nacogdoches ein. Der Erfolg führte den Aufständischen weitere Kämpfer zu. Nachdem Magee gestorben war (6. Februar 1813), übernahm der Abenteurer Samuel Kemper das Kommando. Verstärkt durch Tejanos (Texaner mexikanischer Herkunft), spanische Deserteure, Coushatta-, Lipan- und Tonkawa-Indianer sowie Freiwillige aus Nacogdoches und San Antonio, besiegten Kempers Leute am 29. März eine spanische Armee von 1200 Mann in der Schlacht am Rosillo Creek (heute Salado Creek). Eine Woche später entwarf die »Republikanische Armee« eine Unabhängigkeitserklärung, rief die erste »Republik von Texas« aus und ernannte Gutiérrez zum Präsidenten der neuen Republik. Zwar konnten die Republikaner auch die Schlacht am Alazán Creek überlegen gewinnen, doch Uneinigkeit unter den Offizieren führte schließlich zur Niederlage. Am 18. August 1813 wurden die Revolutionäre und Invasoren (1400 Amerikaner, Tejanos, Spanier, Indianer und Afroamerikaner) in der Schlacht von Medina von einer spanischen Streitmacht vernichtend geschlagen und verloren 1300 Mann. Nur wenige schafften die Flucht in die USA.
1812–1815: Krieg mit Großbritannien
Während der Napoleonischen Kriege verletzten sowohl britische als auch französische Verbände häufig die Neutralität anderer Staaten. Napoleon vereinbarte mit Washington, den Handel zwischen Großbritannien und den USA nicht zu behelligen. Großbritannien, das eine Seeblockade gegen Frankreich durchzusetzen suchte, verlangte jedoch, dass neutrale Schiffe, die einen französischen Hafen anliefen, zuerst in einem britischen Hafen Steuern zahlen sollten. Britische Kriegsschiffe pflegten außerdem häufig US-Schiffe auf hoher See aufzubringen, um nach geflohenen englischen Deserteuren zu suchen. Zudem zeigte sich Washington zunehmend verärgert über Londons militärische Unterstützung für den Shawnee-Häuptling Tecumseh, der sich dem Vordringen weißer Siedler nach Westen widersetzte.
Um die Briten aus Kanada und die Spanier aus Florida zu vertreiben, erklärte Präsident Madison Großbritannien am 18. Juni 1812 den Krieg. Zwar wurden zahlreiche Gefechte um die Kontrolle der Großen Seen geführt (US-Truppen brannten York, Ontario, ab, heute ein Stadtteil von Toronto; britische Truppen zündeten das Weiße Haus in Washington an), doch keiner Seite gelang ein entscheidender Durchbruch. Kriegsmüde unterzeichneten beide Parteien am 24. Dezember 1814 den Vertrag von Gent. Napoleons Niederlage in Waterloo, Tecumsehs Tod im Kampf sowie Andrew Jacksons Zerschlagung der Creek-Konföderation brachten schließlich ein Ende der Kampfhandlungen.
1812–1814: Northwest Territories
Der auch nach dem Vertrag von Greenville fortgesetzte und von Präsident Thomas Jefferson forcierte amerikanische Erwerb zusätzlicher Indianergebiete alarmierte die Stämme. Die beiden Shawnee-Brüder Tecumseh und Tenskwatawa organisierten eine neue Koalition. Während Tecumseh im Süden weitere Verbündete unter den Creek, Cherokee und Choctaw rekrutierte, schlug William Henry Harrison, der Gouverneur des Indiana-Territoriums, Tenskwatawa und seine Verbündeten in der Schlacht von Tippecanoe. Die Amerikaner hofften, dass dieser Sieg den militärischen Widerstand der Eingeborenen beenden würde. Stattdessen entschied sich Tecumseh für eine Allianz mit den Briten. Nachdem die Creek und Shawnee sowohl in der Schlacht am Horseshoe Bend von General Andrew Jackson als auch in der Schlacht am Thames River, in der Tecumseh fiel, von Harrison geschlagen wurden, war der indianische Widerstand in den alten Nordwestgebieten endgültig gebrochen.
1813: Westflorida (spanisches Territorium)
Mit Genehmigung des Kongresses besetzte General James Wilkinson mit 600 Mann die Mobile Bay im heutigen Alabama und vertrieb die spanische Garnison. Damit begann das Vordringen der USA in das umstrittene Gebiet am Río Perdido.
1813–1814: Marquesas (Französisch-Polynesien)
Etwas verspätet traf der Britisch-Amerikanische Krieg von 1812 sogar in Polynesien ein. Monatelang kreuzte eine amerikanische Flotte, angeführt von der Fregatte USS Essex unter dem Kommando David Porters, im Pazifik und verfolgte britische Walfänger. Zu Reparaturarbeiten lief die Essex mit zehn weiteren Schiffen am 25. Oktober 1813 Nuku Hiva an, eine Insel der Marquesas, die Kapitän Porter sofort nach seinem Präsidenten in Madison Island umtaufte. In der Massachusetts Bay errichteten die Seeleute gleich auch den ersten US-Marinestützpunkt im Pazifik: Fort Madison und eine kleine Siedlung Madisonville, wo die Seeleute untergebracht wurden. Ohne die Betroffenen zu fragen, verkündeten die Kolonisten in einer Erklärung, dass die einheimischen Te I’is Untertanen der Vereinigten Staaten seien.
Da die Insel nicht nur von Te I’is, sondern von einer ganzen Reihe weiterer sich befehdender Stämme wie den Happah oder Tai Pi bewohnt war, führten die Amerikaner nun sehr erfolgreich Kriege. Die Kriegskanus, Knüppel und Lanzen der Happah oder Tai Pi hatten nicht die Spur einer Chance gegen amerikanische Fregatten, Kanonen und Musketen. Es bereite ihm keine Freude, gestand Porter später in einer Beschreibung der Kämpfe, ein »glückliches und heroisches Volk« zu unterwerfen. »Eine Szene der Verwüstung und des Schreckens« hätten sie hinterlassen, eine »Reihe rauchender Ruinen«.17
1814: Florida (spanisches Territorium)
Im Britisch-Amerikanischen Krieg hatten sich die Creek (Indianer) mit den Briten verbündet. Nach der Niederlage in der bereits erwähnten Schlacht am Horseshoe Bend flohen die Creek in das spanisch kontrollierte Pensacola in Westflorida. Daraufhin führte General Andrew Jackson 3000 Infanteristen nach Pensacola. Die Briten, die seit dem 23. August 1814 in Pensacola militärisch präsent waren, gaben die Stadt auf und zogen sich zurück. Daraufhin kapitulierten die Spanier kampflos.
1814–1825: Karibik
In diesem Zeitraum kam es zu zahlreichen Seegefechten amerikanischer Verbände gegen Korsaren vor den Küsten Kubas, Puerto Ricos, Santo Domingos und Yucatáns. Allein zwischen 1815 und 1823 wurden nicht weniger als 3000 Piratenangriffe auf Handelsschiffe gezählt.
1815: Regentschaft Algier – Zweiter Berberkrieg
Stephan Decatur, der zwölf Jahre zuvor die USS Philadelphia verbrannt hatte, führte nun als Commodore eine Flotte von zehn Kriegsschiffen ins Mittelmeer, griff Algier an und verlangte Entschädigung für beschlagnahmte US-Schiffe. Diesmal genügte alleine die Drohung, Algier zu bombardieren, um zehn amerikanische Gefangene und einige Europäer frei zu bekommen und die Tributzahlungen vertraglich zu beenden. Danach segelte Decatur nach Tunis und Tripoli, wo er Entschädigungen für Verluste aus dem Ersten Berberkrieg eintrieb.
1816–1818: Florida (spanisches Territorium) – Erster Seminolenkrieg
Während des Britisch-Amerikanischen Kriegs von 1812 unterhielt Großbritannien in der spanischen Kolonie Florida am Río Apalachicola das Negro Fort, wo rund 1000 Briten sowie einige hundert Afroamerikaner stationiert waren. Kurz nach Beendigung des Krieges 1815 zogen die britischen Verbände ab und ließen die schwarze Bevölkerung zurück. Negro Fort wurde eine Zufluchtsstätte für entflohene Sklaven aus Georgia. Nachdem Bewohner von Negro Fort eine Versorgungseinheit der US-Streitkräfte attackiert hatten, griffen General Andrew Jackson und General Edmund Gaines an. 330 Männer, Frauen und Kinder, zumeist freie Ex-Sklaven, sowie einige Seminolen- und Choctaw-Krieger verteidigten die Festung, die unter schweren Beschuss geriet. Eine Kanonenkugel traf das Waffendepot, in dem auch das Schießpulver gelagert war. Die Explosion zerstörte das Fort vollständig und tötete beinahe alle Verteidiger. Die überlebenden Gefangenen wurden zurück in die Sklaverei geschickt.
Ergrimmt über den Tod seiner Leute in Negro Fort warnte Neamathla, ein Seminolen-Häuptling, den kommandierenden amerikanischen General, keinesfalls den Flint River zu überqueren, andernfalls er angegriffen und geschlagen werden würde. Diese Drohung beantwortete General Gaines mit der Entsendung von 250 Mann, die den Häuptling festnehmen sollten. Die darauffolgende Schlacht war die erste Kampfhandlung im beginnenden Ersten Seminolenkrieg.
Auf Befehl von Präsident James Monroe marschierte General Andrew Jackson in Florida ein (obwohl sich die USA nicht im Krieg mit Spanien befanden), verbrannte die Seminolen-Dörfer, wo von amerikanischen Pflanzungen entflohene Sklaven Unterkunft und Schutz gefunden hatten, vertrieb die Seminolen, exekutierte britische Staatsbürger, nahm die spanischen Festungen Pensacola und St. Marks ein und vertrieb ebenfalls die spanischen Bewohner von Fernandina, die 1817 ihre Unabhängigkeit von Spanien erklärt hatten. 1819 annektierten die USA Florida. Monroe wollte die Indianer zwingen, sesshafte Bauern zu werden mit dem Argument: »Ein Jäger oder Wilder braucht ein größeres Territorium, um sich zu ernähren. Das ist nicht vereinbar mit Fortschritt und den gerechtfertigten Forderungen eines zivilisierten Lebens.«18
1817: Amelia Island (spanisches Territorium)
Auf Befehl von Präsident James Monroe besetzten US-Streitkräfte die Insel vor der Nordostküste Floridas und vertrieben eine Gruppe von Schmugglern, Abenteurern und Freibeutern.
1817: Mexiko (spanisches Territorium)
Während des Mexikanischen Unabhängigkeitskrieges führte der ehemalige US-Offizier Henry Perry eine Bande von Freischärlern nach Texas, um die spanische Festung Presidio La Bahía zu erobern. San Antonio schickte Verstärkung. Am 18. Juni schlugen die spanischen Verbände Perrys Truppen am Coleto Creek.
1818–1819: Oregon Territory
Die USS Ontario landete an der Mündung des Columbia River, des heutigen Grenzflusses zwischen Washington und Idaho, und nahm damit das Oregon Country genannte Gebiet ein. Sowohl England als auch Russland und Spanien, die alle längst vor Ort vertreten waren, erhoben Anspruch auf die Region. 1819 beugte sich Spanien, dessen Kolonien in ganz Lateinamerika von Unabhängigkeitsbewegungen bedroht waren, schließlich dem Druck Washingtons und überließ im Transkontinentalvertrag das Oregon Country und auch Florida den USA. Im Gegenzug erkannten die USA Spaniens Souveränität in Texas an. Gleichzeitig bot die amerikanische Regierung Siedlern kostenlos Land an, um mit der Schaffung sogenannter facts on the ground den englischen und russischen Ansprüchen vor allem in Oregon zu begegnen.
1819: Mexiko (spanisches Territorium)
Am 8. Juni führte der Filibuster Eli Harris 120 Mann über den Río Sabine nach Nacogdoches am Golf von Mexiko. Zwei Wochen später folgte ihm James Long, ein Pflanzer und ehemaliger Arzt der U.S. Army, mit zusätzlichen 75 Mann, darunter der berüchtigte Messerheld James Bowie. Am 22. Juni erklärten die Eindringlinge die Unabhängigkeit des Gebiets, riefen eine neue Regierung mit Long als erstem Präsidenten von Texas und einem 21-köpfigen Supreme Council aus und teilten jedem Mitglied der Expedition dreißig Quadratkilometer Land zu. Sie gaben sogar die erste englischsprachige Zeitung in Texas heraus, den Texas Republican, der jedoch nur einen Monat lang existierte. Long kontaktierte den französischen Piraten Jean Lafitte, der zwischen New Orleans und Galveston Island Schmuggel betrieb, und bot ihm den Posten eines Gouverneurs auf Galveston Island an. Lafitte jedoch, der in Diensten der spanischen Krone stand, informierte den spanischen Vizekönig in Mexiko. Als 500 spanische Soldaten in Texas eintrafen und nach Nacogdoches marschierten, floh Long mit seinen Leuten nach Louisiana.
1820–1823: Afrika
Flottenverbände der USA bekämpften den Sklavenhandel vor der afrikanischen Küste.
1821: Texas (spanisches Territorium)
Mit 300 neu rekrutierten Männern traf James Long im April 1820 erneut in Texas ein. Am 4. Oktober des Jahres nahm er mit seinen Leuten die Ortschaften Goliad und Presidio La Bahía ein, musste sich jedoch schon vier Tage später bei San Antonio den royalistischen Truppen von Oberst Ignacio Pérez aus Bexar ergeben. Long wurde als Gefangener nach Mexiko-Stadt gebracht, wo er sechs Monate später von einem Gefängniswärter erschossen wurde. Ende 1821 war Mexiko unabhängig, und Texas wurde Teil des neuen Staates.
1822: Puerto Rico (spanisches Territorium)
Während England mit Spanien über einen möglichen Tausch von Gibraltar und Kuba verhandelte, versuchten amerikanische Abenteurer, die spanische Kolonie Puerto Rico einzunehmen. Docoudray Holstein, ein im Elsass geborener Deutscher, der an der Seite des lateinamerikanischen Unabhängigkeitsgenerals Simón Bolívar gekämpft hatte, ließ sich nach seinem Bruch mit Bolívar zunächst in Curaçao nieder, ehe er in den USA, unterstützt von Geschäftsleuten in Philadelphia, New York und New Jersey eine Armee von 500 Mann bewaffnete, um Puerto Rico von der spanischen Herrschaft zu befreien. Die Spanier bekamen Wind von dem Plan und mobilisierten ihre Truppen. Doch Holstein erreichte Puerto Rico nie. Als der Schoner mit den selbsternannten Befreiern in einem Sturm vom Kurs abkam und leck schlug, musste Holstein in seiner alten Heimat Curaçao Schutz suchen, wo ihn die holländischen Behörden arretierten.
1822: Kuba (spanisches Territorium)
Marineeinheiten landeten an der Nordwestküste Kubas und brannten dort ein Piratenlager ab. Zwischen 1817 und 1825 verfolgte und jagte die US-amerikanische West Indies Squadron nahezu ununterbrochen Piraten, sowohl auf See als auch an Land. Nach der Gefangennahme von Roberto Cofresí, einem der Großen seiner Zunft, 1825 ging die Piraterie erheblich zurück. Bis zur Jahrhundertwende ereigneten sich in der Karibik bloß noch vereinzelte Zwischenfälle.
1823: Missouri (unabhängiges Gebiet)
Im sogenannten Arikara-Krieg besiegten 230 US-Soldaten, unterstützt von 750 Sioux sowie 50 Trappern, den Widerstand der Arikara gegen das Vordringen der Weißen. Dem Stamm wurde danach bei Fort Berthold im heutigen North Dakota eine Reservation zugewiesen.
1823: Afghanistan
Der US-Söldner Alexander Haughton Campbell Gardner ließ sich von Habib Khan anheuern, der seinen Onkel Dost Mohammed Khan vom Thron in Kabul vertreiben wollte. Als der Aufstand scheiterte, floh Gardner in den Punjab, wo er es unter dem Herrscher des Sikh-Reichs, Maharadscha Ranjit Singh, bis zum Obersten brachte. Er blieb auch nach dessen Tod 1839 Offizier der Sikh-Armee. Nach dem Ersten Anglo-Sikh-Krieg (1845/46) und dem Tod Ranjits bot er seine Dienste Gulab Singh an, den die Britische Ostindien-Gesellschaft als Maharadscha von Kaschmir und Jammu eingesetzt hatte.
1823: USA, Monroe-Doktrin
Im März 1822 informierte Präsident James Monroe den Kongress, dass die Vereinigten Provinzen des Río de la Plata (die heutigen Staaten Argentinien, Uruguay, Paraguay und Teile Boliviens) ihre Unabhängigkeit von Spanien erklärt hätten, und wies John Adams an, den Botschaftern in diesen Ländern mitzuteilen, dass die USA die republikanischen Institutionen anerkennen würden und Handelsverträge mit ihnen eingehen wollten. Amerika sollte in der Zukunft frei von europäischer Kolonisierung und europäischen Interventionen sein. Die USA wollten sich in den Kriegen zwischen den europäischen Staaten und ihren Kolonien neutral verhalten, betrachteten neue Kolonien oder Einmischungen in die Angelegenheiten unabhängiger Staaten jedoch als feindliche Handlungen gegen die USA.
1823: Kuba
Zwischen April und Oktober landeten US-Verbände bei der Verfolgung von Piraten fünfmal an verschiedenen Orten, so heißt es bis heute in der offiziellen Geschichtsschreibung der USA. Doch Zweifel sind angebracht. Washington hatte wieder einmal begehrliche Blicke auf Kuba geworfen. Kuba und Puerto Rico »sind natürliche Fortsätze des nordamerikanischen Kontinents, und einer davon, beinahe in Sichtweite unserer Ufer, ist aus verschiedenerlei Erwägungen heraus Gegenstand überwältigender Bedeutung für die wirtschaftlichen und politischen Interessen der Union geworden«, erklärte John Quincy Adams schon 1823, damals noch als Außenminister Monroes. »Das sind Gesetze der politischen wie physischen Schwerkraft. Kuba, gewaltsam von seiner unnatürlichen Verbindung mit Spanien getrennt und unfähig, selbstständig zu überleben, kann sich nur in Richtung der nordamerikanischen Union bewegen, die es aufgrund desselben Naturgesetzes nicht von ihrer Brust weisen kann.« Später, als Präsident, prophezeite Adams, Kuba werde »der Union wie eine reife Frucht in den Schoß fallen«.19
1824: Puerto Rico (spanisches Territorium)
Commodore David Porter griff die Stadt Fajardo im Nordosten der Insel an, die Piraten Unterschlupf geboten und angeblich amerikanische Offiziere beleidigt hatte. Später wurde Porter von einem Militärgericht für sechs Monate vom Dienst suspendiert. Daraufhin nahm er seinen Abschied von der Navy.
1824: Kuba
Im Oktober landete die USS Porpoise bei der Jagd nach Piraten bei Matanzas Bluejackets an.
1825: Kuba
In Spanien hatten Revolutionäre König Ferdinand VII. festgesetzt und eine konstitutionelle Monarchie proklamiert. Nachdem die »Heilige Allianz« (Russland, Österreich und Preußen) und französische Truppen die Revolution niedergeschlagen und König Ferdinand befreit hatten, befürchtete England eine Ausweitung der militärischen Operationen auf die früheren spanischen Kolonien in Amerika. In London und Washington kursierten Gerüchte über Pläne für eine Konferenz der europäischen Kontinentalmächte über das weitere Vorgehen gegen die ehemaligen spanischen Kolonien in Amerika. Angeblich wartete eine französische Flotte schon darauf, spanische Truppen zur Rückeroberung der Kolonien zu verschiffen. Zudem löste ein ausgedehnter Sklavenaufstand auf Kuba in Washington Besorgnisse aus, dieser Freiheitsdrang könne auf die eigenen Sklaven überspringen. Um solches und ein mögliches Eingreifen der »Heiligen Allianz« zu verhindern, landeten US-Marines auf Kuba und Puerto Rico.
1825: Mexiko
Durch Joel R. Poinsett, seinen Botschafter in Mexiko-Stadt, übte Präsident James Monroe Druck auf die dortige Regierung aus, das Gebiet zwischen den Flüssen Mississippi, Río Bravo und Colorado für 1,5 Millionen Dollar zu verkaufen.
1826–1827: Mexiko
Nachdem Mexikos Regierung 1825 US-amerikanischen Siedlern erlaubt hatte, sich in Texas niederzulassen, bereitete einer von ihnen, der reiche Pflanzer Haden Edwards aus den Südstaaten, mit Gleichgesinnten eine Rebellion gegen die mexikanischen Behörden vor in der Absicht, die Unabhängigkeit der Provinz zu erreichen. Am 16. Dezember besetzte Edwards zusammen mit dreißig weiteren Gleichgesinnten das Old Stone Fort in Nacogdoches. Am 21. Dezember 1826 erklärten die Sezessionisten im Gebiet von Nacogdoches zwischen dem Golf von Mexiko und dem Red River die unabhängige Fredonian Republic (in etwa das heutige Gebiet des mexikanischen Bundesstaats Tamaulipas) und unterzeichneten einen Friedensvertrag mit den benachbarten Cherokee-Häuptlingen Richard Fields und John Dunn Hunter. Fields und Hunter behaupteten, weitere 23 Stämme zu vertreten, und versprachen, 400 Krieger zur Verteidigung der neuen Republik abzustellen.20
Oberstleutnant Mateo Ahumada, der Kommandeur der mexikanischen Truppen in Texas, rückte daraufhin am 22. Januar mit 110 Mann Infanterie aus San Antonio de Béxar aus und marschierte nach Nacogdoches; dabei schlossen sich ihm 250 Milizionäre loyaler Siedler an. Als Edwards klar wurde, dass die Cherokee-Krieger nicht kommen würden, floh er mit seinen Anhängern über den Río Sabine in die USA, und am 8. Februar besetzte Ahumada Nacogdoches. Einige Historiker betrachten die Fredonische Republik als den Beginn des texanischen Sezessionskriegs. Die Rebellion sei »verfrüht« gewesen, »entzündete aber das Pulver für den späteren Erfolg«.21 Die Bewohner von Nacogdoches beteiligten sich in den folgenden Jahren an einer ganzen Reihe weiterer Rebellionen in Texas. 1832 vertrieben sie den mexikanischen Kommandeur Oberst José de las Piedras.22
1827: Griechenland
Am 25. September scherte die USS Warren etwa 200 Meilen westlich von Kythira aus dem Konvoi der amerikanischen Mediterranean Squadron aus, um in den griechischen Gewässern Piraten zu jagen. Am 4. Oktober brachte sie das erste Piratenboot mit einer fünfköpfigen Besatzung auf. Nur Stunden später beschlagnahmte die Warren eine Brigg, die unter griechischer Flagge segelte. Am 25. Oktober jagte sie eine weitere Brigg, die mit zehn Kanonen bestückt war, bis zur Insel Kimolos. Doch die Briganten konnten in die Hügel der Insel entkommen. Drei Tage später beschlagnahmte die Warren die Cherub. Bei Mykonos brachte die Warren zwei weitere Schiffe auf. Ein Kommando der Warren ging an Land, wo ihnen die Einwohner vier angebliche Piraten übergaben, einen fünften Mann fanden die Marinesoldaten in den Bergen. Danach überfiel die Warren noch ein Piratenschiff, verbrannte ein weiteres in der Bucht bei Andros, wo auch gleich noch ein Haus gesprengt wurde, das angeblich einem Piraten gehörte.
1827: Nordwestterritorium (unabhängiges Gebiet)
Der Widerstand der Winnebago wurde gebrochen, nachdem ihr Kriegshäuptling Roter Vogel in Haft gestorben war und andere führende Krieger exekutiert worden waren. Nach zähen Verhandlungen traten die Winnebago unter Druck ihre Siedlungsgebiete im heutigen Illinois gegen die Bezahlung von 540 000 Dollar ab, die über dreißig Jahre in jährlichen Raten von 18 000 Dollar ausgezahlt wurden.
1829: Indien
Unter den rund hundert überwiegend französischen und italienischen Söldnern, die die Hindu-Dogras, -Gurkhas und -Sikhs in der Armee Ranjit Singhs, des Gründers des Sikh-Reiches, ausbildeten und führten, dienten auch einige Amerikaner, darunter der amerikanische Quäker Josiah Harlan. Er brachte es zwar nicht bis zum König, zu dem ihn Rudyard Kipling in seiner Kurzgeschichte The Man Who Would Be King machte. Er wurde aber immerhin Gouverneur von Gujrat (im nördlichen Teil des Punjab, an Kaschmir grenzend) und nach einer »Strafexpedition« gegen einen usbekischen Warlord in Afghanistan vom König in Kabul, Dost Mohammed, zum Prinzen von Ghor ernannt (Ghor liegt im westlichen Teil Afghanistans), ehe er – von den britischen Kolonialbehörden zur persona non grata erklärt – in die USA zurückkehrte.
1831–1832: Falklandinseln (Malvinas)
1829 ließ Louis Vernet, ein in Hamburg geborener französischer Kaufmann mit US-amerikanischem Pass, den die Argentinier zum Gouverneur der Malvinas ernannt hatten, drei Schiffe US-amerikanischer Robbenjäger beschlagnahmen. Die Amerikaner hatten nach Angaben Vernets wahllos Robben und andere Tiere auf den Inseln getötet und somit die Fischerei- und Jagdrechte verletzt, die ihm 1823 von der argentinischen Regierung und 1829 von der britischen Regierung garantiert worden waren. Zwei Jahre später, im Dezember 1831, schickten die USA die Korvette USS Lexington, deren Besatzung in Vernets Abwesenheit die von ihm gegründete Siedlung Port Louis zerstörte, sieben Falkländer arretierte sowie weitere 33 deportierte und die Falklandinseln für »frei« (keinem Staat zugehörig) erklärte. Die argentinischen Proteste gegen die Verletzung der Souveränität des Landes taten die USA mit dem Hinweis auf bereits bestehende Souveränitätsrechte ab.23 Gleichzeitig blockierten US-Kriegsschiffe die Küsten der Vereinigten Provinzen des Río de la Plata.
1832: Sumatra (holländisches Territorium)
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden im Gebiet der Westküste Sumatras zwischen 5000 und 10 000 Tonnen Pfeffer produziert, der zu großen Teilen von Händlern aus Neu-England aufgekauft und dann nach Europa weiterverkauft wurde. Dabei führten Dispute um den Preis oder zwischen Seeleuten und Anwohnern häufig zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Im Januar 1831 ankerte die Friendship aus Salem (Massachusetts) vor Kuala Batu auf Sumatra, um Pfeffer zu laden, als sie angegriffen wurde. Die Angreifer töteten fünf Besatzungsmitglieder und raubten Schiff und Ladung. Präsident Andrew Jackson schickte zur Vergeltung die Fregatte USS Potomac unter Kommodore John Downes von der Pacific Squadron, die mit 42 32-Pfündern bestückt war. Am 5. Februar 1832 ankerte die Potomac, getarnt als dänischer Ostindienfahrer, fünf Meilen vor Kuala Batu. Am nächsten Morgen ruderten 282 Matrosen, Marines und Offiziere zur ersten militärischen Intervention der USA in Südostasien und griffen die vier Festungsanlagen der Stadt an. Nach heftigen Kämpfen, in denen zwei US-Soldaten und 150 Malaien fielen, nahm die US-Truppe die Stadt ein, brannte sie ab und überzeugte die Einwohner davon, »dass auf Uncle Sams Stars and Stripes nicht herumgetrampelt werden kann«, wie es auf einem weitverbreiteten Blatt hieß, auf dem in einem Gedicht der »Schlacht von Qualah Battoo« gedacht wurde:
»Exposed to their fires, the Potomacs undaunted
Beneath their rude ramparts stood firmly and brave,
Resolved that the stripes and the stars of Columbia
Fire long on their ramparts in triumph should wave.«
1832: Illinois
Nach den sogenannten Fox-Kriegen mit französischen Kolonialisten im Gebiet der heutigen Bundesstaaten Michigan und Wisconsin hatten die verbliebenen 500 Fox bei den Sauk im Gebiet zwischen dem Wisconsin River im Norden und dem Illinois River im Süden sowie nördlich des Missouri Zuflucht gesucht. 1804 hatte Henry Harrison, der Gouverneur des Indiana-Territoriums, mit einer Gruppe von Fox- und Sauk-Häuptlingen einen Vertrag ausgehandelt, dem zufolge die Indianer das Land »für immer« an die USA abtraten, jedoch auch weiterhin so lange dort leben durften, bis es vermessen und an weiße Siedler verkauft werde. Als Gegenleistung erhielten sie 2234,50 Dollar in Waren und eine jährliche Zahlung von 1000 Dollar. 1809 kam dieses Gebiet zum Illinois-Territorium, das 1818 zum Staat Illinois wurde.
Im Herbst 1829 zogen die Sauk und Fox auf Druck der amerikanischen Regierung ans Westufer des Mississippi im heutigen Iowa. Häuptling Black Hawk wollte die Vertreibung jedoch nicht anerkennen und kehrte 1830 und 1831 mehrmals zur Jagd in sein altes Siedlungsgebiet zurück. Der Gouverneur von Illinois, John Reynolds, betrachtete dies jedoch als »eine Invasion des Staates« und setzte ein Bataillon der Illinois-Miliz (in dem der spätere Präsident Abraham Lincoln als Hauptmann diente) in Marsch, um die Indianer »tot oder lebendig« auf die andere Seite des Mississippi zu vertreiben. Black Hawk zog sich nach Iowa zurück, das noch nicht Bundesstaat der USA war. Am 21. September 1832 traten die Sauk ihr Land in Illinois gegen 640 000 US-Dollar ab. Obwohl Häuptling Black Hawk nicht daran beteiligt war, wurde dieser Akt als Black-Hawk-Purchase bekannt.25
Black Hawks Kämpfe gegen amerikanische Milizen und reguläre Truppen zogen sich vier Monate hin. Nach der Niederlage in der »Schlacht des schlechten Beils«, die schon von zeitgenössischen Historikern als Massaker beschrieben wurde, flohen die Stammeskrieger. Die weiße Besiedlung von Illinois, Iowa und Wisconsin war nicht mehr gefährdet. Black Hawk und andere Häuptlinge wurden gefangen genommen und auf Tourneen in amerikanischen Städten ausgestellt.
1832: Jamaika
Amerikanische Pflanzer und Sklavenhalter machten gemeinsame Sache mit ihren Kollegen auf der Karibikinsel, um die Sklavenwirtschaft aufrechtzuerhalten. Eine von Pflanzern aus Jamaika vorgeschlagene Annexion der Insel kam allerdings nicht zustande.
1833: Argentinien
Während der sogenannten Revolución de los Restauradores, die sich gegen den amtierenden Gouverneur richtete und den vormaligen Gouverneur von Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas (der für die Wiederherstellung der Gesetzmäßigkeit eingetreten war, darum restaurador), wieder an die Macht bringen sollte, landeten US-Verbände in der Stadt am Río de la Plata, um die Interessen der USA zu schützen.
1835–1836: Peru
Als im Januar 1835 die Garnison von Callao gegen Präsident Luis Orbegoso revoltierte, landeten die US-amerikanischen Marines in der Hafenstadt und in Lima – offiziell, um die Interessen der USA zu schützen. Nachdem General Felipe Santiago de Salaverry mit Hilfe der Marines den Aufstand niedergeschlagen hatte, wandte er sich mit Unterstützung noch im Land befindlicher amerikanischer Verbände gegen seinen Präsidenten und ernannte sich zum »Obersten Chef der Republik«. Am 7. Februar 1836 schlug eine bolivianische Invasionsarmee Salaverry vernichtend, nahm ihn gefangen und lieferte ihn an Boliviens Präsidenten Andrés de Santa Cruz aus, der ihn hinrichten ließ.
1835–1836: Mexiko
Schon bald nachdem Mexiko die Unabhängigkeit von Spanien erreicht hatte (1821), lud die Regierung US-Bürger ein, die nur spärlich bevölkerte Provinz Tejas zu besiedeln. Es war eine Entscheidung, die Mexiko bald zu bedauern hatte. Unter Missachtung mexikanischen Rechts, das die Sklaverei längst abgeschafft hatte, brachten die weißen Amerikaner Sklaven mit in die Provinz und forderten die mexikanische Regierung heraus, die die politischen Aktivitäten und die Landverteilung regulieren wollte.
Trotz der nunmehrigen Bemühungen der Regierung in Mexiko-Stadt, eine weitere Einwanderung zu unterbinden, lebten 1835 schon 30 000 Amerikaner in Texas, wo sie den einheimischen Mexikanern (Tejanos) zahlenmäßig im Verhältnis 6:1 überlegen waren. Entschlossen, ihre eigene Regierung auszurufen, trafen sich die amerikanischen Texaner in einem Dorf mit dem angemessenen Namen Washington und erklärten 1836 ihre Unabhängigkeit.
Zwar durfte General Edmund Pendleton Gaines, der während des texanischen Unabhängigkeitskriegs die militärische Südwest-Division der USA kommandierte, in Anbetracht der offiziell neutralen Haltung seiner Regierung keinesfalls in die Auseinandersetzungen eingreifen. Auf Befehl des US-Kriegsministers Lewis Cass postierte er die Sechste Infanteriedivision in Fort Jesup in Louisiana, um Freiwillige davon abzuhalten, sich der Armee Sam Houstons anzuschließen. Über Gaines Ferry, eine Fähre über den Sabine River im Besitz seines Vetters James Gaines, gelangten dennoch einige Einheiten von Freiwilligen unbehindert zu den Texanern. Dabei stand es jedoch in General Gaines eigenem Ermessen, den Fluss zu überqueren, wenn Indianer die Ruhe an der Grenze stören sollten. Unter dem Vorwand, diese Ruhe sicherstellen zu wollen, schickte Gaines ein Dragoner-Regiment an das Ostufer des Sabine River und drohte, er werde nicht tolerieren, wenn sich die Cherokee in den texanischen Kampf um politische Unabhängigkeit einmischen sollten.
Auf die fälschliche Information hin, 1500 Indianer und 1000 mexikanische Kavalleristen würden sich bei Nacogdoches an der alten Straße nach San Antonio versammeln, rückte er mit 14 Kompanien an die Grenze zu Texas vor und rief zur Verstärkung jeweils eine Brigade Freiwilliger aus Louisiana, Arkansas und Mississippi sowie ein Bataillon aus Alabama. Sowohl Stephen Austin als auch Sam Houston drängten ihn, sein Hauptquartier in Nacogdoches aufzuschlagen. Gaines zögerte, befahl aber schließlich Oberst William Whistler und Teile der Siebten United States Infantry nach Nacogdoches, angeblich um Feindseligkeiten der Indianer zu unterbinden. Dadurch konnte sich Houstons Armee ausschließlich um die Mexikaner kümmern. Die Präsenz regulärer US-Truppen in Texas in den Monaten Juli bis Dezember gab natürlich Anlass zu Spekulationen. So behauptete etwa Francis T. Duffau, ein Mitglied einer Kompanie Freiwilliger aus Mississippi, er habe den schriftlichen Beweis, dass Präsident Andrew Jackson Sam Houston militärischen Beistand zugesichert habe, sollte die mexikanische Armee den Trinity River überqueren.
Im Dezember 1835, zu Beginn des texanischen Unabhängigkeitskrieges, besetzten Freiwillige unter dem Kommando von Oberst William Travis die ehemalige Franziskaner-Mission Los Alamos (spanisch: Pappeln). Am 23. Februar 1836 begann der mexikanische General Antonio López de Santa Ana die Belagerung. Nach 13 Tagen nahmen die mexikanischen Truppen das Fort ein. Nach einem weiteren Gemetzel in Goliad, wo die Mexikaner 300 Amerikaner gefangen nahmen, besiegten die amerikanischen Verbände unter ihrem Oberbefehlshaber Samuel Houston am 21. April die mexikanische Armee in der entscheidenden Schlacht von San Jacinto beim heutigen Deer Park in Harris County. Santa Ana wurde gefangen genommen und gezwungen, ein Abkommen zu unterzeichnen, in dem er die Unabhängigkeit von Texas akzeptierte.
1835–1842: Zweiter Seminolenkrieg
Die Seminolen weigerten sich, dem Indian Removal Act (einem Gesetz zur ethnischen Säuberung bestimmter Gebiete, das Präsident Andrew Jackson 1830 unterzeichnet hatte) und den Weisungen aus Washington zu folgen, die 1818 eigens für sie geschaffene Reservation nördlich des Okeechobee-Sees zu verlassen und westlich des Mississippi neu zu siedeln. Weiße Siedler versuchten die Seminolen unter Berufung auf dieses Gesetz von ihrem fruchtbaren Land zu vertreiben. Doch unter der Führung ihres Häuptlings Osceola verschanzten sich die Indianer in den Everglades und leisteten erbitterten Widerstand. Es war der längste und kostspieligste Krieg, den die USA gegen die Eingeborenen führten. Osceola akzeptierte schließlich ein Waffenstillstandsangebot, um Verhandlungen zu führen. Es war eine Falle, Osceola wurde gefangen genommen. Danach flaute der Widerstand der Seminolen ab, die meisten emigrierten nach Westen.
1838: Kanada
Nach dem Scheitern ihres Aufstandes (1837), mit dem sie Kanadas Unabhängigkeit erreichen wollten, flohen die Rebellen um William Lyon Mackenzie nach Navy Island im Niagara River, wo sie die Republik von Kanada ausriefen. Amerikanische Sympathisanten schickten mit der USS Caroline Nachschub. Doch britische Verbände brachten die Caroline auf und verbrannten sie, wobei ein US-Bürger umkam. In Vergeltung verbrannten US-Verbände einen britischen Dampfer, der sich gerade in amerikanischen Gewässern aufhielt. Die Auseinandersetzungen gingen als »Caroline-Affäre« in die Geschichte ein.
1839: Sumatra (holländisches Territorium)
Im August 1838 ermordeten Malaien die Besatzung des US-Handelsschiffes Eclipse. Als Commodore George C. Read, der mit der Ostindien-Schwadron vor Ceylon kreuzte, vier Monate später von dem Vorfall erfuhr, nahm er sofort mit den Fregatten USS Columbia und USS John Adams Kurs auf Sumatra. Die Columbia fuhr mit beinahe 500 Mann und war mit fünfzig Geschützen bestückt, die John Adams mit ihren 220 Mann verfügte über dreißig Geschütze. Am Neujahrstag 1839 trafen die Schiffe vor Sumatra ein und eröffneten das Feuer auf die von fünf Holzfestungen geschützte Siedlung Kuala Batu. Eine Stunde später waren die Forts zerstört, der Dorfhäuptling ergab sich und versprach, nie mehr amerikanische Schiffe anzugreifen.
Anschließend segelte Read nach Muckie, wo er 360 Mann an Land brachte, die das Dorf angriffen. Nachdem der Ort in Flammen aufgegangen war, zogen sich die Angreifer zurück und segelten wieder ab. Diese sogenannte Zweite Sumatra-Expedition erreichte, dass Malaien nie wieder ein amerikanisches Handelsschiff angriffen.
1840: Fidschi-Inseln
Am 18. August 1838 liefen die sechs Schiffe der United States Exploring Expedition unter dem Kommando von Charles Wilkes von Hampton Roads, Virginia, aus. Sie sollten die Südsee erforschen und »die Position aller Inseln und Untiefen, die sie entdecken und die auf den Schiffswegen unserer Schiffe liegen und bislang der Beobachtung wissenschaftlicher Navigatoren entgangen sein könnten, akkurat bestimmen«.26
Nach Besuchen in Feuerland, Chile, Peru, auf dem Tuamotu-Archipel, Samoa, New South Wales und einem Abstecher in die Antarktis segelte die Flotte zu den Fidschi-Inseln und nach Hawaii. Die Einheimischen widersetzten sich den Landvermessern und Forschern. Als sie auf der Fidschi-Insel Malolo zwei von Wilkes’ Seemännern (einer davon war ein Neffe des Commodore) ermordeten, die an Land gekommen waren, um Nahrungsmittel zu kaufen, richtete Wilkes ein Gemetzel an. Nach Aussagen eines alten Mannes auf Malolo, der Zeuge jener Ereignisse war, töteten die US-Amerikaner achtzig Fidschi-Insulaner.
1840: McKean Island, Gilbert Islands (Kingsmill-Gruppe)
Auch hier landete Wilkes seine Truppen an, um die Ermordung eines seiner Leute durch Einheimische zu rächen. Anschließend taufte er das winzige Eiland in der St. Stanislas Bay von Kiribati, das bislang Wigram’s Island geheißen hatte, nach dem getöteten Seemann »Arthur Island«.
1841: Samoa
US-Truppen kamen an Land und brannten ein paar Ortschaften ab, um die Ermordung eines amerikanischen Seemanns auf der Insel Upolu zu rächen.
1842: Mexiko
Weil er glaubte, Krieg mit Mexiko sei ausgebrochen, segelte Commodore Thomas ap Catesby Jones mit drei Kriegsschiffen der amerikanischen Pacific Squadron von Lima (Peru) nach Kalifornien. Am 19. Oktober ankerte er in der Bucht von Monterey, schickte seinen Stellvertreter, Captain James Armstrong mit fünfzig Marines und hundert Matrosen an Land und forderte die mexikanische Garnison, die nur aus 58 Mann in einem alten Fort bestand, auf, bis 9.00 Uhr des nächsten Morgens zu kapitulieren. Angesichts der Übermacht legten die Mexikaner die Waffen nieder. Erst am nächsten Tag erfuhr Jones, dass sich die USA nicht im Krieg mit Mexiko befanden und die Briten auch keinen Angriff auf Kalifornien vorbereiteten. Also ließ er die mexikanischen Soldaten wieder frei und segelte ab mit Kurs auf Hawaii, das die Briten gerade besetzt hatten. Eine Woche später wiederholte sich das Spektakel in San Diego.
1843: China
Seeleute und Marines der USS St. Louis wurden nach Zusammenstößen zwischen Amerikanern und Chinesen in Kanton angelandet. Die immensen Mengen Tees, die Großbritannien in China kaufte, bezahlte es mit den Einnahmen aus dem Verkauf von bengalischem Opium. Das schließlich 1839 von der Regierung in Peking verkündete Verbot von Opiumimporten führte zum Ersten Opiumkrieg. Nach der chinesischen Niederlage zwangen Großbritannien, Frankreich, die USA, Russland und Japan den schwachen Regierungen der Qing-Dynastie eine ganze Reihe sogenannter ungleicher Verträge auf, die den ausländischen Mächten geschichtlich einmalige Souveränitätsrechte auf fremdem Territorium einräumten: ungewöhnlich niedrige Importsteuern, die von einer ausländisch dominierten Behörde überwacht wurden; das Recht der Niederlassung und Geschäftstätigkeit in den treaty ports oder offenen Häfen.
Der Vertrag von Nanking, der den Opiumkrieg (1839–1842) beendete, sicherte Großbritannien das profitable Recht auf den Handel mit Opium und Kulis und die Insel Hongkong (Duftender Hafen). Nach den Zusammenstößen der USS St. Louis in Kanton erzwangen die USA den Vertrag von Wanghia (1844), in dem Peking den USA das Recht auf eine eigene Polizei, ein eigenes Steuersystem, ein eigenes unabhängiges Rechtssystem in den offenen Häfen sowie Missionsfreiheit im ganzen Reich einräumte. Der Vertrag von Tientsin (1858) erweiterte die älteren Verträge. Im gleichen Jahr schloss Peking mit Paris den Vertrag von Huangpu, der französische Staatsbürger von der chinesischen Justiz ausschloss und die Duldung katholischer Missionstätigkeit festschrieb. In der Pekinger Konvention nach dem Zweiten Opiumkrieg wurde ausländischen Flotten der freie Verkehr auf chinesischen Flüssen und die Auswanderung chinesischer Bürger auf ausländischen Schiffen genehmigt. Zudem wurden in diesem Vertrag weite Teile der Mandschurei an Russland und die Halbinsel Kowloon an die Briten überschrieben.
Jeden chinesischen Verstoß gegen die Verträge beantworteten die Großmächte regelmäßig mit Militäraktionen. Bis heute wird diese Zeit in China »das Jahrhundert der Nationalen Demütigung« genannt. Erst mit den 1943 zwischen Großbritannien und den USA mit China geschlossenen Abkommen wurden diese Verträge von der Pekinger Regierung für ungültig erklärt.
1843: Afrika
Vier US-Kriegsschiffe brachten diverse Einheiten an der Elfenbeinküste an Land, um den Sklavenhandel zu stören und Eingeborene zu bestrafen, die amerikanische Seeleute angegriffen hatten.
1844: Mexiko
Präsident John Tyler, dessen erklärtes außenpolitisches Ziel es war, Texas in die Union aufzunehmen, schickte Truppen, um einem möglichen Angriff Mexikos zuvorzukommen.
1844: Dominikanische Republik
Der Krieg, in dem die Dominikanische Republik die Unabhängigkeit von Haiti erreichen sollte, war noch nicht beendet, als Präsident John Tyler, bekannt für seine aggressive Expansionspolitik, die Regierungsjunta in Santo Domingo drängte, den Anschluss an die USA zu beantragen. Das Projekt scheiterte am Widerstand der Bevölkerung.
1844: Mexiko
Angeführt von Francis Sentmanat fielen Filibuster aus New Orleans in Tabasco ein. Mexikanische Verbände nahmen sie gefangen und richteten sie hin. Sentmanat wurde enthauptet und sein Kopf in heißem Öl frittiert, um weitere Filibuster abzuschrecken.
1845: Mexiko
Am 29. Dezember erklärte US-Präsident James K. Polk offiziell die Annexion von Texas.
1846–1848: Mexiko
Kurz nach der US-Annexion von Texas brach Mexiko die Beziehungen zu den USA ab. Daraufhin entsandte Präsident James Polk John Slidell als Sonderbeauftragten in geheimer Mission nach Mexiko-Stadt, um die umstrittene Grenze zu Texas zu verhandeln und amerikanische Ansprüche in Mexiko durchzusetzen. Zudem hatten die USA längst begehrliche Blicke auf das mineralreiche Nevada geworfen und wollten die Häfen von San Francisco sowie San Diego. Im Auftrag seiner Regierung sollte Slidell das Gebiet von Neu-Mexiko für fünf Millionen Dollar kaufen, für Kalifornien offerierte er 25 Millionen. Doch die Mexikaner lehnten es ab, Slidell überhaupt zu empfangen. Diese Zurückweisung betrachtete Präsident Polk als einen »klaren Kriegsgrund«27 und befahl seinem General Zachary Taylor, das umstrittene Gebiet zwischen Nueces und dem Río Grande zu besetzen. Daraufhin griffen mexikanische Truppen an. Mit der Begründung, Mexiko »ist in unser Territorium einmarschiert und hat amerikanisches Blut auf amerikanischem Boden vergossen«28, erklärte Polk mit der überwältigenden Zustimmung des Kongresses Mexiko den Krieg. Während Taylor den Río Grande überschritt, Hauptmann John C. Frémont eine Schar Siedler nach Kalifornien führte, um dort die mexikanische Garnison auszuschalten, Oberst Stephen W. Kearny Neu-Mexiko besetzte, nahm Commodore Matthew C. Perry mit der USS Mississippi die mexikanischen Städte Frontera, Tampico, Tuxpán ein und führte im Juli 1847 eine Invasionsstreitmacht von 1173 Mann gegen San Juan Bautista in Tabasco.
In geheimen Verhandlungen versprach der 1844 gestürzte mexikanische Diktator und General Antonio López de Santa Ana, gegen freies Geleit nach Mexiko Kalifornien und Neu-Mexiko an die USA zu verkaufen. Einmal in Mexiko widerrief Santa Ana diese Zusage, erklärte sich zum Präsidenten und versuchte, die amerikanischen Invasoren wieder zu vertreiben. Doch die Generäle Taylor und Winfield Scott zerschlugen den mexikanischen Widerstand. Nach längerer Belagerung nahm General Scott Veracruz ein, und am 14. September 1847 besetzte er Mexiko-Stadt. Unter dem Druck der amerikanischen Übermacht unterzeichnete Mexiko am 2. Februar 1848 den von Washington diktierten Vertrag von Guadelupe Hidalgo, in dem es alles Gebiet nördlich des Gila River – 1,3 Millionen qkm, die Hälfte seines Staatsgebietes (Neu-Mexiko, Utah, Nevada, Arizona, Kalifornien, Texas sowie das westliche Colorado und den südwestlichen Teil Wyomings) – gegen eine Entschädigung von 18,25 Millionen Dollar abtreten musste. Zudem verpflichtete sich Mexiko, alle Schadensersatzansprüche amerikanischer Bürger zu akzeptieren und zu begleichen.
»Ich glaube nicht, dass es jemals einen bösartigeren Krieg gab, als der Krieg, den die Vereinigten Staaten gegen Mexiko führten«, sagte US-Präsident Ulysses S. Grant 1879, über dreißig Jahre nachdem er als junger Leutnant in diesem Krieg gedient hatte. Als er an Krebs erkrankt im Sterben lag, betonte er noch einmal, dass der amerikanische Krieg gegen Mexiko »einer der am wenigsten gerechtfertigten Kriege (war), der je von einer stärkeren gegen eine schwächere Nation geführt wurde«.29
1846: Oregon Territory
Seit 1819 wurde das Oregon Territory gemeinsam von den USA und Großbritannien kontrolliert. Vorherige Regierungen in Washington hatten London angeboten, die Region am 49. Breitengrad zu teilen, so dass der südliche Teil an die USA fiele und der nördliche an Großbritannien. Dem widersetzte sich London. Nun forderte Präsident James K. Polk »ganz Orgegon«, also das gesamte Gebiet bis 54° 40’ nördlicher Breite, womit die USA bis an die Südgrenze des russischen Gebiets von Alaska gereicht hätten. »54–40 oder Krieg«30 war die Losung von Polks Demokraten. Schließlich einigten sich beide Seiten im sogenannten Oregon-Vertrag auf den Kompromiss, das Gebiet entlang des 54. Breitengrades zu teilen. Der amerikanische Anteil umfasste die heutigen US-Staaten Washington, Oregon und Idaho sowie Teile von Montana und Wyoming.
1849: Smyrna (Türkei)
Ein US-Flottenverband erzwang die Freilassung eines Amerikaners, den österreichische Beamte festgenommen hatten.
1850: Kuba
Nachdem Spanien 1848 Präsident Polks Angebot, die Insel für hundert Millionen Pesos zu kaufen, abgelehnt hatte, versammelte General Narciso López (der einst, nach der Niederlage der spanischen Truppen im Befreiungskampf Simón Bolívars, aus Venezuela geflohen war und es bis in die Cortes sowie zum Militärgouverneur von Madrid gebracht hatte) mit Unterstützung aus den Südstaaten 600 Mann, mit denen er im Mai in Cárdenas unter einer von ihm entworfenen Flagge einmarschierte. Zwar schloss sich die einheimische Bevölkerung wider Erwarten nicht ihm, sondern den spanischen Kolonialtruppen an, woraufhin die Invasoren mit ihrem Dampfschiff Creole nach Key West flohen. Doch seine Fahne wurde später tatsächlich zur Flagge des unabhängigen Kuba. Im August 1851 unternahm López gemeinsam mit US-Oberst William Crittenden einen erneuten Versuch, die Insel zu erobern. Die spanischen Verteidiger nahmen die Invasionsstreitmacht fest und exekutierten viele ihrer Angehörigen, darunter die beiden Befehlshaber. Andere wurden zu Zwangsarbeit in die Minen geschickt.
Mai 1850: Kolumbien
Auf Bitten der kolumbianischen Regierung intervenierten US-Truppen in Panama, als in Panama-Stadt und Colón Unruhen ausbrachen. In den folgenden Jahren rief Bogotá beinahe jedes Jahr US-Truppen, um Rebellionen oder Unruhen in der Provinz zu unterdrücken. Washington war nur zu gerne bereit, diesen Bitten zu folgen, vor allem um die Panama Railroad zu schützen, die US-Firmen Mitte der 50er Jahre gebaut hatten. Bedeutendere Zwischenfälle ereigneten sich 1851, 1853, 1854, 1858, 1860 und 1861. Die Begründung für die Landung amerikanischer Soldaten in Panama war jedes Mal die gleiche: um amerikanische Interessen während einer Revolution oder während gewaltsamer Unruhen zu schützen.
1850: Nicaragua
Großbritannien kontrollierte große Besitzungen in British Honduras (das heutige Belize), an der atlantischen Misquitoküste in Honduras und Nicaragua und auf Bay Islands (heute zu Honduras gehörig). Der Plan der USA, die zwar keine territorialen Ansprüche, aber Verträge mit Nicaragua und Honduras vorweisen konnten, einen Kanal vom Atlantik bis zum Pazifik durch Nicaragua zu bauen, stieß auf den heftigen Widerstand Großbritanniens. Also verhandelten die beiden Großmächte über das Schicksal des mittelamerikanischen Staates, ohne dessen Regierung oder Vertreter auch nur zu informieren, und schlossen den bis heute in Mittelamerika berüchtigten Clayton-Bulwer-Vertrag, so benannt nach den Unterhändlern, John M. Clayton und Sir Henry Lytton Bulwer, dem späteren Lord Dalling.
Der Vertrag verbot beiden Parteien, exklusive Kontrolle über den geplanten Kanal zu erstreben, und verlangte, dessen Neutralität zu garantieren. Ferner dürfe keiner der Unterzeichner jemals »Nicaragua, die Misquitoküste oder irgendeinen Teil Mittelamerikas besetzen oder befestigen oder kolonisieren oder (dort) irgendeine Dominanz durchsetzen oder ausüben«.31
1851: Türkei
Nach einem Massaker in Jaffa, in dem etliche Ausländer, darunter auch einige Amerikaner, umgekommen waren, entsandten die USA eine Schwadron, die als Machtdemonstration die Küsten der Levante entlang patrouillierte.
1851: Johanna Island (Ostafrika)
Vier US-Kriegsschiffe, darunter die USS Dale, landeten Marines und Matrosen an, um eine Wiedergutmachung für die Festnahme des Kapitäns eines amerikanischen Walfängers zu erzwingen.
1851: Mexiko
Eine nordamerikanische Truppeneinheit überfiel Sonora und zerstörte dort mehrere Ortschaften.
1852–1853: Argentinien
Marines landeten in Buenos Aires während einer Revolution in den La-Plata-Staaten, um die amerikanischen Interessen zu schützen und dem Wunsch nach »freiem Zugang zu ihrem Handel« Nachdruck zu verleihen, wie Präsident Millard Fillmore in seiner Rede zur Lage der Nation am 6. Dezember 1852 betonte.32
1853: Mexiko
Um eine südliche Überlandroute nach Kalifornien zu schaffen, wies US-Präsident Franklin Pierce seinen Botschafter in Mexiko-Stadt, James Gadsen, an, mit der mexikanischen Regierung von Antonio López de Santa Ana über den Kauf mexikanischen Landes zu verhandeln. Die Mexikaner, die nach der nur fünf Jahre zurückliegenden Niederlage nicht wagten, es erneut auf einen Machtkampf mit dem mächtigen Nachbarn ankommen zu lassen, verkauften schließlich im sogenannten Gadsen Purchase für zehn Millionen Dollar weitere 30 000 Quadratmeilen ihres Territoriums an die USA.
1853–1854: Nicaragua
Nachdem der konservative General Fruto Chamorro die Regierung übernommen und die führenden Mitglieder der Opposition exiliert hatte, marschierte am 5. Mai 1854 mit der Unterstützung des Nachbarlandes Honduras eine Exilantenarmee in Nicaragua ein. Chamorro gab bekannt, dass seine Verbände alle Rebellen, die ihnen in die Hände fielen, exekutieren würden, während der Führer der Liberalen, General Máximo Jérez, die Anhänger Chamorros zu Verrätern an der Nation erklärte. Um in dem anhaltenden und blutigen Konflikt amerikanische Interessen und Bürger zu schützen, landeten die USA Marines in dem mittelamerikanischen Staat an. Wegen einer Beleidigung des amerikanischen Botschafters bombardierte ein US-Verband San Juan del Sur, anschließend brannten Marines die Stadt völlig ab.
1853–1854: Mexiko
Mit einer kleinen Streitmacht segelte der Zahnarzt, Abenteurer und Filibuster William Walker nach La Paz und erklärte die beiden mexikanischen Bundesstaaten Baja California und Sonora zu einer unabhängigen Republik. Mangel an Ausrüstung und mexikanischer Widerstand zwangen ihn ein halbes Jahr später, sein Projekt aufzugeben.
1853–1854: Japan
1633 erließ das Tokugawa-Shogunat eine Reihe von Sakoku-Edikten (»verschlossenes Land«), wonach Ausländern das Betreten des Landes ebenso unter Androhung der Todesstrafe untersagt war wie Japanern das Verlassen ihrer Heimat. Als einzige Ausnahmen genehmigten die japanischen Behörden den Handel mit Holland, China sowie Korea, der in Nagasaki abgewickelt wurde. Für Schiffe anderer Nationen waren Japans Häfen geschlossen. 1846 jedoch ankerte Commander James Biddle, der von seiner Regierung in Washington beauftragt worden war, Japan für den Handel zu öffnen, mit zwei Schiffen in der Bucht von Edo, dem heutigen Tokio. Drei Jahre später segelte Kapitän James Glynn nach Nagasaki, um Verhandlungen mit dem Land zu führen. Glynns Mission blieb so erfolglos wie zuvor Biddles Versuch. Glynn empfahl dem US-Kongress, die Verhandlungen mit Japan mit einer Demonstration der Stärke zu begleiten.
Im Juli 1853 landeten schließlich vier Schiffe unter dem Kommando von Commodore Matthew C. Perry im Hafen von Uraga in der Bucht von Edo. Als Antwort auf die Aufforderung der japanischen Behörden, nach Nagasaki weiterzusegeln, richtete Perry seine Geschütze auf Uraga, verlangte die Erlaubnis, einen Brief seines Präsidenten Millard Fillmore überreichen zu dürfen, und drohte mit Gewalt, sollten die japanischen Boote, die die amerikanische Schwadron eingekreist hatten, nicht abfahren. Wenn sie den Kampf bevorzugten, würden sie von den Amerikanern notwendigerweise vernichtet. Perrys Schiffe waren mit den neuesten, sehr durchschlagkräftigen Paixhans-Kanonen ausgerüstet. Der Begriff »Schwarze Schiffe« (wegen des schwarzen Rauches der mit Kohle befeuerten Dampfschiffe) sollte bald die Bedrohung durch die überlegene westliche Technologie symbolisieren. Schließlich dampfte Perry nach Yokosuka, wo er das Schreiben seines Präsidenten japanischen Delegierten überreichte, ehe er Kurs nach China nahm, nicht ohne zuvor zu versprechen, dass er zurückkommen werde. Um Edo vor einem möglichen amerikanischen Angriff zu schützen, bauten die Japaner neue Befestigungsanlagen bei Odaiba in der Bucht.
Im Februar 1854 kehrte Perry mit sieben Schiffen zurück und zwang dem Shogun den »Vertrag über Frieden und Freundschaft« auf, der amerikanischen Schiffen die Häfen von Shimoda und Hakodate öffnete, die Sicherheit amerikanischer Schiffbrüchiger garantierte und die Einrichtung eines Konsulats in Shimoda vorsah. Nach zwei Jahrhunderten der Isolation hatte Perry Japan für westliche Diplomatie und westlichen Handel geöffnete und die formellen diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und den USA begründet. Dieser Erfolg, mit dem sich die USA in Asien als gleichwertige Macht neben Russland, Frankreich und Großbritannien etablierten, lieferte der Regierung in Washington in den folgenden Jahren den Vorwand für zahlreiche Interventionen in Japan. Ein Jahr nach Unterzeichnung des Vertrags gestand der US-Kongress Perry eine Belohnung von 20 000 Dollar zu (rund eine halbe Million nach heutigem Wert).
1853–1854: Ryukyu und Bonin Islands
Während der Verhandlungen mit Japan unternahm Commodore Perry mit seiner Flotte einige Abstecher zu diesen Inseln, landete Truppen und erzwang vom Herrscher in Naha auf Okinawa ein Handelsabkommen und das Recht für den Bau einer Kohlestation für US-Schiffe im Pazifik.
1854: Kuba
In den wiederholten Bemühungen, den Spaniern ihre Karibikbesitzung abzukaufen, wies US-Präsident Franklin Pierce seinen Botschafter in Madrid, Pierre Soulé, an, den Einfluss bedeutender europäischer Bankiers für die USA zu sichern. Das Resultat, das sogenannte Ostend Manifesto, wurde von der amerikanischen Öffentlichkeit als Aufruf interpretiert, Kuba den Spaniern zu entreißen, wenn nötig mit Gewalt.
1854: China
US-Marines schützten amerikanische Interessen während bürgerkriegsähnlicher Unruhen in Schanghai.
1855: China
US-Verbände rückten in Schanghai ein, um amerikanische Interessen zu schützen.
1855–1857: Nicaragua
Zwar war General Fruto Chamorro (siehe: 1853 Nicaragua) im März 1855 gestorben. Der Druck der Konservativen in Granada auf die Liberalen in León ließ dennoch nicht nach. Durch einen Agenten wandten sich die Liberalen darum an den Zahnarzt und Söldner William Walker, der – wie sein Präsident Franklin Pierce – zutiefst von der Manifest Destiny überzeugt war, und boten ihm großzügige Landkonzessionen an, wenn er ihnen eine amerikanische Streitmacht zur Hilfe brächte. Walker ergriff die Chance und stellte rasch eine Truppe von 56 Gefolgsleuten zusammen. Am 4. Mai 1855 landete er in Nicaragua, und nur innerhalb eines halben Jahres kontrollierte seine Söldnerarmee das Land.
Aus den USA strömten mehr und mehr Soldiers of Fortune nach Nicaragua, um sich dem erfolgreichen Zahnarzt anzuschließen, was jedoch in den Nachbarstaaten Honduras und Costa Rica Befürchtungen über Walkers weitere Pläne auslöste. Im März 1856 erklärte Costa Rica Walker den Krieg, doch eine Cholera-Epidemie dezimierte die Armee des Landes dermaßen, dass sie sich zurückziehen musste. Ermutigt von diesem Sieg, erklärte sich Walker am 12. Juli 1856 zum Präsidenten Nicaraguas, machte Englisch zur Landessprache, führte die Sklaverei ein und warb in den amerikanischen Südstaaten Siedler für Nicaragua an. Sein Aufruf, Nicaragua als Bundesstaat in die Union aufzunehmen, fand vor allem im Süden der USA durchaus Sympathien. Noch im Januar 1857, nur wenige Monate vor seiner Niederlage, schrieb Harper’s Weekly eine Eloge auf Walker: »Wir müssen seine Hartnäckigkeit, seine Ausdauer, seine Entschlossenheit, sein Heldentum anerkennen, die einen höheren Platz als alle fahrenden Ritter der Geschichte verdienen … Der Unterschied ist, dass unserer ein Held des 19. Jahrhunderts ist.«33
Doch dann beging Walker den Fehler, der zu seinem Sturz führen sollte. Bei einem Coup, mit dem er die Kontrolle über Cornelius Vanderbilts einträgliche Accessory Transit Company (eine Schifffahrtsgesellschaft, die zahlreiche Auswanderer von New York über San Juan del Norte, den Río San Juan aufwärts und den Nicaragua-See an die Pazifikküste und nach Kalifornien brachte) gewinnen wollte, fand Walker die Unterstützung zweier Angestellter Vanderbilts, denen er als Dank dessen Firmenbesitz in Nicaragua übertrug. Nun war Vanderbilt entschlossen, den Emporkömmling zu zerstören.
Die meisten Nicaraguaner waren ohnehin schon aufgebracht über die Einführung der Sklaverei und der neuen offiziellen Landessprache. Die anderen Regierungen Mittelamerikas wünschten ebenfalls Walkers Untergang. Die Briten ermutigten die Opposition in der Absicht, den amerikanischen Einfluss in der Region zu reduzieren. Und sogar die US-Regierung, die eine Annexion Nicaraguas fürchtete, die den schwelenden Konflikt um die Sklaverei innerhalb der Union weiter anfachen könnte, stand dem Abenteurer inzwischen ablehnend gegenüber. Vanderbilt indes organisierte in Costa Rica eine mittelamerikanische Streitmacht, um Walker zu stürzen. Verbände der britischen Marine griffen ein, Costa Rica besetzte die Transitroute durch Nicaragua entlang des Río San Juan, womit Walker von Nachschub abgeschnitten war und keine neuen Rekruten mehr gewinnen konnte, und Vanderbilt bot allen, die sich von Walker abwandten, freie Rückfahrscheine in die USA an. Nach diversen Niederlagen und großen Verlusten durch Cholera, Typhus, Gelbfieber, Amöbenruhr und Desertion war Walker geschlagen.
Um einer Festnahme zu entkommen, ergab er sich am 1. Mai 1857 US-Navy Commander Charles H. Davis. Walker und seine verbliebenen Gefolgsleute marschierten, eskortiert von US-Marines, zur Küste und segelten nach Hause. Walkers erzwungenes Exil war nur von kurzer Dauer. Sieben Monate später verhinderten die USS Saratoga, USS Wabash und die Fulton einen erneuten Versuch Walkers, in Nicaragua einzumarschieren. Commodore Hiram Pauldings Landung von Marines, um die Überstellung Walkers in die USA zu erzwingen, wurde von US-Außenminister Lewis Cass nicht anerkannt. Paulding wurde zur Aufgabe seines Postens und in Pension gezwungen. Walker unternahm vier weitere Versuche, um nach Mittelamerika zurückzukehren (1857, 1858, 1859 und 1860).
1855: Fidschi-Inseln
Angeblich feierten die Bewohner gerade den 4. Juli, den Nationalfeiertag der USA, als Kanonenkugeln auf das Haus des amerikanischen Handelsagenten John Brown fielen. Während eines Bürgerkriegs zerstörte ein Feuer John Williams Laden in Nukulau, woraufhin ein paar Einheimische das Geschäft plünderten. Also schickte die USS John Adams unter Kommandant Edward B. Boutwell, um die Unruhen zu »beobachten«. Soldaten wurden angelandet, die – wie üblich – amerikanische Interessen und Besitz schützen sollten. Als er von Williams Verlusten hörte, forderte Kommandant Boutwell zunächst 5000 Dollar Schadenersatz von König Cakobau, später erhöhte er den Betrag auf 38 000 Dollar. Doch die Fidschi dachten nicht daran zu bezahlen. Also ging eine Einheit Boutwells an Land, um den König gefangen zu nehmen. Dessen Krieger setzten sich zur Wehr, ein US-Soldat starb, zwei weitere wurden verwundet. Am Ende schlugen die Amerikaner die Krieger zwar, doch Cakobau und die Überlebenden konnten entkommen.
1855–1858: Dritter Seminolenkrieg
Als Washington versuchte, nun die letzten Seminolen, die auch nach dem Zweiten Seminolenkrieg immer noch in Florida geblieben waren, umzusiedeln, widersetzten sich diese drei Jahre lang. Schließlich blieb auch ihnen nichts anderes übrig, als (gegen eine kleine Entschädigung) nach Westen zu emigrieren.
1855: Uruguay
Amerikanische und europäische Flottenverbände landeten während einer Revolution in Montevideo, um amerikanische Interessen zu schützen.
1856: Kolumbien
US-Verbände schützten amerikanische Interessen während einer Rebellion, die sich gegen den amerikanischen Bau der Panama Railroad richtete.
1856: Haiti
Nachdem der US-Kongress ein Gesetz verabschiedet hatte, dem zufolge jede Insel mit Guanofundstätten, die US-Bürger für sich reklamierten, annektiert werden würde, ging die zwischen Jamaika und Haiti gelegene Insel Navassa in amerikanischen Besitz über.
1856: Hawaii
Ein US-Flottenverband besetzte die kleinen Hawaiiinseln Jarvis, Baker und Howland.
1856: China
Zu Beginn des Zweiten Opiumkriegs (zwischen England und China) besetzten 150 Mann von den beiden Kriegsschaluppen USS Portsmouth und USS Levant die südchinesische Stadt Kanton. Als chinesische Truppen eine amerikanische Pinasse beschossen, fuhren die beiden Schaluppen zusammen mit einer hinzugekommenen Fregatte den Perlfluss aufwärts und nahmen die vier Festungsanlagen der Stadt unter Feuer. Nach einigen Tagen heftigen Beschusses, in dem Hunderte chinesischer Soldaten starben, führten diplomatische Bemühungen schließlich zu einer Einigung, in der die USA zusicherten, sich im Opiumkrieg neutral zu verhalten.
Dies hielt US-Kapitäne jedoch nicht davon ab, dennoch in den Krieg einzugreifen. Als China 1859 die Einrichtung ausländischer Vertretungen in Peking ablehnte, griff ein britisches Geschwader unter dem Befehl von Admiral Sir James Hope die Festungsanlagen im Mündungsdelta des Peiho-Flusses an. Dabei kam ihm U.S. Navy Commodore Josiah Tattnell zu Hilfe. Es war das erste Mal, dass britische und amerikanische Soldaten Seite an Seite kämpften.
1857: Mexiko
Am 24. März drang eine Gruppe von 104 Filibustern unter dem Kommando von Henry A. Crabb, einem Rechtsanwalt aus Nashville, Tennessee, in Sonora ein, um es für die USA zu annektieren. Am 6. April ergaben sich 59 der Invasoren den herbeigeeilten mexikanischen Truppen und wurden hingerichtet. Der Rest floh in die USA. Einen Tag später unternahm eine weitere Gruppe Amerikaner einen erneuten Invasionsversuch, der ebenso schnell scheiterte.
1857–1858: Utah War
Nach der amerikanischen Annexion der ehemaligen mexikanischen Gebiete von Utah kam es zwischen der US-Regierung und Mormonen-Milizen zu Auseinandersetzungen um die Kontrolle der Region. Am 12. April 1858 übergab Brigham Young, der zweite Präsident und Prophet der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, das Amt des Gouverneurs des Utah-Territoriums an den von Washington entsandten Alfred Cumming.
1858: Mexiko
US-Präsident James Buchanan versuchte, die mexikanische Regierung zur Abtretung Baja Californias und zur Öffnung des Isthmus von Tehuantepec für den »freien Verkehr« zu zwingen.
1858: Nicaragua
Präsident Buchanan schickte Marines, um seiner Forderung an die nicaraguanische Regierung, den USA freie Durchfahrt und Zollfreiheit zu sichern, Nachdruck zu verleihen.
1858: Uruguay
Zwei US-Kriegsschiffe machten in Montevideo fest, um während einer Revolution amerikanischen Besitz zu schützen.
1858: Fidschi-Inseln
Nachdem Untertanen von König Cakobau auf der Fidschi-Insel Waya zwei amerikanische Händler getötet und verspeist hatten, führte die Pacific Squadron mit der USS Vandalia unter Commander Arthur Sinclair und dem Schoner Mechanic eine Strafexpedition durch. Am 9. Oktober standen vor dem Dorf Somatti zehn US-Marines mit vierzig Matrosen 300 Kriegern gegenüber. Die Amerikaner waren mit Säbeln und Karabinern ausgerüstet, die Bewaffnung der Inselbewohner bestand aus Keulen, Steinen, Bögen und ein paar Musketen. Nach einer halben Stunde brannte das Dorf, waren über 115 Hütten zerstört, waren 14 Fidschi-Krieger, darunter zwei Häuptlinge, tot und mindestens 36 verwundet. Die siegreichen Angreifer zählten fünf Verwundete.
1858–1859: Türkei
Nach einem weiteren Massaker an Ausländern in Jaffa befahl Washingtons Außenminister erneut starke Flottenverbände vor die Küsten der Levante, um die türkischen »Behörden an die Macht der Vereinigten Staaten zu erinnern«.
1858: Paraguay
1853 hatte sich Paraguays Diktator Carlos Antonio López geweigert, einen Vertrag mit den USA zu ratifizieren, der die Handelsbeziehungen und amerikanische Schifffahrtsrechte auf den Flüssen des Landes regeln sollte. López untersagte allen unter ausländischen Flaggen fahrenden Schiffen das Eindringen in die Hoheitsgewässer Paraguays. In Befolgung dieses Dekrets schossen 1855 Soldaten seiner Armee auf die USS Water Witch, die den Río Paraná wissenschaftlich vermaß, wobei ein Amerikaner getötet wurde. Ein herbeigerufenes amerikanisches Kanonenboot drohte, den Ort Encarnación zu bombardieren, sollte das Land nicht bereit sein, seine Flüsse der »freien Navigation« zu öffnen.
Ende Dezember 1858 setzte Präsident James Buchanan mit der Zustimmung des Kongresses 19 Schiffe, 200 Artilleriegeschütze und 2500 Seeleute unter dem Befehl von Commodore William B. Shubrick nach Montevideo in Marsch. Von dort fuhr die Flotte den Río de la Plata, den Paraná und den Río Paraguay aufwärts bis Rosario. Die USS Fulton und erneut die Water Witch fuhren bis zur Hauptstadt Asunción. Nach 14 Verhandlungstagen erreichte die amerikanische Kanonenbootpolitik ihr Ziel: Paraguay entschuldigte sich bei den USA, entrichtete der Familie des sechs Jahre zuvor gefallenen Matrosen der Water Witch die verlangte Entschädigung und gestanden den USA einen höchst vorteilhaften Handelsvertrag zu.
1859: Mexiko
Juan Nepomuceno Cortina Goseacochea, bekannter als Cheno Cortina oder der »Rote Bandit vom Río Grande«, war ein mexikanischer Rancher, Politiker, Offizier, Gesetzloser und Volksheld, der erste »sozial motivierte Grenzbandit«, vergleichbar den späteren Catarino Garza oder Pancho Villa. Ihm soll die Romanfigur Zorro nachempfunden worden sein. Geboren und aufgewachsen im Grenzgebiet zu Texas setzte er sich nach dem Amerikanisch-Mexikanischen Krieg für die Tejanos (Texaner mexikanischer Herkunft) ein, die von den Anglos (Texaner amerikanischer Herkunft) ausgebeutet, verfolgt und bestohlen würden. Cortina selbst hatte einen Überfall von Anglos nur knapp überlebt, die sein Anwesen angegriffen hatten, weil er seine Ländereien nicht an amerikanische Neusiedler verkaufen wollte. Zwar wurden Cortina und seine Mutter von einigen Indianern des Karankawa-Stammes gerettet, doch seine Frau Maria Dolores Tijerina und seine drei Kinder wurden bei dem Angriff getötet.
In einer Auseinandersetzung um einen ehemaligen Rancharbeiter erschoss Cortina am 13. Juli 1859 den Marshall von Brownsville. Es war der Beginn des Ersten Cortina-Krieges. Im September besetzte er die Stadt mit einer Bande von vierzig Mann, aber seine Feinde waren schon entkommen. In einer Proklamation erklärte Cortina: »Es gibt keinen Grund zur Furcht. Ehrenwerte Bürger werden wir nicht anrühren. Unser Ziel ist, die Schurkerei unserer Feinde zu verfolgen.« Nun verfolgten ihn Texas Rangers und die US-Armee bis nach Mexiko. Am 27. Dezember wurde er südlich des Río Grande vernichtend geschlagen, verlor sechzig seiner Männer und die gesamte Ausrüstung. Cortina zog sich in die Burgosberge zurück.
Im Mai 1861 unterstützte er im amerikanischen Bürgerkrieg die Regierung in Washington und griff im sogenannten Zweiten Cortina-Krieg die Konföderierten-Armee in Zapata County an, wurde aber in der Schlacht von Carrizo von deren Verbänden geschlagen und zog sich daraufhin abermals nach Mexiko zurück.
Am 29. November 1867 putschte sich Porfirio Díaz in Mexiko an die Macht. Washington übte Druck auf Díaz aus, gegen Cortina vorzugehen. Zudem boten ihm reiche Rancher in Texas, die seinen Staatsstreich finanziert hatten, eine große Summe – die Rede war von einem Betrag zwischen 50 000 und 200 000 Dollar – für die Ausschaltung Cortinas an. Also befahl Díaz die Festnahme und Hinrichtung des populären Briganten. General José Canales, ein alter Feind des Gesuchten, brachte ihn nach Mexiko-Stadt. Aus Furcht, eine Hinrichtung könnte Unruhen im Volk auslösen, wurde er ins Militärgefängnis von Santiago Tlatelolco gebracht, wo er die nächsten 14 Jahre, bis 1890, ohne Prozess oder Urteil festgehalten wurde. Cortina starb am 30. Oktober 1894.
1859: China
US-Kriegsschiffe trafen in Schanghai ein, um amerikanische Interessen zu schützen.
1860: Portugiesisch-Westafrika (Angola)
Weil die Einheimischen »lästig« geworden waren, riefen in Kissembo ansässige Amerikaner und Engländer amerikanische und britische Schiffe zu Hilfe, die sofort Truppen in die kleine Hafenstadt entsandten.
1860: Honduras
Bei seinem letzten Versuch, Mittelamerika zu erobern, wurde William Walker (siehe: 1855 Nicaragua) von einem britischen Kriegsschiff gefangen genommen, als er in Honduras einmarschieren wollte. Die britischen Offiziere übergaben ihn den lokalen Behörden. Am 2. September 1860 wurde er von einem honduranischen Erschießungskommando in Truxillo hingerichtet.
1861–1864: Arizona (wurde 1912 als 48. Bundesstaat in die Union aufgenommen)
Zwar wehrten sich die Navajos längst nicht mit der Hartnäckigkeit etwa der Apachen gegen das Vordringen weißer Siedler, dennoch beauftragte die US-Regierung 1863 Oberst Kit Carson, die aufsässigen Navajos endgültig zu unterwerfen. Das Resultat dieses Befehls waren die Zerstörung der Felder und Obstbaumplantagen sowie der Herden der Indianer und die Inhaftierung von rund 8000 Navajos zusammen mit 400 Mescalero-Apachen in Bosque Redondo, etwa 290 km südlich von Santa Fé. Diese vierjährige Kollektivhaft (1864–1868) hinterließ ein bis heute anhaltendes Gefühl der Verbitterung und des Misstrauens unter den Navajos. Zwar wurden ihnen schließlich mehr als 64 000 qkm Land in Neu-Mexiko, Arizona und Utah als Reservation zugewiesen, doch das trockene Land erlaubte keine Plantagenwirtschaft und kaum Viehzucht, um die Bevölkerung zu ernähren. Die heute dort lebenden Navajos sind weitgehend verelendet und dem Alkohol verfallen.
1862: Dakota
Nachdem Minnesota 1858 der Union beigetreten war und Siedler in den neuen Bundesstaat strömten, kam es zum ersten Aufstand der Sioux. Nach sechswöchigen Kämpfen waren die Sioux unter Führung ihres Häuptlings Taoyateduta (Kleine Krähe) geschlagen. 303 von ihnen wurden in Militärgerichtsverfahren wegen Mordes und Vergewaltigung zum Tode verurteilt. Zwar begnadigte Präsident Abraham Lincoln die meisten, doch am 26. Dezember 1862 wurden 38 Dakota-Sioux in Mankato gehängt. Es war die bis heute größte Massenhinrichtung in den Vereinigten Staaten.
1863: Japan
Die USA schickten Truppen, um ihrer Forderung auf Wiedergutmachung für eine Beleidigung der amerikanischen Fahne Nachdruck zu verleihen.
16. Juli 1863: Japan
In der sogenannten Seeschlacht von Shimonoseki beschossen sich amerikanische und japanische Kriegsschiffe. Der Grund, der nie eindeutig geklärt werden konnte: Japanische Kriegsschiffe hatten angeblich das amerikanische Schiff Pembroke beschossen.
1864: Japan
Zehn Tage lang, vom 4. bis zum 14., September, belagerten amerikanische, britische, französische und holländische Flottenverbände die japanische Hafenstadt Nagato, um durchzusetzen, dass ein bereits unterzeichneter Vertrag zur Nutzung der Straße von Shimonoseki im internationalen Seeverkehr nun auch ratifiziert wurde.
1864: Colorado
Zwar war den Indianern am Sand Creek von der US-Regierung versichert worden, in ihrem Siedlungsgebiet unbehelligt zu bleiben. Eine lokale Miliz weißer Siedler griff dennoch ein Dorf von Cheyenne- und Arapaho-Indianern im Südwesten Colorados an, das erst 1876 ein US-Bundesstaat werden sollte, und metzelte 150 Männer, Frauen und Kinder nieder.
1865: Panama (Kolumbien)
US-Truppen landeten, um während einer Revolution amerikanische Bürger und amerikanischen Besitz zu schützen.
1866: Mexiko
Um amerikanische Bürger zu beschützen, besetzte General Sedgwick im November mit hundert Mann die Grenzstadt Matamoros in Tamaulipas. Nach drei Tagen befahl die US-Regierung seinen Rückzug.
1866: China
US-Truppen straften die Einwohner von Niuzhuang (heute der Hafen von Yingkou), weil der amerikanische Konsul überfallen worden war.
1866–1877: Nicaragua
US-Marines besetzten León und Managua.
1866–1868: South Dakota
Der Kriegshäuptling der Lakota-Sioux, Makhpyia Luta (Rote Wolke), setzte dem Vordringen der weißen Siedler massiven Widerstand entgegen und führte die erfolgreichsten Angriffe gegen die US-Armee während aller Indianerkriege. Im Vertrag von Fort Laramie von 1868 sprachen die USA den Lakota schließlich ihr angestammtes Siedlungsgebiet (zu dem auch die gesamten Black Hills gehörten) »auf alle Zeiten« zu – ohne Militärpräsenz oder Aufsicht, ohne weiße Siedlungen und ohne Einschränkungen etwa durch Straßenbaurechte. Im Gegenzug dazu garantierten die Lakota und zahlreiche weitere Stämme der Great Plains den auf dem sogenannten Oregon-Trail nach Kalifornien ziehenden weißen Siedlern freie Passage.
1867: Formosa
US-Truppen landeten auf der Insel und brannten eine Reihe von Hütten ab, um »eine Horde Wilder« zu bestrafen, die angeblich ein Mitglied der Mannschaft eines in Seenot geratenen Schiffes ermordet hatte.
1867: Hawaii
Ein US-Flottenverband besetzte Midway, und errichtete auf der Insel einen Marinestützpunkt.
1867–1870: Kanada
Den Bemühungen von Expansionisten in Minnesota, die eine Annexion von Ruperts Land in Westkanada forderten, begegnete Großbritannien mit dem British North America Act, mit dem das Dominion von Kanada geschaffen wurde. Die Anstrengungen der Expansionisten scheiterten endgültig, als Kanada die Provinz Manitoba gründete und Truppen in Winnipeg stationierte.
1868: Japan
US-Truppen rückten während des Bürgerkriegs, der das Shogunat beendete in Osaka, Hiogo, Nagasaki, Yokohama und Negata ein, um amerikanische Interessen zu schützen.
1868: Uruguay
US-Truppen landeten in Montevideo, um während eines Aufstandes ausländische Bewohner der Stadt sowie das Zollhaus im Hafen zu schützen.
1868: Kolumbien
In Abwesenheit der lokalen Polizei übernahmen US-Truppen den Schutz von Passagieren und Gütern der Panama Railroad.
1868: Oklahoma (Beitritt zur Union 1907 als 46. Staat)
In der Schlacht am Washita River griff die 7. US-Kavallerie unter Oberst George Armstrong Custer nahe dem heutigen Cheyenne ein Cheyenne-Dorf an und metzelte 250 Männer, Frauen und Kinder nieder.
1869: Santo Domingo (heute: Dominikanische Republik)
1867, während der Präsidentschaft Andrew Jacksons, beantragte die von einer Invasion aus Haiti bedrohte Regierung Santo Domingos bei den USA die Annexion. Der US-Kongress lehnte jedoch ab. Als 1869 Jacksons Nachfolger, Präsident Ulysses S. Grant, von dem Interesse seiner Marine an einer Kohlestation in der Samana-Bucht erfuhr, handelte er auf Vorschlag des Unternehmers Joseph W. Faben aus Neu-England mit dem Präsidenten Santo Domingos, Buenaventura Báez, einen Annexionsvertrag aus, in dem der ehemaligen spanischen Kolonie die spätere Eingliederung in die Union als Bundesstaat versprochen wurde. Zudem beinhaltete das Abkommen den Kauf der Samana-Bucht für zwei Millionen Dollar. Grant versprach sich davon einerseits den Zugriff auf die natürlichen Ressourcen des Staates und einen amerikanischen Hafen, der dem Schutz eines geplanten Kanals am Isthmus des Daríen (Panama) dienen sollte, aber auch eine Heimstatt für umzusiedelnde ehemalige Sklaven aus den Südstaaten, die dort immer noch unter schwerer Verfolgung durch den Ku-Klux-Klan litten. Zudem, so glaubte er, könnte Santo Domingo auf diese Weise ein Vorbild für andere Staaten wie etwa Brasilien werden und dort das Ende der Sklaverei beschleunigen.
Zwar stieß der Annexionsvertrag in der Bevölkerung von Santo Domingo einem von Báez durchgeführten Plebiszit zufolge auf breite Zustimmung, in Washington jedoch widersetzten sich die beiden Senatoren Carl Schurz und Charles Sumner, der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, dem Vertrag. Sie vermuteten, die Annexion diene nur der Bereicherung privater Interessen und dem Schutz des korrupten Despoten Báez. Der Vertrag scheiterte schließlich am Widerstand des US-Kongresses.
1869–1878: Kuba
Während des Ersten Kubanischen Unabhängigkeitskriegs (1868–1878), auch der »Zehnjährige Krieg« genannt, meldeten sich in den USA Freiwillige, um die Aufständischen zu unterstützen, und bildeten das »Ejército Mambí«, die Befreiungsarmee. Berühmt wurde der 1850 in Brooklyn geborene Henry Reeve, der 1869 als Teil des Expeditionskorps mit dem Dampfschiff Perrit in der Bahía de Nipe im Norden der Provinz Oriente auf Kuba eintraf und heute noch unter seinem Spitznamen »El Inglesito« (der kleine Engländer) auf Briefmarken, in Reden und Broschüren gefeiert wird. Kurz nach seiner Landung kämpfte er in Las Cuevas und Las Calabezas, wo er mit einigen Kameraden in spanische Gefangenschaft geriet. Von einem Erschießungskommando als vermeintlich tot zurückgelassen, wurde Reeve von einer Einheit der Aufständischen gefunden und in ein Lager gebracht, wo er genesen konnte und anschließend der Kavallerie zugeteilt wurde. Er wurde rasch befördert, 1870 zum Hauptmann, 1872 zum Comandante, 1874 zum Brigadegeneral. 1873 wurde er in der Schlacht von Santa Cruz del Sur schwer am Bein verwundet. Fortan konnte er nur noch mit einer Metallprothese gehen und musste auf seinem Pferd festgebunden werden, wenn er seine Einheit, das Camagüey Kavallerie-Corps, in die Schlacht führte. Am 4. August 1876, nach 400 Gefechten und Schlachten, wurde seine Einheit von den Spaniern aufgerieben. Reeve, mit Schussverletzungen in Brust, Leiste und Schulter und ohne Pferd, das ebenfalls getroffen worden war, erschoss sich mit seiner Pistole.
1870: Hawaii
Nach dem Tod von Königin Kalama landeten US-Truppen, um die amerikanische Flagge auf halbmast zu setzen. Der US-Konsul in Honolulu, der eine Annexion Hawaiis wünschte, hatte sich geweigert, dies zu tun.
1870: Mexiko
US-Kriegsschiffe zerstörten am 17. und 18. Juni das Piratenschiff Forward, das im Río Tecapán vierzig Meilen flussaufwärts auf Grund gelaufen war.
1871: Korea
Ein US-Flottenverband besetzte fünf Forts in Shinmiyangyo, um ins Stocken geratene Verhandlungen über ein Handelsabkommen wieder in Gang zu bringen und die Einheimischen zu bestrafen, weil sie den Schoner General Sherman verbrannt und die Mannschaft exekutiert sowie einige kleinere Schiffe beschossen hatten, die den Salee-Fluss ausloteten. Die Besatzung der General Sherman hatte zuvor Nahrungsmittel gestohlen und einen koreanischen Beamten entführt.
1873: Kolumbien (Bucht von Panama)
Während bürgerkriegsähnlicher Unruhen lokaler Gruppen landeten US-Verbände an der panamaischen Atlantikküste, »um die Kontrolle der Regierung des Staates Panama« zu schützen. So beschreibt die Liste des Kongresses diese Intervention, die zu einem Zeitpunkt stattfand, als Panama eine Provinz Kolumbiens war, der Staat Panama also noch gar nicht existierte. Tatsächlich handelte es sich um einen ersten amerikanischen Versuch, die Provinz von Kolumbien abzuspalten.
1873: Mexiko
Amerikanische Truppen überquerten bei der Verfolgung von Viehdieben mehrfach die Grenze. Die Mexikaner antworteten mit ähnlichen Operationen. In den 70er und 80er Jahren war es eine weitverbreitete Praxis unter amerikanischen Cowboys, Viehherden in Mexiko zu überfallen, die Vaqueros zu ermorden und das Vieh nach Texas zu treiben, um es dort US-Ranchern zu verkaufen. Einer dieser Rancher, Ike Clanton, und seine Cowboys gingen durch die Schießerei am O.K.-Corral in Tombstone 1881 in die Geschichte des »Wilden Westens« ein.
1874–1875: Hawaii
US-Truppen landeten, um amerikanische Bürger und die Krönungsfeierlichkeiten des neuen Königs zu schützen. Anschließend erzwang Washington den sogenannten Reciprocity Treaty, in dem der König von Hawaii Ford Island und Pearl Harbor mit einem vier bis fünf Meilen breiten Uferstreifen kostenfrei den USA überlassen musste.
1875: Samoa
Unstimmigkeiten zwischen zwei Häuptlingsfraktionen um die Thronfolge machte sich ein gewisser Albert Barnes Steinberger zunutze. Der war Büroangestellter aus San Francisco, hatte sich selbst den Rang eines Obersten verliehen und erklärte sich nun als vermeintlicher Beauftragter der US-Regierung kurzerhand zum Premierminister mit unbegrenzten Vollmachten. Das angeblich offizielle Dokument aus Washington, so stellte sich später heraus, waren zwei zusammengeklebte alte Pässe. Er hatte eine Affäre mit einer vermögenden Halb-Samoanerin, Emma Coe, die aus Dankbarkeit den USA Land in Pago Pago überschrieb. Als Steinberger von einer Geschäftsreise nach Deutschland zurückkehrte, ließen ihn der amerikanische und der englische Konsul verhaften und auf die Fidschi-Inseln deportieren.
1875–1877: Montana, South Dakota (ab 1889 US-Bundesstaat)
»Alle Zeiten«, in denen die Sioux laut Fort-Laramie-Vertrag von 1868 (siehe: 1866 South Dakota) in den Black Hills leben und jagen durften, dauerten nur wenige Jahre. 1874 wurde dort Gold gefunden. Nachdem die Sioux 1875 das Angebot der US-Regierung, das Gebiet zu kaufen, abgelehnt hatten, befahl die Regierung die Umsiedlung der Lakota in andere Reservate. In einem groß angelegten Feldzug griffen US-Truppen unter Oberst John Gibbon, General Alfred Terry und General George Crook die Lakota aus verschiedenen Richtungen an. Zunächst verzeichneten die Sioux Erfolge in der Schlacht der Rosenknospe gegen General Crook und eine Woche später in der Schlacht am Little Bighorn, wo sie, angeführt von ihrem Häuptling Crazy Horse, die 7. US-Kavallerie unter Oberst George A. Custer vernichtend schlugen. Als der US-Kongress jedoch die Mittel bereitstellte, um weitere 2500 Mann gegen die Lakota zu mobilisieren, wurden sie in einer Reihe von Gefechten von der US-Armee geschlagen und kapitulierten schließlich, als ihr Volk durch eine Hungersnot erheblich dezimiert worden war. Am 5. September 1877 wurde Häuptling Crazy Horse in Camp Robinson ermordet, womit der Widerstand der Lakota gegen die Weißen erlosch. Sie mussten die Black Hills und die Büffeljagd aufgeben und sich in Reservate begeben, wo sie auf Nahrungsmittelzuteilungen der Regierung angewiesen waren.
1876: Mexiko
Weil die Stadt Matamoros in unmittelbarer Nähe zur texanischen Grenze vorübergehend ohne Lokalregierung war, rückten US-Truppen ein mit der Begründung, »die Ordnung aufrechtzuerhalten«.
1877: Mexiko
US-Präsident Rutherford B. Hayes unterschrieb einen Befehl, der amerikanischen Truppen das Recht einräumte, bei der »Verfolgung flüchtiger Indianer« auf mexikanisches Gebiet vorzudringen.
1882: Ägypten
Während kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen Briten und Ägyptern, in deren Verlauf es in Alexandria zu Plünderungen kam, landeten US-Truppen, um die amerikanischen Interessen zu schützen.
1885: Guatemala
Nach einer Invasion guatemaltekischer Streitkräfte in El Salvador drohte Guatemala, die Kabel der New Yorker Central and South American Telegraph Company zu durchtrennen. Auf Bitten des Firmenpräsidenten, James A. Scrymser, entsandte die US-Regierung die USS Wachusetts zum Schutz amerikanischer Besitztümer in Nicaragua, El Salvador und Guatemala.
1885: Panama
US-Truppen besetzten Colón und Panama-Stadt während einer Revolution, um die Safes und den Besitz der (amerikanischen) Panama Railroad zu schützen.
1887: Hawaii
Die US-Marine erzwang das Recht, einen Stützpunkt in Pearl Harbor zu errichten.
1888: Korea
In Erwartung von Unruhen unter der Bevölkerung rückten US-Verbände in Seoul ein, um amerikanische Einwohner zu schützen.
1888: Hawaii
US-Truppen landeten, um die Freigabe eines amerikanischen Dampfers zu erzwingen, den die königliche Regierung unter dem Vorwurf beschlagnahmt hatte, ein Einlaufverbot verletzt zu haben.
1888–1889: Samoa
US-Truppen landeten, um während eines Bürgerkriegs unter den Eingeborenen amerikanische Interessen und das Konsulat zu schützen.
1887–1892: Hawaii
Dem Innenminister gelang es mit Unterstützung der Honolulu Rifles, einer einheimischen Miliz, die sogenannte Bayonet-Verfassung bei König David Kalakaua durchzusetzen, mit der allen Einwohnern mit Ausnahme reicher Hawaiianer, Europäer und Amerikaner das Wahlrecht entzogen wurde. Die neue Verfassung garantierte mit dem Sieg der Reformpartei bei den Parlamentswahlen am 12. September, dass amerikanische Wirtschaftsinteressen die Regierung kontrollierten.
Daraufhin bereiteten die Schwester des Königs, Prinzessin Lili’uokalani, und Robert William Wilcox, der einst in Italien unter Garibaldi gedient hatte, gemeinsam mit 300 Mitverschwörern einen Staatsstreich vor, um die Prinzessin an die Macht zu bringen. Durch einen Zufall wurden die Putschpläne entdeckt. Wilcox wurde des Landes verwiesen.
1889 kam er auf Wunsch von Lili’uokalani zurück, versammelte rund 150 Hawaiianer, Chinesen und Europäer in der Liberalen Patriotischen Vereinigung und organisierte am 30. Juli eine weitere Rebellion, um König Kalakaua zu zwingen, der alten, demokratischeren Verfassung von 1864 wieder Geltung zu verschaffen. Der König schloss sich ihnen jedoch nicht wie erhofft an, sondern wartete untätig den weiteren Verlauf ab. Die Königliche Garde weigerte sich zu kapitulieren. Schließlich schickte die Reformpartei die Honolulu Rifles unter dem Kommando von Oberst Volney Ashford, einem kanadischen Unternehmer, und machte auch dieser Rebellion ein Ende. Zwei Jahre später, 1891, starb König Kalakaua. Ihm folgte Prinzessin Lili’uokalani auf den Thron.
Frustriert darüber, dass die neue Königin die ungeliebte Bayonet-Verfassung immer noch nicht abgeschafft hatte, organisierte Wilcox 1892 einen weiteren Putschversuch, diesmal mit dem Ziel, die Monarchie abzuschaffen und eine Republik auszurufen. Doch Agenten der Regierung infiltrierten seine Hawaiische Patriotische Liga, weshalb er auch diesen Umsturzversuch abbrechen musste.
1890: Argentinien
US-Seestreitkräfte liefen in Buenos Aires ein, um das Konsulat und die Legation zu schützen.
1890–1891: South Dakota
Auch nach der Kapitulation von 1877 war es immer wieder zu Scharmützeln zwischen kleinen Lakota-Banden und weißen Siedlern gekommen. Ein Jahr nach dem Beitritt South Dakotas zur Union versuchte die Armee, einen rituellen Geistertanz in der Lakota-Reservation am Wounded Knee zu nutzen, um die Sioux ein für alle Mal zu unterwerfen. Am 15. Dezember 1890 wurde der Sioux-Häuptling Sitting Bull im Standing-Rock-Reservat ermordet. In einem Angriff der US-Armee am 29. Dezember 1890 in der Pine Ridge starben 300 Indianer, zumeist alte Männer, Frauen und Kinder. Die 25 Soldaten, die ebenfalls fielen, waren – so vermuten Historiker heute – hauptsächlich Opfer von friendly fire. Zwei Monate zogen sich die Auseinandersetzungen hin, ehe eine amerikanische Übermacht, die beinahe die halbe Infanterie und Kavallerie der US-Streitkräfte einschloss, die überlebenden Lakota zwang, die Waffen niederzulegen und in ihre Reservationen zurückzukehren.
1891: Haiti
US-Truppen schlugen eine Rebellion der einheimischen schwarzen Bevölkerung gegen ihre andauernde Anwesenheit auf Navassa nieder. Gleichzeitig blockierten US-Seestreitkräfte die Küsten Haitis, um die Regierung zu zwingen, den USA die Mole von Saint Nicholas als Marinestützpunkt zu überlassen.
1891: Beringsee
US-Marineverbände versuchten, der illegalen russischen Robbenjagd Einhalt zu gebieten. So heißt es in den offiziellen Verlautbarungen des Außenministeriums. Nicht erwähnt werden die im selben Jahr entdeckten Ölvorkommen im Cook Inlet und an der Beringstraße.
1891: Chile
Eine internationale Flotte, zu der auch das amerikanische Kriegsschiff USS Baltimore gehörte, unterstützte die chilenische Regierung in ihrem Kampf gegen den Aufstand des Parlaments und der Marine im chilenischen Bürgerkrieg. Als die Baltimore die Itata, die Waffen für die Aufständischen in die nördlichen Provinzen bringen wollte, beschlagnahmte, griff am 16. Oktober ein Mob erregter Bürger einige Besatzungsmitglieder der Baltimore vor einer Hafenkneipe an, wo sie gezecht hatten. Bei dem Zwischenfall starben zwei US-Matrosen, 17 weitere wurden verletzt. Nach dem Sieg der Rebellen und dem Selbstmord des chilenischen Präsidenten José Manuel Balmaceda wies die neue Regierung in Santiago die amerikanischen Proteste wegen des Vorfalls zurück. Als Präsident Benjamin Harrison jedoch mit Vergeltungsmaßnahmen drohte, entschuldigte sich Chile und zahlte als Wiedergutmachung 75 000 Dollar in Gold.
1893: Hawaii
Als Königin Lili’uokalani auf Wunsch der überwiegenden Mehrheit ihrer heimischen Untergebenen eine neue Verfassung erarbeiten ließ, welche die verlorene Autorität der Monarchie wiederherstellen und die Einschränkungen im Wahlrecht (siehe: 1887–1892 Hawaii) beseitigen sollte, gründete eine Gruppe von Europäern und Amerikanern ein Committee of Safety, das den Sturz der Königin und den Anschluss an die USA verfolgte. Die einheimischen Hawaiianer machten nur noch ein Drittel der Gesamtbevölkerung aus, Königin Lili’uokalani war selbst mit einem Amerikaner verheiratet. Als das Komitee von einer »Gefahr für amerikanische Leben und Vermögen« berichtete, bezogen auf Anordnung des US-Botschafters John L. Stevens am 16. Januar drei Kompanien von der USS Boston Positionen vor der US-Legation und dem Konsulat. Als sich auch noch die Honolulu Rifles an die Seite der neu ausgerufenen »Provisorischen Regierung von Hawaii« stellten, war das Schicksal der Inselgruppe besiegelt. Lili’uokalani wurde zusammen mit 190 Hawaiianern und Weißen, die mit den Einheimischen sympathisierten, des Hochverrats angeklagt und zu fünf Jahren Schwerarbeit sowie einer Geldstrafe von 5000 Dollar verurteilt. Zwar wurde ihr die Haft erlassen, aber ihr blieb nichts anderes übrig als die Abdankung: »Um jeden Zusammenstoß der Streitkräfte und den möglichen Verlust von Leben zu vermeiden, trete ich unter Protest zurück …, bis die Regierung der Vereinigten Staaten, wenn ihr die Fakten vorgelegt werden, die Handlungen ihrer Repräsentanten rückgängig machen und mich wieder als verfassungsgemäße Herrscherin der Inseln von Hawaii einsetzen werden.«34
Doch Lili’uokalani erhielt ihren Thron nie mehr zurück. Zwar schloss Präsident Grover Cleveland aus den Ergebnissen, zu denen eine Untersuchungskommission gekommen war, dass die USA »den Status wiederherstellen sollten, der vor unserer gewaltsamen Intervention bestand«.35 Der provisorische Präsident Hawaiis, Sanford Dole, lehnte es jedoch ab, die Königin wiedereinzusetzen. Er rief am amerikanischen Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli 1894, die Republik Hawaii aus. Daraufhin untersuchte der außenpolitische Ausschuss des US-Senats die Angelegenheit erneut und kam zu dem Schluss: »Lili’uokalanis Beschwerde, die sie dem Präsidenten der Vereinigten Staaten mit Datum vom 18. Januar 1893 zusandte, ist unserer Meinung nach weder faktisch noch juristisch gut begründet.«36 Dieser Bericht beerdigte alle Hoffnungen der ehemaligen Königin. Fortan unterhielt Cleveland diplomatische Beziehungen mit der Dole-Regierung.
1895 versuchte eine Konterrevolution unter Oberst Robert Nowlein, Pfarrer Joseph Nawahi und Mitgliedern der Königlichen Garden, die Republik wieder abzuschaffen. Die Anführer einschließlich Lili’uokalani wurden gefangen, verurteilt und inhaftiert.
Im März 1897 trat William McKinley die Nachfolge von Grover Cleveland als Präsident an. Er stimmte einer Annexion Hawaiis zu, der Senat jedoch ratifizierte den Vertrag nicht, weil Zweifel an seiner Rechtmäßigkeit bestanden. Daraufhin verfasste der Kongressabgeordnete Francis G. Newlands eine entsprechende Resolution, die vom Repräsentantenhaus wie vom Senat angenommen wurde. Am 7. Juli 1898 wurde Hawaii das Territorium von Hawaii, und am 22. Februar 1900 wurde mit dem Hawaiian Organic Act eine territoriale Regierung eingerichtet. Der US-Präsident ernannte Sanford Dole zum ersten Gouverneur des neuen Gebiets.
1894: Nicaragua
US-Truppen landeten nach einer Revolution in Bluefields, um amerikanische Interessen (vor allem die Holzindustrie) zu schützen. In keinem Land sollten die USA häufiger intervenieren als in Nicaragua.
1894: Brasilien
Nach mehreren Zwischenfällen während des Marineaufstands im Januar 1894, in deren Verlauf amerikanische Handelsschiffe im Hafen von Rio de Janeiro beschossen wurden, warnte US-Admiral Andrew E. K. Benham, der vor Ort drei Kreuzer kommandierte, den Kommandeur der Rebellenflotte, Konteradmiral Saldanha da Gama, der 24 Schiffe zur Verfügung hatte, vor weiteren Interventionen. Am Morgen des 29. Januar geriet der amerikanische Frachter Amy unter Beschuss des Kreuzers Trajano. Die USS Detroit feuerte zurück und beschädigte den Bug der Trajano. Nach einer weiteren Breitseite der Trajano, die die Detroit erneut beantwortete, stellten die Rebellen das Feuer ein. Admiral Saldanha erklärte später, er habe nie Befehl gegeben, das Feuer auf amerikanische Schiffe zu eröffnen.
1894–1895: China
Während des japanisch-chinesischen Kriegs stationierten die USA Militäreinheiten in Tientsin und rückten bis Peking vor. Gleichzeitig strandete die US-Marine ein Kriegsschiff an der Küste von Niuhuang, um es zum Schutz amerikanischer Bürger als Fort zu nutzen.
1894–1896: Korea
Während des Japanisch-Chinesischen Krieges entsandte Washington Marines nach Seoul mit dem Auftrag, amerikanische Bürger und Interessen zu schützen.
1895: Kolumbien
Während des Angriffs eines Banditen auf die Stadt Bocas del Toro in der Provinz Panama trafen siebzig US-Soldaten zum Schutz amerikanischer Interessen ein. Sie blieben nur einen Tag. Tatsächlich intervenierten die USA nahezu bei jeder sich bietenden Gelegenheit in der kolumbianischen Provinz Panama, alleine zwischen 1856 und 1903 offiziell 13 Mal. 1856 im Wassermelonen-Krieg etwa hielten sich 160 Marines vier Tage lang in der Provinz auf, und während der Aizpuru-Revolte blieben 1200 US-Soldaten 57 Tage im Land.
1896: Nicaragua
Während politischer Unruhen schützten US-Marines die amerikanischen Interessen in Corinto.
1898: Nicaragua
US-Marines landeten zum Schutz amerikanischer Bürger und amerikanischen Besitzes in San Juan del Sur.
1898–1901: Kuba, Philippinen (Spanisch-Amerikanischer Krieg)
Etwa gleichzeitig begann in beiden Inselstaaten der Unabhängigkeitskampf gegen die spanische Kolonialherrschaft. Als die kubanischen Revolutionäre kurz vor dem Sieg standen, nutzten die USA die (bis heute ungeklärte) Versenkung der USS Maine im Hafen von Havanna als Vorwand, Spanien den Krieg zu erklären. Durch den Vertrag von Paris (10. Dezember 1898) fiel Puerto Rico an die USA, zugleich verlieh er Kuba eine seltsame Unabhängigkeit unter amerikanischer Besatzung. Zwar erlaubte Washington freie Wahlen, aus denen Tomás Estrada Palma als erster gewählter Präsident des Landes hervorging. Doch das Platt Amendment stellte 1901 sicher, dass die USA Kubas internationale Beziehungen, seine Wirtschaft und innere Angelegenheiten kontrollieren und in der Guantánamo-Bucht »auf alle Ewigkeit« eine Marinebasis einrichten konnten.
1896 hatte der philippinische Bauernsohn und Unabhängigkeitskämpfer Emilio Aguinaldo die spanische Kolonialmacht zu einem Friedensabkommen gezwungen, in dem ihm Spanien die Erfüllung seiner Forderungen zusicherte: die Heimkehr der spanischen Mönche und Rückgabe des von ihnen konfiszierten Landes, gleiche Bezahlung und gleiche Behandlung vor den Gerichten für alle ungeachtet ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Freiheit der Presse und parlamentarische Repräsentation der Einheimischen in der Cortes in Madrid. Im Gegenzug dafür war er dem Verlangen der spanischen Behörden gefolgt und hatte sich freiwillig in die Verbannung begeben. Doch Spanien hatte sich nicht an das Abkommen gehalten, keine der Forderungen Aguinaldos war erfüllt worden, woraufhin die Kämpfe erneut ausbrachen.
Kurz nach Ausbruch des Spanisch-Amerikanischen Krieges in Kuba griffen die USA auch hier, in der anderen Spanien verbliebenen Kolonie, an. Commodore George Dewey versenkte die spanische Flotte im Hafen von Manila. Während Dewey die spanischen Verbände von See her angriff, legten die aufständischen Filipinos unter Führung ihres zurückgekehrten Generals Aguinaldo einen Belagerungsring um die Stadt. Nach drei Monaten kapitulierten die spanischen Verbände. Mit dem Friedensvertrag von Paris, der den »großartigen, kleinen Krieg« beendete, verlor Spanien Kuba, Puerto Rico, die Philippinen und Guam. Doch anstatt den Philippinen die erwartete Unabhängigkeit zu geben, bezahlten die USA der spanischen Krone zwanzig Millionen Dollar und sicherten sich diesen Grundstein eines Imperiums, das sie nun gegen die »Terroristen« verteidigten, die zuvor als willkommene Aufständische an der Seite Deweys gekämpft hatten.
Zwar beschrieben Zeitgenossen Aguinaldo in lobenden Superlativen. »Wir hielten Manila und (die Provinz) Cavite«, schrieb General Anderson, Commander-in-Chief der US-Verbände auf den Philippinen, »den Rest der Insel (Luzon) hielten nicht die Spanier, sondern die Filipinos. Auf den anderen Inseln waren die Spanier in zwei oder drei befestigte Städte zurückgedrängt.« Zwei amerikanische Soldaten kehrten von ihren sechsmonatigen Streifzügen durch Luzon »nur mit den besten Erinnerungen an das ruhige und wohlgeordnete Leben, das die Eingeborenen unter der Regierung (Aguinaldos) führen«, nach Manila zurück. »Wir fühlten uns auf unserer ganzen Reise absolut sicher.« In einer ätzenden Kritik an Washingtons Kolonisierung der vormaligen spanischen Kolonie verglich Mark Twain den Freiheitskämpfer mit George Washington und Jeanne d’Arc: »Keine andere Person der Geschichte, antik oder modern, christlich oder heidnisch, begann so bescheiden und stieg in solche Höhen.«37
Dennoch sahen die Vertreter der US-Staatsmacht in den Filipinos eine unzivilisierte Rasse, außerstande sich selbst zu regieren. »Ich behandelte ihn nie als Alliierten, sondern benutzte ihn und die anderen Eingeborenen bei meinen Operationen gegen die Spanier«, beschrieb Commodore Dewey sein Verhältnis zu dem ehemaligen Verbündeten, der nun zum Feind geworden war. Die Kämpfe, bei denen die USA erstmals weitverbreitet Folter anwandten (besonders populär war das Untertauchen der Opfer in Wassertrögen, das als Waterboarding hundert Jahre später im sogenannten Krieg gegen den Terror von der CIA wieder praktiziert wurde), kosteten »4000 unserer Boys das Leben«, zog ein Historiker 1901 eine erste Bilanz. »Es ist unmöglich, die philippinischen Verluste zu schätzen, aber ein Offizier hat sie auf ein Sechstel der Bevölkerung geschätzt, was über eine Million Gefallene wären.«38
Am 23. März 1901 wurde Aguinaldo in seinem Hauptquartier in Paanan von einer Streitmacht unter General Frederick Funston gefangen genommen. Am 19. April schwor er den USA Treue. Ein Jahr später, als Aguinaldos General Miguel Malvar kapitulierte und Präsident Theodore Roosevelt eine einseitige Amnestie verkündete, wurde der Krieg offiziell für beendet erklärt. Doch vereinzelte Kämpfe in entlegeneren Regionen des philippinischen Archipels hielten bis 1913 an.
Am 4. Juli 1946 entließen die USA ihre südostasiatische Kolonie in eine ähnlich abhängige Unabhängigkeit wie knapp fünfzig Jahre zuvor Kuba. 94-jährig starb Aguinaldo am 6. Februar 1964 in Quezon.
1898: Guam (spanisches Territorium)
Nach ihrem Sieg über Spanien besetzten US-Verbände die Insel und richteten in Apra Harbor einen permanenten Stützpunkt ein.
1898–1900: China
Während eines Konflikts zwischen der Kaiserinwitwe Cixi und ihrem Neffen Guangxu rückten Marines erneut in Peking und Tientsin ein, um die dortigen diplomatischen Vertretungen zu schützen.
1898: Guatemala
Die United Fruit Company verhalf General Manuel Estrada Cabrera zur Macht und erhielt unter dem langjährigen Diktator (1898–1920) weitgehende Vollmachten. Fortan dominierte die Bostoner Obstfirma wie eine Schattenregierung die Entwicklungen in dem mittelamerikanischen Land.
1899: Nicaragua
Während eines Putschversuchs von General Juan P. Reyes übernahmen Marines den Schutz amerikanischer Interessen in San Juan del Norte und in Bluefields.
1899: Samoa
Geradezu absurd klingt die Begründung des US-Außenministeriums für den Einsatz von Truppen auf der Pazifikinsel: »um amerikanische Interessen zu schützen und Einfluss in einem blutigen Konflikt um die Thronfolge zu nehmen«. Später änderten die Forscher des Kongresses die Version der Ereignisse und schrieben vom »Zweiten Bürgerkrieg Samoas«, der aufflammte, weil sich »Deutschland, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten in dem Disput, wer die Kontrolle über die Inseln haben sollte, nicht einigen konnten«.39 In einem der häufigen Dispute um die Thronfolge unterstützten die anwesenden Briten und Amerikaner den Hohen Häuptling Malietoa, während sich die Deutschen für den Hohen Häuptling Tamesese einsetzten. Keiner der beiden Häuptlinge wurde König. Nutznießer des Konflikts um den Thron waren vielmehr die Europäer und Amerikaner: Samoa war ein weiteres »monumentales Beispiel für engstirnige und internationale Dummheit«.40 Am Ende teilten sich Berlin und Washington die Inseln, ohne die Einwohner Samoas auch nur zu fragen. Im Tausch für weite Teile der Solomonen verzichtete Großbritannien auf Ansprüche in Samoa und überließ dem deutschen Kaiserreich neun Inseln Westsamoas. Die USA annektierten die sechs Inseln des östlichen Teils Samoas.
1900: China
Zwei Jahre lang ging eine äußerst nationalistische, ausländerfeindliche und antichristliche Bewegung, die Miliz der Vereinigten Rechtschaffenheit (Yihetuan) in Shandong und der nordchinesischen Ebene, gewaltsam gegen die »ausländischen Teufel« vor. Nach anfänglichen Erfolgen waren die »Boxer«, wie sie von den Ausländern genannt wurden, Mitte 1900 überzeugt, unverwundbar zu sein, und marschierten mit dem Schlachtruf »Alles für die Qing (Name der herrschenden Manchu-Dynastie), nieder mit den Ausländern« nach Peking. Am 21. Juni erklärte die Kaiserinwitwe Cixi den ausländischen Mächten den Krieg. 55 Tage lang belagerten die kaiserlichen Truppen das Botschaftsviertel.
Schließlich landete die Acht-Nationen-Allianz (Japan, Russland, USA, UK, Frankreich, Deutschland, Österreich-Ungarn, Italien) mit 20 000 Mann unter dem Kommando des Feldmarschalls Alfred Graf von Waldersee in der Hafenstadt Tianjin. Das Expeditionskorps besiegte die kaiserliche Armee, nahm am 14. August Peking ein, plünderte und verwüstete anschließend die Stadt und ihre Umgebung und führte summarische Massenhinrichtungen durch. Über einhundert führende Mitglieder der Regierung und der Boxermilizen wurden hingerichtet, zahlreiche weitere nahmen sich selbst das Leben, Prinz Tuan und sein Bruder wurden nach Turkestan in die Verbannung geschickt. Zwar hatte US-Außenminister John Hay noch während der Kämpfe den Alliierten in einem Rundschreiben klargemacht, dass Chinas territoriale Integrität unangetastet bleiben solle und darum keine Reparationsforderungen gestellt werden sollten, die das Land in den Bankrott trieben. Irritiert merkte von Waldersee an, die USA »scheinen zu wünschen, dass niemand etwas aus China rausbekommen soll«.41 In dem sogenannten Boxer-Protokoll vom 7. September 1901 einigte man sich dann doch auf die höchste der vorgeschlagenen Summen: China sollte, verteilt auf 39 Jahre, 67 500 000 Pfund Sterling(4 355 000 000 Dollar nach heutigem Wert) und Unterkünfte für die Besatzungstruppen bereitstellen.
1901: Kolumbien
Um amerikanischen Besitz während revolutionärer Unruhen auf dem Isthmus zu schützen und die Bahn- und Kommunikationsverbindungen offen zu halten, landeten US-Truppen erneut in Panama.
1902: Kolumbien
Um amerikanische Bürger und amerikanischen Besitz zu schützen, trafen US-Truppen während eines Bürgerkriegs in Bocas del Toro in der Provinz Panama ein. Gleichzeitig begleiteten amerikanische Wachsoldaten die Züge der Panama Railroad. Zudem stationierten die USA Flottenverbände an beiden Küsten Panamas, um eine mögliche Landung kolumbianischer Truppen zu verhindern.
1903: Honduras
Während einer Revolution besetzten US-Marines Puerto Cortéz und sicherten das dortige US-Konsulat und die Hafenanlagen, die besonders für die amerikanischen Bananenpflanzer von Bedeutung waren.
1903: Dominikanische Republik
Beim Ausbruch einer Revolution landeten US-Truppen zum Schutz amerikanischer Interessen in der Hauptstadt Santo Domingo.
1903: Syrien
In Befürchtung eines bevorstehenden Aufstandes einheimischer Muslime, der allerdings nie stattfand, entsandte Washington zum Schutz seines dortigen Konsulats Marines nach Beirut.
1903–1904: Abessinien
Als der US-Generalkonsul in Addis Abeba einen Vertrag aushandelte, wurde er von 25 Marines begleitet, um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen.
1903: Kolumbien
US-Truppen besetzten die Provinz Panama »während und nach den Kämpfen um die Unabhängigkeit von Kolumbien, um amerikanische Interessen und amerikanische Bürger zu beschützen«.42 Tatsächlich hatten die USA die Abspaltung der Provinz betrieben, weil sich Kolumbien beharrlich weigerte, der amerikanischen Kanalbaugesellschaft die Erlaubnis zum Bau eines Kanals durch Panama zu erteilen. Die Notwendigkeit eines Kanals hatte sich 1898 während des Amerikanisch-Spanischen Krieges besonders deutlich gezeigt, als US-Kriegsschiffe 13 000 Seemeilen rund um Südamerika segeln mussten, um Kuba zu erreichen. Ein Kanal hätte die Strecke auf 4600 Meilen verkürzt. Also bestach Washington einen kolumbianischen General, zu putschen und eine neue Republik auszurufen. Um eine mögliche Landung von kolumbianischen Streitkräften in Panama zu verhindern, patrouillierten zehn US-Kriegsschiffe vor den Küsten der Provinz. Der Putsch dauerte exakt vier Tage, drei Tage davon beanspruchten die Verhandlungen über die Höhe der Bezahlung des Generals. Ein Direktor der amerikanischen Panama-Kanal-Gesellschaft sowie der französische Ingenieur Philippe Bunau-Varilla riefen am 3. November 1903 die unabhängige Republik Panama aus. 15 Tage später unterzeichneten US-Außenminister John Hay und Bunau-Varilla (als Botschafter der neuen Regierung Panamas in Washington) den Hay-Bunau-Varilla-Vertrag, der den USA auf alle Zeiten die exklusive Nutzung, Besetzung und Kontrolle der Kanalzone (eines 16 km breiten Streifens entlang des Kanals) einräumte. In der Kanalzone richteten die USA die berüchtigte Escuela de las Americas ein, an der im Laufe der folgenden achtzig Jahre Tausende lateinamerikanischer Offiziere ausgebildet wurden, weshalb sie im Volksmund »Escuela de los golpes« (Staatsstreichschule) genannt wurde.
Politische und wirtschaftliche Unruhen führten zu zahlreichen weiteren amerikanischen Militärinterventionen in Panama. 1977 nahm die Regierung Jimmy Carters Verhandlungen auf, die zur Übergabe des Kanals an Panama führten. Am 31. Dezember 1999 ging der Kanal endgültig in den Besitz Panamas über, wobei sich die USA allerdings vertraglich das Recht vorbehielten, weiterhin für die Sicherheit des Kanals zuständig zu sein.
1904: Dominikanische Republik
Aufständische in Santo Domingo beschossen den US-Dampfer New York. Daraufhin vertrieben 300 Marinesoldaten vom Kreuzer Newark die Rebellen. US-Truppen landeten während dieser revolutionären Unruhen auch in Puerto Plata und Sosua, um amerikanische Interessen zu schützen. Gleichzeitig entsandte Präsident Theodore Roosevelt Zollbeamte, um die Finanzen des Landes zu übernehmen und sicherzustellen, dass dessen Auslandsschulden vor allem in Europa in Höhe von 32 Millionen Dollar bezahlt wurden. Die USA würden in Ausübung internationaler Polizeigewalt in der westlichen Hemisphäre für Ordnung sorgen, wann immer das notwendig werden sollte, versprach Roosevelt.
1904: Marokko
Mit der Forderung »Wir wollen entweder Perdicaris lebend oder Raisuli tot«43 kreuzte die amerikanische Mittelmeerflotte in einer Machtdemonstration vor Tanger, um die Freilassung des – angeblich – amerikanischen Marinesoldaten Ion Perdicaris zu erzwingen, der von dem Berber-Rebellen Ahmed ben Mohammed el-Raisuli als Geisel entführt worden war.
1904: Panama
Angesichts eines drohenden Aufstandes verstärkten die USA ihre Militärpräsenz.
1904–1905: Korea
Während des Japanisch-Russischen Krieges entsandte Washington Marines, um seine diplomatische Vertretung in Seoul zu schützen.
1905: Dominikanische Republik
Um während politischer Unruhen amerikanischen Besitz zu sichern, schickten die USA erneut Truppen.
1905: Mexiko
US-Marines halfen dem Diktator Porfirio Diáz, einen Streik von Arbeitern in einer Mine in Sonora niederzuschlagen, die von einer amerikanischen Bergbaugesellschaft ausgebeutet wurde.
1906: Guatemala
Organisiert von dem im mexikanischen Exil lebenden Ex-Präsidenten Manuel Barillas kam es zu einem Aufstand gegen die Regierung Manuel Estrada Cabreras, der von den Regierungen der meisten anderen mittelamerikanischen Staaten unterstützt wurde. Mit Hilfe des mexikanischen Präsidenten Porfirio Díaz und seines amerikanischen Amtskollegen Theodore Roosevelt gelang es Estrada jedoch, die zentralamerikanische Krise beizulegen und den Aufstand niederzuschlagen. Im März des Folgejahres wurde Barillas auf Anordnung Estradas in Mexiko-Stadt erstochen.
1906–1909: Kuba
Amerikanische Militärintervention, um nach revolutionären Unruhen die Ordnung wiederherzustellen, Ausländer zu beschützen und eine stabile Regierung einzusetzen.
1907: Honduras
Unterstützt von Elementen der nicaraguanischen Armee marschierte im Februar eine Armee von Exilhonduranern in ihrem Heimatland ein, um den Diktator Manuel Bonilla zu stürzen, und bildete eine provisorische Regierungsjunta. Trotz massiver militärischer Unterstützung durch El Salvador erlitten Bonillas Truppen im März eine entscheidende Niederlage. Als nicaraguanische Verbände in Honduras einmarschierten, landeten die USA, die befürchteten, Nicaraguas Präsident José Santos Zelaya López wolle die ganze Region dominieren, Marines in Puerto Cortés an, um die Plantagen der nordamerikanischen Bananenfirmen zu schützen. Gleichzeitig verhinderten US-Marineverbände den nicaraguanischen Angriff auf Bonillas letzte Stellung in Amapala im Golf von Fonseca. Mit Bonillas Flucht auf die USS Chicago waren die Kämpfe beendet. Der amerikanische Marinekommandeur vermittelte einen fragilen Frieden, der in Tegucigalpa General Miguel Dávila an die Macht brachte, mit dem niemand glücklich war. Zelayas Plan, gemeinsam mit El Salvador Dávila zu stürzen, wurde durch die Anwesenheit der US-Marineverbände und die Stationierung amerikanischer Truppen in den honduranischen Städten Trujillo, La Ceiba, Puerto Cortés, San Pedro Sula, Laguna und Cholima sowie in den wichtigsten nicaraguanischen Städten (Masaya, Leon, Managua, Bluefields, Puerto Cabezas, Matagalpa) verhindert.
1907: Mexiko
Washington entsandte Truppen, um einen Streik in den in amerikanischem Besitz befindlichen Kupferminen von Cananea blutig niederzuschlagen.
1908: Panama
US-Marines intervenierten, als während des ersten Wahlkampfes seit der Trennung Panamas von Kolumbien Unruhen ausbrachen. So zumindest stellt es die Liste des US-Kongresses dar. Tatsächlich hatten US-Kriegsminister William Howard Taft und der Gouverneur der Kanalzone den Präsidenten Panamas gezwungen, einer US-Kommission zu erlauben, die bevorstehenden Wahlen zu überwachen. Diese Kommission zwang den aussichtsreichen Präsidentschaftskandidaten Ricardo Arias, den Washington keinesfalls wollte, zur Aufgabe seiner Kandidatur. Es kam zu Unruhen. Die Arias-Anhänger blieben schließlich den Wahlen fern, was den Sieg des von den USA favorisierten Kandidaten José Domingo de Obaldía erleichterte. Taft hatte angedeutet, Präsident »Teddy« Roosevelt habe ihn zu der Warnung ermächtigt, die USA sähen jeden Versuch, einen Nachfolger durch gefälschte Wahlen ins Amt zu bringen, als Störung der öffentlichen Ordnung an, die laut der panamaischen Verfassung eine Intervention notwendig mache. Washington werde es nicht zulassen, dass Panama unter die Kontrolle irgendjemandes komme, der auf diese Weise gewählt worden sei.
»Mit anderen Worten: Wenn ein Kandidat gewählt wurde, den die USA ablehnten, waren die Wahlen gefälscht und erforderten Intervention. Die Wahlen galten nur dann als fair und demokratisch, wenn Washingtons Favorit gewann«44, urteilte Jahrzehnte später die regierungsunabhängige Organisation North American Congress on Latin America.
1910: Nicaragua
US-Marines sollten »während eines Bürgerkrieges die Vorgänge in Corinto in Erfahrung bringen und in Bluefields amerikanische Interessen schützen«45. Die Interessen bestanden in der La Luz and Los Angeles Mining Company, deren Anwalt Philander Knox gewesen war, ehe er US-Außenminister wurde. Die Bestrebungen des liberalen Präsidenten José Santos Zelaya, amerikanische Bergwerksunternehmen und Obstfirmen der Steuerpflicht zu unterstellen, die von ihm betriebene Verstaatlichung kirchlicher Ländereien sowie seine Geschäftsbeziehungen mit europäischen Firmen missfielen den USA. Als er nicht nur Washingtons Wunsch, einen interozeanischen Kanal durch das Land zu bauen, ablehnte, sondern stattdessen Japan anbot, einen solchen Kanal zu bauen, orchestrierten die USA seinen Sturz. Als in den folgenden Unruhen zwei US-Söldner, die Flüsse und Häfen vermint hatten, hingerichtet wurden, landeten US-Marines in Bluefields und erzwangen Zelayas Rücktritt. Die USA machten den Hauptbuchhalter der Bergbaufirma, Adolfo Díaz, zum Präsidenten, für den sie 1912 erneut intervenierten. Fortan blieben hundert US-Marines im Land, um die Wahlsiege konservativer Präsidenten zu sichern.
1910: Honduras
Als Präsident Miguel Dávila die Pacht von einem Dollar pro Monat und Acre, die Sam Zemurrays Cuyamel Fruit Company bezahlte, erhöhen wollte, rekrutierte »Sam, the Banana Man«, wie er genannt wurde, eine Bande von Söldnern unter dem Kommando von General Lee Christmas. Nachdem die honduranische Armee von vor der Küste liegenden US-Kriegsschiffen nachdrücklich aufgefordert worden war, keinen Widerstand zu leisten, nahm die Bande kampflos den Hafen von Trujillo ein. Der wenig kooperative Präsident Dávila wurde durch seinen Vorgänger Manuel Bonilla ersetz. Der hatte sich ausländischen Investoren gegenüber als freundlicher erwiesen und unter anderem Zemurray zuvor geschrieben: »Ich werde Sie reich machen, Ihnen Land und Macht geben, haben wir erst einmal die Hauptstadt.«46
Während Lee Christmas mit seiner perlenverzierten Pistole und den zahlreichen Uhren am Arm zum Oberkommandierenden der honduranischen Streitkräfte avancierte, wurde Zemurray tatsächlich reich. Cuyamel Fruit übernahm alles Land, das es bebauen konnte, ohne 25 Jahre lang auch nur einen Cent Pachtzins zu bezahlen. »In Honduras ist ein Senator billiger als ein Maultier«, behauptete Zemurray fortan. 1910 lag die Hälfte der Bananenproduktion in Honduras noch in Händen einheimischer Kleinbauern. Doch mit einem unterwürfigen Präsidenten Bonilla und einem Armeechef Christmas war es kein Problem, diese Bauern zu enteignen. Christmas’ rechte Hand, der sich den Spitznamen Maschinengewehr-Maloney erworben hatte, trieb die Bauern mit vorgehaltener Waffe wie Vieh zusammen und brachte sie auf die Cuyamel-Pflanzungen, wo sie fortan für einen Hungerlohn arbeiten mussten. Auf diese Weise eignete sich die Tela Railroad Company, so der neue Name der Cuyamel, unter dem sie später von der United Fruit Company (im Ausland bekannt als United Brands) übernommen wurde, bis 1946 nicht weniger als 410 000 Acres an, von denen allerdings nur 82 000 tatsächlich landwirtschaftlich genutzt wurden.
1910–1920: Mexiko
Seit 1871 regierte Porfirio Díaz, der einst an der Seite von Präsident Benito Juárez gegen Kaiser Maximilian und die französischen Besatzungstruppen gekämpft und sich dann gegen seinen Präsidenten gewandt hatte. Lange Jahre räumte er den USA und amerikanischen Firmen mehr Rechte in seinem Land ein als jede andere mexikanische Regierung vor und nach ihm, womit er sich die Gunst Washingtons sichern konnte. Doch langsam breitete sich dort und unter den amerikanischen Investoren Unzufriedenheit aus – nicht weil er alle Freiheiten unterdrückte und die Bevölkerung unter seinem korrupten Regime im Elend lebte, sondern weil er sehr zum Ärger von Standard Oil bedeutende Ölkonzessionen an die britische Firma Pearson & Son vergeben, den ausgelaufenen Pachtvertrag mit der US-Navy über die Magdalenabucht in Baja California nicht erneuert, die finanziellen Verbindungen mit Europa gestärkt und schließlich auch noch Nicaraguas von den USA gestürzten Präsidenten José Santos Zelaya (siehe: 1910 Nicaragua) in einem Kanonenboot ins sichere Exil nach Mexiko gebracht hatte.47
Vor den Wahlen am 8. Juli 1910 schaltete Porfirio Díaz die Opposition aus, ließ seinen Hauptwidersacher Francisco Ignacio Madero González zusammen mit etlichen von dessen rund 60 000 Anhängern verhaften und erklärte sich zum Wahlsieger. Gegen den Wahlbetrug rebellierten Emiliano Zapata im Bundesstaat Morelos, Francisco »Pancho« Villa mit seiner División del Norte in Chihuahua sowie nach seiner Befreiung Madero und zwangen Díaz aus dem Amt ins europäische Exil. Im November 1911 wurde Madero Präsident.
Zwar war Madero, Absolvent der École des Haute Études Commerciales in Frankreich sowie eines agrarwissenschaftlichen Studiums an der Universität in Berkeley, Zeitungsherausgeber, Autor einer Reihe von Büchern über den Zustand Mexikos und Sohn einer der reichsten Familien des Landes, weit moderater als seine Mitstreiter Zapata und Villa, die er gelegentlich sogar bekämpfte. Doch seine Reformen in der Arbeitsgesetzgebung, in der Behandlung der Yaqui, die unter Díaz brutalen Repressionen ausgesetzt gewesen waren, weil sie amerikanischen Bergwerksinteressen im Wege gestanden hatten, die Rückführung der entwurzelten Indianer in ihre heimatlichen Siedlungsgebiete und die Wiederherstellung ihrer früheren Besitzverhältnisse, die Mexikanisierung der überwiegend mit amerikanischem Personal betriebenen Eisenbahn und vor allem seine neuen Steuergesetze für ausländische Ölgesellschaften brachten ihn bald auf Kollisionskurs mit den USA. Er missfiel Washington alsbald noch mehr als der exilierte Ex-Präsident.
Angespornt und geführt vom amerikanischen Botschafter Henry Lane Wilson bereitete der Oberkommandierende der Streitkräfte, General Victoriano Huerta, seinen Sturz vor, während US-Kriegsschiffe in den Häfen von Veracruz, Tampico, Acapulco und Mazatlán festmachten, »um zu beobachten und zu berichten«. Zehn Tage lang, die »tragischen zehn Tage«, als die sie in die Geschichte Mexikos eingegangen sind, lagen sich die revoltierenden Truppen unter General Félix Díaz, die sich in La Ciudadela (einer ehemaligen Tabakfabrik, die später als Kaserne und Gefängnis diente und heute die Biblioteca de México beherbergt) verschanzt hatten, und die loyalen Regierungsverbände unter ihrem Oberkommandierenden untätig gegenüber. Dann vermittelte Botschafter Wilson zwischen den beiden Generälen, bis sie schließlich in der US-Botschaft den sogenannten Pacto de la Embajada (Botschaftsvertrag) unterzeichneten, in dem Maderos Abschiebung ins Exil und Huertas Machtübernahme beschlossen wurden.
Einen Tag nach Unterzeichnung des Abkommens in der amerikanischen Botschaft, am 18. Februar 1913, zwang Huerta Madero zum Rücktritt und übernahm selber die Präsidentschaft. Vier Tage später wurde Madero im Alter von 39 Jahren hingerichtet. Huertas Machtergreifung stieß auf erbitterten Widerstand. Im Nordwesten des Landes formierten sich Truppen unter dem Befehl des Generals Álvaro Obregón, im Norden sammelte sich Pancho Villas División del Norte mit ihrer legendären Kavallerie, die als eine der besten der Welt galt, und den Süden kontrollierte die Bauernarmee Emiliano Zapatas. Auch der von Madero eingesetzte Gouverneur des Bundesstaates Coahuila, Venustiano Carranza, manipulierte und manövrierte und sammelte ebenfalls eine Armee. Alle mit Ausnahme Zapatas waren Großgrundbesitzer. Zunächst marschierten sie noch gemeinsam und machten Carranza zum primer jefe, zum ersten Boss. Doch es gelang ihnen nicht, ihre unterschiedlichen Ziele und Auffassungen zu vereinen, und so bekämpften sie sich bald gegenseitig. »Wo immer Carranza hinging, hemmten Uneinigkeit, Zögerlichkeit und Langsamkeit die Revolution«48, kritisierte ihn damals der Philosoph, Schriftsteller und spätere Bildungsminister José Vasconcelos. Nur solange sie ihm nützlich waren, hofierte Carranza Villa und sogar Zapata, dessen Bauern er wie schon Porfirio Díaz und Huerta vor ihm als »blutdürstige Barbaren« schmähte. Der Bruch war unvermeidbar.
Im Machtkampf um die Präsidentschaft konnte Carranza mit der Hilfe Obregóns, der Villa in den Schlachten von Torreón, Celaya und León besiegte, den härtesten Konkurrenten ausschalten. Villa konnte sich von den verheerenden Niederlagen nie wieder erholen. 1917 wurde Carranza zum Präsidenten gewählt. Und die USA schwankten, wem sie ihre Unterstützung geben sollten. Villa hatten sie fallen gelassen, nachdem er 1916 das Grenzstädtchen Columbus überfallen hatte, um Waffen zu besorgen. Also wandten sie sich Carranza zu, wenngleich ihm ebenfalls nicht zu trauen war, weil er – wie schon sein Vorgänger Huerta – gerne den Einflüsterungen deutscher Gesandter und Agenten lauschte.
Als Nächster zog sich Emiliano Zapata den Zorn des primer jefe zu. Zunächst hatte der Bauernführer Obregón angeboten, eine gemeinsame Allianz gegen Carranza einzugehen. Dann hatte er in einem »offenen Brief« heftige Klage gegen den Präsidenten geführt. Die Banken seien geplündert, das Land überflutet von wertlosem Papiergeld, Bergbau und Landwirtschaft lägen infolge von erzwungenen Abgaben brach, die Armen vegetierten im Elend dahin, Gewerkschaften seien durch politische Eingriffe zur Bedeutungslosigkeit verurteilt. Das Land wurde nicht an besitzlose Bauern verteilt, wofür Zapata hauptsächlich kämpfte. »Die alten Latifundisten sind von modernen Grundbesitzern mit Epauletten und Pistolen im Gürtel ersetzt worden.«49 Carranza befahl, den Aufrührer gefangen zu nehmen oder zu töten. Ein Verräter und ein Oberst lockten Zapata in eine Falle und brachten ihn um. Den Oberst erhob Carranza in den Generalsrang.
1920 begannen sich die alten Revolutionsveteranen, die noch übrig waren, zur Wehr zu setzen, und rückten gegen die Hauptstadt vor. Von allen verlassen, sogar von seinem Schwiegersohn, wurde der einstige Erste Boss am 21. Mai 1920 sozusagen »auf der Flucht erschossen«. Carranza hatte keines der Ziele der Revolution verwirklicht. Die liberale Verfassung von 1917 war »ein totes Dokument« geblieben. Es gab keinen kostenlosen Schulunterricht, keine Pressefreiheit, die Gewerkschaften wurden von Generälen und Gouverneuren kontrolliert. Das einzige Vermächtnis, das Carranza hinterließ und dessentwegen er immer noch in Mexiko verehrt wird, waren ein paar Sätze in seiner Jahresansprache an den mexikanischen Kongress am 1. September 1919: Er werde die Monroe-Doktrin nicht anerkennen, »weil sie gegen den Willen der Völker Amerikas eine Regelung begründet, zu der sie nicht befragt wurden … Diese Doktrin greift die Souveränität und Unabhängigkeit Mexikos an und würde allen Nationen Amerikas die Vormundschaft (der USA) aufzwingen.«50
1911: China
Während der chinesischen Revolution gegen das Feudalsystem und die Qing-Dynastie führten die USA mehrere Militäroperationen durch: in Wuchang zur Rettung von Missionaren, in Hankow zum Schutz amerikanischer Einrichtungen und Interessen, in Schanghai zum Schutz der Telegraphenstationen sowie in Nanking, Chinkiang, Taku und anderen Orten. Die USA stationierten 5000 Soldaten in den Städten, während 44 ihrer Kriegsschiffe vor den Küsten patrouillierten.
1912: Honduras
Auf Wunsch der Tela Railroad landete eine kleine US-Streitmacht in Puerto Cortés, um die geplante Verstaatlichung der in amerikanischem Besitz befindlichen Eisenbahn zu verhindern. Die Truppen wurden abgezogen, weil die US-Regierung die Aktion verurteilt hatte.
1912: Kuba
US-Verbände schlugen einen Streik auf den amerikanischen Zuckerrohrplantagen in der Provincia del Oriente nieder und lieferten sich in Havanna heftige Gefechte mit Unabhängigkeitskämpfern.
1912: China
US-Truppen landeten während der anhaltenden revolutionären Kämpfe auf Kentucky Island vor der Halbinsel Shandong sowie in Camp Nicholson, um amerikanische Bürger und Interessen zu schützen.
1912: Türkei
US-Truppen übernahmen während des Ersten Balkankrieges den Schutz der amerikanischen Legation in Konstantinopel.
1912: Panama
Präsident José Domingo de Obaldía war noch während seiner Amtszeit gestorben (1910), seine Nachfolge trat Vizepräsident Carlos Antonio Mendoza an. Da dessen Ernennung aber dem Interesse der USA an der Kanalzone zuwiderlief, musste er auf deren Druck schon nach wenigen Monaten wieder zurücktreten. Also führte für die nächsten beiden Jahre bis zu den Wahlen ein anderer Vizepräsident, Pablo Arosemena Alba, die Amtsgeschäfte. Die Wahlen 1912 gewann endlich Belisario Porras Barahona, der erst nach der Abspaltung Panamas von Kolumbien (1903) aus dem Exil in Costa Rica zurückgekehrt und als ehemaliger Unabhängigkeitskämpfer sowohl in den USA als auch in der Bevölkerung Zentral-Panamas äußerst beliebt war. Er war so beliebt, dass er zweimal wiedergewählt wurde. Die US-Botschaft in Panama-Stadt hatte sogar mit der militärischen Besetzung und Annexion des Landes gedroht, sollte nicht der Kandidat Washingtons die Wahlen gewinnen.
1912–1925: Nicaragua
Angesichts revolutionärer Unruhen besetzten US-Marines das Land und veranstalteten Wahlen, in denen die 4000 Wahlberechtigten des Landes den einzigen Kandidaten, Adolfo Díaz (siehe: 1910 Nicaragua), wählen durften. 1914 setzten die USA den berüchtigten Bryan-Chamorro-Vertrag durch, der ihnen exklusive Kanalrechte in Nicaragua einräumte, um zu verhindern, dass ein anderes Land dort einen mit Panama konkurrierenden Kanal bauen könnte. (Der derzeitige Präsident, Daniel Ortega, war der Erste, der es wagte, gegen dieses Abkommen zu verstoßen, als er der VR China die Rechte zum Bau eines Kanals durch das Land übertrug.) Zur Unterstützung stabiler konservativer Regierungen blieben Truppen und Berater. Wie schon in den Anmerkungen zur Intervention im Jahre 1910 schrieb der Congressional Research Service auch diesmal: »Eine kleine Streitmacht blieb bis zum 5. August 1925 als Wache der amerikanischen Legation und versuchte, Frieden und Stabilität zu fördern.«
1912–1941: China
Während der Guomindang-Revolution, dem Erstarken der kommunistischen Bewegung unter Mao Zedong und des japanischen Vordringens in China stationierten die USA Truppen an zahlreichen Orten, die Tschiang Kai Scheks Guomindang-Verbände mit Militärberatern, Material und Finanzhilfen unterstützten. 1927 hatten die USA 5670 Soldaten und 44 Schiffe in China und Chinas Gewässern stationiert. 1933 waren es immer noch 3027 Mann. Im Allgemeinen berief sich Washington dabei auf jene Ungleichen Verträge, die China und die westlichen Mächte zwischen 1858 und 1901 abgeschlossen hatten.
1914: Dominikanische Republik
Um Wahlen durchzusetzen, nahmen Marine-Verbände der USA von See aus die Revolutionäre unter Feuer, die im Begriff waren, die Hauptstadt Santo Domingo und den Hafen Puerto Plata einzunehmen. Die Flotte erzwang unter Androhung von Gewalt, dass Santo Domingo eine neutrale Zone blieb.
1915–1917: Mexiko (Tampico-Zwischenfall)
Unter fadenscheinigen Begründungen und ohne Kriegserklärung ließ Präsident Woodrow Wilson Veracruz besetzen. Deutsche Agenten hatten versucht, Mexiko zu einem Kriegseintritt an der Seite des Deutschen Reichs zu bewegen, und Kriegsmaterial (200 Maschinengewehre, 16,8 Millionen Patronen sowie 8327 Rollen Stacheldraht) nach Veracruz geschickt.51 Nach einem Angriff des mexikanischen Revolutionsführers Pancho Villa 1916 auf das Grenzstädtchen Columbus in New Mexico (»Ich bin sicher, dass Villas Angriffe made in Germany sind«, kabelte US-Botschafter James Gerard aus Berlin52) setzte Wilson ein 6600 Mann starkes Expeditionskorps unter General John »Black Jack« Pershing mit dem Befehl in Marsch, den »Banditen« zu fangen und vor ein amerikanisches Gericht zu bringen. Doch Villas Popularität und Kenntnis des Terrains sowie Pershings Unbeliebtheit in Mexiko zwangen die Verfolger nach elf Monaten erfolgloser Suche zur Rückkehr.
1915–1934: Haiti
1825 hatte Frankreich Haiti gezwungen, jährliche Zahlungen zu leisten als Kompensation für die Profite, die den einstigen Plantagenbesitzern und Sklavenhaltern entgingen, weil sich die Sklaven befreit hatten. Im Gegenzug hoben Frankreich, England und die USA das Embargo auf, das sie seit 1804 über die Republik verhängt hatten, und erklärte sich Paris bereit, Haiti als unabhängigen Staat anzuerkennen. (Die USA erkannten Haitis Unabhängigkeit erst 1862 an, nachdem sich die Südstaaten von der Union getrennt hatten.) Auf 150 Millionen Goldfrancs bezifferten die französischen Buchhalter den Verlust, die alle Wertgegenstände auflisteten, die den einstigen Kolonialisten und dem französischen Staat durch die Revolution verloren gegangen waren. (Gezählt wurden neben immobilen Werten auch die Bevölkerung einschließlich der Regierungsmitglieder, die 21 Jahre zuvor als Sklaven ja ebenfalls einen monetären Wert dargestellt hatten.) Während des gesamten 19. Jahrhunderts musste die haitianische Regierung darum immer wieder Kredite zu weit überhöhten Zinssätzen in Frankreich aufnehmen. Diese Zahlungen fraßen regelmäßig siebzig Prozent aller Deviseneinnahmen des Inselstaates auf. Wenn schlechtes Wetter die Kaffee- oder die Zuckerernte verhagelte, musste Haiti in Frankreich Kredite zum doppelten des üblichen Zinssatzes aufnehmen, um seine Zahlungen auch weiterhin leisten zu können.
Zwischen 1911 und 1915 regierten in Haiti nicht weniger als sechs Präsidenten, die alle entweder ermordet oder ins Exil vertrieben wurden. Um den unverhältnismäßig starken Einfluss der 200 deutschstämmigen Geschäftsleute auf Haitis Wirtschaft (sie kontrollierten achtzig Prozent des internationalen Handels des Landes; zudem befürchteten die USA, das Deutsche Reich könnte einen Flottenstützpunkt in Haiti errichten) zu begrenzen, unterstützte das US-Außenministerium ein Konsortium amerikanischer Investoren bei der Übernahme der Banque Nationale d’Haiti, der einzigen Handelsbank des Landes und gleichzeitig Haitis Finanzbehörde.
Im März 1915 reagierte Washington auf Klagen amerikanischer Banken, bei denen Haiti tief verschuldet war, besetzte das Land, machte es zu einem De-facto-Protektorat der USA und schrieb ihm 1917 eine neue Verfassung. (Franklin D. Roosevelt, damals stellvertretender Marineminister in Woodrow Wilsons Regierung, betonte später gerne, er persönlich habe die neue Verfassung geschrieben.) Diese Konstitution schaffte das Verbot fremden Landbesitzes ab – eine der Schlüsselkomponenten des haitianischen Rechts, das sofort nach dem Ende der Unabhängigkeitskämpfe 1804 eingeführt worden war. Als die neu und unter US-Aufsicht gewählte Nationalversammlung dieses Dokument ablehnte und eine eigene Verfassung schrieb, die dieses Verbot wieder enthielt, wurde sie vom amerikanischen Kommandeur der haitianischen Gendarmerie, General Smedley Darlington Butler, aufgelöst. Die von den USA geschriebene Verfassung wurde 1919 durch ein Plebiszit angenommen, an dem sich weniger als fünf Prozent der Wahlberechtigten beteiligten. Dennoch bestätigte das State Department die Rechtmäßigkeit des Plebiszits mit dem Hinweis, dass »die Leute, die abstimmten, ohnehin zu 97 Prozent Analphabeten waren und in den meisten Fällen nicht verstanden, worüber sie abstimmten«.53
Nun kontrollierte eine US-Verwaltung die Finanzen und die Politik der Inselrepublik und baute einen Marinestützpunkt, um die Seewege zum Panamakanal besser schützen zu können. Haitis Präsident wurde der Zutritt zum amerikanischen Offiziersclub in Port-au-Prince untersagt, weil er ein »französisch sprechender Nigger« war, wie US-Außenminister William Jennings Bryan die Haitianer zu nennen pflegte. Unter der Besatzung war der schwarzen Bevölkerung (neunzig Prozent) der Zugang zu öffentlichen Ämtern verwehrt. Gleichzeitig wurden sie von den Marines in Zwangsarbeit beim Straßenbau eingesetzt. Einen Aufstand sogenannter Cacos (Bauernguerillas), die Posten der Besatzungstruppen angriffen, schlugen die Marines mit grausamer Härte nieder. Hunderte Haitianer wurden gefoltert, an Kirchentore genagelt und erschossen. »US-Streitkräfte hielten die Ordnung aufrecht während einer Periode chronischer Instabilität«, nannten die Autoren des Congressional Research Service Report solche Politik.
1934 zogen die USA im Rahmen von Roosevelts Politik der guten Nachbarschaft ihre Besatzungstruppen wieder ab, behielten aber auch weiterhin die Kontrolle über Haitis Außenhandel, um sicherzustellen, dass das verarmte Land tatsächlich all seine Schulden bezahlte. Erst 1947, nachdem Port-au-Prince die letzte Rate der 150 Millionen Goldfrancs an Paris überwiesen hatte, gab Washington das Finanzwesen an Haiti zurück.
1916: China
US-Marines eröffneten das Feuer auf gewalttätige Demonstranten auf ihrem Besitz in Nanking.
1916–1924: Dominikanische Republik
Unter einer Reihe von Caudillos, die zumeist nur kurze Zeit regierten, versank das Land im Chaos. Alarmiert von dem drohenden Bankrott der Republik übernahmen die USA erst die Verwaltung der Zoll- und Steuerbehörden, 1916 dann auch die vollständige Kontrolle der Regierungsgeschäfte. Sie stationierten Tausende Soldaten in dem Land, bauten Straßen und Schulen und führten Rechtsreformen durch, die es den US-eigenen Zuckermühlen und -plantagen erlaubten, ihre Geschäfte erheblich auszuweiten. Bald jedoch formierte sich unter General Ramón Natera eine Widerstandsbewegung, deren Mitglieder sich gavilleros nannten und die Souveränität ihres Landes zurückgewinnen wollten. 1921, nach vierjährigen hartnäckigen Kämpfen, vernichteten die Besatzungstruppen die gavilleros in einem Feldzug der verbrannten Erde.
Als die Marines das Land verließen, hatten sie ein modernes Militär geschaffen, das fortan die Militärdiktatoren des Landes lieferte.
1917: China
Amerikanische Truppen landeten in Chungking, um amerikanische Bürger zu schützen.
1917–1922: Kuba
Während des »Kleinen Kriegs vom Februar 1917«, als der er in die Geschichtsbücher einging, landeten US-Truppen auf Kuba, um die Regierung von Mario García Menocal gegen die aufständischen Liberalen unter Gerardo Machado, der deutscher Sympathien verdächtigt wurde, zu stützen und Kuba in ein amerikanisches Wirtschaftsprotektorat zu verwandeln, womit die Zuckerlieferungen während des Ersten Weltkrieges sichergestellt wurden. Einige Einheiten blieben bis 1933.
1917–1918: Europa, Erster Weltkrieg
Am 6. April 1917, provoziert durch den uneingeschränkten U-Boot-Krieg und das »Zimmermann-Telegramm« (eine Depesche des deutschen Außenministers Arthur Zimmermann an den Berliner Gesandten in Mexiko, in dem es um ein mögliches Bündnis zwischen beiden Staaten ging, wenn die USA ihre bisherige Neutralität aufgeben sollten), erklärten die USA dem Deutschen Reich den Krieg. Am 7. Dezember 1917 folgte die Kriegserklärung an Österreich-Ungarn.
1918–1919: Mexiko
Nach dem Abbruch der Pershing-Expedition überschritten US-Verbände auf der Jagd nach Banditen die mexikanische Grenze 1918 mindestens dreimal und 1919 sechsmal.54 Nachdem deutsche Agenten mit mexikanischen Soldaten einen Angriff auf die Grenzstadt Nogales in Arizona ausgeheckt hatten, in dessen Verlauf ein amerikanischer Soldat von einem mexikanischen Offizier erschossen wurde, begann die Schlacht von Ambros Nogales, die mit der mexikanischen Kapitulation endete.
1918–1920: Panama
US-Truppen übernahmen – wie vertraglich vereinbart – Polizeiaufgaben in Chiriqui, als bei Wahlen Unruhen ausbrachen. Das behauptet der Autor der Kongress-Liste. Tatsächlich hatten US-Truppen während der Wahlen Panama-Stadt und Colón besetzt, weil Washington die beabsichtigte Verschiebung der Wahlen als verfassungswidrig ansah. Die Regierung Panamas protestierte gegen die Einmischung der Regierung Woodrow Wilsons, die die »Souveränität Panamas ohne jede Rechtfertigung verletzt«.55 Später entsandten die USA Truppen in die Provinz Chiriqui, um US-Besitz zu schützen. Trotz der Proteste Panamas und Garantien zum Schutz von Ausländern zogen die US-Truppen erst 13 Monate später wieder ab.
1918–1920: Costa Rica
General Federico Tinoco schloss mit der britischen Ölfirma Amory, die Richard Lloyd George, dem Sohn des britischen Premierministers (1916–1922) gehörte, einen Vertrag über Bohrrechte ab, der Washington aufbrachte. »Das State Department hält es für äußerst wichtig, dass in der Nachbarschaft Panamas nur Amerikaner über Öl-Konzessionen verfügen«, warnte das US-Außenministerium den Diktator. Als sich Tinoco dem amerikanischen Druck mit dem Hinweis, der Vertrag sei bereits rechtsgültig, widersetzte, telegraphierte Washingtons Botschafter in San José seinem Vorgesetzten, es könne nichts gegen den Amory-Plan unternommen werden, bis »Tinoco aus dem Verkehr gezogen ist«.56 Wenig später wurde Tinoco ermordet. Die USA sorgten dafür, dass sich an den kommenden Wahlen nur Kandidaten beteiligen konnten, die mehr Aufgeschlossenheit gegenüber amerikanischen Investoren zeigten. Sofort nach Amtsantritt löste die neue Regierung die Tinoco-Amory-Verträge wieder auf und ließ nur amerikanische Bewerber um die Bohrrechte zu.
1918–1922: Sowjetunion
»Befanden sie (die Alliierten) sich mit Sowjetrussland im Kriegszustand? Gewiss nicht. Aber sie schossen Sowjetrussen nieder, wo sie ihrer ansichtig wurden, und standen als Angreifer auf russischem Boden. Sie bewaffneten die Feinde der Sowjetregierung, blockierten deren Häfen und versenkten ihre Kriegsschiffe. Sie wünschten von Herzen ihren Sturz und schmiedeten Pläne dafür. Aber Krieg – abscheulich! Einmischung – schändlich! Es war, wie sie wiederholt versicherten, für sie völlig gleichgültig, wie Russland seine eigenen inneren Angelegenheiten in Ordnung brachte. Sie waren unparteiisch – basta«57, schrieb Winston Churchill zehn Jahre nach den Ereignissen.
Zunächst war Wladimir I. Lenin »einer fremden Intervention zum Widerstande gegen die Deutschen nicht ganz abgeneigt, vorbehaltlich gewisser Bürgschaften gegen eine Einmischung in die russische Politik«.58 Nach dem Abschluss des Vertrags von Brest-Litovsk wollte die sowjetische Armee die Tschechoslowakische Legion – eine 60 000 Mann starke alliierte Armee unter der rot-weißen Flagge Böhmens, die von der russischen Front nach Sibirien marschiert war – entwaffnen. Doch die Tschechen setzten sich zur Wehr, nahmen Wladiwostok, Charbin, Irkutsk und kontrollierten schließlich ein mehrere Hundert Kilometer breites Gebiet zwischen Wolga und Baikalsee.
Plötzlich sahen die Alliierten die Möglichkeit, die kommunistische Herrschaft in Russland zu beseitigen, ehe sie sich festigen konnte. Im Juli 1918 landeten zwei japanische Divisionen (30 000 bis 40 000 Mann), 7000 Amerikaner, zwei britische Bataillone, 3000 Franzosen und Italiener in Wladiwostok, riefen eine Notstandsregierung aus und erklärten deren Neutralität. Die weißrussische antibolschewistische Armee und ihre Alliierten kontrollierten praktisch ganz Sibirien, alle russischen Gebiete östlich des Ural.
Zur selben Zeit bekämpften Polen, Litauen, Lettland und Estland die sowjetische Regierung an der westrussischen Front und drangen bis Kiew vor. Zugleich hatten sich in Murmansk und Archangelsk 12 000 Mann britischer, 6000 verbündeter und 5000 amerikanischer Truppen verschanzt. Zwei weitere britische Bataillone sicherten die weißrussische Regierung in Omsk, fünf britische Brigaden landeten in Batum und besetzten die Kaukasusbahn vom Schwarzen Meer bis Baku. Sie blieben bis Juni 1919. Im Juli stellte Churchill »zwei neue Brigaden zu je 4000 Mann auf«59, und im August landeten die USA 7000 zusätzliche Soldaten in Wladiwostok an, die bis Januar 1920 als Teil einer internationalen Besatzungsarmee blieben.
All diese Operationen dienten der Unterstützung der Weißrussen und der Anhänger des gestürzten menschewistischen Ministerpräsidenten Alexander Kerenski in ihrem Kampf gegen Lenins und Trotzkis Sowjetregierung. Als die Niederlage der Alliierten und der weißrussischen Armee gegen Ende des Jahres 1919 nicht mehr aufzuhalten war, versetzte die New York Times ihre Leser in Angst und Schrecken mit Schlagzeilen wie »Rote wollen Krieg mit Amerika« (30. Dezember 1919), »Britannien vor Krieg mit Roten, ruft zu Konferenz in Paris« (16. Januar 1920), »Rote heben Truppen aus, um Indien anzugreifen« (7. Februar 1920) oder »Befürchtungen, dass Bolschewiken nun japanisches Gebiet angreifen« (11. Februar 1920). Die USA erkannten die UdSSR erst 1933 diplomatisch an.
1919: Dalmatien
Auf Bitte der italienischen Regierung landeten US-Verbände in Trau (heute Trogir), um Italien in anhaltenden Auseinandersetzungen mit Serbien zu unterstützen.
Juni 1919: Mexiko
Nachdem Francisco Pancho Villa zum wiederholten Mal die mexikanische Grenzstadt Ciudad Juárez angegriffen hatte, um dort einen Stützpunkt zu errichten, überschritten US-Truppen die Grenze und vertrieben den alten Revolutionär.
1919: Türkei
Marinesoldaten der USS Arizona landeten im Hafen von Konstantinopel, um das dortige US-Konsulat während der griechischen Besetzung zu schützen.
1919: Honduras
Der erste Streik der Arbeiter 1917 auf den Plantagen der Cuyamel Fruit Company wurde vom honduranischen Militär niedergeschlagen. Doch als im folgenden Jahr Arbeiterunruhen auf den Plantagen der Standard Fruit Company in La Ceiba ausbrachen, die wiederum ein Jahr später in einen Generalstreik an der ganzen Karibikküste mündeten, schickte Washington Kriegsschiffe, und die honduranische Regierung begann, die Streikführer zu verhaften. Als Standard Fruit schließlich ein neues Lohnangebot in Höhe von 1,75 Dollar pro Tag machte, brach die Streikbewegung zusammen.
1920: China
Truppen wurden bei Unruhen in Kiukiang an Land geschickt, um US-Staatsbürger zu schützen.
1920: Guatemala
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts schloss Präsident Manuel Estrada Cabrera (1898–1920) die ersten Verträge mit der nordamerikanischen United Fruit Company (UFCO). In der Folge erwarb die UFCO ganze Landstriche, die sie aus Investitionsgründen zum größten Teil brach liegen ließ. Sie pachtete auf 99 Jahre die Eisenbahnlinien und den einzigen Hafen und machte dadurch den Export direkt von den USA abhängig. Auch die Gewinne aus diesen Plantagen gingen direkt an die UFCO, die von Steuern befreit war. Damit wurde Guatemala das Paradebeispiel für eine »Bananenrepublik«, abhängig von den USA und anderen ausländischen Investoren, an denen nur eine kleine guatemaltekische Oberschicht mitverdiente. Als zahlreiche Revolten den langjährigen Präsidenten Manuel Estrada Cabrera, der sein Land der United Fruit Company geöffnet hatte, bedrohten, ließen die USA Kriegsschiffe vor den Küsten ankern und drohten mit Intervention, sollte eine Revolution den Diktator aus dem Amt vertreiben. Eine Koalition beider in der Nationalversammlung vertretenen Parteien enthob ihn schließlich seines Amtes und ernannte am 8. April Carlos Herrera zu seinem Nachfolger.60
1921: Panama, Costa Rica
Amerikanische Flottenverbände zeigten beiderseits des Kanals Flagge, um den Ausbruch eines Krieges zwischen den beiden Ländern wegen eines Grenzdisputs zu verhindern. Gleichzeitig landeten US-Truppen in Panama, um den Präsidenten zu schützen, der von verärgerten Bürgern angegriffen worden war.
1922: Türkei
Als türkische Nationalisten unter Kemal Atatürk die griechischen Besatzungstruppen nach Westen trieben und in Smyrna (Izmir) einmarschierten, gingen US-Truppen mit Einwilligung sowohl der griechischen als auch der türkischen Seite an Land, um amerikanische Bürger und amerikanischen Besitz zu schützen.
1922–1923: China
Zwischen April 1922 und November 1923 landeten US-Truppen fünfmal zum Schutz der dort lebenden Landsleute.
1923: China
Marineeinheiten Großbritanniens, Frankreichs, Japans, Portugals und der USA liefen in Kanton ein, um die militärische Übernahme der internationalen Zolleinrichtungen durch die chinesische Regierung zu verhindern. Nachdem Peking eingelenkt hatte, zogen die Schiffe wieder ab.
1924: Honduras
Eine der wohl skurrilsten Episoden in der langen Reihe amerikanischer Interventionen begründete die Liste des US-Außenministeriums wie üblich mit dem Schutz amerikanischer Bürger und Interessen angesichts von Unruhen, die bei Präsidentschaftswahlen ausgebrochen waren. 1923 verlor Tiburcio Carías Andino, der Kandidat der Konservativen Partei sowie der United Fruit Company, die Präsidentschaftswahlen nach einem grandiosen Wahlbetrug, der den Kandidaten der Liberalen Partei sowie der amerikanischen Cuyamel Fruit Company ins Amt brachte. Mit Unterstützung der United Fruit revoltierte Carías und putschte sich ins Präsidentenamt. Washington jedoch stellte sich hinter die Cuyamel Obstfirma und ihren Kandidaten und entsandte Truppen, um Carías wieder zu vertreiben. 1932, drei Jahre nachdem die United Fruit ihren Konkurrenten Cuyamel übernommen hatte, kam Carías doch noch ins Amt und regierte das Land für 17 Jahre.
1924: China
Während bürgerkriegsähnlicher Unruhen landeten US-Marines in Schanghai, um Amerikaner und andere Ausländer zu schützen.
1925: China
Erneut landeten US-Marines, um Leben und Besitz in Schanghais Internationalem Viertel zu schützen.
1925: Honduras
Während politischer Unruhen an der Atlantikküste landeten US-Verbände in La Ceiba zum Schutz von Ausländern und der Plantagen der United Fruit. »Nachdem es schon so häufig praktiziert worden war, war die Landung von Marines an der Nordküste von Honduras zur Routine geworden«61, schrieb der amerikanische Diplomat Willard Beaulac, der seinem Land in Honduras, Nicaragua, Haiti, Paraguay und Kolumbien als Botschafter gedient hatte, in seinen Erinnerungen.
1925: Panama
In der entlegenen Provinz Darién rebellierten die Kuna-Indianer, weil die Regierung ihre Frauen zwingen wollte, ihre traditionelle gegen westliche Kleidung einzutauschen und den goldenen Nasenring aufzugeben. Der amerikanische Ingenieur, Diplomat und Abenteurer Richard Oglesby Marsh, der schon an den Vertragsverhandlungen um den Panamakanal beteiligt gewesen war, forderte US-Truppen aus der Kanalzone zum Schutz der Aufständischen an und schrieb eine »Erklärung der Unabhängigkeit und der Menschenrechte des Volkes von Tule und Darién«. Am 12. Februar proklamierten die Häuptlinge von 45 Clans nach 26-tägiger Debatte die Republica de Tule. Am 4. März unterzeichneten Vertreter der Regierung sowie der Kuna im Beisein des amerikanischen Botschafters ein Friedensabkommen. Die Indios durften auch weiterhin goldene Nasenringe tragen und gaben dafür ihre Unabhängigkeitsbestrebungen auf.
Sechs Monate später landeten 600 US-Soldaten, um einen Streik für niedrigere Mieten in Panama-Stadt und Colón zu unterdrücken.
1926: China
Als Guomindang-Einheiten Hankow angriffen, landeten US-Marineverbände, angeblich um amerikanische Bürger zu schützen, tatsächlich aber, um Tschiang Kai Scheks Verbände zu unterstützen. Wenig später attackierten die Nationalisten Kiukiang, und wieder schickten die USA Flottenverbände. Und auf dem Jangtsekiang patrouillierten nicht weniger als 15 britische, neun amerikanische, zehn japanische und sechs französische Kanonenboote.
1926–1933: Nicaragua
Als angesichts des Ergebnisses von Wahlen, die von den USA überwacht worden waren, ein Bürgerkrieg ausbrach, besetzten Marines in Unterstützung des Wahlsiegers das Land. Außenminister Frank B. Kellogg sprach von einer »nicaraguanisch-mexikanisch-sowjetischen« Verschwörung mit dem Ziel einer »mexikanisch-bolschewistischen Hegemonie« in nächster Nähe zum (Panama-)Kanal. Augusto César Sandino jedoch, ein Nationalist, der sich gegen ausländische Interventionen wehrte und die Konzentration des Landbesitzes in den Händen einer winzigen Oligarchie bekämpfte, lehnte die von Kellogg und seinem Präsidenten Calvin Coolidge vorgesehene Lösung des Konfliktes ab und verwickelte die USA in ihren ersten Anti-Guerilla-Krieg in Lateinamerika. Die USA brachten 4000 Marines ins Land, flogen Bombenangriffe auf Stellungen Sandinos und bauten eine lokale nicaraguanische Streitmacht auf, die Nationalgarde, die sie ihrem Protegé Anastasio Somoza unterstellten, ehe sie am 3. Januar 1933 wieder abzogen. 1934 lud Somoza Sandino zu Verhandlungen ein und ließ ihn ermorden. Drei Jahre später erlangte Somoza in einer Wahlfarce die Macht, die sein Clan erst 42 Jahre später unfreiwillig wieder abgab.
1927: China
Amerikanische und britische Zerstörer beschossen Nanking, um Ausländer zu schützen. »Nach diesem Zwischenfall entsandte Washington zusätzliche Streitkräfte und Marineverbände, die bei Schanghai und Tientsin stationiert wurden.«62
1927–1929: Mexiko
Die neue, 1917 geschriebene Verfassung hatte die (katholische) Kirche als weltliche Institution im Land abgeschafft. Doch erst Präsident Plutarco Elías Calles, der schon 1915 als Gouverneur von Sonora alle Priester seines Bundesstaates hatte ausweisen lassen, setzte die Verfassung durch und erließ die entsprechenden Gesetze. Die katholische Kirche, bis dahin der reichste Grundbesitzer des Landes63, wurde enteignet. Alle Kirchen gingen in Staatsbesitz über. Religionsunterricht, kirchliche Schulen, Mönchsorden oder religiöse Zeremonien unter freiem Himmel wurden verboten. Religiöse Gewänder durften nicht mehr in der Öffentlichkeit getragen werden. Priester mussten mexikanischer Nationalität, mindestens vierzig Jahre alt und verheiratet sein, ihre Anzahl wurde streng reglementiert. 189 ausländische Priester wurden des Landes verwiesen, später auch alle Bischöfe und Erzbischöfe.
Papst Pius XI. verdammte in einer Enzyklika diese »größte Perversion staatlicher Autorität«. Mit der Rückendeckung Roms trat Mexikos Klerus in den Streik, suspendierte Gottesdienste, die Erteilung der Sakramente und rief zum Boykott des Staates auf. Fanatische Glaubensanhänger Roms rebellierten mit der Gründung von »Einheiten der Liga zur Verteidigung der Religionsfreiheit«. Von einem »Gottlosenstaat« schrieb Graham Greene in seinen Aufzeichnungen Gesetzlose Straßen, einem Untersuchungsbericht, den er 1938 im Auftrag der katholischen Kirche verfasst hatte – »ein schlimmes Land…, keine Priester, keine Kirche« –, und er zitierte eine Mexikanerin: »Wir sterben wie Tiere«, ohne Beichte, ohne Sakramente. 64
Im »katholischsten aller katholischen Länder«, als das sich Mexiko gerne rühmt, formierte sich der Widerstand, besonders in den Bundesstaaten Colima, Zacatecas, Michoacán, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro sowie Jalisco mit seiner Hochebene von Los Altos, wo die cristeros (Soldaten Christi), wie die Aufständischen sich nannten, zeitweilig sogar eine Gegenregierung ausgerufen hatten. Die Verteidiger der Religion wetterten gegen die »Callista-Fraktion« und die »Kollaborateure und Komplizen der Tyrannei«. Die Regierung erklärte Los Altos zur Kampfzone. »Alle Bewohner müssen sich in Konzentrationszentren einfinden«, berichtete der amerikanische Journalist Carleton Beals, »andernfalls sie als Rebellen angesehen werden«.65
Die Kämpfe zwischen den cristeros und der Regierung wurden mit unglaublicher Brutalität geführt. Die USA schickten Calles militärische Ausrüstung, Waffen und Militärberater. Regierungstruppen hängten cristeros oder Verdächtige im Dutzend an Telegraphenmasten auf, die Rebellen zerstörten die staatlichen Schulen und ermordeten Hunderte junger Lehrer, die aufs Land geschickt worden waren, um den Bauern und Kindern dort Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen. »Die Soldaten haben damals viele Priester an den Bäumen der Alameda aufgehängt«, erzählte eine alte Dame, die als Kind von ihrem Vater regelmäßig »im Brunnen versteckt« worden war, wenn die Kämpfe nach Tepatitlán kamen (das heute längst Teil Guadalajaras geworden ist). »Wenn die Soldaten wieder fort waren, kamen die cristeros. Sie brachten alle um, die nicht ihren Ideen folgten. Einmal riegelten die cristeros ganz Tepatitlán drei Tage lang ab«, erinnerte sie sich, »ehe Regierungstruppen die Umklammerung durchbrachen. Wer versuchte, den Ort zu verlassen, den erschossen sie.«66
1930: Dominikanische Republik
Die USA verhalfen Rafael Trujillo an die Macht, der das Land über dreißig Jahre bis zu seiner Ermordung 1961 despotisch regieren sollte.
1932: China
US-Truppen landeten in Schanghai zum Schutz amerikanischer Interessen während der japanischen Besetzung der Stadt.
1932: El Salvador
Um amerikanische Bergbauinteressen während der blutigen Niederschlagung eines indianischen Bauernaufstandes unter Führung des Mestizen und Trotzkisten Farabundo Martí (nach ihm nannte sich auch die Guerillabewegung der 80er Jahre: Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí) durch den langjährigen Diktator Maximiliano Hernández Martínez zu schützen, entsandte Präsident Herbert C. Hoover einen Kreuzer und zwei Zerstörer in den Hafen von Acajutla, die schließlich halfen, die Revolte niederzuschlagen, in der innerhalb einer Woche 30 000 zumeist indianische Bauern von der Armee niedergemetzelt wurden. »Alle, die eine Machete (das Universalwerkzeug eines lateinamerikanischen Campesinos) trugen, waren schuldig. Alle mit indianischem Aussehen oder in der abgerissenen Bekleidung eines Campesinos wurden als schuldig angesehen.«67 Das Trauma, dass alleine die Tatsache, ein Indio zu sein, ausreichte, um getötet zu werden, wirkt bis heute nach. Seit jenen Tagen gibt niemand mehr in El Salvador freiwillig seine indianische Herkunft zu.
1932: Paraguay, Bolivien
Der Chaco-Krieg zwischen Bolivien und Paraguay war ein Krieg zweier Ölgiganten. Die Standard Oil Company von New Jersey finanzierte Boliviens Streitkräfte, stellte ihnen Curtiss-Wright-Flugzeuge zur Verfügung und provozierte sie, Paraguay anzugreifen. Standard Oil hoffte, Bolivien werde einen großen Teil des Gran Chaco, in dem erhebliche Ölvorkommen vermutet wurden, in seinem Interesse annektieren. Zudem brauchte die Firma den Chaco für eine Pipeline von Bolivien zum Paraguay (Fluss). Shell hingegen drängte die Paraguayer, ihre Ölvorkommen für die holländisch-britische Firma zu verteidigen. Am Ende gewann Paraguay den Krieg, nicht aber den Frieden. Als Vorsitzender der Verhandlungskommission nach Beendigung des Krieges sorgte Spruille Braden von der Standard Oil dafür, dass Tausende Quadratkilometer, die Paraguay beanspruchte, Bolivien und somit Rockefeller zugeschlagen wurden.
1933: Kuba
Zwischen 1925 und 1933 hatte sich Präsident Gerardo Machado, genannt »der Schlächter«, um die amerikanischen Interessen gekümmert. Zu Beginn der 30er Jahre jedoch brachten zunehmende soziale Unruhen und die Furcht vor einer Revolution Washington zu dem Schluss, dass Machado zu einer Belastung geworden war. Washington schickte Sonderbotschafter Sumner Welles nach Kuba, um eine linke Regierung zu verhindern. Dreißig Kriegsschiffe vor den Küsten Kubas verliehen der Botschaft Nachdruck. Machado ging, und die USA fanden in Fulgencio Batista y Zaldívar einen willigen und folgsamen Nachfolger, der den zu linken Übergangspräsidenten Carlos Manuel de Céspedes mit seiner »Unteroffiziersrevolte« aus dem Amt putschte, ehe dieser Neuwahlen hatte organisieren können.
1934: China
US-Marines landeten in Foochow, um das US-Konsulat zu schützen.
1936: Argentinien
Am 1. Dezember ließ sich Präsident Franklin D. Roosevelt von dem Kreuzer USS Indianapolis, begleitet von der USS Chester, zu einer interamerikanischen Tagung nach Buenos Aires bringen. Trotz dieser amerikanischen Machtdemonstration stimmten die Delegierten der argentinischen Position zu, die jedes Interventionsrecht dritter Staaten in Lateinamerika ablehnte.
1940: Neufundland, Bermuda, St. Lucia, Bahamas, Jamaika, Antigua, Trinidad, Britisch-Guyana
US-See- und -luftverbände übernahmen die Sicherung der Karibikstaaten, die Großbritannien im Rahmen des Land-lease-Programms als Sicherheit für die amerikanischen Kriegskredite den USA überlassen hatte.
1941: Panama
Nachdem er die Zustimmung des amerikanischen Botschafters erhalten hatte, putschte Ricardo Adolfo de la Guardia Präsident Arias aus dem Amt, den Kriegsminister Henry Stimson für »sehr lästig und nazifreundlich« hielt.
1941: Grönland
Nach der deutschen Besetzung Dänemarks übernahmen US-Truppen den Schutz dieses dänischen Gebiets.
1941: Holländisch-Guyana
Nach der deutschen Besetzung der Niederlande und in Übereinstimmung mit der niederländischen Exilregierung übernahmen amerikanische und brasilianische Truppen den Schutz der dortigen Aluminium- und Bauxit-Vorkommen.
1941: Island
Mit Zustimmung der Regierung in Reykjavík übernahmen die USA den Schutz des Inselstaates.
1941: Deutschland
Ab September griffen US-Kriegsschiffe deutsche U-Boote auf Befehl des Präsidenten, aber ohne Genehmigung des Kongresses oder Kriegserklärung an. Im November wurde das Neutralitätsgesetz teilweise aufgehoben, um die amerikanische Militärhilfe für Großbritannien zu legalisieren.
Dezember 1941–1945: Deutschland, Italien, Japan
Kriegserklärung, Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg.
1943: Honduras
Der Chefredakteur der Zeitung El Cronista wurde in die US-Botschaft zitiert, wo ihm klargemacht wurde, dass Kritik an dem Diktator Tiburcio Carías Andino die Kriegsanstrengungen schädige. Kurz darauf schloss die Regierung das Blatt.
1943–1946: Bolivien
1943 putschten nationalistische Militärs unter der Führung von Major Gualberto Villarroel Lopéz gegen die Militärregierung des Generals Enrique Peñaranda del Castillo, der den Achsenmächten den Krieg erklärt hatte. Zunächst wurde Villarroel Präsident einer Regierungsjunta, später übernahm er offiziell das Amt des Präsidenten Boliviens.
Während seiner Amtszeit kam es zu weitreichenden Reformen wie zum Beispiel der amtlichen Anerkennung der Gewerkschaften. Um die Situation der Bauern zu verbessern, richtete Villarroel zum ersten Mal in der Geschichte des Landes einen Congreso Indígena ein, einen Kongress für die indianischen Völker, die zwar 95 Prozent der Bevölkerung ausmachte, bis dahin jedoch keinen Einfluss auf die politischen Entwicklungen im Land hatte. Zudem schaffte er einige der schlimmsten Lebensbedingungen der indianischen Bevölkerung ab, wie das feudalistische System der Lehnsherrschaft, das zwischen den Oligarchen und den einheimischen Bauern herrschte und sich gelegentlich bis zur Leibeigenschaft auswuchs. Eine notwendige Landreform jedoch gelang ihm nicht. Seine Reformen erhöhten zwar seine Popularität unter der indigenen Bevölkerung, forderten jedoch den Widerstand der Oligarchie sowie des Mittelstandes heraus.
Den USA war der Nationalist mit seinen Sympathien für die deutschen Nazis ohnehin schon lange ein Dorn im Auge. So nutzten die Opposition und der US-Geheimdienst OSS die Unzufriedenheit unter der weißen Bevölkerung. Aufgestachelt von US-Agenten und finanziell unterstützt von la gente bien (den besseren Leuten aus Handel und Oligarchie) plünderte ein Mob von Studenten, Professoren und Lehrern ein Waffenlager und belagerte den Palacio Quemado an der Plaza Murillo, den Regierungssitz. Villarroel verkündete zwar seine Abdankung. Doch am 21. Juli stürmte der Pöbel das Gebäude und ermordete ihn. Seine Leiche wurde von einem Balkon geworfen und an einem Laternenpfahl gegenüber dem Palast aufgehängt. Das OSS soll den Demonstranten zuvor Bilder von der Ermordung Mussolinis gezeigt haben.