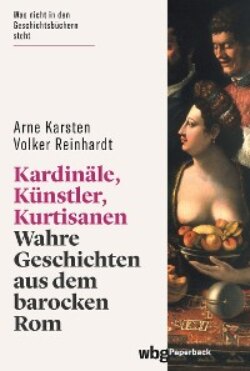Читать книгу Kardinäle, Künstler, Kurtisanen - Arne Karsten - Страница 10
Schreckliche Diplomaten, Politik der Illusionen. Auf dem Weg in den Sacco di Roma
ОглавлениеIm März 1525 steht Rom noch in einiger Entfernung vom Krater des Vulkans, auf dem die päpstliche Diplomatie zu tanzen beginnt. Doch rücken der Papst und seine Minister dem Abgrund unaufhaltsam näher, wie von einem Unstern geleitet. Das jetzt anhebende Todesballett hat der damalige außenpolitische Chefberater Papst Clemens’ VII. Medici, Francesco Guicciardini, zwölf Jahre danach in seiner monumentalen Geschichte Italiens von 1490 bis 1534 festgehalten: Akt für Akt, Pirouette für Pirouette, bis zum Sturz ins Bodenlose. In die Bitternis und Empörung dieses unversöhnten Rückblicks mischt sich doppeltes Unbehagen: darüber, am Anfang mit dem eigenen Ratschlag die römische Politik in die fatale Richtung manövriert zu haben und dann der Eskalation der Unvernunft hilflos zusehen zu müssen. Die Niederschrift der unheilvollen Ereignisse bewirkt keine Katharsis, sondern qualvolles Nochmal-Erleben. Die Schatten der Toten steigen wieder auf. Selber auf den Tod krank, ringt der Historiker Guicciardini mit den Gespenstern der Vergangenheit. Bannen lassen sie sich nur durch die unbarmherzige Genauigkeit des Berichts.
Rom hatte im Machtkampf zwischen Kaiser Karl V., in Personalunion König von Spanien sowie Chef des Hauses Habsburg, und König Franz I. von Frankreich auf die falsche Karte gesetzt. In der Schlacht von Pavia am 24. Februar 1525 hatte der französische König nicht nur den Krieg um Mailand und die Blüte seines Adels, sondern auch seine Freiheit verloren. Sein päpstlicher Bundesgenosse hatte vom Sieger vorerst, so schien es, wenig zu befürchten. Beunruhigt war man in Rom dennoch. Clemens hatte immerhin erst kurz vor Aufnahme der Feindseligkeiten die Seiten gewechselt, um sich den vermeintlich stärkeren Bataillonen anzuschließen. Mit französischen Waffen hoffte er, die spanisch-kaiserliche Machtstellung zu schwächen, die sich zu einer regelrechten Hegemonie auszuweiten drohte; schließlich bildete ganz Süditalien einschließlich Siziliens einen Teil des habsburgischen Imperiums. Diese handfesten Machtinteressen Roms ließen sich allerdings durch eine erhabene Formel verbrämen: dass der Pontifex maximus als gemeinsamer Vater der Christenheit für Ausgleich unter den weltlichen Herrschern zu sorgen und deswegen eine einseitige Übermacht zum Schutze der Kirche und des Glaubens zu verhindern habe. Beim Kaiser durfte man für solche Floskeln auf Entgegenkommen hoffen, produzierte er doch selbst genug davon: nackte Staatsräson nobel zu bemänteln, das war seit langem Brauch der europäischen Politik.
Doch waren die Motive der römischen Besorgnis damit noch nicht erschöpft. Allzu lange hatte Giulio de’Medici, der spätere Papst Clemens VII., mit seiner ganzen Familie in den Zeiten ihres Exils 1494 bis 1512 die Gunst von Karls Großvater Maximilian genossen. Dass aus dem ehemaligen Klienten jetzt ein Gegner geworden war, konnte man durch eine nicht minder wohlklingende Wendung begründen: Rollentausch, Identitätsauswechslung, Annahme höherer Wesenszüge, eine Verwandlung, wie sie – so die offizielle Version des Papsttums – die Erhebung auf den Stuhl Petri durch den Heiligen Geist bewirke. Auch für diese Erklärung brachte Karl V. viel Verständnis auf, hatte er doch selbst in seinem erst 25-jährigen Leben mehr Länder und Titel geerbt als je ein Sterblicher vor ihm und damit stetig an internationaler Statur und Rang gewonnen. Auf diese Weise aber mussten die gerade noch Ebenbürtigen zu Vasallen schrumpfen – oder Freunde zu Feinden werden. Das alles war als unvermeidlich akzeptiert. Und auch dass dieser Verrat in der Stunde der Not und zuerst heimlich geschah, ist durch die neue Idee der Staatsräson gedeckt, wie sie wenige Jahre zuvor von Machiavelli prägnant formuliert, aber schon seit langem praktiziert wurde. Wenn sich das alles durch Normen entschuldigen ließ, was treibt dann dem Historiker Francesco Guicciardini mehr als ein Jahrzehnt danach den Angstschweiß auf die Stirn? Um diese Beklommenheit zu verstehen, muss man einen kurzen Umweg einschlagen. Er führt über den Charakter des regierenden Papstes.
Clemens VII., so Guicciardini, ist in jeder Hinsicht ein Sonderfall: Er glaubt, dass andere seine Lügen glauben. Und noch seltsamer: er glaubt die Lügen der anderen. Zudem ist er chronisch entscheidungsunfähig. Hat er einen Beschluss gefasst, überkommt ihn postwendend die tiefste Reue, sich so und nicht anders entschieden zu haben, woraufhin alles wieder rückgängig gemacht wird und die qualvolle Prozedur von vorne beginnt. Auf diese Weise hat der Papst schnell den Respekt der Kurie und damit seine Autorität gegenüber den Prälaten verspielt. Sein pathologischer Schwebezustand dringt zudem nach außen. Wie sollte es auch anders sein, wenn ein Eilbote dem anderen nachjagt, um eben ausgesandte Briefe wieder einzuziehen? Manchmal ist der erste Kurier so schnell, dass er nicht mehr eingeholt werden kann. Dann bekommen gekrönte Häupter sich widersprechende Botschaften des Papstes zu lesen – mit äußerst abträglichen Folgen für dessen Reputation. Vertrauen wird verspielt, Misstrauen macht sich breit. All dies hat zur Folge, dass der Medici-Papst Verhandlungen grundsätzlich doppelgleisig, immer mit den beiden verfeindeten Seiten zugleich führt, was ihm notwendigerweise als Doppelzüngigkeit, ja als Unehrlichkeit ausgelegt wird, umso mehr, als er für dergleichen heikle Manöver nicht die notwendige Geschicklichkeit und Kaltblütigkeit besitzt. Ganz im Gegenteil. Antrieb seiner Politik ist überwiegend Angst, die sich nicht zuletzt aus dem Misstrauen nährt, welches er selber einflößt, und deren logische Ergänzung, die Gier, der unersättliche Hunger nach noch mehr Macht, vor allem in Florenz, wo die Medici nach ihrer Vertreibung von 1494 seit 1512 hinter der immer brüchigeren Fassade der Republik de facto die Herrschaft ausüben.
Porträt des Francesco Guicciardini
Gedankenschwer im Staatsgewand, so zeigt das Cristoforo dell’Altissimo zugeschriebene Porträt Francesco Guicciardinis den Florentiner Patrizier. Zugleich ist der Betrachter versucht, in die melancholischen Züge des vorzeitig gealterten Historikers und Staatsdenkers Todesnähe und Verachtung der Welt, speziell ihrer Mächtigen, hineinzulesen. Vor allem aber ist das Bildnis gemalte Memoria, ein Werk des Gedächtnisses und des Gedenkens für die Familie. Sie hat diesen Auftrag getreulich erfüllt; das Studierzimmer des – so Felix Gilbert – größten Intellektuellen der Renaissance im Palazzo von Oltrarno erweckt den Eindruck, als habe er soeben erst die Feder aus der Hand gelegt.
Psychologisch entspricht dieser uneingeschränkt in Anspruch genommenen Lizenz zum Täuschen eine ebenso unbegrenzte Naivität, die Hinterhalte der anderen betreffend. Dieser Papst rechnet nie mit dem Prinzip des „Wie du mir, so ich dir“. Darin spiegelt sich eine fatale Überschätzung des Amtskredits, härter ausgedrückt: der Wahn, als Statthalter Christi in einem christlichen Europa unantastbar zu sein. Eine solche Rechnung aber ist ohne den Zeitgeist gemacht. Dieser nämlich unterscheidet zwischen der Sakralität des Papstamtes und der mehr oder minder hohen Würdigkeit seines Inhabers. Darüber aber macht sich kaum jemand falsche Vorstellungen – der Heilige Geist, so Guicciardini, lässt sich in den unreinen Seelen der heutigen Kardinäle gewiss nicht nieder. Und schließlich lag die Absetzung dreier ungeeigneter Päpste durch das eine und allmächtige Konzil in Konstanz erst einhundertacht Jahre zurück. Unangreifbar also war das Amt, nicht aber eine Person oder gar eine Familie. Beiden, Papst und Nepoten, konnte man im Fall extremer Regelüberschreitungen durchaus eine grausame Lektion erteilen.
Rachegelüste gegenüber Rom und dem Papsttum hatte zudem die Reformation seit 1517 kräftig geschürt. In der Beurteilung dieses zuerst rein theologischen, doch schnell auch politisch motivierten Fundamentalaufstandes gegen die römische Autorität unterläuft dem Papsttum – und speziell Clemens VII. – die folgenreichste Fehleinschätzung seiner Geschichte. Nichts Neues unter der Sonne, so lautet das Fazit der vatikanischen Haustheologen, ein fader Aufguss längst abgetaner Häresien, künstlich aufgebauscht durch die üblichen Erpressungsversuche gekrönter Häupter – und durch entsprechende Gegenmanöver leicht zu ersticken. Auf diese Weise übersieht man in Rom nicht nur die Anziehungskraft dieses theologisch-kirchlichen Gegenentwurfs auf intellektuelle und politische Kreise, sondern man verkennt auch die tiefe Erregung der Massen, die durch die ungeheuer grobschlächtige antirömische Propaganda hervorgerufen wird. In Hunderttausenden von illustrierten Flugblättern nämlich wird den einfachen Leuten im Bild vorgeführt, wie sie mit dem Papst und seinen Kardinälen zu verfahren haben – und warum: Schlagt sie tot, denn sie sind des Teufels. Das alles und noch manches mehr entzieht sich der selbstzufriedenen Wahrnehmung der Kurie. Mit einem solchen Papst so schweren Zeiten entgegenzugehen, macht vielen Römern Angst. Wer es sich leisten kann, setzt sich ab, in Vorausahnung dessen, was da kommen sollte. Im Rückblick erscheint Guicciardini das Verhängnis geradezu vorprogrammiert: ein Lehrstück, wie man scheinbar unerschöpflichen politischen und sozialen Kredit vergeudet, eine Parabel von der Pathologie der Macht, vom Zerstörungspotential der unbeschränkten Einzelherrschaft, wenn diese in falsche Hände fällt.
Franz I. in der Gewalt Karls V., d. h. ein christlicher Fürst von einem anderen gefangen gesetzt. Das war eine Konstellation, die päpstliche Interventionen zugunsten des Unterlegenen auf den Plan rief. Offiziell wurden diese Bemühungen mit der Rolle des Pontifex maximus als gemeinsamer Vater der Christen und Tröster der Gedemütigten gerechtfertigt, 1525 waren sie de facto vom Bedürfnis Roms motiviert, einen Schutzwall gegen das unaufhaltsam expandierende Imperium Karls V. zu errichten. So stoßen die Venezianer bei Clemens auf offene Ohren mit ihrem Vorschlag, ein bewaffnetes Schutz- und Trutzbündnis gegen den Kaiser zu schließen. Der Pakt ist unterschriftsreif aufgesetzt und ein Kurier zum König von England, der ihm beitreten soll, schon unterwegs, als ein kaiserlicher Gesandter mit Gegenvorschlägen Karls eintrifft. Dadurch wird der eben vereinbarte Vertrag schlagartig hinfällig und der Bote per Eilpost gestoppt.
Natürlich ist die Markus-Republik von dieser Richtungsänderung Roms zutiefst irritiert, umso mehr, als sie viel Geld zahlen müsste, um in diese Allianz einbezogen zu werden. Dieser Ärger lässt Clemens kalt; Hauptsache er und seine Familie genießen die Gunst des Siegers. Und so werden der Papst und die Medici schon am 1. April 1525 – gerade einmal fünf Wochen nach der Schlacht von Pavia – in den umfassenden Schutz des Kaisers aufgenommen. Zusätzlich verpflichten sich beide Seiten, Francesco Sforza, den schattenhaften, vom Reichsoberhaupt abhängigen Herzog von Mailand, durch Truppen zu unterstützen. In seiner Erleichterung über dieses Abkommen, das er für die Lösung aller seiner Probleme hält, tut der Papst sogar mehr als verlangt. Aufgrund unverbindlicher Zusicherungen Karls veranlasst er das französische Heer, den geplanten Feldzug zur Eroberung Neapels abzubrechen, und entlässt einen Großteil seiner eigenen Truppen. In seiner diplomatischen Handlungsfreiheit aber fühlt sich Clemens durch den Pakt keineswegs eingeschränkt; er ist ja noch nicht einmal ratifiziert – unauflösliche, ja unfassbare Widersprüche wahnhafter Machtausübung, so lautet das Urteil Guicciardinis.
Immerhin ist da ja noch der gefangene König von Frankreich, der auf Rache sinnt. Für solche Revanchepläne sind die päpstlichen Unterhändler ideale Ansprechpartner. Die für ihren Sohn als Regentin fungierende Königinmutter Louise von Savoyen nämlich macht den alten Bundesgenossen Venedig und Rom verlockende Angebote. Sie ist zu fast allem bereit; ein Königreich mit einem König im fremden Kerker ist ein Torso. Clemens leiht ihr umso geneigter das Ohr des „gemeinsamen Vaters“, als er den politischen Zustand Italiens als immer unerträglicher empfindet, trotz aller Garantien für sich und seine Familie; zu übermächtig ist der habsburgische Universalherrscher, der den Papst zudem mit Forderungen nach einem Konzil unter Druck setzt. Eine solche, die verworrenen Glaubensverhältnisse Europas ordnende Kirchenversammlung aber fürchtet der zunehmend von Panik getriebene Pontifex maximus mehr als alles andere. Zu frisch ist der Kurie die Demütigung von Konstanz in Erinnerung; zu lebendig sind weiterhin die Theorien, wonach die Gemeinschaft der Gläubigen über dem Papst stehe. Und noch ein ganz persönlicher Makel kommt hinzu: Clemens ist unehelich geboren und daher, bei strenger Regelauslegung, als Kleriker gar nicht zugelassen.
Die Entfremdung zwischen Papst und Kaiser nimmt zu, als Clemens den Pakt mit Karl veröffentlichen lässt, Letzterer jedoch den Bündnistext nicht als Ganzen bestätigt, sondern Klauseln ausnimmt, welche den römischen Zugriff auf das lehensrechtlich dem Heiligen Stuhl unterstellte Ferrara und die dort regierende Familie Este verstärken sollen: zum Nachteil des Reichs, wie der Kaiser befindet. Auf eine effizientere Oberhoheit über Ferrara aber sind die Päpste seit Jahrzehnten bedacht, ja, sie steigern sich fast duchgehend in eine gefährliche Anti-Este-Politik hinein. Clemens ist über die einseitige Abänderung des von ihm bereits publizierten Vertrags empört und zugleich zutiefst verängstigt: Was führt Karl gegen ihn im Schilde?
Kein Wunder also, dass sich der Papst auf immer dubiosere Unternehmungen einlässt. Das verhängnisvollste dieser Manöver ist die Verschwörung des Geronimo Morone, seines Zeichens Chefratgeber Francesco Sforzas, der sein Schattendasein gründlich satt hat und, von der großen Vergangenheit seiner Familie berauscht, endlich eigenständige Macht ausüben möchte. Als Bundesgenosse ist der Marchese di Pescara ausersehen; der Sieger der Schlacht von Pavia nämlich fühlt sich ungenügend belohnt, ja zurückgesetzt. In Sforzas Auftrag unterbreitet Morone dem schmollenden Feldherrn ebenso verführerische wie gefährliche Angebote: Pescara soll das Königreich Neapel, Francesco die volle Herzogsherrschaft in Mailand und, propagandistisch unverzichtbar, Italien die Freiheit vom spanischen Joch gewinnen. Das schöne Komplott krankt allerdings daran, dass Pescara nur scheinbar auf diesen Vorschlag eingeht, in Wahrheit aber Karl V. auf dem Laufenden hält. Dieser staunt nicht schlecht, dass auch sein Quasi-Bundesgenosse in Rom mit von der Partie ist, dem nach erfolgreichem Coup die Rolle als oberster Schiedsrichter Italiens zugedacht ist – mit vielen weiteren Aufstiegsmöglichkeiten für die Familie Medici, versteht sich.
Seinen Zorn muss der Kaiser jedoch einstweilen noch verbergen. Karl benötigt eine Sondererlaubnis, um die verwitwete Königin von Portugal, seine Cousine, heiraten zu können. Rom glaubt, dadurch in alt bewährter Weise ein unfehlbares Druckmittel in der Hand zu haben, und zieht die Dispensverhandlungen künstlich in die Länge. Währenddessen wird intensiv über die Konditionen für die Freilassung des französischen Königs gerungen. Und auch hier ist Rom an vorderster Front aktiv. Gesandte des Papstes sollen sondieren, ob Franz I. die vorgesehenen Bedingungen – unter anderem den Verzicht auf alle mailändischen und burgundischen Ansprüche – einzuhalten gedenkt, und ihn gegebenenfalls zum Wortbruch ermächtigen. Im Folgenden von beiden Seiten, der kaiserlichen wie der französischen, umworben, schwankt und wankt Clemens wie gehabt. Und aufgrund seiner Entscheidungsunfähigkeit wiederholen sich peinliche Episoden. Wieder ist das Bündnis mit Frankreich und Venedig zu Papier gebracht, erneut fehlt nur noch die Signatur des Papstes, als wie von Zauberhand ein kaiserlicher Bote am Vatikanischen Palast Einlass begehrt – natürlich mit Bündnisangeboten im Gepäck. Guicciardini, der das alles als ohnmächtiger Ratgeber miterlebt, fühlt sich wie in einem nicht enden wollenden Albtraum befangen: und täglich grüßt die Doppeldiplomatie. Was um alles in der Welt soll man nur an den Höfen Europas von dieser Politik halten? Ihm selbst bleibt ein gutes Jahrzehnt später in der Abgeschiedenheit seines Schreibkabinetts nur das letzte Mittel stolzer Selbstbehauptung: Ich, Francesco Guicciardini, habe anders geraten, aber die blinde Gier der Mächtigen nicht bezwingen können. Im Nachhinein ist die Feder stärker als das Schwert, der unbestechlich Kausalitäten aufzeigende Historiker mächtiger als die Herrschenden, er trägt den finalen Geschichtssieg über sie davon: so und nicht anders ist es gewesen.
Die Bündnisvorschläge Karls, die jetzt im Dezember 1525 nach Rom gelangen, sind nicht weniger doppeldeutig als die Strategien der Gegenseite. Die im kaiserlichen Schreiben enthaltene Bestätigung Francesco Sforzas als Herzog von Mailand nämlich würde den Kaiser nicht daran hindern, diesem als ungetreuen Vasallen den Prozess zu machen – sofern er von dessen Verwicklung in die Verschwörung weiß. Weiß der Kaiser und tut nur so, als ob er nicht wüsste, oder weiß er wirklich nicht, das sind die Fragen, die man sich in Rom besorgt stellt. Und weiß er von der Rolle des Papstes in all diesen Intrigen? Clemens zögert und erhält zwei Monate Frist, um den Allianztext nach eigenen Vorstellungen zu modifizieren. Davon abgesehen, versichern sich beide Seiten ihres unverbrüchlichen Vertrauens – und wissen doch genau, dass der Schein triumphiert. Clemens nämlich verfasst eigenhändig einen langen Brief an den Kaiser, der die besten Wünsche zum neuen Jahr 1526 ausdrückt und zugleich von doppeldeutigen Formeln nur so wimmelt, die Verstrickung in das Komplott weder zugibt noch leugnet, vorsorglich aber alle Schuld auf den – inzwischen opportunerweise verstorbenen – Marchese di Pescara abwälzt. Was ganz und gar nicht stimmt, wie die Kaiserlichen peinlicherweise genau wissen.
Unterdessen ist sich Karl V. mit seinem illustren französischen Gefangenen über die Konditionen von dessen Freisetzung einig geworden. Die harten Auflagen sind Makulatur. Franz denkt nicht einen Augenblick daran sie einzuhalten, darin vom Papst weiterhin tatkräftig bestärkt. Dieser nämlich tendiert jetzt mehr denn je zum Bündnis mit Frankreich und Venedig gegen den allmächtigen Kaiser. De facto geht es also um Machtpolitik, offiziell um Harmonie in der Christenheit als Voraussetzung für den Kampf gegen die Osmanen. Währenddessen wird die Lage der Eingeschlossenen im Mailänder Kastell immer prekärer; der Herzog ist krank, vom Damoklesschwert des Prozesses eingeschüchtert, und die Lebensmittel werden knapp. Die Einwohner der lombardischen Metropole leiden furchtbar unter der Zügellosigkeit der spanischen Soldaten, die sich als uneingeschränkte Herren über Leben und Besitz aufführen. Vor diesem Hintergrund neigt sich die politische Waagschale endgültig zum anvisierten Dreierbündnis Frankreich-Rom-Venedig. Dessen Abschluss wird jetzt vom Papst – in einer Art psychologischer Schubumkehr – über alle Maßen forciert.
Bei ruhiger Betrachtung aber türmen sich gegen eine solche Allianz gravierende Einwände auf. Noch nämlich sind die Söhne Franz’ I. in spanischer Geiselhaft; Blut aber ist dicker als Wasser, das gilt allemal für einen König, der nur durch das Fehlen männlicher Erben in der Hauptlinie des Hauses Valois auf den französischen Thron gelangt ist und seine Dynastie um jeden Preis fortsetzen möchte. So aber ist der wichtigste Verbündete des Papstes, kommt es hart auf hart, zu heiligem Egoismus verdammt. Ähnlich egoistisch sind die Prioritäten Venedigs: nur keine Wiederholung des achtjährigen Abnutzungskriegs auf eigenem Territorium wie zwischen 1509 und 1517 gegen Kaiser Maximilian. Clemens aber glaubt sich durch die Liga von Cognac, die am 18. Mai 1526 abgeschlossen wird, wieder einmal aller Sorgen ledig. Obwohl sich das Bündnis für alle Welt einsichtig gegen Karl V. richtet, wird dieser zum Beitritt binnen drei Monaten aufgefordert, wofür allerdings Gegenleistungen zu erbringen sind: Freilassung der königlichen Prinzen und Garantien für Francesco Sforza. Diese Einladung wird von kaiserlicher Seite denn auch als das verstanden, was sie ist: eine sinnentleerte Formalität, wenn nicht Hohn und Spott. Vorsorglich hat die Liga nämlich schon die Heereskontingente in einem Krieg gegen das Reichsoberhaupt festgelegt. Der im Geschützwesen unvergleichlich versierte Herzog von Ferrara, ein regelrechter Kanonen-Künstler, ist auf ausdrücklichen Wunsch des Papstes nicht dabei. Noch gravierender: der französische König zögert mit der Ratifizierung des Bündnisses. Er hat ein weiteres Blatt im Ärmel: Verhandlungen mit dem Vizekönig von Neapel, also mit Spanien und Karl V. Wie du mir, so ich dir. Gegen diesen Papst muss man sich absichern.
Denn auch dessen Verhandlungen mit der Gegenseite gehen weiter. Trotzdem setzen jetzt die Kriegshandlungen ein. Das Heer der Liga, obwohl noch ohne die sehnlichst erwarteten Schweizer Söldner – das militärische Zünglein an der Waage in den Kriegen dieser Zeit –, beginnt seine Operationen in der Lombardei, wo es Lodi erobert. Der Befehlshaber des venezianischen Aufgebots und zugleich de facto Oberkommandierender der gesamten Armee ist ein alter Bekannter der Medici: Francesco Maria della Rovere, Herzog von Urbino. Ihn hatte Clemens’Vetter, Papst Leo X., 1516 in einem selbst nach den moralischen Maßstäben der Zeit schmutzigen Krieg aus seinem Herzogtum vertrieben, um dort einen Nepoten einzusetzen. Francesco Maria hatte zwar nach dem Tod Leos seinen Staat zurückgewonnen, doch unter Verlust einiger Gebiete, die an Florenz gefallen waren. Mit Clemens VII. war also eine Rechnung offen. Dementsprechend führt der Herzog jetzt und in der Folgezeit einen seltsamen Krieg. Vollmundige Verlautbarungen unmittelbar bevorstehender Triumphe kontrastieren mit Ausweichmanövern und Rückzügen allerorten. Dabei beruft er sich nicht minder hochtönend auf die spezifisch italienische Militärtradition: ragione, also Vernunft, nicht ferocia, Wildheit nach barbarischem Muster, sei der Garant des Erfolges. So zögerlich wie ihn aber hat man die hoch gerühmten gentleman-condottieri der Vergangenheit nie agieren sehen. Obwohl andauernd frisch angeworbene Schweizer ins Lager strömen, traut sich der Herzog erst sehr spät, die Belagerung von Mailand zu beginnen. Kurz zuvor trifft dort der Konnetabel von Bourbon mit spanischen Söldnern ein.
Auch er ist ein Heerführer der besonderen Art. Er hat die uralte Bindung seines Hauses an die Krone von Frankreich zerrissen und ist zum Kaiser übergelaufen; diesen Verrat bezahlt er mit der Verachtung seiner Standesgenossen in ganz Europa. Die kaiserlichen Soldaten in Mailand sind weniger empfindlich. Obwohl ihr Aufgebot dem der Liga weiterhin zahlenmäßig unterlegen ist, hebt dieser Zuzug die Stimmung in der belagerten Metropole. Und als die Verteidiger am Morgen des 8. Juli 1526 über die Mauern lugen, trauen sie ihren Augen nicht: Wo bitte sind die Feinde? Der Herzog hat den Abzug in angeblich sicherere Positionen, einige Meilen von der gemarterten Stadt entfernt, befohlen; seine wenig erfahrenen italienischen Fußsoldaten seien der Kampfkraft der spanischen Veteranen nicht gewachsen. Dabei hatten Scharmützel des Vortags genau das Gegenteil erwiesen. Della Roveres Offiziere sind ebenso rat- wie machtlos gegen diesen merkwürdigen Entschluss. Guicciardini schüttet klassischen Hohn aus: veni, vidi, fugi, dieser Anti-Cäsar kam, sah und floh.
Während im Norden eine Kriegskomödie zu seinem Nachteil aufgeführt wird, verhandelt Clemens VII. in Rom unverdrossen hinter dem Rücken seiner Alliierten, um sie zu möglichst günstigen Konditionen im Stich zu lassen. Und zu allem Überfluss lässt er sich darauf ein, einen Regimewechsel in Siena herbeizuführen, zum Nutzen und Frommen von Florenz und der Medici, die sich eine gefügige südliche Nachbarstadt wünschen. Dilettantisch eingefädelt, schlägt der Coup fehl, und das, obwohl die Republik Siena für ihre zermürbenden Konflikte zwischen rivalisierenden Interessengruppen berüchtigt ist, fremde Mächte also gute Interventionschancen haben. Unterdessen haben auch die Verteidiger des Mailänder Kastells die Waffen gestreckt. Francesco Sforza ist in den Händen seiner potentiellen Ankläger, was zu verhindern ein Hauptziel der Liga von Cognac gewesen war. Jetzt, da in Mailand alles verloren ist, zieht der Herzog von Urbino wieder vor die Mauern der Stadt; irgendwie muss man die vielen tausend Soldaten ja beschäftigen. Spektakuläre Aktionen aber bleiben weiterhin aus.
So viele Misserfolge rufen unweigerlich die inneren Gegner des Papsttums auf den Plan, die endlich die Stunde der Abrechnung herannahen sehen. Besonders kühne Pläne hegt die führende Baronalfamilie der Colonna, die seit alters Dutzende von castelli, Bergdörfern, in der römischen Umgebung und bis ins Königreich Neapel hinein beherrscht. Die Colonna wittern die Gelegenheit, ihre seit den Zeiten Alexanders VI. stetig verringerte Macht in alter Herrlichkeit zurückzugewinnen. Und sie brennen darauf, den verhassten Pontifex, der ihren chronisch oppositionellen Kardinal Pompeio aus dem Senat der Kirche ausgeschlossen hat, in seinem ureigenen Lebensraum zutiefst zu demütigen. An dieser zweiten Front stellt sich ein ungerufener Friedensstifter ein: Ugo de Moncada, seines Zeichens Vizekönig von Sizilien und laut Guicciardini einer der vielen düsteren Protagonisten, welche die schattenreiche diplomatische Bühne der Zeit bevölkern. Dementsprechend werden die Unterhandlungen zwischen Clemens und Don Ugo zu einem Paradestück der Doppelzüngigkeit. Der Papst nämlich plant, mit eigenen Truppen und seinen Verbündeten die spanische Herrschaft in Neapel zu stürzen. Und der Vizekönig hegt die Absicht, den ziellos hin und her schwankenden Pontifex mit Versöhnungsangeboten des Kaisers und der Colonna, dessen fünfter Kolonne in Rom, vollends zu desorientieren. Das gelingt in der Tat aufs beste, denn wieder einmal ist Clemens für die Täuschungsmanöver der Gegenseite blind. Er glaubt weiterhin, die Situation im Griff zu haben – und täuscht sich entsetzlich.
So ermahnt er in herrischen Tönen den König von Frankreich, endlich mehr Initiative zu zeigen und am besten Mailand, Genua und Neapel gleichzeitig anzugreifen. Und selbst den feindlichen Vasallen in Ferrara umwirbt der Papst, freilich auf seine Art. Was sollte der ahnenstolze Este-Herzog, der im Gegensatz zu den Medici-Parvenüs auf zweieinhalb Jahrhunderte der Herrschaft in seiner Hauptstadt sowie in Modena und Reggio zurückblicken konnte, von dem Vorschlag halten, die beiden letzteren Städte gegen das weitaus ärmere und zudem von den Venezianern begehrte Ravenna einzutauschen?
Inzwischen hat der Herzog von Urbino das Mailänder Unternehmen erneut abgeblasen und sich ein leichteres Objekt ausgewählt: Cremona, das sich bald darauf ergibt. Der strategische Nutzen dieser Alibieroberung tendiert gegen Null. Aufregender geht es derweil in Rom zu. Dort nämlich ist der große Coup der Colonna herangereift. Während ein Scheinangriff auf das Richtung Neapel gelegene Anagni die päpstlichen Truppen ablenkt, erstürmen sie mit gut fünfhundert Fußsoldaten und einigen Reitern in der Nacht zum 20. September 1526 drei südliche Stadttore, rücken nach Trastevere ein und dringen in den von Truppen weitgehend entblößten Borgo beim Vatikanischen Palast vor. Anfangs entschlossen, wie einst Bonifaz VIII. 1303 in Anagni im vollen päpstlichen Habit, die Tiara auf dem Kopf, unerschütterlich dem Ansturm der Gegner zu trotzen, wird Clemens VII. in letzter Minute in die Engelsburg und damit in Sicherheit gebracht. Denn dies ist nicht der Augenblick für effektvolle Inszenierungen. Die Familie Colonna, speziell der zu allem entschlossene Kardinal Pompeio, trachtet dem Pontifex nach dem Leben. Um ihre blutige Rache gebracht, halten sich die entfesselten Barone an Kult- und Kunstgegenständen des Vatikans schadlos und plündern, was nicht niet- und nagelfest ist. Der ganze Spuk dauert nicht länger als drei Stunden. Die Römer aber lassen sich die Nachtruhe nicht stören; für diesen Papst rührt keiner einen Finger.
Diese Parole gilt auch in der Lombardei, wo der Herzog von Urbino weiterhin energie- und ziellos rochiert. Inzwischen aber hat sich nördlich der Alpen Bedrohliches zugetragen. Nachdem die kaiserlichen Rüstungen aufgrund chronischer Geldknappheit nur zögernd vorangekommen sind, sammelt der populäre Landsknechtführer Georg von Frundsberg in Süddeutschland seine Veteranen, die durch das Ende des Bauernkriegs arbeitslos geworden sind, und stellt sie in den Dienst des Kaisers. Dieser allerdings hat kein Geld, um sie zu besolden. Obwohl Söldner normalerweise höchstens zwei Monate ohne Bezahlung bei der Fahne bleiben, kommt es in dieser eigenartigen Armee nicht zu den üblichen Meutereien. Das ist ein Alarmzeichen für die Feinde. Offenbar gibt es alternative Anreize – unheimliche Antriebe: Der Hass der vielen lutherisch gesonnenen Landsknechte gegen den Papst und nicht zuletzt nationale Ruhmes- und Revanchebedürfnisse halten diesen wilden Haufen zusammen. Man will den perfiden Italienern ein für alle Mal zeigen, was eine ehrliche deutsche Pike ist – und natürlich reiche Beute machen. Im Herbst 1526 hat dieses verwegene Heer den Gardasee erreicht und strebt Richtung Mailand, um sich mit den Truppen Bourbons zu vereinigen. Den Winter verbringen beide Seiten mit Stellungs- und Quartierwechseln, wobei intensivere Feindberührung vor allem von Della Rovere vermieden wird. Dennoch kommt bei einem strategisch überflüssigen Scharmützel der einzige Unterführer der Liga ums Leben, der das Zeug zum energischen Generalkommandanten gehabt hätte: Giovanni delle Bande Nere aus der jüngeren Linie des Hauses Medici.
Aber auch ohne größere Kampfhandlungen spitzt sich die Lage im Norden weiter zu. Frundsbergs vierzehntausend Landsknechte wollen verköstigt werden; die Versorgungsschwierigkeiten der spanischen Kontingente sind kaum geringer. Da die Poebene nach fast drei Jahrzehnten ununterbrochener Feldzüge ausgeplündert ist, der Krieg sich dort also nicht mehr selbst ernähren kann, muss man den Ort des Geschehens nach Süden verlagern; Toskaner und Römer sehen es mit ohnmächtigem Entsetzen. In Rom aber verhandelt Clemens weiterhin mit Moncada, als ob er alle Zeit der Welt und das allerbeste Gewissen hätte. In diesem Sinne hatte er ein bitterböses Breve an Karl V. gesandt, in dem er diesem als Kriegstreiber schwerste Vorhaltungen machte und sich selbst als unschuldiges Opfer dieser hinterhältigen Machenschaften darstellte. Dieser Ton erschien ihm dann allerdings nach dem üblichen Hin- und Herüberlegen zu scharf, so dass der fast schon obligatorische Zweitkurier mit einem weitaus milderen Schreiben hinterhergeschickt wurde, aufgrund des schlechten Wetters seinen Kollegen jedoch nicht mehr einzuholen vermochte. So kam Karl in den Genuss der beiden Texte, auf die er sich zweifach zu antworten das Vergnügen machte: einmal schroff, einmal verständigungsbereit. War das der Punkt ohne Wiederkehr, der letzte Anstoß dazu, den Dingen ihren Lauf zu lassen und diesen Papst seinem Schicksal zu überantworten?
Auch andernorts werden makabre Komödien aufgeführt. Geronimo Morone, die schwarze Seele der antikaiserlichen Verschwörung, sieht seiner für den nächsten Tag angesetzten öffentlichen Hinrichtung mit amüsierter Gelassenheit entgegen. Zu Recht: auf dem Schafott tut sich nichts, die schaulustigen Mailänder müssen enttäuscht von dannen ziehen. Der schlaue Diplomat wird nicht nur begnadigt, sondern rückt auch gleich wieder in seine alte Führungsposition auf. Im Zeitalter des Scheins sind Meisterbetrüger wie er absolut unverzichtbar. Das Jahr 1526 endet, wie es begonnen hatte: mit bösen Vorzeichen für Rom. Am Silvestertag nämlich schließt der Herzog von Ferrara einen Pakt mit dem Kaiser – rette sich, wer kann. Inzwischen nähert sich dessen immer zügellosere Armee Bologna und damit den Apennin-Übergängen. Clemens VII. aber sieht keinerlei Grund für Besorgnis oder gar Eile. Er führt in der nächsten Umgebung Roms Krieg gegen die Colonna und spanische Truppen, natürlich ohne die Unterredungen mit Moncada abzubrechen. Und während im Januar und Februar 1527 Moncadas Truppen Frosinone im römischen Hinterland belagern, versichern sich Papst und Kaiser in einem freundlich gehaltenen Briefwechsel ihrer guten Absichten und wechselseitigen Friedenssehnsucht, was Frankreich und Venedig naturgemäß aufs Höchste irritiert. Clemens zieht aus den milden Tönen seines Kontrahenten den Schluss, weiterhin am längeren Hebel zu sitzen, und hält dementsprechend seine Verbündeten energisch dazu an, mit der Expedition gegen Neapel endlich Ernst zu machen. Am 12. Februar soll das Unternehmen beginnen. Die Beute ist schon vorab verteilt. Das südliche Königreich ist für einen französischen Prinzen reserviert, der die siebenjährige Caterina de’Medici, eine Nichte des Papstes, heiraten soll; große Politik und Nepotismus befinden sich in zeittypischer Interesseneinheit. Der angesichts der Lage im Norden äußerst riskante Feldzug aber gerät von Anfang an ins Stocken: kein Geld, nichts zu essen, mangelhafte Logistik und keinerlei Enthusiasmus, stattdessen tiefes Misstrauen auf allen Seiten.
Die eisernen Würfel fallen anderswo. Dem abgerissenen kaiserlichen Heer hingegen stellt sich auf seinem Weg zur Beute kein nennenswerter Widerstand entgegen. Stattdessen hat der Herzog von Urbino eine Art Escortservice eingerichtet. Ein kleiner Heeresverband der Liga zieht der feindlichen Armee voraus, der große Rest hinterher, in sicherer Entfernung, versteht sich. Jetzt endlich geht Clemens’ Beratern ein Licht auf. Vielleicht sollte man dem Herzog von Urbino seine verlorenen Gebiete zurückgeben. Der Papst ist strikt dagegen. Sein Geiz erlaubt vorerst kein Einlenken; zähneknirschend gibt er am 13. April dann doch nach – als es längst zu spät ist. Inzwischen nämlich hat die feindliche Truppe das Gebirge überschritten und peilt Florenz an: rasend vor Hunger und Wut. Ihr sind auch die eigenen Kommandeure längst nicht mehr gewachsen; der Einzige, der diese verrohten Söldner noch bändigen könnte, Frundsberg, hat einen Schlaganfall erlitten und die Sprache verloren.
Statt sich in letzter Minute zu energischen Verteidigungsanstrengungen aufzuraffen, setzt Clemens weiterhin auf Verhandlungen, natürlich mit beiden Seiten. Einerseits fordert er immer kategorischer Unterstützung von seinen Verbündeten, andererseits schließt er mit den Kaiserlichen einen Waffenstillstand auf acht Monate. Im Glauben, jetzt endlich im sicheren Hafen angekommen zu sein, gibt er – wiederum den Bestimmungen des Pakts vorauseilend – allen Gegnern in der römischen Campagna ihre zwischenzeitlich entzogenen Besitzungen zurück. Frankreich und Venedig sind naturgemäß alles andere als erfreut über die hinter ihrem Rücken getroffenen Abmachungen; ihre ohnehin geringe Bereitschaft, dem irrlichternden Pontifex maximus noch zur Hilfe zu eilen, erlahmt vollends. Nur ein einziges Mittel könnte die rasende Soldateska jetzt noch aufhalten: viel Geld, bar auf die Hand. Dazu aber sieht Clemens nicht den geringsten Anlass; wo blieben dann seine Nepoten? Andere sind klüger und greifen nach diesem Strohhalm; Bologna etwa kauft sich in letzter Minute von der Plünderung frei.
Der Papst aber pocht auf sein Vertragspapier und entlässt seine letzten Truppen. Als das kaiserliche Heer vor den Mauern von Florenz angekommen ist, brechen dort Tumulte aus. Seit vier Jahren trug die Arnostadt die Kosten der päpstlichen Politik; jetzt aber, im Augenblick der höchsten Gefahr, sieht sie sich allein gelassen. Längst war ein großer Teil des Patriziats und die überwältigende Mehrheit der Mittelschicht das pseudorepublikanische Vormundschaftsregiment des Papstes beziehungsweise seiner arroganten Parvenüs vor Ort überdrüssig. Sie alle werden jetzt vertrieben, jedoch binnen weniger Stunden zurückgeholt und wieder eingesetzt. Noch ist die Macht des Papstes nicht gestürzt, noch funktionieren seine Sicherheitskräfte. Um dieselbe Zeit, am 25. April 1527, hatte sich Clemens wieder seiner Verbündeten erinnert und eine neue Föderation mit Frankreich und Venedig geschlossen. Doch dieser Panikdiplomatie trauen die nominellen Alliierten längst nicht mehr; auf ein alles entscheidendes Gefecht lassen sie sich weiterhin nicht ein.
Nur pro forma werden einige Truppen per Eilmarsch Richtung Tiber geschickt; sie bleiben Zaungäste des dortigen Geschehens. In Rom nimmt der Papst den condottiere Renzo da Ceri unter Vertrag. Dessen große Zeit liegt lange zurück. Er versichert seinem Auftraggeber, dass die Verteidigung der Ewigen Stadt kein Problem darstelle und sich das feindliche Heer an deren Mauern die Zähne ausbeißen werde. Clemens ist beruhigt; vorsichtshalber lässt er jedoch einen feierlichen Aufruf an die Römer ergehen, sich ihrer mehr als zweitausendjährigen ruhmreichen Geschichte würdig zu erweisen. Das Echo ist schwach; der reichste Mann Roms, so Guicciardini süffisant, spendet dem Gemeinwohl stolze hundert scudi.
So kommt es, wie es kommen muss. In den Morgenstunden des 6. Mai 1527 erstürmt das kaiserliche Heer unter Bourbon, der gleich zu Beginn von einem Arkebusenschuss tödlich getroffen wird, ohne allzu große Mühe die Borgomauern, strömt von dort nach Trastevere und ergießt sich über die Brücken, die einzureißen man nicht für nötig befand, in die übrigen Stadtteile. Eine monatelange Terrorherrschaft der Soldateska hebt an, der inklusive der Kampfhandlungen an die viertausend Personen zum Opfer fallen. Und jetzt stürzt auch die Macht der Medici in Florenz quasi von selbst. Eine der üblichen Plünderungen aber, wie sie viele Städte der Zeit über sich ergehen lassen müssen, ist der Sacco di Roma nicht. Zum einen wird die Anarchie zum Dauerzustand; für die Römer bricht ein Alptraum an, der ein volles Dreivierteljahr dauert. Er kann zum anderen schon deshalb nicht enden, weil die Söldner keinen Befehlshaber mehr anzuerkennen bereit sind. Selbst kaiserliche Würdenträger, in die Ewige Stadt zur Herstellung eines Minimums von Ordnung abkommandiert, müssen um ihr Leben fürchten. Vor allem aber ist die Gewaltanwendung anders als sonst motiviert und auf andere Ziele gerichtet. Ein Großteil der deutschen Söldner hat aus der reformatorischen Propaganda die Botschaft mitgenommen, dass der Papst der Antichrist, Rom die Hure Babylon sei, die Vernichtung der Stadt und ihres Hauptes also ein frommes, möglicherweise sogar die seligen tausend Jahre Christi auf Erden einleitendes Erlösungswerk bedeute. Und dieser Auftrag wird nach Vorschrift, genauer: nach Gebrauchsanweisung vollzogen. Die wirkungsvollsten der antipäpstlichen Pamphlete nämlich waren, um ein leseunkundiges Publikum anzusprechen, mit aussagekräftigen Holzschnitten versehen. Darauf verrichten Landsknechte ihre Notdurft in die päpstliche Tiara, baumeln Kardinäle am Galgen. In der virtuellen Welt der Flugblätter wie in deren getreulicher Umsetzung auf römischen Straßen und Plätzen läuft alles auf einen dauerhaften Karneval, auf eine verkehrte, von oben nach unten und von unten nach oben gekehrte Weltordnung hinaus, in der die einfachen Leute sich selbst ein ewiges Schlaraffenland bescheren.
Dessen Verwirklichung schien jetzt endlich, im Zeichen des nahenden Weltenendes, angebrochen. Alle Zeugen der bestürzenden Vorgänge, so emotional ihr Bericht im Einzelnen auch aufgeladen ist, stimmen hierin überein: dass die Stunde der Profanierung, der systematischen Entweihung geschlagen hat, dass die Riten der Kirche jetzt zu deren Verhöhnung benutzt werden. Spottumzüge mit hohen Prälaten, rückwärts auf Maultiere platziert, dienen der Belustigung, vor allem aber der Selbstrechtfertigung der johlenden Menge und der Bestätigung der zentralen Botschaft: Dieser pervertierte Palmsonntag zeigt an, dass die Zeit gekommen ist, in der die Großen klein und die Kleinen groß sind. Söldner sind jetzt Herren. Wie echte Ritter nehmen sie vornehme Feinde gefangen und verlangen Lösegeld, im Unterschied zu ihren aristokratischen Vorbildern jedoch nicht einmal, sondern immer wieder. Und auch dann gibt es keine Garantie für die Freilassung. Nicht wenige römische Adelige müssen sich bis zu viermal aus den Händen ihrer Peiniger loskaufen – um dann doch nicht heil davonzukommen.
Schließlich aber kehrt sich diese Ökonomie des Terrors gegen ihre Urheber. Nach sechs Monaten der Anarchie nämlich ist in der Ewigen Stadt mehr Gold als Getreide vorhanden; Hunger und Seuchen sind die Folge. Am Ende fällt mehr als die Hälfte der Sieger den Folgen des Sieges zum Opfer. Es gibt also doch eine göttliche Nemesis, vermerken die meisten Chronisten erleichtert. Und noch eine Schlussfolgerung ziehen sie: Das Volk ist ein Tier, es bedarf der Zügel und gegebenenfalls der Ketten, damit es nicht über die Stränge schlägt. Einmal entfesselt, ist seine Herrschaft – von Neid, Ignoranz, Aberglauben und Dummheit angefacht – der schlimmste aller politischen Zustände.
Der Papst, im letzten Moment in die Engelsburg geflüchtet, verhandelt selbst in dieser äußersten Bedrängnis weiterhin mit Feind und Freund. Und am Ende hat er damit – so Guicciardinis ebenso resigniertes wie empörtes Fazit – sogar noch Erfolg. Schon bald nämlich gebärden sich Kaiser und Papst wie die engsten Freunde, das Malheur von 1527 ist schnell vergessen. Kein Wort mehr von dieser Peinlichkeit, als Clemens Karl an dessen dreißigstem Geburtstag in Bologna zum Kaiser krönt. Ein halbes Jahr danach, im August 1530, wäscht die eine Hand die andere, ein spanisches Heer macht der endzeitlich fanatisierten Republik in Florenz ein blutiges Ende. Die Medici sind wieder die Herrn ihrer Stadt. Und als i-Tüpfelchen auf der schönen dynastischen Freundschaft heiratet der neue Herzog von Florenz, Alessandro de’Medici, die ‘natürliche’ Tochter Karls V., Margarethe. Ihre sechsjährige Ehe wird ein Alptraum, dem erst die Ermordung ihres gewalttätigen Gatten durch einen eifersüchtigen Verwandten im Januar 1537 ein Ende setzt. Zu diesem Zeitpunkt liegt Clemens VII. schon über zwei Jahre im Grab. Er starb mit sich und der Welt zufrieden. Schließlich war es ihm gelungen, seine Familie auch mit dem Königshaus von Frankreich zu verschwägern; in Marseille hatte er höchstselbst den zweiten Sohn Franz’ I. mit Caterina de’Medici vermählt. Ihr wird viel später als Königin und Mutter von drei Königen eine bedeutende Rolle in der französischen Geschichte sowie ein lang anhaltender schlechter Ruf als Giftmischerin und Hugenotten-Mörderin beschieden sein – überwiegend zu Unrecht, wie die heutige Forschung befindet.
Überhaupt ist der Sacco di Roma kein tiefer Einschnitt, geschweige denn das brüske Ende einer Epoche. Nicht einmal das Papsttum verzeichnet die geringsten Sofortwirkungen. Nepotismus, Amtsverständnis, Selbstdarstellung, alles bleibt erst einmal unverändert. Langfristig aber stellt sich dann doch ein Memento ein. Die Herrschaft des Pontifex maximus ist auf Religion gegründet; übernatürliche, überzeitliche Einsetzung allein verleiht seiner Macht Weihe und Dauer. Dieser Unterschied zu weltlicher Macht bedarf der dauerhaften Umsetzung: in Propagandakunstwerken, aber auch in der praktischen Politik. Wenn der Papst jedoch dieselbe Staatsräson betreibt wie Kaiser und Könige, geht diese Differenz verloren. Das aber hat zur Folge, dass man mit Rom nicht zimperlicher umspringt als mit anderen Gegnern – und sich sein Machtanspruch definitiv verschleißt. Aus dieser Lektion von 1527 werden langfristig Lehren gezogen, verhüllter, indirekter, vorsichtiger zu agieren. Mit einem Schlüsselwort gesagt: es geht darum, prudenza zu praktizieren, sich vielfältig abzusichern, keine zu großen Risiken mehr einzugehen, Hintertüren offen zu lassen und vor allem in Worten, Bauten und Bildern die Andersartigkeit des Papsttums, seine religiöse Fundierung, zu verkünden. Um etwa 1600 ist diese Wende und Neuausrichtung definitiv vollzogen.
Zu diesem Zeitpunkt ruht Francesco Guicciardini seit mehr als einem halben Jahrhundert in der Familiengruft von S. Felicità in Florenz. Er hat den Wettlauf mit dem Tod knapp gewonnen – sein Werk ist fertig, er kann sterben. Auch er hat seine Schlüsse aus dem Schicksalsjahr 1527 gezogen. Alle Macht ist de facto Unvernunft, ihre Ausübung von der Verblendung der Mächtigen irregeleitet. Alle Macht ist daher böse. Die Geschichte gehorcht nicht der ordnenden Ratio, sondern wird vom verworrenen Kräftediagramm der Gier, der Expansion, des Betrugs getrieben. Vor allem aber bedeutet Geschichte umfassenden Wandel, der Mensch selbst bleibt in der Zeit nicht gleich; seine Vorlieben, seine Vorurteile, seine Glaubenswelten – alles ändert sich, und zwar fundamental. Man kann aus Vergangenheit nicht lernen, sondern sie nur im Rückblick verstehen. So erwächst aus der Katastrophe von 1527 eine große Erkenntnis und ein neuer Beruf: der des Historikers.