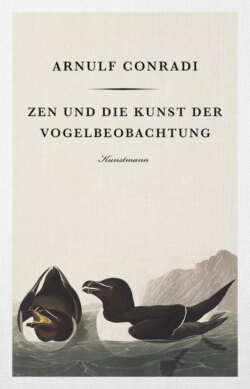Читать книгу Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung - Arnulf Conradi - Страница 7
I DIE ANTARKTIS
ОглавлениеSouth Georgia versank langsam hinter uns, während ich im Heck des Schiffes stand und auf den ersten Albatros dieser Reise wartete. Der Albatros ist halb Vogel, halb Mythos, in vielen Gedichten besungen, dem Menschen nahe wie sonst vielleicht nur der Schwan. Die Berge der Insel, die Shackleton einst auf seiner verzweifelten Wanderung überquert hatte, lagerten nun als flacher, rauchfarbener Schatten über dem Horizont. Das Wasser war ein dunkles Grün mit einigen weißen Schaumkronen, die gleißend auftauchten und gleich wieder versanken, und am Himmel zogen dicke, vom Wind getriebene Kumuluswolken mit dunkelgrauen, regenerfüllten Rändern über uns hinweg. Zwischen ihnen zeigten sich hier und da blaue Flecken am Himmel, und ab und zu trat die Sonne aus den Wolken und hellte das Grün der langen Wogen auf, ließ die Gischt auf ihnen erstrahlen. Der kraftlose Sonnenschein war ein blasses Gelb, das die Kälte der Luft eher betonte als milderte. Zwei riesige, fast rechteckig geformte, kastenartige Eisberge lagen schimmernd in ein paar Meilen Entfernung an Steuerbord, strahlend weiß, wo die Sonne sie traf, und mit grünlicher und blauvioletter Schattierung der zerklüfteten Kanten, wenn Wolken über ihnen standen. Ihre enorme Oberfläche war schneebedeckt, und sie erstreckten sich bis zum Horizont, flach und weit wie tausend Fußballfelder. Da, wo blauer Himmel über den Eisbergen stand, schien der Schnee einen Stich ins Blaue zu haben, als spiegelte er schüchtern den Himmel. Sie waren vom Schelf abgebrochen und würden nun als kleine, eisige Kontinente Jahrzehnte im kalten Wasser dahintreiben, bis sie in wärmere Breiten gerieten und abschmolzen. Einer von ihnen schien eine lange Nase vor sich herzuschieben, denn grünes Wasser brach sich schäumend weit vor seiner narbigen Stirn. Die kalte, klare Luft ließ alles näher erscheinen, als es war. Die Antarktis ist der trockenste, windigste und kälteste Kontinent der Erde – und fast menschenleer.
Ich stand hinten am Heck und beobachtete die schwarzweiß getüpfelten Kapsturmvögel, die sich dem Schiff seit South Georgia angeschlossen hatten. Es waren etwa ein Dutzend, die über unserem Heckwasser schnell hin und her schossen, kreisten und sich immer wieder kurz auf dem Wasser niederließen. Die weißen Flecken auf ihren schwarzen Flügeln bildeten ein scheckig durcheinandergehendes Muster aus kräftigen Schwarz-Weiß-Gegensätzen. Kopf und Nacken der Kapsturmvögel sind ganz schwarz, der Rücken aber und der Bürzel weiß, und auf diesem reinen Weiß zeichnen sich bis in den Flügel hinein tiefschwarze, hier und da hingesetzte Tupfer in ganz verschiedenen Formen ab. Wie auf einem japanischen Gemälde standen da feine ebenmäßige Striche nebeneinander, kleinere und größere Flecken, einige zusammenhängend, andere wie Inseln. Zwei schwarze Balken dort, wo die unteren Flügelkanten an den Körper stoßen, trennten den Rücken vom Bürzel. Der Schwanz war ein breiter tiefschwarzer Streifen. Von der Kehle an war der Bauch strahlend weiß. Ein auffallender und ein auffallend schöner Vogel.
Die Kapsturmvögel treiben sich auf dem ganzen südlichen Ozean herum, im antarktischen Winter weichen sie bis hinauf zum Äquator aus – selbst im Mittelmeer sind sie schon beobachtet worden – und kehren dann in der Zeit von September bis Oktober zu ihren Kolonien zurück. Sie machen mit steifen Schwingen ein paar schnelle Flügelschläge und segeln dann knapp über den Wogen dahin, ganz ähnlich wie unser Eissturmvogel im Norden. Auch ein paar Taubensturmvögel mit ihrer blauschwarzen Zeichnung waren dabei, die geschwungene schwarze Linie wie ein umgedrehtes »W« auf dem Rücken. Ein Schneesturmvogel, ganz weiß mit dunklem Auge und dunklem Schnabel, strich vorbei, interessierte sich aber offenbar nicht für das Schiff. Das alles war schon faszinierend genug, um einen Vogelbeobachter auf dem kalten Heck festzuhalten.
Das Schiff lief mit der gleichmäßigen, endlosen Dünung des Südatlantiks nach Südosten, auf die South-Sandwich-Inseln zu. Wir befanden uns in den Breiten der »Roaring Forties«, die für ihre furchterregenden Stürme bekannt sind. In der Zeit des Segels wurden hier viele Schiffe, die immer wieder versuchten, gegen den vorherrschenden Westwind um das Kap Hoorn herumzukommen, nach Osten verschlagen. Wochenlang kreuzten sie, bis der Wind umschlug, oder sie wurden zurückgetrieben und scheiterten im Sturm. Ein »Kap Hoorner« zu sein galt als Ehrenzeichen unter den Seeleuten der damaligen Zeit. Diese kalten Gewässer mit ihren gewaltigen, stets nach Südosten laufenden Wogen müssen viele Schiffer, die in den Weiten des Südatlantiks herumirrten, zur Verzweiflung gebracht haben.
Der Albatros glitt aus der Himmelsrichtung, in der wir South Georgia hinter uns gelassen hatten, aus Nordwesten, auf das Schiff zu – die langen, schmalen Schwingen regungslos, in etwa fünf Metern Höhe über dem Meer. Auf diesen Augenblick hatte ich gewartet. Durch das Glas konnte ich erkennen, dass es ein junger Wanderalbatros war, das Gefieder noch nicht makellos weiß wie beim ausgewachsenen Wanderalbatros, sondern gefleckt, mit dunkelbraunen Streifen an den Armflügeln, mit dichtem Schwarz an den Flügelspitzen, das, zunehmend weiß gesprenkelt, bis zur Hälfte der Flügellänge reichte. Die helle Tüpfelung der Schwingen nahm mit der Nähe zum Körper deutlich zu und ging dann in ein strahlendes Weiß über, das nur von einem einzigen dunkelbraunen Streifen unterbrochen wurde. Der rundliche, kräftige Körper selbst war ganz weiß, nur der Schwanz trug eine schwarze Endbinde, die von schmalen weißen Längsstreifen durchbrochen war. Die Endbinde ist das letzte Merkmal, das der junge Wanderalbatros verliert, ehe er als erwachsener Vogel ganz weiß wird. Nur ein schmaler dunkelbrauner Rand, der sich zur Flügelspitze hin verbreitert, zieht sich dann noch auf der Unterseite an der hinteren Kante des Flügels entlang. Das Auge war ein dunkler Punkt mit einem kleinen schwarzen Dreieck am hinteren Augenwinkel, die hellgrauen Kopffedern bildeten über ihm eine schräg nach oben gerichtete Strichelung. Von vorne gesehen trug dieser junge Wanderalbatros noch eine braune Binde um den kräftigen Hals, die bis in die Brust hineinreichte. Der große Schnabel war ein blasses Pink, die beigefarbenen Beine ragten im Flug hinter dem kurzen Schwanz heraus.
Er hatte keine Mühe, das Schiff einzuholen, obwohl er seinen Flug mit keinem Flügelschlag unterstützte. Er schwebte ruhig herein, wie von einer unsichtbaren Hand geschoben. Die Schnelligkeit, mit der er das Schiff, das ja nicht langsam war, erreichte, war erstaunlich. Und ihn herangleiten zu sehen war ein unvergesslicher Augenblick.
Ich kannte das Dahinschweben der Möwen an der Ostseeküste, wo ich aufgewachsen bin. Schon als Kind habe ich bewundert, wie sie – oft auch gegen den Wind – ohne einen Flügelschlag über mir dahinzogen. Ich kannte das Kreisen der Seeadler am hohen blauen Himmel über der Uckermark. Auch das Schweben des Mäusebussards über den Kiefernwipfeln von Brandenburg zusammen mit seinem wilden Schrei ist eindrucksvoll. Ich habe in Afrika Adler und Geier beobachtet, und in den Bergen Feuerlands habe ich den Kondor dahingleiten sehen. Der Albatros aber kam auf mich zugeschwebt, als trüge er eine Botschaft aus dem Herzen der Natur.
Dieses schwerelose Schweben ist Teil des evolutionären Wunders des Vogelflugs, der schon immer das Staunen und die Sehnsucht des Menschen geweckt hat. Ob es nun die kleinen Finken sind, die zwischen schnellen Flügelschlägen mit angelegten Schwingen dahinschießen, oder die unfassbar schnellen Schwalben und Mauersegler, die eleganten Raubvögel wie Milane oder Weihen oder die großen Segler wie die Geier und Adler in Afrika, der Kondor in Südamerika und der Albatros in den südlichen Breiten des Atlantik und Pazifik – der Vogelflug ist etwas, was die Dichter und Erzähler, aber auch die bloßen Beobachter immer schon inspiriert hat. Zu fliegen wie ein Vogel ist ein Menschheitstraum, der sich nie erfüllt hat.
Wenn man an der Nordsee im dünner werdenden Abendlicht auf einem Deich im Gras liegt und die Möwen und Limikolen über sich hinwegstreichen sieht und ihre Rufe hört, das Gefieder hell vor dem sich verdunkelnden Blau des Abendhimmels, dann spürt man etwas von dieser Sehnsucht. So möchte man auch dahintreiben, frei und leicht, nicht gekettet an die Erdenschwere. Vielleicht hat sogar der Impuls, Vögel zu beobachten, seinen tiefsten Grund in diesem Traum, diesem Wunsch, sie nachzuahmen und irgendwohin zu fliegen. Was für ein Gefühl muss es sein, die Erde unter sich zu sehen, die Wälder, die Seen, die Flüsse. Und wie grenzenlos ist die Freiheit der Vögel, sich zu bewegen, neue Routen zu fliegen und in fremden Landschaften zu landen. Denn die Vögel fliegen überallhin. Wenn man ihre Flugrouten betrachtet, ergeben sich ganz neue geografische Verbindungen, nicht nur große Entfernungen, die sie mit immer noch rätselhaftem Orientierungssinn überwinden, sondern auch seltsame, fast spielerische Umwege – Schleifen und Ausflüge, die der Logik und der Ökonomie der Kräfte zu widersprechen scheinen. So fliegt unsere Küstenseeschwalbe, um ein extremes Beispiel zu nennen, in den äußersten Süden der Erde (ich habe sie selbst in der Antarktis gesehen), um ausgerechnet dort, wo es am kältesten ist, zu »überwintern«. Damit nicht genug, fliegt sie die afrikanische Ostküste hinunter und wechselt dann nach Südamerika über, wo sie über Feuerland die Antarktis erreicht. Es gibt Ornithologen, die ernsthaft die These vertreten, das uralte Gedächtnis dieser Vögel habe eine Zeit gespeichert, in der die beiden Kontinente noch zusammenhingen oder zumindest dichter beieinanderlagen. Und die Surfbirds, die ich im Norden Kanadas, am Polarkreis beobachten konnte, fliegen die ganze nordamerikanische Pazifikküste hinunter, weiter an der südamerikanischen Küstenlinie hinab, um dann nach Westen abzubiegen und ein paar Inseln in den Weiten des Pazifik aufzusuchen. Wie sollte man sie nicht beneiden, nicht der träumerischen Sehnsucht nachgeben, so zu sein wie sie?
Der Vogelflug hat auch den Glauben der alten Völker an göttliche oder übersinnliche Zeichen und Botschaften angeregt. Vor großen Entscheidungen suchten die Auguren dieser Zeit Hinweise auf den Willen der Götter und das Schicksal der Menschen im Flug der Vögel. Die langen Ketten der ziehenden Vögel am Horizont wirken wie rätselhafte Schriftzeichen, wie eine Kalligrafie der Natur. Ich habe an klaren Abenden vor allem an der Ostküste der USA endlose und kaum einmal unterbrochene Reihen von fernen Vögeln gesehen, etwa auf Martha’s Vineyard oder auf den Outer Banks von North Carolina, nur Tupfer vor dem lichtgrauen Himmel – unendlich viele, die auf dem Weg nach Süden waren, ein Anblick, der selbst wirkte wie ein Traum. Aus der Ferne erscheinen sie wie eine Schrift der Natur, die niemand entziffern kann. Aber ihr Anblick ist Anlass genug, die Botschaften der Natur aufzunehmen, Botschaften, die uns aufrufen, sie zu schützen und zu erhalten.
Wenn man eine Landschaft liebt, sie immer wieder aufsucht – das Land am Meer, die Berge, die Seen der Uckermark –, verbinden sich mit ihr nicht nur der optische Eindruck, sondern auch die Laute, die man wahrnimmt, vor allem die Rufe der Vögel, die dort häufig vorkommen und die zum Symbol dieser Landschaften werden. Die Lachmöwe an der Ostsee etwa, der Schrei der Silbermöwe oder der Ruf des Austernfischers an der Nordsee, der Anblick des Seeadlers am hohen blauen Himmel über den Seen der Uckermark. Wie tief diese Verbindung geht, merkt man, wenn man etwa in einem Film den meckernden Ruf der Lachmöwe hört – die Assoziationen stellen sich fast sofort ein. Man glaubt, dort zu sein. Diese Rufe lösen nicht einfach nur Erinnerungen aus, sie versetzen einen zurück, ganz unwillkürlich, und sie sind immer auf schwer fassbare Weise mit Sehnsucht verbunden. Es ist etwas Zeitloses in den Rufen der Vögel. Stammesgeschichtlich sind sie sehr alt – sie stammen von den Reptilien ab. Wenn man den klagenden Ruf der Silbermöwe hört, weiß man, dass dieser Laut über dem Watt der Nordsee schon ertönte, als es noch keine Menschen gab. Dieses Gefühl der Zeitlosigkeit gehört auch zu der Empfindung, die man, wahrscheinlich unbewusst, in sich spürt, wenn man abends an der Nordsee am Watt entlanggeht. »Einsames Vogelrufen, so war es immer schon«, heißt es bei Storm in einem seiner schönsten Gedichte.1
Der Albatros ist der Vogel der Weite des Meeres, der endlosen Freiheit, der Eintönigkeit der dahingleitenden Wellen, der Gewalt der Stürme, die sich hier ungehindert entfalten können. In den vierziger, fünfziger und sechziger Breiten der Meere befindet sich sein Lebensraum, und der zieht sich um den gesamten Globus. Bis zu tausend Kilometer an einem Tag kann der Wanderalbatros zurücklegen, mit sehr geringem Energieaufwand. Offenbar ist es ihm möglich, die Flügelgelenke in Ellenbogen und Schulter (wenn man es beim Vogel so nennen darf) zu arretieren, sodass er keinerlei Energie verliert. Nach neueren Beobachtungen steigen die großen Vögel dann und wann in größere Höhen auf – bis zu zehn oder fünfzehn Meter –, woraus sie sich mit einer steilen Flugkurve und hinterher im allmählichen Sinkflug neue Energie holen, um dann wieder mit regungslosen Schwingen dahinzuschweben. Die Wissenschaftler haben es sogar geschafft, den Puls der Segler zu messen, und sie stellten fest, dass er beim dahingleitenden Albatros fast dem Ruhepuls entspricht. Das ist nicht weiter überraschend, wenn man weiß, dass der Albatros im Flug schläft.
Land betreten die Albatrosse nur, um sich fortzupflanzen. Wenn sie ein Junges haben – meist ist es nur eines –, wird es von den Alten so reichlich mit Nahrung vollgestopft, dass es schließlich schwerer ist als ein Elternvogel. Ist das Junge groß genug, um allein gelassen zu werden, gehen beide Eltern auf Nahrungssuche und kehren nur noch in Intervallen zum Nest zurück. Früher hat man gedacht, sie überließen das Junge ganz seinem Schicksal, aber das scheint nicht der Fall zu sein. Jedenfalls ist das Fett, welches das Junge angesammelt hat, überlebenswichtig, denn bei den seltener werdenden Besuchen der Eltern muss das Junge davon leben, bis es lernt, zu fliegen und selbst für seine Nahrung zu sorgen. Keine geringe Aufgabe für einen Jungvogel. Hat der Albatros kein Junges – und die Vögel ziehen höchstens alle zwei Jahre ein Küken auf –, lebt er ausschließlich in der Luft und auf dem Wasser. Und wenn die Elternvögel ein Junges großgezogen haben, lassen sie bis zu vier Brutperioden aus, um sich zu erholen. Sie schließen eine Partnerschaft fürs Leben, und sollte der Partner sterben, braucht der oder die Hinterbliebene sehr lange, bis er oder sie eine neue Verbindung eingeht. Es ist kein Wunder, dass sich Ornithologen, die den Albatros studieren, Sorgen um die Zukunft des gewaltigen Seglers machen. Die neuesten Zählungen zeigen nach einer gewissen Erholung in den Achtziger- und Neunzigerjahren wieder starke Rückgänge bei fast allen Albatrosarten, und man kann nur hoffen, dass dies eine vorübergehende Erscheinung ist. Liebt man die Welt der Vögel, muss man sich, so scheint es, immer Sorgen machen.
Die Kälte hier in der Antarktis hatte nichts Passives, sie fiel einen an wie eine Naturgewalt. Aber ich spürte sie nicht mehr, hatte auch jedes Gefühl dafür verloren, wo ich mich befand. Ich verschwand in dem magischen Gleiten des großen Vogels, der da langsam auf mich zukam. In der Beobachtung wurde ich für lange Minuten Teil seines Fluges, Teil dieser Leichtigkeit und Schönheit. Es war ein Jetzt, ein Augenblick, der sich tief einprägt – eine Senkrechte in der Zeit. Es war das, was man beim Vogelbeobachten unbewusst sucht, das Erleben eines Fluges oder der Anblick eines Vogels, auf den man lange gewartet hat. Man kennt das alles aus Bildern und Filmen, aber der reale Anblick, das Erleben, übersteigt immer jede Erwartung.
Der Anblick ist wie ein Stoß, und die Erfahrung geht durch den ganzen Körper – es ist offensichtlich kein nur zerebrales Ereignis, sondern wird sinnlich wahrgenommen, es erfüllt einen ganz und gar. Und die Aufgabe, die sich stellt, wenn man es erlebt, liegt darin, dieses Gefühl des sinnlichen Anstoßes möglichst zu verlängern, es für sich auf lange Zeit, vielleicht für das Leben fruchtbar zu machen. Man kann den Anblick eines Vogels nicht allein theoretisch vermitteln, indem man sagt, ich habe ihn gesehen, da und dort, und er sieht so und so aus. Das geht an der Unmittelbarkeit eines solchen Erlebnisses vorbei. Wenn man den Albatros sieht, ist man ganz bei dem Albatros und zugleich ganz bei sich. Da gibt es eine schwer zu erklärende Identität zwischen dem Sehenden und dem, was er sieht. Und von diesem Augenblick, diesem kostbaren Jetzt, geht eine große Ruhe aus.
Der Albatros zog an dem Schiff vorbei, flog in einem weiten Bogen um uns herum und ließ sich auf dem Wasser nieder. Offenbar hatte er mit seinem scharfen Auge irgendetwas Essbares auf dem Wasser gesehen und nahm es nun auf. Jetzt konnte ich den Kopf in Ruhe studieren und das Friedliche, Ruhige, das von seinem Gesichtsausdruck ausging, bewundern. Und nun sah ich auch den leichten Rosaton des Schnabels, von dem ich gelesen hatte. Lange trieb er in den Wellen so dahin, bis er schließlich mit einer gewaltigen Anstrengung den Körper aus dem Wasser hob und mit langem, platschendem Anlauf der breiten Füße wieder in sein eigentliches Element, die Luft, aufstieg. Sobald er eine gewisse Höhe, etwa zehn Meter, erreicht hatte, ging er in sein ruhiges Schweben über, flog mit regungslosen Flügeln ein paar Kurven und strich dann davon. Ich verfolgte ihn mit dem Glas, bis ich ihn im Dunstgrau des Horizonts verlor.
Es war nicht der erste Albatros, den ich sah. Neben einigen Schwarzbrauenalbatrossen, die ich in Südafrika von der Küste nördlich des Kaps der Guten Hoffnung aus beobachtete, habe ich zwei Albatrosse an einem sehr unwahrscheinlichen Ort gesehen – auf der Nordseeinsel Sylt. Ich war dort in der Nähe eines bekannten Restaurants am Strand entlanggegangen, um mich herum andere Spaziergänger, und ich war in Gesellschaft zweier Bekannter. Es war Ende April, kalt, und der starke Südwestwind trieb dicke Kumuluswolken weiß und grau schattiert über den blauen Himmel in Richtung Festland. Zwei ungewöhnlich große Vögel kamen von Südwesten her auf uns zugeflogen. Ich habe immer mein Fernglas bei mir, und ich blieb stehen und sah sie mir an, während sie noch auf den Strand zusteuerten. Dann drehten sie in einer einzigen, eleganten Bewegung ab und flogen nach Nordwesten wieder aufs Meer hinaus. Sie waren bis etwa siebzig Meter, so glaubte ich, an den Strand herangekommen. Ich erkannte sie sofort. Mollymauks, rief ich einem der Bekannten zu, während eine große Welle den Strand hinauflief und mir die Stiefel durchnässte. Mollymauk ist der ältere Name für den Schwarzbrauenalbatros. Die Engländer nennen alle mittleren Albatrosse »Mollymawks«, und diese Bezeichnung haben die Deutschen eine Zeit lang für den Schwarzbrauenalbatros übernommen. Ich hielt dem Bekannten das Fernglas hin und bat ihn aufgeregt, sich die Vögel anzusehen. Ich brauchte einen Zeugen, wenn ich die sensationelle Sichtung melden wollte, aber mein Bekannter war kein geübter Vogelbeobachter, kein »Birder«, und während er noch versuchte, mit dem Glas zurechtzukommen, waren die beiden großen Vögel schon zu weit weg, als dass man noch etwas hätte erkennen können.
Zu Hause, in der Wohnung, die wir gemietet hatten, begann ich zu telefonieren. Zuerst rief ich einen alten Bekannten auf Amrum an, den Buchhändler Quedens, der ein Kenner der Vogelwelt an der Nordsee war. »Sie haben Basstölpel gesehen«, sagte er mit großer Bestimmtheit. Ich war ein paar Monate zuvor in Irland gewesen und hatte vor der Westküste von Donegal Basstölpel beobachtet. Ich hatte sie sogar mehrmals gezeichnet. »Das waren keine Basstölpel«, sagte ich, »ich weiß, wie Basstölpel aussehen.« – »Sie haben Basstölpel gesehen«, sagte der alte Quedens mit norddeutscher Sturheit. Da war nichts zu machen. Auf einem DIN-A-4-Bogen begann ich dann, Telefonnummern aufzuschreiben: Beobachtungsstationen an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste, Bekannte, die dort wohnten und Vögel beobachteten. Ich besorgte mir sogar die Nummern von zwei Schiffen, die weit vor der Küste kreuzten, um die Bedingungen für Windparks zu untersuchen. Drei Tage verbrachte ich mit diesen Versuchen, jemanden aufzuspüren, der die Albatrosse gesehen hatte. Es waren etwa vierzig Gespräche. Den Bogen mit den Nummern und Adressen habe ich immer noch. Niemand hatte sie gesehen, und aus jeder Antwort ging die tiefe Skepsis hervor, die zuerst der alte Quedens so deutlich zu erkennen gegeben hatte. Schließlich gab ich auf.
Erst jetzt, im Jahre 2017, auch im April, las ich, dass im Rantumbecken auf Sylt und auf Helgoland ein Albatros gesichtet worden war – von so vielen Vogelbeobachtern, dass kein Zweifel mehr möglich war. Ein Schwarzbrauenalbatros. Meine Sichtung der beiden »Mollymauks« lag da schon zwölf Jahre zurück.
Ich sage nichts Neues, wenn ich behaupte, dass jede Beobachtung eines Vogels zu einer gesteigerten Wahrnehmung der Natur beiträgt. Jeder Vogelbeobachter wird bestätigen, dass der Anblick eines unbekannten oder seltenen Vogels die Zeit dehnt, die man in der Anschauung verbringt. Ich habe mal in einem Vogelbuch gelesen, dass der Verfasser, der, wie er selbst sagte, ansonsten nur ein mittelmäßiges Gedächtnis besaß, sich sofort an einen Ort erinnern konnte, wenn seine Frau ihm sagte, welchen Vogel er dort gesehen hatte. Ich bezweifle das nicht im Mindesten. Ich glaube, ich erinnere mich an jeden Ort, wo ich einen Eisvogel gesehen habe, dieses fliegende Juwel aus schimmernden Grün- und Blautönen. Der Anblick oder besser das Erlebnis, einen Albatros auf sich zufliegen zu sehen, prägt sich so tief ein, dass man ihn noch nach Jahren wieder aufrufen kann.
Die Vogelbeobachtung stärkt etwas in uns, was man das visuelle Gedächtnis nennen kann, aber nicht nur das – auch die Umgebung, in der man dieses Erlebnis gehabt hat, prägt sich ein, sodass auch kleine und scheinbar unbedeutende Dinge in der Erinnerung haften bleiben. Es ist ein schwer zu schilderndes Erleben, weil man es oft nicht bewusst registriert, sondern in ihm verschwindet, und wenn man nach einiger Zeit »erwacht« – meist, weil der Vogel weg ist –, findet man sich nur schwer zurecht. Es ist, als müsste man einen Traum abschütteln.
Die Begegnung mit der Welt des Eises war atemberaubend – eine Welt der Stille und des Sturms und ganz und gar unberührt vom Menschen. Dies war wahrlich eine der letzten Gegenden der Erde, die seit Jahrtausenden unverändert dalag, und man wollte unwillkürlich ein Stoßgebet zum Himmel schicken, dass es doch um Gottes willen so bleiben möge. Es gab hier eine unversöhnliche Natur, die trotz der Kälte und der Stürme von Leben wimmelte, wo die Robben und Pinguine jagten und auf eine unendliche Fülle von Fischen, Tintenfischen und Krebsen stießen, wo die Wale ihren uralten Wegen folgten wie einst die Elefanten in Afrika.
Ich verbrachte viele Stunden am Heck mit dem Fernglas in der Hand und beobachtete die Vögel, die das Schiff begleiteten. Ich sah noch ein paar Wanderalbatrosse. Wir glitten langsam an einer Kolonie von Schwarzbrauenalbatrossen auf einer felsigen Landzunge vorbei. Sie sind nicht ganz so groß wie die Wanderalbatrosse, die Spannweite ihrer Flügel erreicht »nur« zweieinhalb Meter. Ihr Bauch und die Kehle sind weiß, der Schwanz ist ebenso dunkelgrau wie der Rücken, und die Flügel sind von oben gesehen ein stumpfes Braun, das aus der Ferne natürlich schwarz wirkt. Von unten gesehen, haben die langen Schwingen nicht nur am hinteren Rand ein schwarzes Band, wie beim Wanderalbatros, sondern auch am vorderen, sodass das erste Bild, wenn man sich der Klippe mit den vielen kreisenden Vögeln nähert, ein scheckiges Gewirr aus Schwarz-Weiß ergibt, wie ein abstraktes Gemälde, das man erst allmählich aufschlüsselt. Die Schwarzbrauenalbatrosse wirken im Ganzen etwas plumper und kräftiger als die Wanderalbatrosse, weil sie einen gedrungenen, kurzen Hals haben, sodass es scheint, als säße der schwere Kopf direkt an den langen braunen Schwingen. Sie heißen Schwarzbrauenalbatrosse, weil sie einen schwarzen Streifen am Auge besitzen, der allerdings weniger eine Braue ist, die ja über dem Auge sitzen müsste, als ein durch das Auge gehender Schatten, der vor dem vorderen Augenwinkel ein breiter Flecken ist und sich hinter dem Auge dünn und lang zuspitzt und dann erst wie eine feine Braue in einem Bogen ausschwingt.
Jeder Vorsprung der schwarzen Felsen war von Schwarzbrauenalbatrossen besetzt, und die Luft war voll von ihnen. Hunderte zogen da ihre Bahn und kreisten um den Felsen, wie ich es früher einmal auf Helgoland und vor einer unbewohnten Insel an der französischen Küste gesehen hatte, wo die Basstölpel sich wie ein drehender weißer Nebel um die aufragenden Felsen legten. Ich hätte das Schiff gerne angehalten, aber das war natürlich nicht möglich. Später besuchten wir eine Schwarzbrauenalbatros-Kolonie. Die Vögel waren von den näher kommenden Menschen nicht weiter irritiert, und wir wurden mehrmals Zeuge, wie zärtlich und ausführlich die Pärchen sich begrüßten, wenn Männchen oder Weibchen hereingeschwebt kamen. Es war ein rührendes Ritual, das man auch von anderen Vögeln kennt, etwa den Störchen in meiner Heimat Schleswig-Holstein, bei denen jedes Wiedertreffen ebenso überschwänglich ausfällt. Es ist, als wollten sie sagen: Ja, ich bin’s, ich bin’s wirklich. Es handelt sich da um eine Art Überdetermination, damit auf keinen Fall ein Irrtum unterläuft. Nur dass die Störche vielleicht von einem zwei Stunden währenden Ausflug wiederkamen, während die Albatrosse manchmal erst nach Tagen zu ihren brütenden Partnern zurückkehren. Die Kolonie erstreckte sich über ein ganzes Plateau, das zu einer steilen Klippe aufstieg, von der die Albatrosse bequem losfliegen konnten. Denn das Starten und In-die-Luft-Kommen ist für die Albatrosse keine ganz einfache Geschichte. Auf dem Meer brauchen sie einen langen, platschenden Anlauf, und auf dem flachen Land haben sie größte Mühe. Am besten geht es, wenn sie eine über dem Meer aufragende Klippe in der Nähe ihrer Kolonie haben, wo sie sich in den Aufwind fallen lassen können.
Viel hört man von den Albatrossen nicht, außer einem allgemeinen, vielstimmigen Murren in der Kolonie. Aber es gibt den Ruf eines Albatros, der die ganze Wildheit der Antarktis und des südatlantischen Ozeans in sich zu schließen scheint. Das ist der Schrei des Rußalbatros, dieses eleganten, schwarz und dunkelbraun gefärbten mittelgroßen Albatros, und ich hörte ihn sowohl an der Küste von South Georgia als auch auf den Shetlandinseln. Der Kopf dieses Albatros ist ganz schwarz, und schon daran erkennt man ihn sofort. Der Rücken ist ein helleres Grau, die Flügel sind dunkelbraun, wirken aber aus der Entfernung oft schwarz. Der schwarze Schnabel hat, wenn man den Rußalbatros im Glas genau betrachten kann, eine seitliche Rille im unteren Schnabel, die deutlich blau schimmert. Es gibt eine Unterart, die in nördlicheren Breiten lebt, und die besitzt auch so eine Rille, aber die ist orangefarben oder gelblich. Wie das kommt, weiß niemand. Hinter dem Auge des Rußalbatros steht ein Halbkreis weißer Federn, der dem Vogel einen stets erstaunten Ausdruck gibt.
Der Ruf des Rußalbatros besteht aus zwei Tönen, die manchmal ineinander übergehen, manchmal deutlich getrennt herauskommen, der eine Ton ist tiefer als der andere, beide sind lang gezogen und klagend und von einer fast schon unheimlichen Wildheit. Ich habe immer das gedehnte, miauende »hiiiäh« unseres Mäusebussards für den Vogelruf gehalten, der das Wilde und Freie der Natur am vollkommensten ausdrückt, aber der Ruf des Rußalbatros übertrifft ihn noch an Intensität und Melancholie – eine klagende, wilde Dunkelheit liegt in ihm. Die Rußalbatrosse führen anscheinend während der Paarungszeit wunderbare synchrone Formationsflüge zu zweit auf, bei denen sie einander mit diesem Ruf antworten, aber das habe ich nicht erlebt.
Der Wind war aufgefrischt, und bald befanden wir uns in einem der Stürme, die sich in den Weiten des Südatlantiks ungehindert austoben. Die Kreise der Gäste beim Abendessen lichteten sich, und eine Frau fiel mit ihrem Stuhl einfach nach hinten um. Sie wurde wieder aufgehoben, hatte sich nicht verletzt und aß bald weiter. In diesen Breiten, schon in der Nähe der ersten Ausläufer der Antarktis, blieb es auch nachts hell, und ich ging noch einmal hinaus aufs Heck, wo der Wind um die Metallgeländer pfiff.
Ein Schwarzbrauenalbatros folgte dem Schiff, und auf den bewegten Wellen schaukelte, fast ebenso groß, graubraun und massig, ein Riesensturmvogel herum. Sein Kopf war hellgrau mit dunklen Einsprengseln, ansonsten waren der Körper, die Flügel und der Schwanz dunkelgrau und braun gefleckt. Die ältesten Riesensturmvögel haben schließlich einen ganz weißen Kopf. Der mächtige, wie mit Platten gepanzerte Schnabel war gut zu erkennen, auf den ersten Blick erschien er gelblichbraun, aber wenn man näher hinsah, gab es da noch andere Farben, ein blasses Grün, Rosa und Ocker. Die Augen dieses Vogels waren hell und durchdringend, aber sie können in derselben Spezies auch dunkelbraun und graubraun sein. Überhaupt sind die Riesensturmvögel im Aussehen sehr variabel, hell und dunkel, ein wenig wie unser Mäusebussard, der lange die Ornithologen verwirrt hat, und zu allem Überfluss gibt es noch einen »südlichen« Riesensturmvogel und einen »nördlichen«, die schwer zu unterscheiden sind. Sie fliegen mit den für die Sturmvögel typischen starren, gerade gehaltenen Schwingen, gleiten aber nicht so elegant wie die schlankeren Albatrosse, denen ihre längeren Flügel sehr viel mehr Beweglichkeit verleihen.
Ich kannte Sturmvögel aus den nördlichen Breiten – den Eissturmvogel etwa kann man auch auf Helgoland sehen, wo er sogar brütet. Sein riesiger Verwandter hier schien über die Maßen aufgebläht, eigentlich wirkte er zu massig, um überhaupt fliegen zu können. Ich hatte ihn ein paar Tage vorher schon an einem schwarzen Kiesstrand gesehen, den wir entlanggingen, und er war trotz der Menschengruppe, die da auf ihn zuwanderte, ganz ruhig sitzen geblieben. Ich konnte ihn in aller Muße studieren.
Der Riesensturmvogel hinter dem Schiff versuchte nun, in die stürmische Luft zu kommen, was aber bei der hohen Dünung gar nicht so einfach war. Er nahm mit klatschenden Füßen gewaltig Anlauf, machte ein paar Flügelschläge, kam knapp in die Luft, aber nicht hoch genug, um den nächsten dahinwandernden Wellenkamm zu überwinden, und fiel zurück ins Wasser. Einen Moment lang sah man nur Teile der ausgebreiteten Flügel über den Schaumkronen, der Kopf hob sich, und dann schwamm er wieder und musste sich erst einmal ordnen, was eine ganze Weile dauerte, sodass ich ihn immer wieder hinter den Wogen aus den Augen verlor. Dann nahm er wieder Anlauf, landete aber ebenso kläglich in einer grünen, am Kamm weiß aufschäumenden Welle. Erst beim vierten Mal gelang es ihm, genug Luft unter die Schwingen zu bekommen. Mit schweren Schlägen gewann er langsam und mühevoll Höhe, hob den schweren Körper Meter um Meter, noch immer dicht über den Wogen, ging schließlich ins Gleiten mit starren Flügeln über, schaltete dann wieder mächtige Schläge ein und strich schließlich in einer langen Kurve nach Süden davon.
Auf dem rollenden und schlingernden Heck hätte ich es nicht lange ausgehalten, ohne seekrank zu werden, aber ich hatte mir vom Schiffsarzt ein Pflaster hinter das Ohr kleben lassen, und deshalb kam ich in den Genuss eines Spektakels, das ich sonst verpasst hätte. Aus einem der tiefen Wellentäler schoss ein Schwarzbrauenalbatros hervor, stieg mit regungslosen Flügeln steil in den Wind, ließ sich vom Aufwind der Woge bis in eine Höhe von etwa zwanzig Metern hinauftragen, schien dort oben einen Moment wie ein großes schwarz-weißes Kreuz still zu stehen, die durchgehend dunklen Schwingen quer stehend, der weiße Kopf, der helle Bürzel und der dunkle Schwanz in der Senkrechten. Dann lehnte er sich in den Wind, ließ sich ein Stück zurücktragen und jagte schließlich, den treibenden Wind im Rücken, nach unten und in ein Wellental hinein. Unsichtbar für mich hielt er sich tief hinter der Woge, flog eine Strecke in dem Tal dahin, parallel zu den Wasserwänden an beiden Seiten, und schoss dann plötzlich etwa zwanzig bis dreißig Meter weiter im reißenden Aufwärtsflug aus dem Wellental und ließ sich vom Aufwind der Woge wieder in die Höhe tragen. Das ganze Manöver wiederholte er zu meiner Begeisterung immer wieder, als wollte er eine Vorstellung geben. Wenn er in einer langen Kurve am Schiff vorbeizog, sah man, dass er die breiten Füße zum Steuern benutzte, er hielt sie senkrecht neben dem kurzen Schwanz. Es war eine Darbietung von fliegerischer Eleganz und Kühnheit, die kaum zu übertreffen war, atemberaubend schön und wild zugleich, und sie schien ganz zweckfrei zu sein.
Warum machte der Vogel das, wenn nicht aus reiner Lust am Flug, am Vergnügen, mit dem harten Wind und der hohen See zu spielen? Ich hatte mich dasselbe gefragt, als ich ein paar Tage zuvor einen Wal aus dem Meer hervorbrechen sah, etwa dreihundert Meter vom Schiff entfernt. Es war ein Buckelwal, und er musste unter Wasser einen ungeheuren Anlauf genommen haben, um sich ganz aus seinem Element, dem Wasser, herauszukatapultieren. Das gewaltige Tier stand einen Augenblick senkrecht in der Luft, nur die Schwanzflosse blieb zu einem Teil im Wasser, um sich dann, langsam, so schien es, seitlich kippend wie ein gefällter Baum wieder mit einem enormen Aufklatschen und Aufschäumen ins Wasser fallen zu lassen. Es war ein Weibchen mit einem Kalb. Immer wieder tauchte es, blieb Minuten unter Wasser, um dann unvermittelt wie in einer Explosion senkrecht aus dem Wasser herauszubrechen. Das Kalb schwamm in der Nähe herum. Auch der Wal schien das »aus Spaß« zu machen – oder gibt es einen verborgenen Zweck hinter den Steilflügen des Schwarzbrauenalbatros und dem gewaltigen Herausschnellen der Wale? Freute sich die Walmutter so überschwänglich, weil es ihr gelungen war, ihr Kalb aus den wärmeren Wassern um den Äquator hier herunterzuführen, wo es endlich wieder unerschöpfliche Nahrung gab? Liebte der Albatros den Wind so sehr, dass er diese berauschenden Manöver vollführte? Geht das zu weit? Unterstellt man da Tieren zu viel an menschlichem Gefühl? Schon Darwin hat sich diese Frage gestellt. Beantworten kann sie niemand.
Der Schwarzbrauenalbatros führte noch immer sein Kunststück auf, aber das Schiff entfernte sich, stetig mit den Wellen rollend, weiter von ihm, und bald sah ich sein Aufsteigen im Aufwind der Woge nur noch als kleinen schwarz-weißen Punkt in der Weite des Meeres. Ich hielt ihn so lange wie möglich im Glas, überwältigt von diesem Schauspiel der Flugkunst auf der endlosen Bühne des Meeres.
Grenzen scheint der Schwarzbrauenalbatros nicht zu kennen. Die Welt ist klein für diesen großen Flieger. Er ist es, der manchmal nach Norden fliegt, immer weiter nach Norden, bis er vor Schottland oder Sylt, bei den Orkneys, den Shetlandinseln oder vor der norwegischen Küste auftaucht. Auch an der amerikanischen Ostküste ist er gesichtet worden, etwa vor North Carolina oder Massachusetts, und selbst an der grönländischen Küste hat man ihn beobachtet. Man sieht ihn in Südafrika, Australien und Neuseeland, im Indischen Ozean, aber vor allem ist er im Südatlantik zu Hause, in dem riesigen Seegebiet zwischen der Packeisgrenze und dem Wendekreis des Steinbocks, der sich etwa auf der Höhe von Rio de Janeiro und südlich von Madagaskar um den Globus zieht, aber es gibt auch Albatros-Kolonien im Indischen Ozean und im südlichen Pazifik. Offenbar ist er unermüdlich, keine Reise ist ihm zu weit.
Ich verließ das Heck und ging hinein, um mich irgendwo aufzuwärmen. Ich dachte an die beiden berühmten Gedichte, die sich mit dem Albatros verbinden, das von Baudelaire, in dem er den Poeten mit dem Albatros vergleicht – schwerfällig, fast hilflos an Land, was für den Poeten gleichbedeutend mit dem Alltag ist, und unerreicht in seiner Kunst des Fliegens, was für den Dichter natürlich der Flug der Fantasie ist.2 Wobei Baudelaire glaubte, dass die riesigen Flügel des Albatros ihm beim Gehen an Land behinderten, was in der Logik des Gedichts liegt, aber ornithologisch nicht richtig ist. Dass er aber an Land sehr unbeholfen ist, besonders bei der Landung, ist wahr, wie ich des Öfteren beobachtet habe.
Das andere Gedicht ist die lange Ballade von Coleridge, »The Rime of the Ancient Mariner«3, in der der alte Seefahrer immer wieder davon berichten muss, dass er einst mit seiner Armbrust einen Albatros erschoss. Ein Fluch liegt auf ihm, er ist gezwungen, bestimmten Menschen seine Geschichte zu erzählen. Und er erkennt jeweils sofort den Mann, der ihn anhören muss, auch wenn der viel lieber auf die Hochzeit einer Verwandten ginge. Aber zu dem Fluch gehört auch die Unfähigkeit des Angesprochenen, sich abzuwenden. Der Blick des Alten hält ihn unerbittlich fest, er muss zuhören. Seine Geschichte beginnt mit den klassischen Worten: »There was a ship …«, und der Gipfelpunkt ist das Eingeständnis, dass der alte Seefahrer ohne Not den menschenfreundlichen Albatros erschossen hat. Das ist sein Sündenfall, und dafür wird er bestraft, wie er auf die Frage des Hochzeitsgastes eingesteht:
God save thee, ancient mariner, from the fiends that plague thee thus.
What lookst thou so? – With my crossbow I shot the albatross.
Dieser Albatros ist sehr wahrscheinlich ein Schwarzbrauenalbatros gewesen, denn der folgt gerne Schiffen, und tut das oft über mehrere Tage. Angeblich verdankt sich die wilde Intensität des langen Gedichts der Tatsache, dass Coleridge unter dem Einfluss von Opium stand und das Gedicht wie in einem Fieberanfall niederschrieb. Später fürchtete er, die Leute würden nicht verstehen, was er da gesagt hatte, und fügte ganz überflüssige Kommentare und Erklärungen als Marginalien hinzu.
Bei zwei der ehemaligen Walfangstationen auf South Georgia, Grytviken und Stromness, die nun schon seit vielen Jahren verlassen waren und still verfielen, waren wir an Land gegangen. Die Station an der Stromness Bay war jene, in welcher der erschöpfte Shackleton mit seinen Gefährten Worsley und Crean auftauchte und von den erstaunten Walfängern in Empfang genommen wurde. Er hatte die Fahrt im offenen Boot von Elephant Island nach South Georgia hinter sich gebracht, etwa tausend Meilen in den stürmischsten Gewässern der Welt – eine der größten seemännischen Leistungen aller Zeiten. Worsley war es, der das Wunder einer Navigation vollbrachte, die verhinderte, dass sie auf dem weiten, wilden Meer an der kleinen Insel South Georgia vorbeisegelten – ins Nirgendwo. Sie waren an der Südküste gelandet und mussten die schneebedeckten Berge überqueren, die das Rückgrat der Insel bildeten, denn der Weg die Küste entlang war unpassierbar, und um die Insel herumzusegeln erschien Shackleton bei den stürmischen Winden zu gefährlich. Er wollte kein Risiko mehr eingehen, denn er wusste, dass die zurückgebliebenen Männer auf Elephant Island zum Untergang verurteilt waren, wenn er nicht zurückkehrte, um sie zu retten. Dass er sie nach zwei Jahren tatsächlich alle nach England zurückbrachte, macht seinen Ruhm aus und bedeutete ihm am Ende mehr als die Erkundung der Antarktis. Er ließ drei Männer der Besatzung an der südlichen Küste South Georgias zurück und versuchte, mit Worsley und Crean die schneebedeckten Berge zu überqueren, auf deren anderer Seite sich die Stromness Bay mit der Walfangstation verbarg. Die Überquerung erschöpfte ihn und seine beiden Begleiter so, dass sie mit Wahnvorstellungen zu kämpfen hatten. Berühmt wurde Shackletons hartnäckiges Gefühl, dass noch einer mit ihnen ging, eine rätselhafte Gestalt, die sich keiner von ihnen erklären konnte. Shackleton deutete das später religiös:
Wenn ich an diese Tage zurückdenke, habe ich keinen Zweifel daran, dass die Vorsehung uns geleitet hat … Während jenes langen, zermürbenden Marsches von sechsunddreißig Stunden über die namenlosen Berge und Gletscher South Georgias hatte ich oft das Gefühl gehabt, wir seien nicht zu dritt, sondern zu viert. Ich redete darüber nicht mit meinen Gefährten, aber hinterher sagte Worsley zu mir: »Boss, ich hatte das seltsame Gefühl, als wäre auf dem Marsch noch jemand anderes bei uns gewesen.« Crean gestand mir dasselbe.4
Dieses Rätsel fand Eingang in T. S. Eliots großes Gedicht, das berühmte »The Waste Land«: »Who is the third who walks always beside you?«5, heißt es da, wobei Eliot die drei, Shackleton, Worsley und Crean, auf zwei Männer reduziert hat. Sicherlich wusste Eliot, dass sie zu dritt waren, aber ein geheimnisvoller Dritter ist einfach poetischer als ein Vierter. Den letzten Steilhang auf der Nordseite South Georgias rutschten sie auf dem Hosenboden herunter, weil sie nicht mehr die Kraft hatten, vorsichtig abzusteigen. Worsley und Crean wollten rasten und langsamer vorangehen, aber Shackleton trieb sie an. Sie mussten es noch an diesem Tag schaffen, darauf bestand er mit eiserner Willenskraft. Später stellte sich heraus, wie recht er gehabt hatte. In der Nacht brach ein Sturm los, den die entkräfteten Männer nicht überlebt hätten. Sie erreichten schließlich Stromness Bay, eine Walfangstation, in der sie zuerst mit Unglauben, dann mit Jubel begrüßt wurden.
Die drei Männer auf der anderen Seite der Insel wurden am nächsten Tag geholt, aber Shackleton brauchte unter den Bedingungen des Ersten Weltkriegs zweiundzwanzig Monate, bis er ein Schiff bekam, mit dem er seine Männer auf Elephant Island endlich erlösen konnte. Als er mit einem kleinen Schlepper vor Elephant Island auftauchte, zählte er sie noch vom Schiff aus mit dem Fernglas vor Augen. Sie waren vollzählig da.
1921 fuhr er noch einmal zu einer Expedition in die Antarktis, starb aber auf South Georgia an einer Herzschwäche. Bestattet wurde er in der Walstation Grytviken, wo man heute sein Grab besichtigen kann. Wie Stromness Bay wurde Grytviken schon vor vielen Jahren stillgelegt.
Diese aufgegebenen Walfangstationen sind Mahnmale des Kriegs der Menschen gegen die Natur. In alten Berichten ist die Rede davon, das Wasser der Stromness Bay sei an manchen Tagen rot gewesen vom Blut der Wale, die hier hereingeschleppt wurden, um zerlegt zu werden. Jetzt lagen auf dem Gebiet der ehemals geschäftigen, von Menschen wimmelnden Station zerfallende Schiffe, rostende Maschinen, vor allem riesige Winden, die die schweren Wale an Land gezogen hatten. Große Bretterschuppen mit flachen Anbauten, deren weiße Farbe längst vergilbt und rissig geworden war, standen verlassen herum, in einem kleineren Schuppen gab es noch Fässer, in die das Walfett, der Tran, gefüllt worden war. An den Decken der Schuppen hingen verrostete Haken und Ketten. Es herrschte tiefe Stille, nur manchmal von den plötzlich einsetzenden Schreien der Möwen unterbrochen.
Der Verfall, vor allem der Rost, wurde von der trockenen Kälte so sehr verlangsamt, dass bei vielen der Werkzeuge und Maschinen noch erkennbar war, wozu sie einmal gedient hatten. Nichts war wirklich zerstört, alle Teile der Maschinen und Winden waren noch da, sie schienen nur erstarrt, als hätte ein plötzlicher Fluch sie gelähmt. Eine kleine Schienenstrecke zog sich vom Hafen hinauf zu den Hallen, in denen die Wale verarbeitet wurden. Ein paar Waggons mit niedrigen Ladeklappen, deren große Eisenräder unbeweglich geworden waren, standen dort herum, als warteten sie darauf, noch einmal beladen zu werden. Der vorherrschende Farbton war das Rotbraun des Rosts, das in das im Sonnenlicht strahlende Weiß des Schnees einsickerte. Überall zwischen den Häusern und Maschinen, den Schuppen und Hallen lagen die gewaltigen schwarzgrauen Leiber von schlafenden See-Elefanten, von dunkelbraunen Robben, Seehunden und Seebären, die sich die Station zurückerobert hatten. Sie kümmerten sich wenig um uns, die See-Elefanten öffneten vielleicht ein Auge, um uns zu betrachten, rührten sich aber nicht, auch wenn man dicht vor ihnen stand. In den alten Schuppen hatten sich die gewaltigen Männchen, die sich gerade häuteten, buchstäblich breit gemacht, in dem Dämmerlicht leuchteten die Scheidenschnäbel auf, weiß wie Gespenster, Vögel, die zwischen ihnen und auch auf ihnen herumliefen. Pinguine watschelten furchtlos auf den alten Straßen herum, einer begleitete meine Frau ein ganzes Stück des Weges, ging ruhig und aufmerksam neben ihr her, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Es sah aus, als unterhielten sie sich.
So würde die industrielle Welt sehr bald aussehen, dachte ich, wenn die Menschen aus irgendeinem Grund von der Erde verschwänden. Rost und Verfall, die langsame Rückkehr der Vegetation, die Tiere, die es sich in den leeren Höhlen der Menschen bequem machten, der Schrei der Möwen von gebrochenen Masten. Mehrere Schiffe mit geborstenen Planken, die nie wieder Wasser unter dem Kiel haben würden, ruhten hier für immer auf der Seite liegend im flachen Wasser vor dem Strand, und ihre Aufbauten und Masten waren von Wind und Wetter zerfressen, vor dem Hintergrund der schneebedeckten Berge ragten sie auf wie Zeugen einer gescheiterten Vergangenheit. Ein großes Walfangschiff war halb auf den Strand gezogen worden, die Harpune am Bug ragte schräg nach oben, als zielte sie auf den Himmel. Seebären – eine Robbenart, die vor hundert Jahren wegen ihres Fells fast ausgerottet war, sich nun aber erholt hat – bevölkerten die Decks der für immer gestrandeten Schiffe. Eine große Stille lag über dem kolossalen Wrack dieser alten Walfangstation, nur ab und zu hörte man ein klatschendes Aufschlagen vom Hafen her, wenn sich eine der Robben ins Wasser warf.
Ich hatte gehofft, auf dem Kreuzfahrtschiff, mit dem meine Frau und ich in die Antarktis fuhren, ein paar Vogelbeobachter zu finden, mit denen ich abends zusammensitzen und meine Beobachtungen vergleichen konnte. Aber unter den Passagieren schien es niemanden zu geben, der sich für die Vogelwelt interessierte. Zweifellos für die eindrucksvollen Landschaften aus Schnee und Eis, für das Meer und die Wale. Aber nicht für die Vögel. Vielleicht wäre es besser gewesen, dachte ich, wenn wir mit einem amerikanischen oder englischen Schiff gefahren wären, denn das Birdwatching ist in England und den USA ungleich populärer und verbreiteter als in Deutschland.
Einer der Passagiere war ein höflicher und netter junger Mann, der mit seinem Vater unterwegs war, und mit ihm verbindet sich eine Beobachtung, die dazu beitrug, dass ich diese Dinge zu Papier gebracht habe. Der Vater hatte die Angewohnheit, mit entschlossenem Gesicht in der Lounge, im Restaurant oder in der Bibliothek aufzutauchen, als müsse er sofort mit irgendjemandem ernste Dinge besprechen. Mit konzentriertem Blick unter heruntergezogenen Augenbrauen stürzte er herein, verlor aber nach nur wenigen Sekunden seine Zielstrebigkeit, blieb stehen und sah sich hilflos um. Manchmal kam dann sein Sohn auf ihn zu und führte ihn an seinen Tisch, wo sie sich mit einer dritten Person unterhielten. Der Sohn hatte eine sehr gewandte Art, sich mit aufmerksamem Gesicht während des Gesprächs mal seinem Vater, mal der anderen Person zuzuwenden. Er saß immer sehr aufrecht da. Wie gesagt, er war ein durch und durch netter Mensch.
Dieser junge Mann saß eines Tages an einem Tisch auf dem Deck des Schiffes und trank mit einer Bekannten Champagner. Der Tag war klar und voller Sonne, der Himmel in einem hellen Blau, und ich saß, wie immer mit dem Fernglas in den Händen, in der Nähe. Über uns waren Heizstrahler angebracht, sodass man es hier trotz der Kälte aushalten konnte. Vor uns lag ein Eisberg im Wasser, der in seiner Form dem Matterhorn ähnelte. Die Sonne stand tief hinter ihm, und durch die Lichtstreuung erschien er tatsächlich grün – nicht smaragdgrün, wie Coleridge in seinem Gedicht sagt, aber er schimmerte in einem schönen Blassgrün, das sich in den Falten und Einkerbungen verdunkelte.
Wir waren dicht unter einer strahlend weißen Küste an einer Insel entlanggefahren, um den Gletscher genauer sehen zu können, der mit zerklüfteter Stirn steil zum Meer abfiel, und jetzt drehte das Schiff ab und ließ die Insel hinter sich. Die im hellsten Weiß gleißende Küste fiel hinter der schäumenden Spur des Kielwassers langsam zurück und öffnete sich in einem weiten Halbrund, sodass man bei zunehmender Entfernung sehen konnte, dass wir uns in einer Bucht befunden hatten. Die bläulich schimmernden Berge wichen zurück, die am weitesten entfernten sanken unter den Horizont. Das Panorama, das sich hinter dem Heck weitete, war fantastisch. Die Kontraste stießen im Sonnenlicht hart aufeinander: das blendende Weiß des Eises unter dem Blau des Himmels, die Falten und Kanten der Gletscher mit ihren scharfen dunklen Schatten, das schwach violette Licht in den Spalten und Kavernen, das Grün und Blau des Wassers, das sich an den kantigen Abrissen des Landes mit schwarzen, feucht glänzenden Felsen brach, die aufstrahlenden Schaumkronen und die schneebedeckten Kuppen und Hänge der Berge dahinter.
Wie fast alle Passagiere hatte der junge Mann eine Kamera mit einem langen Teleobjektiv. Das Fotografieren hatte sich verändert, die meisten nutzten motorgetriebene Mehrfachaufnahmen, sodass bei jedem auftauchenden Wal, jeder Robbenoder Pinguingruppe, die in die Nähe des Schiffes kamen, ein sirrendes Dauergeräusch entstand, das sich wie ein Zittern in der Luft hielt. Der junge Mann warf einen Blick zurück auf das Panorama hinter uns, nahm die Kamera, die auf dem Tisch lag, ließ den Apparat losrattern, legte ihn dann zufrieden lächelnd zurück, griff nach seinem Glas und wandte sich wieder seiner Gesprächspartnerin zu. Er dachte offenbar, er »hätte« es – aber was hatte er? Er hatte gar nichts.