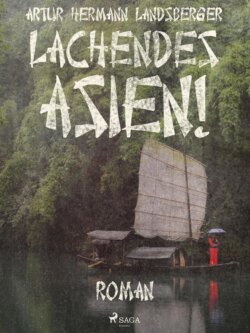Читать книгу Lachendes Asien! - Artur Hermann Landsberger - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fünftes Kapitel
ОглавлениеUnser Schiff lag so lange im Hafen, daß wir Zeit gehabt hätten, nach Jerusalem zu fahren. Andernfalls verbindet damit eigenartige Vorstellungen:
»Bei der Tüchtigkeit der Juden sieht es da gewiß schon aus wie in Paris,« meint sie. »Man hätte sich amüsieren und am Ende schon für den Herbst einkleiden können.«
Ein paar jüdische Auswanderer mit ihren Familien klären sie auf. Das ist bösestes Polen. Und durch die Brille dieser Menschen gesehen, erscheint Jerusalem eher als eine Zufluchtsstätte für gehetzte Arme und Beladene als ein Pflaster, auf dem eine heitere sorglose Welt flaniert.
Ich spreche von der Möglichkeit, auf der Rückreise für ein paar Tage nach Jerusalem zu gehen. Aber Andernfalls, die einem arabischen Händler das ganze Obst abkauft und es unter die Auswanderer verteilt, ist schon bekehrt. Wir entschließen uns für Kairo, das man in vier Stunden mit dem Expreß erreicht, nach dem, was man las und hörte, aber keinen tiefen Eindruck macht. Zwar ist Andernfalls’ Urteil: »ein englisch-amerikanischer Hotelbetrieb mit exotischer Aufmachung« nicht erschöpfend. Aber sie hat doch wieder das richtige Gefühl. Jeder Aegypter und jedes Kamel in Kairo macht den Eindruck, als seien sie nur zur Unterhaltung der Engländer und Amerikaner da. Für die paar Deutschen, die jetzt hier reisen, hat der vierbeinige Wüstensohn, hier lediglich Instrument der Fremdenindustrie, nur einen gelangweilt impertinenten Blick. Dabei heißt sein gefährlicher Gegner nicht German, sondern Ford. Zweiundzwanzig für Aegypten bestimmte Wagen setzte allein unser verhältnismäßig kleines Schiff an Land, und in dem kleinen Suez zählte ich in einer Viertelstunde mehr als ein Dutzend dieser kleinen, schnittigen Wagen. — Aber freilich, was versteht ein Kamel davon?
Man muß bewundern, wie die Wagen von U. S. A. via Triest hierher transportiert werden. Man vermutet in den Kisten, die einander gleichen wie ein Ei dem andern, allenfalls ein Klavierchen. Vor dem Worte »Ford«, das breit auf jeder Kiste steht, bekreuzigen sich Engländer, Amerikaner und Italiener. Nur Andernfalls und die Nonnen nicht. Das Wort »Ford« übt heute eine gewaltige Wirkung. Es verkörpert eine Weltanschauung. Ich möchte unseren mit allen Wassern gewaschenen, in allen Sätteln gerechten Russen, der zwar noch auf seine Chemnitzer Seidenwaren schwört, nicht mit der Parole »Ford« auf China loslassen. Er könnte den Missionaren gefährlich werden. Mit der Devise »Ford« kann man Berge versetzen. Oder ...? Seit Suez haben wir ein jüdisches Ehepaar, das aus Syrien kommt, an Bord. Mit einem eigenen Koch und einer syrischen Sklavin als Dienerin. Sie kehren von einer zweijährigen Weltreise nach Singapore zurück. Sie stehen an der Reling und ihre Blicke schweifen sehnsuchtsvoll über das Meer nach der bis zu dreihundert Meter ansteigenden Wüste el-Kàa. Nicht den Hafenort Tôr, die Quarantänestation für die Zeit der Wallfahrten nach Mekka, suchen sie. Es ist der Dschebel Mûsa, der Mosesberg, dem ihre Sehnsucht gilt und der eben, kurz bevor die Sinaihalbinsel endet, emporsteigt. Dies Ehepaar Isaak, das weder im Dining room, noch in einem der Salons je sichtbar wird, und das man höchstens mal gegen Abend eng aneinandergeschmiegt an Bord stehen sieht, — pfeift auf Ford. Ich würde sein Alter auf fünftausend Jahre schätzen, wenn Andernfalls, deren gutes Herz sich zu der syrischen Sklavin hingezogen fühlt, mir nicht versichern würde, daß sie am 15. November Silberne Hochzeit feiern.
Daß die Seefahrt gesund macht, fühlt von uns jeder; daß sie die Frömmigkeit vertieft, ist eine Mär des Confucius, an die ich — ungern — auf dieser Reise den Glauben verlor. — Als wir ins Rote Meer einfuhren, — wie schön waren da die Abende an Deck! Die Nonnen, von der Natur stark beeindruckt, ihrem Gott sich hier noch näher fühlend, sangen religiöse Lieder. Wir ruhten in den tiefen Liegestühlen, lauschten, und es schien, als vereinige sich der Gesang der Nonnen mit dem Rauschen des Meeres, das ihn hinwegtrug, der Welt den Glauben zu verkünden.
Als wir in der Mitte des Roten Meeres waren, sangen die Schwestern schon nicht mehr. Sie sahen auch nicht mehr zu Boden, wenn sie an uns vorüberschwebten. Auch der italienische Pater war hier schon ein anderer geworden. Er hatte das Gebetbuch mit dem langen Holzstab vertauscht und wetteiferte an Leidenschaft mit einem italienischen Capitano beim Shuffle board (Shuffle board ist ein jedem Seereisenden bekanntes Spiel). Und als wir abermals ein paar Tage später Massaua verließen, kredenzte der Pater einer fröhlichen Tafelrunde den für China bestimmten Meßwein, während die Schwestern sich beim Shuffle board vergnügten. Zwar übertreibt der Russe, der in bezug auf die Nonnen meint, vom Shuffle board bis zur Reunion sei nur ein Schritt. Nein! diese Nonnen sind keine Wedekindgestalten, sind Kinder, die die Schüsseln mit den erlesenen Speisen ebenso harmlos bestaunen wie die nackten Araber, die sich in Massaua an das landende Schiff drängen.
Bei dem Namen Massaua schlägt jedes Italieners Herz höher. Denn es ist der Eritreia vorgelagerte Hafen. Und Eritreia ist eine italienische Kolonie. Ein Land mit Kolonien aber ist eine Großmacht. Des zum Zeichen man uns auch die Kolonien raubte. — Ich weiß nicht, ob die Italiener gute Kolonisten sind, aber die Betriebsamkeit im Hafen, die Heiterkeit und der Eifer, mit dem die schwarzen Eingeborenen arbeiten, die Furchtlosigkeit, mit der die unzähligen nackten Kinder sich an die Europäer hängen, läßt darauf schließen, daß sie Psychologen und gute Menschen sind.
Wir trafen es gut. Denn gerade in der Nacht, in der wir im Hafen lagen, feierte die italienische Kolonie ihren Karneval. Ich habe nicht erst hier den bestimmten Eindruck gewonnen, daß die Einstellung der Italiener den Deutschen gegenüber im Lande selbst wie draußen (man kennt die Unterschiede) in gleichem Maße freundlich ist. Sie haben den Glauben an Deutschland, an dem es, wie mir scheint, überhaupt nur — in Deutschland fehlt. Man glaube mir, daß das wochen- und monatelange Zusammenleben auf einem Schiff der beste Boden für die Gewinnung von Sympathien ist. Deutschland, das weiß, wie wichtig für seine Wiederaufrichtung die Entspannung der antideutschen Atmosphäre im Auslande ist, hält trotz seiner Finanznot überall Propagandisten — nur auf dem Meere nicht. Sehr unklug! Ich schlage vor, kluge, unterhaltende, gutangezogene Menschen mit Kinderstube, und zwar beiderlei Geschlechts, als harmlose Reisende auf die großen Schiffe der Weltlinien zu setzen. Sie könnten Wunder wirken!
Doch keine Politik! Zurück zu fröhlicheren Dingen. Ein Karneval in Massaua, das ein Erdbeben vor zwei Jahren niederriß, ist eine zahme Angelegenheit, derentwegen sich eine Reise nach Afrika nicht lohnt. Und von dem weniger zarten »Nachtisch« bei »Madame«, zu dem jedes schwarze Kind, das die Beine setzen kann, den Weg weiß, und zu der man der Wissenschaft wegen in platonischer Absicht pilgerte, wendet sich der europäische Gast mit Grausen. Er flüchtet spät in der Nacht auf das Schiff zurück, auf dem alles längst schlummert.
Nur Andernfalls ist noch wach. Sie sitzt im Salon und liest. Vor ihr steht ein Kübel mit Eis und ein paar Flaschen Apollinaris. Daneben eine Flasche Irish Whisky von John Gillon. Bei vierzig Grad wacht Andernfalls und lernt Japanisch. Ich bewundere das und setze mich zu ihr. Sie klappt das Buch zu und lehnt jedes Lob ab.
»Einer von uns beiden wird ja wohl sprechen müssen«, sagt sie und gießt mir ein Glas klaren Whisky ein. »Trink! Damit du einen anderen Geschmack bekommst.«
Ich fahre mir ohne zu wollen mit der Hand über den Mund und gieße den Whisky herunter.
»Du hast recht,« sage ich, »es war ekelhaft.«
»Ich sehe es dir an.«
»Du glaubst doch nicht etwa ...?«
»Würde ich mit dir reisen, wenn ich dich dazu für fähig hielte?«
»Und woraus siehst du, daß ich da war?«
»Daß du mir die Hand geben wolltest — überlegtest und es nicht tatst.«
»Das konntest du doch nicht sehen.«
»Gefühlt hab’ ich’s.« — Ich sehe sie an. Sie schüttelt den Kopf und sagt: »Daß dich das wundert.«
»Man wird doch empfindsamer draußen auf dem Meer.«
»Ich schon,« erwidert sie.
»Wünschest du, daß ich es auch werde?«
Sie setzt ihr allerliebstes Lächeln auf, erhebt sich, tritt dicht an mich heran und sagt, während sie mir mit der Hand durchs Haar fährt:
»Ich weiß nicht, ob ich es wünsche. — Gute Nacht!«
Damit gab Andernfalls mir das erste Rätsel auf dieser Reise auf.
Nach einer Stunde etwa kehrten die letzten Karnevalsgäste auf dem Umwege über Madame an Bord zurück. Ich hatte den bitteren Geschmack mit Whisky-Apollinaris grade hinuntergespült. Als ich sie sah und dies sogenannte Haus der Liebe wieder vor mir aufstieg, aus dem einem Brunstgeruch und Geschrei schon auf der Straße entgegenschlug, da ekelte ich alter Sünder mich vor diesen Menschen, die zu Haus, teilweis auch auf dem Schiff reizvolle weiße Frauen hatten. Sie aber erzählten angeregt und noch lüstern und ohne Scham. Und während ich noch vor einer Stunde beim Anblick dieser Schwarzen schon den Gedanken einer Berührung als Sodomie empfand, erkannte ich nun, daß auch der Weiße ein Tier ist. Daß diese These in gleicher Weise für Mann und Frau gilt, belehrte mich ein Neger, den ich auf dem Wege zu meiner Kabine über den Flur schleichen und an der Treppe scheu nach einem Kimono sich umwenden sah, deren Trägerin bei meinem Anblick aufschrie und das Gesicht mit den Händen bedeckte.
Ich mußte an die Worte meines Freundes aus Duala denken: »Die Etikette des Schiffes verlangt ...« — und dann zählte er eine endlose Reihe mehr oder weniger äußerlicher Dinge auf, deren Beobachtung der strenge Code des internationalen gesellschaftlichen Verkehrs verlangte und die im Zusammenhang mit den Vorgängen dieser Nacht etwa wirkten, als wenn eine hohe Obrigkeit bestimmte: Personen, die ins Wasser fallen, haben im Interesse der öffentlichen Moral beim Ertrinken darauf zu achten, daß ihre Kleider nicht ins Rutschen kommen.
Andernfalls teilt meine Empörung nicht. Sie will, was für sie und mich gilt, nicht unbedingt auch für alle Andern gelten lassen. Und während ich, was mich abschreckt, ästhetisches Empfinden nenne, bucht sie, auch auf die Gefahr hin, mich zu kränken, mein Unbehagen mehr auf Konto meines Alters.
»In deinen Jahren liebt man eben mehr mit Verstand als mit den Sinnen. Und dann bedenke die Hitze und das Rote Meer! Die Wasserverdunstung und der hohe Feuchtigkeitsgehalt der Luft! Sind das für diese Art Menschen nicht mildernde Umstände?«
»Wer hat dir das erzählt?« frage ich. Sie erwidert böse:
»Sobald ich etwas Gescheites sage, fragst du, von wem ich es habe.«
»Liebes Kind, in Fragen des Geschmacks habe ich das noch nie getan. Aber wenn eine Berliner Soubrette Feststellungen über die Wasserverdunstung und den Feuchtigkeitsgehalt im Roten Meer anstellt, so ist das doch etwas ungewöhnlich.«
»Wenn sie es in Berlin täte, vielleicht. Hier ist es nur natürlich, daß man sich informiert. Schon für dein Buch über Asien. Und da du es nicht tust, so muß ich eben.«
Einer Fortsetzung des Gesprächs entzog sie sich, indem sie sich zur Seite legte und einschlief. Ich stellte, wie allabendlich, wenn sie eingeschlafen war, den elektrischen gesundheitschädlichen Ventilator ab, ohne den sie behauptete, nicht schlafen zu können. Dann legte auch ich mich in meine Kabine und schlief ein.
Am nächsten Tage setzten wir die Fahrt fort — nachdem das Schiff wohl eine Stunde lang nach halbwüchsigen Afrikanern abgesucht worden ist, die sich auf alle möglichen Arten trotz der Wachen an Bord geschlichen haben und sich dort versteckt halten, um, ahnungslos, wohin die Reise geht, die Fahrt mitzumachen. Sie fühlen sich eben als Italiener! Der letzte wird in einem jener großen Kochbecken gesichtet, in denen ein paar auf Zwischendeck reisende Araber ihre Mahlzeit selbst bereiten.
An einer Reihe wunderlicher vulkanischer Inseln, die bis zu 600 Meter emporragen, geht die Fahrt vorüber, abseits an der Küste entdeckt mein Zeiß die Hafenstadt Hodeida, von der aus ein Handelsweg nach der Stadt Sana, dem Hauptort des unter türkischer Oberherrschaft stehenden Gebirgslandes des Jemen, führt. Unser geographischer Ehrgeiz ist erwacht, wir wollen durchaus die Moscheen von Mokka, der Heimat des guten Kaffees, sehen. Kurz vor dem Bab-el-Mandeb, dem »Tor der Tränen«, erfüllt sich unsere Sehnsucht. Mokka liegt vor uns, eine der Moscheen ragt wie ein Schiffahrtssignal steil empor und wir fahren nach Passieren der verengten Meerstraße schließlich in den Golf von Aden ein.
Etwas Lustiges bereitet sich unterdessen auf dem Schiffe vor, dessen Chronique scandaleuse damit voraussichtlich eine Bereicherung erfährt. Ein, wie man mir versichert, und was Schmuck und Dienerschaft zu bestätigen scheinen, steinreicher Siamese, ein Graf S.-M., führt seine in England ihm angetraute junge Frau mit, eine — ja, ich weiß nicht recht, sie ist schön, schlank, elegant und hat eine herrliche Stimme. Ihre Heimat ist Deutschland; aber ihr Wirkungskreis seit über zehn Jahren ist London — und eben über diesen Wirkungskreis zerreißen sich unsere Dekolletées die Mäuler. Das liegt wohl daran, daß sie schön, schlank und elegant und seit drei Wochen die angetraute Frau des steinreichen siamesischen Grafen S.-M. ist, mit dem sie nun über Penang in ihre neue Heimat fährt. Wenn das keinen Neid erregen soll!
Das Lustige, das sich vorbereitet, sich hoffentlich aber nicht erfüllt, hat natürlich Andernfalls ausspioniert. Die syrische Sklavin steht längst nur noch nominell in Diensten des jüdischen Ehepaares aus Singapore. In Wirklichkeit bedient sie nur Andernfalls, und ich zittre dem Augenblick entgegen, in dem ihr Eigentümer die Konsequenzen daraus zieht und sie mir zum Geschenk macht. — Also, diese syrische Sklavin ist die einzige, die sich mit der Dienerschaft des Grafen S.-M. verständigen kann. Und die hat ihr verraten, daß der Graf daheim noch elf andere ehelich ihm angetraute Frauen sitzen hat, so daß mit dieser nun das Dutzend voll würde. Der Graf will die junge Gräfin mit der schönen Stimme erst auf siamesischem Boden »aufklären«. Aber Andernfalls ist entschlossen, das nicht zuzulassen. Da ich mich nicht für berechtigt halte, ihre edle Regung zu unterdrücken, so werden wir vielleicht sehr bald ein Schauspiel an Bord erleben.