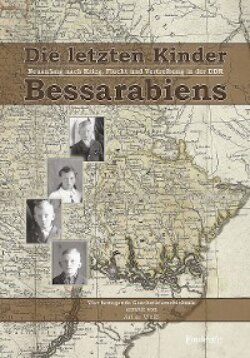Читать книгу Die letzten Kinder Bessarabiens. Neuanfang nach Krieg Flucht und Vertreibung in der DDR - Artur Weiß - Страница 9
Neuanfang und Berufsausbildung
ОглавлениеIn der damaligen russischen Besatzungszone schickten sich die Flüchtlinge aus den vielen Ländern an, der Familie eine neue Heimat zu schaffen. Dies betraf auch uns Bessarabiendeutsche. Die erlebten Grausamkeiten und Todesängste während der Flucht von Polen nach Deutschland hatten mich hart im Nehmen gemacht. Ich war der Älteste und spürte, dass ich Verantwortung für die Jüngeren tragen musste. Vor allem hatte ich für Mutter eine Stütze zu sein. Wenn es auch schmerzte, wieder unter einer neuen Gewaltherrschaft leben und arbeiten zu müssen, verdrängten wir doch die vorhandenen Realitäten.
Die Möglichkeit nach Baden-Württemberg umzusiedeln, wie es viele unserer Landsleute taten, wurde uns von der russischen Besatzungsmacht verweigert. An Unrecht, Gewalt und Bevormundung gewöhnt, beschloss ich, in der russischen Zone zu bleiben und die Landarbeit an den Nagel zu hängen. Der Bauer war meinen bescheidenen Lohnforderungen nicht nachgekommen, es kam dann zu Streitigkeiten.
Der Wunsch, einen Beruf zu ergreifen, nahm vollen Besitz von mir. Ich durfte ihn in Belzig beim Schmiedemeister Ernst Gottwald umsetzen. Nun schon als 17-Jähriger trat ich die dreijährige Lehre am 15. November 1947 an. So begann für mich ein neuer wichtiger Lebensabschnitt, der mich froh und glücklich stimmte.
Mein erster Eindruck in der Schmiede, der Meister beim Hufeisen schmieden
Zum ersten Mal in meinem jungen Leben konnte ich auf eigenen Beinen stehen und mein eigenes Geld verdienen. Der tägliche Weg zur Arbeit war beschwert, weil er mit einem Fußmarsch von drei Kilometern zur Eisenbahn nach Dahnsdorf verbunden war. Später bewältigte ich die Strecke mit einem Fahrrad, das mir durch ein Lebensmitteltauschgeschäft zum Eigentum wurde. Auf dieselbe Weise hat auch mein Freud Simon ein Fahrrad bekommen, denn mit Lebensmitteln war es 1947 möglich, alles zu bekommen. Weil sich Simon eine Lehrstelle als Schumacher beschaffte, fuhren wir beide täglich bei Wind und Wetter acht Kilometer nach Belzig zur Arbeit.
Das tägliche Miteinander ließ unsere Freundschaft noch enger werden, es entstand eine echte Kameradschaft, wozu auch Hugo zählte. Mein Freund Hugo war zunächst in der Landwirtschaft geblieben, erst später hat er den Beruf eines Lokomotivführers erlernt. Wir als Trio waren unzertrennlich und hatten inzwischen guten Kontakt zu der einheimischen Jugend gefunden.
In dieser alten Schmiede erlernte ich den Beruf eines Schmiedes
Wenn es zu Meinungsverschiedenheiten, Rangeleien und Handgreiflichkeiten mit der einheimischen Jugend gekommen war, brauchte man gute Freunde, um sich wehren zu können.
Der Pfarrer und Lehrer des Dorfes unterstützten die Jugendgruppe massiv bei ihrer Arbeit und organisierten Veranstaltungen. Sie sorgten auch dafür, dass wir Flüchtlinge in der Gruppe nicht mehr ignoriert und beleidigt wurden, sondern einfach dazugehörten. Traditionell wurden Theaterstücke eingeübt, die unter der Leitung des Dorfschullehrers aufgeführt wurden. Anschließend spielte im Saal die Musik zum Tanz auf. In den Wintermonaten gingen die Mädels und jungen Frauen abwechselnd zur Spinnichte (Spinnstube), zu Spinn- und Nadelarbeiten. Dabei wurden Heimatlieder gesungen und Neuigkeiten ausgetauscht. Das war wohl nicht so recht erwünscht, die kommunistische Jugend-Organisation (FDJ) schickte ihre Funktionäre auf die Dörfer, die bestehenden Jugendgruppen sollten in die neue Organisation eintreten. Die Bürgermeister bekamen Weisungen, in ihren Gemeinden kommunistische Organisationen wie FDJ, SED, FDGB und DSF zu gründen. Die Einflussnahme der Funktionäre in das dörfliche Leben war das Ende verschiedener Traditionen, die zu den Lebensgewohnheiten der Bauern gehört hatten. Dazu kamen noch die Bestrebungen zur Kollektivierung der Landwirtschaft und eine Reihe anderer einengender Bestimmungen. Dies zusammen machte dem herkömmlichen Leben auf dem Dorf den Garaus. Das ländliche, sittliche und heimatliche Flair ging durch die atheistische-kommunistische Einflussnahme für immer verloren.
Meine beiden Freunde und ich distanzierten sich von allen politischen Aktivitäten, weil wir nicht noch einmal von einer Diktatur gedrillt und missbraucht werden wollten. Vielmehr wandten wir uns des Lebens schönster Seite zu, weil uns Siebzehnjährigen auffiel, dass sich die Mädchen für uns interessierten. Aufgrund des Krieges, der Flucht und Vertreibung erfasste uns die Pubertät erst später als die anderen. Mit einer Freundin die Abende und Wochenenden zu verbringen, war schön. Das half auch, die schrecklichen Erlebnisse zu verdrängen. Wenn das Wochenende nahte, hatten Hugo, Simon und ich immer einen festen Plan, wohin wir mit unseren Freundinnen per Fahrrad tanzen fahren wollten.
Wenn meine Schwester Irma von der Schule nach Hause kam, brachte sie öfter die eine oder andere Freundin mit, die mir schöne Augen machte. Dies ließ ich wohlwollend über mich ergehen. Zurzeit ging es in ihren Gesprächen darum, welche Kleider sie zu der anstehenden Konfirmation tragen werden. Traditionell waren die Kleider blau zur Prüfung, welche vier Wochen vor der Konfirmation stattfand, und schwarz zur Konfirmation. Ein blaues Kleid hatte Irma, ein Schwarzes aber fehlte ihr, Mutter suchte einen Ausweg und fand ihn. Es verging kaum ein Tag, wo nicht Frauen und Männer aus den Großstädten im Dorf ihre Habseligkeiten gegen Lebensmittel eintauschten. Diese Situation nutzte Mutter, als eine Frau sie nach Lebensmitteln ansprach, die zufällig ein Kleid am Leibe trug, wie es sich meine Schwester wünschte. Nun geschah etwas Makaberes: Die junge Frau gab ihr Kleid für Kartoffeln, Erbsen, Mehl und ein paar Eier her. Damit die Frau nicht halb nackt den Hof verlassen musste, gab Mutter ihr ein abgelegtes Kleid. Hier zeigt sich, was man alles tut, wenn einem der Magen knurrt.
Die Freude war ganz auf meiner Schwester Seite, als Mutter ihr das eingetauschte Kleid zeigte. Mit Freudentränen in den Augen umarmte sie ihre Mutter. Bei der Anprobe wurde festgestellt, dass nur wenige Änderungen vorgenommen werden müssen. Dies besorgte eine Flüchtlingsfrau aus Schlesien. Es war Eile geboten, weil es nur noch wenige Tage bis zur Einsegnung waren. Irma konnte es kaum erwarten, bis sie endlich ihr Kleid anziehen konnte. Aber zuerst kam der Tag der Konfirmandenprüfung, wobei die Mädels alle in Blau gingen. Irma wurde von ihrer Freundin Plantina abgeholt. Dann gingen die beiden Vierzehnjährigen die Dorfstraße entlang, ich schaute ihnen zufrieden nach. Stunden später kamen sie mit strahlenden Gesichtern zurück. Stolz zeigten sie uns ihre Zeugnisse und auch das Datum der Konfirmation. Schon am frühen Morgen des 14. April 1947 lag eine gewisse Unruhe in der Luft, als Irma endlich ihr Lieblingskleid anzog und von uns allen bewundert wurde. Indem kam Plantina mit zwei Freundinnen lärmend und aufgeregt die Treppe hoch. Auch sie trugen ihre schönsten Kleider. Sie bestaunten sich gegenseitig und tauschten Komplimente. Dann steckte Mutter ihrer Tochter noch eine Ansteckrose an das schwarze Kleid. Nun hatte das arme Flüchtlingsmädchen doch noch eins der schönsten Kleider an.
Als das Glockengeläut einsetzte, stürzten die Konfirmandinnen die Treppe hinunter und liefen eilig zu ihrem Treffpunkt. Aus allen Richtungen strömten die Dorfbewohner in die Kirche, auch wir folgten ihnen.
In der gut besuchten Kirche fanden alle einen Platz, dann zogen bei Orgelmusik die Konfirmanden ein und nahmen im Altarraum ihre Plätze ein. Pfarrer Maier trug zur Feier des Tages seine Predigt vor, in welcher er sich an die Konfirmanden und Eltern wandte. Auch ließ er die gegenwärtige Zeit nicht unerwähnt und ermahnte die Gemeinde zur Besonnenheit.
Wahrscheinlich veranlassten auch ihn die schlechte Politik und die Lebensbedingungen dazu, die Versorgung war 1947 immer noch katastrophal und alles war rationiert. Daher war es uns Flüchtlingen nicht möglich, nach dem Kirchengang eine Konfirmationsfeier abzuhalten. Es reichte nur zu einem Kuchen, den Mutter gebacken hatte. Die Bauern konnten, wie üblich, für ihre Kinder eine reiche Festtafel bieten und den Gästen ein berauschendes Fest ausrichten. Dies hätte unsere Mutter zu Hause auch gekonnt, wenn wir nicht durch Krieg, Flucht und Vertreibung alles verloren hätten.
Mit dieser Feststellung ging eine turbulente Zeit zu Ende und für Irma begann ein neuer Lebensabschnitt.
Vorerst musste sie, wie alle anderen Konfirmanden, bis zu den Sommerferien den Schulabschluss der 8. Klasse machen.
Inzwischen waren meine kleinen Brüder Helmuth und Herbert herangewachsen und besuchten täglich die Schule in Mörz. Sie hatten Zeit, sich nur um die Belange der Schule zu kümmern und konnten intensiv ihre Schularbeiten machen.
Meine Schuljahre waren durch den Zweiten Weltkrieg anders verlaufen. Ich kann aber trotz allem Unbehagen mit Stolz den Schmiedeberuf erlernen. Wenn sich auch in den letzten zwei Jahren vieles in unserer Familie verbesserte, war es doch schwer für Mutter und mich, unsere Bedürfnisse aufgrund der Mangelwirtschaft zu erfüllen. Mutter arbeitete weiter bei dem Bauern für Lebensmittel und 40 Mark pro Monat und ich brachte meinen Lehrlingslohn von 60 Mark in die Familienkasse ein, damit war die Not weitgehend gebannt.
Was uns als Familie seit unserer Ankunft im Winter 1945 in Mörz stark belastet, war der Verlust unseres Vaters. Alle Versuche, ihn durch die Suchdienste zu finden, blieben erfolglos. Glück hatten Hugo und Simon, ihre Väter waren durch das Rote Kreuz gefunden worden. Dadurch waren sie als Familie besser gestellt. Wir wohnten als Familie noch immer zu fünft in einer Stube. Es machte es sich erforderlich, zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. So wurde mit dem Einverständnis des Bauern die neben der Stube vorhandene Futterkammer als Wohnküche umgebaut. Von nun an hatte jeder seinen Sitzplatz am Tisch und ich zum ersten Mal mit 17 Jahren mein eigenes Bett. Mein Bruder Helmuth war nun schon 10 und Herbert 7 Jahre alt, sie brauchten sich nicht mehr das Bett teilen. So hatte nach Jahren jeder seinen eigenen Schlafplatz. Für unsere Familie war das ein kleiner, aber wichtiger Schritt nach vorn. Sogar einen Schrank für unsere Kleider konnten wir aufstellen.
Um in der Versorgung unserer Familie selbstständig zu werden, schafften wir Jungs uns Kaninchen an, um ab und an einen Braten zu haben.
Auch ergab es sich, vom Bauern ein Ferkel (Kümmerling) zu übernehmen, welches Mutter in Pflege nahm. Sie mästete es zum prächtigen Schlachtschwein. Jährlich wurden auf dem Bauernhof mehrere Schweine für all die Beschäftigten auf dem Gehöft geschlachtet. Hierbei wurde unser Schwein auch zu Fleisch und Wurst verarbeitet. Somit hatten wir als Familie eine Unabhängigkeit vom Bauern erreicht, die Futtermittel für das Schwein hatten wir zu ersetzen. Dazu gingen wir auf den abgeernteten Feldern Kartoffeln stoppeln und Getreideähren nachlesen. Diese übergaben wir dem Bauern. Nach dem Motto: „Ohne Müh ist selten Brot“ praktizierten wir diese Möglichkeit einige Jahre, weil alle mittlerweile einen guten Appetit an den Tisch brachten.
Die Ernte des Jahres 1947 war voll im Gange und die großen Schulferien hatten begonnen. Dies bedeutete für Irma das Ende ihrer Schulzeit. Schon immer hatte sie den Wunsch, Schneiderin zu werden. Jedoch war es nicht möglich, in der näheren Umgebung eine Lehrstelle für sie zu finden. Gezwungenermaßen trat sie im Frühjahr 1948 in einer kleinen Gaststätte, die auch Landwirtschaft betrieb, eine Lehrstelle als Hausmädchen an. Dort bezog sie ein Zimmer mit Vollpension und erhielt einen Lohn von 20 Mark monatlich. Leider hat die Wirtin Irma in der Vorweihnachtszeit entlassen. Den Winter verbrachte sie wieder im Kreis ihrer Familie, sie wurde dann im Frühjahr 1949 im Nachbardorf als Dienstmädchen in der Landwirtschaft tätig.
Auch dort hatte sie ein Zimmer mit Vollpension und bekam 25 Mark pro Monat. Leider wurde sie auch hier nur als Saisonarbeiterin benutzt. Daraufhin hat Mutter mit ihrem Bauern für Irma eine stundenweise Arbeit in den Morgen- und Abendstunden für die Fütterung der Tiere ausgehandelt. Dies erwies sich zunächst als gute Lösung. Im Frühjahr 1950 bekam Irma eine Festanstellung. Ihr Lohn verbesserte sich auf 60 DDR-Mark. Nun waren Mutter und Tochter für längere Zeit ein Team auf dem Bauernhof und hatten öfter für andere Dinge des Lebens Zeit. Sie nähten sich mit einer erworbenen Nähmaschine ihre Kleider selbst, diesbezüglich konnte Mutter ihrer Tochter viel beibringen.
Mittlerweile sind nun schon fast fünf Jahre in der neuen Heimat vergangen, sodass die seelischen, moralischen und traumatischen Wunden von Krieg, Flucht und Vertreibung nicht mehr so wehtaten. Es wird Zeit, rückblickend über die nur schleppende wirtschaftliche und politische Entwicklung in der russischen Zone, in der wir leben müssen, Bilanz zu ziehen.
Der Wiederaufbau des durch den Krieg zerstörten Landes wurde anfangs durch die Demontage der noch heil gebliebenen Werke durch die Russen massiv erschwert. So kam es, dass eine von den alliierten Bombenangriffen verschont gebliebene Munitionsfabrik in meinem Heimatort Belzig mit der Unterstützung der deutschen Kommunisten gesprengt wurde. Eisenbahngleise wurden landesweit demontiert, Erdkabel wurden in Fronarbeit ausgegraben, verladen und per Eisenbahn in die Sowjetunion abtransportiert. An der Erdkabelaktion musste ich als Sechzehnjähriger teilnehmen. Die Norm war: 100m mussten pro Tag mit Pickelhacke, Spaten und Schippe ausgeschachtet werden. Und dies bis zu 16 Stunden, auch alte Männer wurden zur Arbeit aufgerufen.
Ein Teil der von den Bauern eingebrachten Ernte verließ auch Richtung Osten die Zone. Das schmälerte den Speiseplan der Menschen in Stadt und Land. Auch die Industrie wurde systematisch ausgenommen. Nur ein geringer Teil vom Kuchen bekam die Industrie. Den Löwenanteil kassierten die Russen. Das dauernde Abschöpfen der Landwirtschaft und Industrie wurde zur beliebten Dauererscheinung im Herrschaftsgebiet der russischen Zone. Die von Stalin 1946 eingesetzte Regierung war ihm in jeder Hinsicht hörig, daher konnte die Ulbrichtgruppe die wahren Interessen der Bevölkerung nicht durchsetzen.
Gezwungenermaßen entwickelte sich daher die so genannte DDR nur schleppend und rutschte in eine dauernde Mangelwirtschaft ab. So blieb den Menschen die Rationalisierung der Lebensmittel noch lange erhalten.
Was unsere Familie betraf, war sie in den letzten fünf Jahren gestärkt herangewachsen und hat sich voll integriert. Mutter, Irma und ich hatten ein sicheres Einkommen, meine Brüder besuchten erfolgreich die Schule. Wir haben die große Not gemeinsam überwunden. So gesehen können wir alle vorerst zufrieden nach vorne schauen. Was uns die Zukunft noch alles bringen wird, das steht in den Sternen. Durch Umsicht, Fleiß und Sparsamkeit ist es unserer Familie gelungen, nicht mehr Hunger leiden zu müssen. Vergessen sind die Erlebnisse der vierzehntägigen Flucht von Polen nach Deutschland.
Bei -20 Grad tauten wir unser gefrorenes Brot und die Wurst am Feuer auf, ließen den Schnee schmelzen, um uns Getränke zu machen. Wir stillten unseren Heißhunger mit heißem Tee, drängten damit die Kälte aus unseren Gliedern.
Das Auftauen der Lebensmittel am Knackholzfeuer
In dieser, sich leicht normalisierenden Zeit haben wir Jugendliche schon längst die Initiative ergriffen, um unser Vergnügen voll auszukosten. Wir drei Freunde hatten dabei das Gefühl, nach erlebter Gewalt und Entbehrung, wieder wie Menschen zu leben. Kein Weg war uns zu weit, um zum Vergnügen mit unseren Fahrrädern in die Nachbardörfer zu fahren und unsere Jugend zu genießen. Auch war es normal, wie immer und überall, dass Alkohol getrunken wurde. Dieser war aber für uns fast unerschwinglich, sodass wir zur Selbsthilfe griffen. Hier erinnerte ich mich, wie unser Knecht Janek in Polen (Warthegau) mit seinem Destilliergerät aus Zuckerrüben, Kartoffeln und Roggen Schnaps gebrannt hatte. Es war für mich als angehender Schmiedegeselle kein Problem, ein solches Gerät herzustellen, obwohl mir bekannt war, dass Schwarzbrennen verboten war. Die Rohstoffe, um einen Sud herstellen zu können, waren auf dem Dorf immer erhältlich, es war uns auch bekannt, wie und wann destilliert werden kann. An einem Sonnabend wurde der erste Brennvorgang angesetzt, der sich bis spät in die Nacht hinzog. Aber es war ein voller Erfolg geworden, was sich bei uns Dreien spürbar bemerkbar machte. Das Verfahren nutzte uns, da so immer etwas Hochprozentiges vorhanden war und wir so für lange Zeit unsere eigene Quelle hatten. Mit der Zeit gelang es uns auch, aus dem Sprit mit gewissen Zutaten Liköre zu mixen, damit auch unsere Mädchen etwas zu sich nehmen konnten. An den Wochenenden waren wir drei Freunde unzertrennlich. Wenn es zu Streitigkeiten mit fremden Jungen kam, die uns unsere Mädchen ausspannen wollten, bewährte sich die Freundschaft.
An den Werktagen war ich mit Simon meist allein, weil wir denselben Weg zur Arbeit hatten. Hugo war immer noch bei seinem Bauern beschäftigt. Für Simon und mich näherte sich das Ende unserer Lehrzeit, was uns mit einem gewissen Stolz erfüllte. Es war doch eine schwere Zeit, bei gutem und schlechtem Wetter jeden Tag pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Darauf legte Meister Gottwald großen Wert. Zu ihm hatte ich von Anfang Vertrauen und eine fast väterliche Beziehung. Vielleicht lag es daran, dass bei mir die Vaterstelle verwaist war, woran der Zweite Weltkrieg die Schuld trug. In der Berufsschule wurde derzeit die Vorbereitung zur schriftlichen Gesellenprüfung getroffen, ich wusste, dass sie mir schwer fallen wird. Ich konnte die Schule nicht regelmäßig besuchen. Was die praktische Prüfung betraf, hatte ich ein gutes Gefühl, denn Schmieden hatte mir mein Meister beigebracht.
Unaufhaltsam kamen die beiden Berufsschultage im September 1950 heran, an denen in den verschiedenen Fächern Prüfungsarbeiten geschrieben wurden. Nach der Überprüfung der Arbeiten durch die Lehrkräfte erreichte ich 60 von 100 Punkten. Damit waren meine Erwartungen übertroffen. Auf die praktische Prüfung freute ich mich deshalb, weil ich mich hundertprozentig sicher fühlte, diese zu bestehen. Am 15. September 1950 standen 12 Prüflinge mit mir am Schmiedefeuer und Ambos, um ihre Gesellenstücke zu schmieden. Es sind die verschiedensten Stücke geschmiedet worden. Die Prüflinge konnten sich verschiedene Stücke zum Schmieden selbst wählen.
Meine Prüfstücke waren: eine Linz Tülle, eine Geschirrkappe und ein Hufeisen, die ich der Prüfungskommission zur Begutachtung vorlegte. Beim Schmieden meiner Stücke fühlte ich mich vom Schaumeister auffällig beobachtet. das Schmieden der Linz Tülle war mit einem hohen Schwierigkeitsgrad verbunden (Feuerschweißen).
Meine Gesellenstücke: Hufeisen Geschirrkappe Linz Tülle
Beim Schmieden der Linz Tülle
Es lag Spannung in der Luft. Jeder gab sein Bestes, um möglichst gut abzuschneiden. Im Verlauf des Vormittags übergaben alle ihre Arbeiten der Prüfungskommission. Jeder hatte die Möglichkeit, 100 Punkte zu erreichen. Dann ergriff der Obermeister das Wort und rief namentlich nach dem Alphabet die Prüflinge auf und nannte jedem die erreichte Punktzahl. Als Letzten rief er den Namen Weiß auf mit der Punktzahl 100. Ich war erschrocken, als schallender Applaus den Raum erfüllte. Die Krönung war, dass mir eine Prämie, verbunden mit einer Urkunde für besonders gute Leistungen, übergeben wurde. Ich war sichtlich gerührt, weil zum ersten Mal in meinem Leben meine Arbeit Anerkennung fand. Als Sachwert wurde mir unter anderem ein Fahrradschlauch überreicht, was 1950 nicht mit Gold aufzuwiegen war. Mein Freund Simon bestand seine Gesellenprüfung auch. Sein Gesellenstück war ein Paar Halbschuhe für sich. Die bestandene Prüfung feierten Simon, Hugo und ich ausgiebig, wozu auch unsere Mädels eingeladen waren. Hochprozentiges war zur Genüge vorhanden.
Es erfüllte uns mit Stolz, mit 19 Jahren Fachmänner unseres Berufes zu sein und wir freuten uns auf unseren ersten Gesellenlohn, der für einen Schmiedegesellen immerhin 290 DDR-Mark betrug.
Als Meister Gottwald mir zur bestandenen Prüfung gratulierte und die Auszeichnung lobend erwähnte, bot er mir an, zu gegebener Zeit sein Nachfolger zu werden, was ich freudig zur Kenntnis nahm.
Dann wünschte sich der Meister, dass meine Schmiedestücke einen gebührenden Platz in seiner Werkstatt bekommen.
Vorerst blieb alles beim Alten, bis ich auf eine kleine Wanderschaft ging, um Land und Leute kennen zu lernen. Insbesondere war es meinem Beruf dienlich, in einer alten Dorfschmiede war ich ernsthaft gefordert, wo es noch urig zuging und dem Schmied wirklich nur das Schmiedefeuer, Schmiedehammer, Ambos und diverses Hilfswerkzeug zur Verfügung stand. Der Meister zeigte mir, wie mit primitivem Werkzeug alte und schöne Schmiedearbeit hergestellt wird, was mir später sehr nützlich wurde. Ich bemerkte auch, dass er mir seine Tochter schmackhaft machte, um so zu einem Nachfolger zu kommen. Dazu war aber das Feuer nicht heiß genug und die Proportionen zu gewaltig. Mein Desinteresse ihr gegenüber trübte das Für- und Miteinander, so dass ich mich um eine andere Arbeit bemühte.
Zu dieser Zeit hatte ich bereits meine zukünftige Frau Irene kennen gelernt. Im Mai 1951 kam es zu unserer Verlobung, weil wir uns sicher waren, gemeinsam durch das Leben zu gehen. Bei meiner Verlobung lernte mein Freund Simon seine Freundin Lina kennen, die Freundin von Irene. Es bahnte sich eine Freundschaft an, die langen Bestand hatte.
So festigte sich die Freundschaft und es folgte eine abwechslungsreiche Zeit, die viel Freude Vergnügen mit sich brachte. Auch meine Schwester lernte ihren Hermann kennen und verliebte sich in ihn. Zu einem festen Verhältnis hat es aber nicht gereicht. Hermann war Schmiedelehrling in der Dorfschmiede zu Mörz und auch ein Freund von mir.
Bislang wohnte ich immer noch in Mörz. Das änderte sich am 18. Februar 1951, als mir eine Arbeit in Treuenbrietzen angeboten wurde. Meine Wohnung war die Gesellenstube, die über der Schmiede lag. Die Wochenenden verbrachten wir gemeinsam in Mörz. Mutter und Irma waren noch immer des Bauern Mägde und die Arbeit war nicht leichter geworden, worüber beide sich bei mir des Öfteren beklagten. Aber Freude kam auf, als Mutter mitteilte, dass unser Bruder Helmuth als 14-Jähriger in der Osterzeit konfirmiert wird und sich auf den Schulabschluss vorbereitet. Erfreut waren wir, als sie uns erklärte, dass Helmuth auch eine Lehrstelle hat, die sie im Dorf beim Schuhmachermeister Paul für ihn gefunden hatte. Als Helmuth das hörte, machte er einen Luftsprung, fiel seiner Mutter um den Hals und rief dabei: „Hurra, ich werde Schuster.“ Irma fügte mit trauriger Miene hinzu: „Ich wäre so gerne Schneiderin geworden.“ Daraufhin nahm Mutter sie mit den Worten in die Arme, du wirst einen Mann finden, der dich auch ohne Beruf lieben wird. Nun war es Zeit, meine Sachen zu packen und Simon sowie Hugo Auf Wiedersehen zu sagen, von nun an werden wir uns nur noch an den Wochenenden sehen. Mit einem Rucksack auf dem Rücken und einem Pappkarton auf den Gepäckhalter fuhr ich mit meinem Fahrrad die 32 km nach Treuenbrietzen. Bei Schmiedemeister Baitz angekommen, führte er mich in meine Gesellenstube und wies mich anschließend in seine Werkstatt ein. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war sie bis 1951 geschlossen. Seiner Frau gehörte ein mittelgroßes Hotel, in dem sich auch die Wohnung des Meisters befand. Die Mahlzeiten wurden gemeinsam im Gastzimmer eingenommen. Den Rest des Sonntags nutzte ich, um meine Stube einzurichten und um die nähere Umgebung der Stadt zu erkunden. In den Jahren der Stilllegung wurde die Schmiede als Abstellraum genutzt, das abzuändern wurde mir zur Aufgabe gemacht. Für die Wiedereröffnung der Schmiede hat Meister Baitz großzügig investiert, so war die Werkstatt auf dem neuesten Stand. Als er dann noch einen Lehrling einstellte, konnte die Arbeit aufgenommen werden und aus der Schmiede ertönte wieder ein Pochen und Hämmern. Da sich der Meister mehr um das Hotel kümmern musste, war ich mit dem Lehrling meist allein in der Schmiede. So reifte in mir eine gewisse Selbständigkeit heran, was sich für mich später auszahlte. Zum anderen hatte ich die Absicht, die Stelle längere Zeit zu halten, weil der Meister es mir überließ, die Arbeit selbst einzuteilen.