Описание книги
Auerbach, Berthold: Die Geschichte des Diethelm von Buchenberg. Gotthelf, Jeremias [d. i. Albert Bitzius]: Der Notar in der Falle. Wilbrandt, Adolph: Johann Ohlerich.
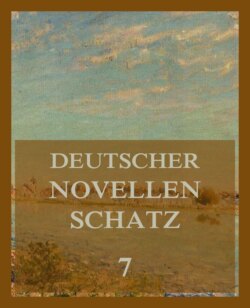
Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.
INHALT:
Der Notar in der Falle
Vorwort
Die Geschichte des Diethelm von Buchenberg
Vorwort
Johann Ohlerich
Vorwort
Deutscher Novellenschatz
BAND 7
.....
Da lächelte Julie schalkhaft und sagte: Luise, nimm dich in Acht, der sagt dir nicht Herr, der will oben aus, macht Ansprüche. Mein Fritz, der Spitzbube, sagt, der Notar habe gesagt, er wolle entweder gar nicht heiraten oder reich; er glaube, dem Vaterland, welches feste, grundsätzliche, unabhängige Männer nötig hätte, auf diese Weise am besten zu dienen. Daneben frage er dem Gelde gar nichts nach, es sei ihm nur Mittel zum Zweck. Er sei gar fest mit den Grundsätzen, der Notar, sagt mein Mann, und werde es weit bringen, wenn man einmal mit Grundsätzen was machen könne. So speiste Julie die arme Luise ab und konnte ihr nicht einmal nähere Auskunft geben, was er treibe, der Notar. Es ging nicht lang, so kriegte Fritz, der Spitzbube, eine sehr schöne Stelle, wurde aus einem Subjekt Präsident, oder noch mehr, und musste über Hals und Kopf mit seiner Frau von dannen ziehen. Nun war die Brücke zwischen Luise und dem Notar vollständig abgebrochen, Luise trostlos. Den Notar im Herzen ward sie nicht los. Derselbe ward ungestümer und plagte sie alle Tage wilder, wollte hinaus, wollte Leben, Seele, wollte Luise alles in Allem sein! Die arme Luise, wie sie sich auch Mühe gab, kam nie zum Glück, mit dem Notar zusammenzutreffen, sie sah ihn höchstens zuweilen von ferne und von hinten. Wie sehr sie dies für einen Augenblick auch glücklich machte, hintendrein ward sie nur unglücklicher, das Bild in ihrem Herzen ungestümer. Sie hatte keine Freundin, welcher sie sich mitteilen konnte; der Frau Spendvögtin musste sie sogar ihre Seufzer verbergen. Diese war ohnehin sehr unzufrieden wegen Luises Vergesslichkeit, klagte, es sei gar nichts mit ihr anzufangen, und drang mit Ernst darauf, dass Luise, wenn nicht zu Ader, so doch schröpfen lasse. Die Spitalvögtin missriet dies sehr. Sie sagte, ein Fall, wie der, dass man Personen von diesem Aussehen geschröpft, sei ihr nicht vorgekommen, das könnte sie ja töten. Sie habe augenscheinlich zu wenig Blut und nicht zu viel, sie wäre sonst nicht so blass; sie wette, Luise habe die Auszehrung, oder gar die galoppierende Bleichsucht. Da wäre nichts besser als ab Bocksbart zu trinken. Möchte nicht dabei sein, möchte ab diesem oder jenem Bocksbart ein absonderlich Trinken sein. Die Frau Seimeisterin war anderer Meinung. Sie hielt dafür, die Kost der Frau Spendvögtin sei nicht gut für Luise, die sollte nicht bloß Kaffee trinken, sondern tüchtig Fleisch essen, Brat- und andere Würste, gebratene Kartoffeln, kurz so was Währschaftes, Tüchtiges; die Krankheit liege sicherlich im Magen, und wenn alle Glieder schwach würden, so wüsste sie nicht, warum nicht auch das Hirn schwachen und das Gedächtnis abnehmen müsste. Andere hatten andere Meinungen, schlugen andere Mittel vor, und da alle Tage die Konsultationen von vorne anfingen, aber nicht zu Ende kamen, so blieb Luise einstweilen mit Schröpfen und Bocksbart verschont.
Diese Uneinigkeit kam Luise sehr zu statten, sonst hätte sich an ihr das Sprichwort erwahren können: viele Köche versalzen den Brei, und viele Hunde sind des Hasen Tod. Wenn sie der Reihe nach alle Mittel hätte gebrauchen sollen, welche die Meisterinnen, Vögtinnen und Herrinnen ihr verordnet, das Ding hätte schlimm kommen können. Luise war krank, aber sie wusste allein, wo es ihr fehlte; aber wie helfen, das wusste sie nicht, und doch trieb sie der Instinct der Selbsterhaltung, Heilmittel zu suchen. Dieser Instinct geht zuweilen über alle Doktoren, er fordert Dinge, welche der Arzt auf das schärfste verboten hat; kalte Milch z. B. in heißen Fiebern, und zum großen Erstaunen von männiglich weicht die Krankheit, und gesund wird der Mensch. Solcher Instinct stellt sich aber zumeist nur ein, wenn die Krankheit den Höhepunkt erreicht hat, die Krisis naht, das Leben des Menschen in der Schwebe ist. So war es wirklich auch mit Luise, sie war ein Schatten geworden, nur fiel es an ihr weniger auf, weil sie nie eine blendende Erscheinung gewesen. Und weiß Gott, wie manchen Tag Luise es noch gemacht hätte, wenn sie nicht eines Morgens früh zu Marei, der Magd, welche ihr wohlwollte, gesagt hätte: Marei, willst mir einen Gefallen tun, aber versprechen, keinem Sterbensmenschen was davon zu sagen? Ja, wenn ich kann und es sich mir schickt, warum nicht, ja freilich, antwortete Marei. — Du weißt, Tante geht diesen Nachmittag zur Frau Seckelmeisterin, aber ich darf dir nicht sagen, was ich möchte, gewiss darf ich nicht, stotterte Luise. — Pah, sagte Marei, tut nicht dumm und scheut Euch nicht; wenn Ihr wüsstet, was ich mein Lebtag schon alles gehört habe, Ihr machtet nicht so lange Flausen. — Aber willst es dann Niemanden sagen? fragte Luise. Ei nun so dann: wann du diesen Morgen in die Metzg gehst, so geh doch zum Notar Stößli, er hat seine Schreibstube hinten am Waschhaus, und sage ihm, ich lasse meine Komplimente vermelden und ihn ersuchen, diesen Nachmittag zu mir zu kommen, es sei wegen Geschäften, wenn ich wohl wäre, so wäre ich zu ihm gekommen. — Das kann ich machen, sagte Marei trocken. Verdammt Wunder nahm es Marei, was ihre Jungfer mit Dem wolle, wenn die Tante nicht daheim sei. Wie aber Luise zitterte und bebte, als Marei fort war, und wie gern sie den Auftrag zurückgenommen hätte und wieder nicht warten mochte, bis Marei zurückkam und Bescheid brachte, ob er komme oder nicht! Er lasse sein Kompliment machen und werde, wenn nichts dazwischen komme, sich einstellen, brachte Marei zurück. Er hat mich gefragt, was er machen solle. Was sollte ich ihm sagen? Ich wisse es nicht, habe ich ihm gesagt; was habe ich anders sollen? erörterte Mareili unwillig und erwartete als Trinkgeld und Botenlohn weitere Eröffnungen. Aber umsonst. Luise seufzte nur, ward bleich und rot, und Marei musste brummend sich schieben. Beim Mittagessen brachte Luise keinen Bissen hinunter, so dass es der Frau Spendvögtin Angst wurde. Ich ließe der Frau Seckelmeisterin absagen, sagte sie, wenn ich ihnen nicht die Partie verderben würde. Aber gewiss muss ernstlich dazu getan sein. Sie mögen sagen, was sie wollen, sicher wäre Schröpfen am besten. Jedenfalls muss morgen der Arzt kommen. Marei, hörst, gehe und sage dem Doktor Habicht: ich lasse das Kompliment vermelden, und morgen solle er kommen, wenn er könne. Louise protestierte umsonst. Es werde schon bessern, sagte sie, es sei nur vorübergehend u. s. w. Die Tante bezeugte das Gegenteil und vertiefte sich so in das Thema, dass es Luise katzangst wurde, die Tante vergesse die Frau Seckelmeisterin und die Partie Boston, treffe mit Notar Stößli unter der Haustüre zusammen und frage barsch: Was wollt Ihr hier? Nun, diese Angst ging glücklich vorüber, Tante segelte ab, und zwar mit geschwellten Segeln; die Andern saßen sicher bereits hinter dem Spieltische, denn schon hatte es Ein Uhr geschlagen. Die Spendvögtin wusste, welches scharfe Gericht von Vorwürfen über solch unverantwortliche Verspätung sich ergoss. Kaum war diese Angst gehoben und die Tante verschwunden, kam Luise die Angst vor dem Erscheinen des Notars, und zwar so heftig, dass sie zu ersticken meinte, und ihr sonst so stilles Herz polterte, als plumpste eine zweizentrige Köchin Tritt für Tritt eine hölzerne Treppe hinunter. Und wie das Herz am stärksten plumpste, klopfte es an der Türe. Die Stimme versagte Luise, die Glieder zitterten, vom Sofa konnte sie sich nicht erheben. Da öffnete sich die Türe, und ein schönes Gesicht schob sich durch die Spalte, eine schöne Figur kam nach, und leibhaftig stand Notar Stößli vor Luise, verbeugte sich zierlich und fragte, womit er dienen könne, oder ob er etwa ungelegen komme? Nein, hauchte Luise, tat einen tiefen Atemzug, zeigte auf einen Stuhl und sagte endlich: Ihr seht, ich bin krank! Mit schönen Redensarten drückte der Notar sein Bedauern aus und begann zu vermuten, warum er gerufen worden. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, hauchte Luise und Herr Stößli musste sich ganz nahe setzen, um zu verstehen, was Luise hauchte. Es wäre mir eine Erleichterung, wenn ich wüsste, in welche Hände mein kleines Vermögen käme, nahe Verwandte habe ich nicht. Aber ich weiß nicht, wie dieses machen, ich habe mein Lebtag kein Testament gesehen und weiß nicht, wie eins aussieht. Da habe ich gedacht, ich könnte Sie fragen. Sie wüssten es am besten. Zu Ihnen hätte ich das Zutrauen, mehr als zu jemanden sonst. Tante soll Nichts davon wissen, es schmerzte sie viel zu sehr, wenn sie wüsste, wie weit es mit mir ist. Erschöpft schwieg Luise, und dienstfertig, nachdem er noch einmal erst sein Bedauern, dass sie so unwohl sei, und dann seine Hoffnung, dass sie doch nicht so unwohl sei, als sie glaube, ausgedrückt hatte, begann Herr Stößli ihr die notwendigen Formalitäten auseinanderzusetzen, und wie ein Testament beschaffen sein müsse, um gültig zu sein. Das sei keine schwere Sache, sagte er; wenn man einmal wisse, wie man disponieren wolle, so sei die Sache bald geschrieben. Am besten freilich sei es immer, wenn die Zeit es erlaube, man mache erst seinen Aufsatz, gebe seinen Willen dem Notar kund, der könne die Sache gehörig zu Faden schlagen, es gehe dann um so schneller, wenn die Sache gültig ausgefertigt werden solle, und sei für die Zeugen und den Testator äußerst angenehm. Wenn es der Jungfer Luise wohl genug sei und sie das Vertrauen zu ihm habe, so könnte er ihr gleich einen flüchtigen Entwurf machen; wenn man es auf dem Papier habe, so komme einem das eine oder das andere in Sinn, man übersehe das Ganze besser. Der Notar wusste, dass, wenn man einen Fisch vor dem Garn habe, es am besten sei, nicht zu rasten, bis man ihn darin habe. Vielleicht nahm es ihn auch Wunder, worüber Jungfer Luise, von deren Vermögen er nie was gehört, eigentlich zu testieren habe. Der Vorschlag hatte Luise ganz rot gemacht, wieder eng ward es ihr auf der Brust, mit Mühe sagte sie: Ach, wie gut Ihr doch seid; aber diese Mühe darf ich Euch nicht machen! Ei warum nicht? sagte Herr Stößli, nahm aus seiner Brieftasche das nötige Schreibzeug und schrieb kürzlich den schönen Eingang, wie man seine Seele der Gnade Gottes empfehle, sein zeitlich Gut aber in folgende Hände geben wolle. Luise weinte, als er ihr das vorlas. Er wolle es noch schöner machen in der Ausfertigung, sagte Herr Stößli, das sei nur so oberflächlich hingeworfen. Jetzt muss ein Haupterbe sein, mahnte Herr Stößli. Tante Spendvögtin, sagte Luise. Und jetzt allfällige Vergabungen. Julie, meiner Freundin, mein Haus, stotterte Luise. Ja so, dachte Herr Stößli, also darum hat die mir nicht von Vermögen gesagt. Meinem Küher den Berg. Wie heißt der Berg? fragte Herr Stößli. Sie hätte ihm nie anders gesagt als Berg, sagte Luise. Und weiter fragte Herr Stößli, und Luise, welche nach und nach auflebte, machte Vergabung um Vergabung, und zwar stattliche, dass Herr Stößli endlich sagte, er müsse mahnen, nach seiner Pflicht, der Armen zu gedenken, und alsobald bedachte Luise die Armen ihrer Gemeinde mit 2000 Gulden. Man müsse sich immer in Acht nehmen, sagte Herr Stößli, dass man durch zu viele Vergabungen den Haupterben nicht in Verlegenheit setze; dadurch könnten fatale Geschichten entstehen. Die Tante weiß, was ich habe, antwortete Luise. Ganz ehrerbietig sagte Herr Stößli: So so! Wir wollen hoffen, das alles sei nicht nötig, Jungfer Luise erhole sich wieder, setzte er mit großer Teilnahme hinzu. Wenn sie wolle, sagte er, so wolle er ihr den Entwurf da lassen; sie könne ihn übersehen und bedenken und allfällige Änderungen ihm später diktieren. Wenn es Jungfer Luise gelegen sei, dass er wiederkomme? Luise bestimmte den Tag; am selben war die Tante bei der Seckelmeisterin, und sie dankte herzlich Herrn Stößli für seine Gefälligkeit, stand auf, wie sehr er auch bat, doch ja sich zu schonen, und begleitete ihn bis zur Türe, wo ein recht inniger und herzlicher Wettstreit, welcher sie um Vieles näher brachte, stattfand, wie weit die Höflichkeit gehen solle. So rosig und süß im Gemüte war es Luise noch nie gewesen; was sie im Herzen getragen, war nun vor ihr gesessen, ganz freundlich und herzig, und wollte wieder kommen; es war, als ob ihr Blut ein anderes würde, ein anderes Leben einziehe in ihren Körper.
.....