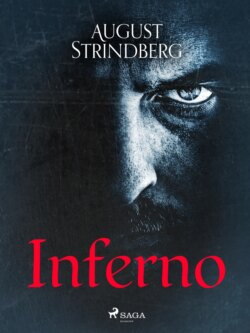Читать книгу Inferno - August Strindberg - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
Die Hand des Unsichtbaren
ОглавлениеMit einer wilden Freude wandte ich dem Nordbahnhof den Rücken; denn soeben hatte der Zug mein Frauchen zur Ferne entführt, wo unsere plötzlich erkrankte Kleine der Mutter harrte. Das Opfer war vollbracht. »Also auf baldiges Wiedersehen« klang mir noch in den Ohren, aber ich ahnte nur zu gut, daß es ein Abschied auf Nimmerwiedersehen gewesen war. Und in der Tat habe ich seit damals, November 1894, bis heute, Mai 1897, meine vielgeliebte Gattin nicht wiedergesehen.
Bald darauf saß ich im Café de la Régence und zwar am selben Tische, an dem ich eben noch mit meiner Frau gesessen, meiner schönen Kerkermeisterin, die Tag und Nacht meine Seele belauert, meine geheimen Gedanken erraten und, voll Eifersucht auf meine Liebe zur Erkenntnis, den Lauf meiner Ideen überwacht hatte ...
Die wiedergeschenkte Freiheit verjüngt und erhebt mich, und tief unter mir liegt die Großstadt, so klein. Was ist mir jetzt noch der Sieg, den ich auf diesem Schauplatz geistiger Kämpfe erfochten: daß ich auf einer Pariser Bühne gespielt wurde! Bedeutete das für mich doch nichts Geringeres als die Erfüllung eines Jugendtraumes, wie er von all den zeitgenössischen Schriftstellern meines Landes geträumt wird und nun allein von mir verwirklicht worden ist. Aber gleichviel. Das Theater stieß mich, wie alles, was man einmal erreicht hat, ab, und die Wissenschaft zog mich an. Meine Wahl zwischen Liebe und Wissenschaft hat sich für letztere entschieden, und läßt mich über dem Opfer meiner eigenen Liebe ganz vergessen, daß ich zugleich ein schuldloses Weib auf dem Altar meines Ehrgeizes oder, sagen wir, meines inneren Berufes opfere.
Denselben Abend noch durchwühlte ich in meinem ärmlichen Studierzimmer im Quartier latin meinen Schrank und zog sechs Tiegel aus feinem Porzellan, deren Preis ich mir seinerzeit heimlich vom Munde abgespart, aus ihrem Versteck hervor. Eine Lampe und eine Stange reiner Schwefel vollendeten das Laboratorium. Nachdem ich dann noch im Kamin ein Schmiedefeuer angefacht, verriegelte ich die Tür und ließ die Vorhänge herab; denn Caserio ist erst vor drei Monaten hingerichtet und Paris noch nicht so beruhigt, daß man sich ohne Gefahr mit chemischen Experimenten beschäftigen kann.
Die Nacht bricht herein, der Schwefel brennt wie flammende Hölle, und, als es Morgen wird, habe ich das Vorhandensein von Kohlenstoff in diesem für einfach gehaltenen Körper festgestellt und glaube damit ein großes Problem gelöst, die herrschende Chemie gestürzt, und mir selbst die Sterblichen verstattete Unsterblichkeit erworben zu haben.
Meine von der unmäßigen Hitze gedörrten Hände schuppen sich und machen mir beim Auskleiden schmerzhaft bemerklich, um welchen Preis ich meine Eroberung gemacht habe. Als ich aber allein im Bette liege, in dem noch alles an die Frau erinnert, überkommt mich ein tiefes Glücksgefühl. Aus einer seelischen Reinheit, einer männlichen Jungfräulichkeit heraus betrachte ich die vergangene Ehe als etwas Unreines und ich möchte nur jemanden haben, dem ich für meine Befreiung aus ihren trüben und nun ohne viel Worte gelösten Banden danken könnte. Die unbekannten Mächte haben die Welt so lange ohne ein Lebenszeichen von sich gelassen, daß ich im Laufe der Zeit zum Atheisten geworden bin.
Aber ich möchte so gern danken! Irgend jemandem! Mich drückt diese aufgezwungene Undankbarkeit!
Ich bin so eifersüchtig auf meine Entdeckung, daß ich nichts tue, was zu ihrem Bekanntwerden führen könnte. Schüchtern, wie ich in solchen Angelegenheiten bin, lasse ich Autoritäten Autoritäten und Akademien Akademien sein und experimentiere ruhig weiter. Aber die Risse meiner Hände verschlimmern sich, die Schrunden springen auf und füllen sich mit Kohlenstaub, das Blut sickert hervor und ich kann zuletzt nichts mehr berühren, ohne die unerträglichsten Schmerzen zu empfinden.
Voll wilder Anklagen wende ich mich gegen jene unbekannten Mächte, die es sich zur Aufgabe gemacht zu haben scheinen, mein ganzes Leben und Streben durch ihre Verfolgungen zu vergällen, ziehe mich, menschenscheu, von allen Gesellschaften zurück, lehne alle Einladungen ab und verleugne mich vor allen meinen Freunden. Schweigen, Einsamkeit breitet sich um mich, das erhaben-schreckliche Schweigen der Wüste, in der ich mich trotzig an dem Unbekannten messe, Leib an Leib, Seel' an Seele ...
Der Kohlenstoff im Schwefel wäre nachgewiesen, nun gilt es noch den Wasser- und Sauerstoff. Aber was ist mit ungenügenden Apparaten und ohne Geld zu machen? Dazu sind meine Hände schwarz und blutig, schwarz wie mein Elend, blutig wie mein Herz. Denn ach, während alledem schrieben wir uns, meine Frau und ich, verliebte Briefe. Aber meine Erfolge als Chemiker lassen sie kalt; sie antwortet mit Krankheitsberichten über das Kind und gibt nicht undeutlich zu verstehen, für wie eitel sie meine Wissenschaft halte und wie töricht es sei, dafür Geld zu vergeuden.
Da packt mich der Teufel, und in einer Anwandlung gerechten Stolzes tue ich mir selbst das Leid, den Selbstmord an, und gebe in einem unverzeihlich nichtswürdigen Briefe Weib und Kind den Laufpaß, indem ich mich stelle, als ob eine neue Liebschaft meinen Geist beschäftige.
Der Hieb sitzt. Meine Frau antwortet mit einer Klage auf Scheidung.
Welcher Kummer, welche Sorgen, die über mich Mörder und Selbstmörder hereinbrechen! Niemand teilt meine furchtbare Einsamkeit, und ich bin zu stolz, jemanden aufzusuchen.
Hoch über dem Spiegel eines Meeres treibe ich dahin ... Das Ankertau hab' ich kühn durchhauen – aber wo ließ ich die Segel?
Inzwischen taucht das Schreckbild einer unbezahlten Rechnung inmitten meiner wissenschaftlichen Arbeiten und metaphysischen Spekulationen auf und erinnert mich wieder an die Erde.
So kommt Weihnachten heran. Ich habe die Einladung einer skandinavischen Familie, deren Atmosphäre mir wegen ihrer peinlichen Unregelmäßigkeiten mißfällt, derb abgelehnt. Am Abend aber tut es mir leid und ich gehe doch hin. Man setzt sich alsobald, und das Abendessen beginnt unter einem Heidenlärm. Die jungen Künstler sind von einer unbändigen Ausgelassenheit und fühlen sich hier wie zu Hause. Eine Vertraulichkeit der Bewegungen und Mienen, dazu ein Ton, der nicht in die Familie paßt, erfüllt mich mit unbeschreiblichem Mißbehagen, und in meiner Traurigkeit erscheint mir inmitten der Saturnalien das friedliche Haus meiner Frau. Eine plötzliche Vision zeigt mir den Salon, den Weihnachtsbaum, die Mistel, mein Töchterchen und ihre verlassene Mutter ... Gewissensbisse überfallen mich, ich stehe auf, schütze ein Unwohlsein vor und gehe.
Durch die schreckliche Rue de la Gaieté, wo die gemachte Lustigkeit der Menge mich beleidigt, und die düstere, schweigsame Rue Delambre, eile ich nach dem Boulevard Montparnasse und werfe mich vor der Brasserie des Lilas auf einen Sessel.
Kaum aber, daß mich ein guter Absinth ein paar Minuten lang tröstet, als eine Bande Kokotten mit ihren Studenten des Wegs kommt und auf mich losstürzt. Man schlägt mich mit Ruten ins Gesicht, daß ich wie von Furien gejagt, meinen Absinth stehen lasse, um auf dem Boulevard St. Michel im Franz I. einen andern zu trinken.
Aber vom Regen in die Traufe! Ein neuer Trupp grinst mir sein: Heda, der Einsiedler! entgegen. Und ich fliehe, von Eumeniden gepeitscht, unter den foppenden Geleitfanfaren der Mirlitons nach Hause.
Der Gedanke an eine Züchtigung, als Folge meines Verbrechens, kommt mir nicht. Vor mir selbst fühle ich mich als unschuldiges Opfer einer ungerechten Verfolgung. Die Unbekannten haben mich gehindert, mein großes Werk fortzusetzen: so mußte, was sich nicht biegen wollte, brechen, bevor ich wagen konnte, die Hand nach der Krone des Siegers auszustrecken.
Ich habe unrecht gehabt und zugleich habe ich recht gehabt und werde recht behalten.
Diese Weihenacht schlief ich schlecht. Ein kalter Luftzug streifte mehrere Male mein Gesicht, und von Zeit zu Zeit weckte mich der Ton einer Gitarre.
Allmählich überkommt mich eine gewisse Hinfälligkeit. Meine schwarzen, blutigen Hände hindern mich am Auskleiden und am Ordnen meiner Toilette. Die Furcht vor der Hotelrechnung läßt mir keine Ruhe mehr, und ich wandere in meinem Zimmer, wie ein wildes Tier in seinem Käfig, auf und ab.
Ich schlafe nicht mehr, und der Wirt rät mir das Krankenhaus an. Es ist zu teuer, und man muß es vorher bezahlen, also ist es damit nichts. Aber mit einem Male beginnen die Armadern anzuschwellen –: also Blutvergiftung. Das ist der Gnadenstoß. Das Gerücht davon verbreitet sich unter meinen Landsleuten, und eines Abends kommt die gute Frau, aus deren Abendgesellschaft ich auf eine nichtswürdige Weise ausgerissen war, sie, die mir zuwider war, die ich fast verachtet hatte, sie kommt zu mir, erkundigt sich, begreift mein Elend und bezeichnet mir unter Tränen das Krankenhaus als einzige Rettung.
Man stelle sich meine Hilflosigkeit und meine Zerknirschung vor, als mein beredtes Schweigen ihr endlich begreiflich macht, daß ich ganz ohne Mittel bin. Sie weint laut auf, da sie mich so gesunken sieht.
Sie will sofort unter den Skandinaviern eine Sammlung veranstalten und den Gemeindegeistlichen aufsuchen, denn sie selbst ist arm und von Sorgen des täglichen Lebens überhäuft. Die Sünderin hat Erbarmen mit dem Manne, der soeben sein rechtmäßiges Weib verstoßen.
Bettler, der ich bin, doppelter Bettler, da ich um Nächstenliebe durch die Vermittelung eines Weibes bitte! Ist da nicht eine unsichtbare Hand im Spiele, welche die unwiderstehliche Logik der Ereignisse lenkt? Und ich beuge mich dem Sturme, und gelobe mir, als ein neuer Mensch mich wieder zu erheben.
Der Wagen bringt mich nach dem St. Ludwigs-Krankenhaus. In der Rue de Rennes lasse ich einen Augenblick halten und kaufe ein paar weiße Hemden.
Ein Totenhemd für die letzte Stunde!
Warum beschäftigen sich meine Gedanken so mit der Nähe des Todes? ...
So bin ich denn glücklich interniert, darf nicht ohne Erlaubnis ausgehen, und sitze wie ein Gefangener da, von meinen umwickelten Händen zu vollkommener Untätigkeit verdammt. Mein Zimmer ist kahl, nur mit dem Notwendigsten versehen und ohne jede Spur von Schönheit. In der Nähe liegt der Gesellschaftssaal, wo vom Morgen bis Abend geraucht und Karten gespielt wird.
Es läutet zum Frühstück, und ich sehe mich in einer grausigen Tischgesellschaft. Wohin ich blicke, Köpfe von Toten und Sterbenden; hier fehlt eine Nase, da ein Ohr, dort ist eine Lippe gespalten, dort eine Wange zerfressen. Zwei davon sehen nicht wie Kranke aus, aber ihre Gesichter sind trüb und trostlos genug. Es sind zwei große Diebe der vornehmen Gesellschaft, die es infolge mächtiger Verbindungen durchgesetzt haben, aus dem Gefängnis als krank entlassen zu werden.
Ein ekelhafter Jodoformgeruch benimmt mir den Appetit, dazu zwingen mich die Bandagen der Hände, beim Brotschneiden und Einschenken die Hilfe meiner Gefährten in Anspruch zu nehmen. Und um dies Bankett von Verbrechern und zum Tode Verurteilten herum geht in ihrer strengen weiß und schwarzen Tracht unsere treffliche Vorsteherin und bringt einem jeden seine Giftmedizin. Mit meinem Arsenikbecher trinke ich einem Totenkopf zu, der mir mit Digitalin nachkommt. So grausig das alles ist, muß man doch zugleich dankbar dafür sein. Man könnte rasend werden, für ein solches Nichts auch noch dankbar sein zu sollen.
Ich werde angekleidet, ausgekleidet, wie ein Kind gepflegt. Die Schwester gewinnt mich lieb, behandelt mich wie ein Baby, sagt mein Kind zu mir, und ich nenne sie wie alle andern Mutter.
Wie süß klingt dies Wort Mutter, das ich seit dreißig Jahren nicht mehr ausgesprochen habe! Die Alte, vom Orden des heiligen Augustin, wie eine Tote gekleidet – hat sie doch niemals das Leben gelebt! und sanft wie die Ergebung selber lehrt uns über unsere Leiden wie über ebensoviele Freuden lächeln; denn sie kennt die Wohltaten des Schmerzes. Kein Wort des Vorwurfs, keine Vorstellungen oder Ermahnungen. Ihre Instruktion erlaubt ihr, den Kranken auf eigene Faust kleine Freiheiten zu gestatten. So erlaubt sie mir, in meinem Zimmer zu rauchen und erbietet sich, mir Zigaretten zu drehen, was ich jedoch ablehne. So erwirkt sie mir die Erlaubnis unter der Zeit auszugehen, und als sie die Entdeckung gemacht, daß ich mich mit Chemie befasse, verhilft sie mir zu einer Empfehlung an den gelehrten Apotheker des Krankenhauses, der mir Bücher borgt und mich, nachdem er meine Theorie über die Zusammensetzung der einfachen Körper angehört, in seinem Laboratorium zu arbeiten einlädt. Diese Schwester hat eine Rolle in meinem Leben gespielt. Ich fange an, mich mit meinem Lose wieder auszusöhnen und mein Unglück, das mich unter dies gesegnete Dach geführt hat, als Glück zu preisen.
Der erste Band aus der Bibliothek des Apothekers öffnet sich von selbst, und mein Blick schießt wie ein Falke auf eine Zeile des Kapitels vom Phosphor. In kurzen Worten erzählt da der Verfasser, daß der Chemiker Lockyer durch die Spektralanalyse nachgewiesen habe, daß der Phosphor kein einfacher Körper sei, und daß sich die Pariser Akademie der Wissenschaften der Richtigkeit seiner Auseinandersetzungen nicht habe verschließen können.
Dieser unerwartete Beistand gibt mir neue Kraft. Ich nehme meine Tiegel mit den Resten des noch nicht völlig verbrannten Schwefels und übergebe sie einem Bureau für chemische Analysen, das mir das Zertifikat bis zum nächsten Morgen verspricht.
Bei meiner Rückkehr ins Krankenhaus – es war gerade mein Geburtstag – finde ich einen Brief meiner Frau vor. Sie beklagt mein Mißgeschick, will mich wiedersehen, mich pflegen und mich lieben. Das Glück, trotz allem noch geliebt zu werden, ruft in mir das Bedürfnis zu danken hervor ... aber wem sollte ich danken? dem Unbekannten, der sich so lange nicht um mich gekümmert hatte?
Das Herz will mir brechen, und, ehe ich mich's versehe, schreibe ich wieder wie ein Liebhaber an meine eigne Gattin. Ich beichte ihr, wie meine sogenannte Untreue eitel Lüge gewesen und bitte sie um Verzeihung. Nur unser Wiedersehen will ich noch auf einen günstigeren Zeitpunkt verschoben wissen.
Den nächsten Morgen laufe ich nach dem Boulevard Magenta zu meinem Chemiker und bringe die Analyse in geschlossenem Kuvert nach dem Krankenhaus zurück.
Vor dem St. Ludwigs-Standbild im Hofe der Anstalt fallen mir die Quinze-Vingt, dies große Blindenhospital, die Sorbonne und die Heilige Kapelle ein, diese drei Werke des Heiligen, welche gleichsam »Vom Leiden durch Wissen zur Buße« predigen.
Im wohlverschlossenen Zimmer öffne ich endlich das Schreiben, das über meine Zukunft entscheiden soll. Es lautet:
»Das unsern Versuchen unterworfene Pulver hat folgende Eigenschaften:
Farbe: grau-schwarz, hinterläßt Spuren auf Papier.
Dichtigkeit: sehr groß, größer als die mittlere Dichtigkeit des Graphit, es scheint ein harter Graphit zu sein.
Chemische Untersuchung:
Dieses Pulver verbrennt leicht, unter Entbindung von Kohlenoxyd und Kohlensäure. Es enthält also Kohle.«
Der reine Schwefel enthält Kohle!
Ich bin gerettet. Ich kann von heut an meinen Freunden und Verwandten beweisen, daß ich kein Narr bin, ich kann die Theorien rechtfertigen, die ich vor einem Jahre in meinem Antibarbarus vorgetragen, den man in den Zeitschriften wie das Werk eines Scharlatans oder Verrückten behandelt hat, ich kann meiner Familie, die mich infolgedessen wie einen Taugenichts, wie eine Art von Cagliostro fortgejagt hat, das Gegenteil beweisen.
Seht, meine Gegner, wie ihr nun zu Boden geschmettert seid! Mein Blut wallt in gerechtem Stolz, ich will das Krankenhaus verlassen, durch die Straßen schreien, vor dem Institut brüllen, die Sorbonne niederreißen ... aber meine Hände bleiben gebunden, und als ich draußen auf dem Hofe stehe, rät mir die hohe Ringmauer – Geduld.
Als ich dem Apotheker das Ergebnis der Analyse mitteile, schlägt er mir vor, das Problem einer Kommission ad oculos zu demonstrieren.
Ich jedoch, in meiner Scheu vor der Öffentlichkeit, schreibe statt dessen einen Aufsatz über die Sache und schicke ihn an den Temps, der ihn nach zwei Tagen bringt.
Die Parole ist gegeben. Man antwortet mir von allen Seiten. Man muß die Tatsache zugeben, ich habe Anhänger gefunden, ich bin in einer chemischen Zeitschrift eingeführt und in eine Korrespondenz verwickelt, welche die Fortsetzung meiner Untersuchungen fördert.
Eines Sonntags, dem letzten meines Aufenthalts im Fegefeuer des Heiligen Ludwig, beobachte ich vom Fenster aus den Hof. Die beiden Diebe gehen mit ihren Frauen und Kindern auf und ab und umarmen sich von Zeit zu Zeit mit glückstrahlenden Mienen wie Menschen, die das Unglück mit um so festerer Liebe aneinanderkettet.
Meine Einsamkeit bedrückt mich, ich verfluche mein Los und schelte es ungerecht, ohne daran zu denken, daß mein Verbrechen die ihrigen an Gemeinheit übersteigt. Der Hausmeister bringt einen Brief meiner Frau. Er ist von einer eisigen Kälte. Mein Erfolg hat sie verletzt und sie tut so, als wolle sie nicht eher daran glauben, als bis ich einen Chemiker von Fach zu Rate gezogen hätte; außerdem warnt sie mich vor allen Illusionen, die nur zu Gehirnstörungen führten. Was gewänne ich schließlich mit all dem? Könnte ich mit der Chemie eine Familie ernähren?
Noch einmal die Alternative: Liebe oder Wissenschaft! Ohne Zaudern schreibe ich einen letzten vernichtenden Brief und sage ihr ade, zufrieden mit mir wie ein Mörder nach seiner Tat.
Am Abend schlendere ich in meinem trübseligen Viertel umher und gehe über den St. Martins-Kanal. Er ist schwarz wie das Grab und so recht gemacht, sich darin zu ersäufen. Ich bleibe an der Ecke der Rue Alibert stehen. Warum Alibert? Wer ist das? Hieß nicht der Graphit, den der Chemiker in meinem Schwefel fand, Alibert-Graphit? Nun, was weiter? Seltsam, aber der Eindruck von etwas Unerklärlichem bleibt in meinem Geiste haften. Dann Rue Dieu. Warum Dieu, wenn Gott von der Republik abgeschafft worden ist? Rue Beaurepaire. Der beau repaire der Übeltäter ... Rue de Baudry ... Führt mich der Teufel? Ich gebe auf die Inschriften nicht mehr acht, verirre mich, kehre um, finde mich nicht mehr zurecht, schrecke vor einem Schuppen zurück, der nach rohem Fleisch und ekelhaften Gemüsen, besonders nach Sauerkraut stinkt ... Verdächtige Individuen streifen mich an und ergehen sich in rohen Ausdrücken ... Ich habe Angst vor dem Unbekannten, wende mich rechts, wende mich links und gerate in eine schmutzige Sackgasse, wo Unflat, Laster und Verbrechen zu wohnen scheinen. Dirnen versperren mir den Weg, Kerle grinsen mich an ... Die Szene von Weihnachten wiederholt sich, vae soli! Wer spielt mir diese hinterlistigen Streiche, sobald ich mich von Welt und Menschen trenne? Irgend jemand hat mich in diese Falle gebracht! Wo ist er, ich will mit ihm kämpfen!
Im Augenblick, da ich zu laufen beginne, geht ein mit schmutzigem Schnee gemischter Regen nieder ... Im Hintergrund einer kleinen Straße zeichnet sich ein großes, kohlschwarzes Tor gegen das Firmament ab, ein Zyklopenwerk, ein Tor ohne einen Palast, das sich auf ein Meer von Licht öffnet ... Ich frage einen Polizisten, wo ich bin. – Am St. Martins-Tor. –
Mit ein paar Schritten bin ich auf den großen Boulevards. Die Theateruhr zeigt ein Viertel auf sieben. Es ist gerade Feierabend, und meine Freunde warten wie gewöhnlich im Café Neapel. Hastig eile ich weiter, vergessen sind Krankenhaus, Kummer und Armut. Beim Vorbeigehen am Café du Cardinal stoße ich an einen Tisch, an dem ein Herr sitzt. Ich kenne ihn nur dem Namen nach, aber er kennt mich und in derselben Sekunde fragen mich seine Augen:
Du hier? Du bist also nicht im Krankenhaus? Dieser Klatsch!
Und ich fühle, daß dieser Mann einer meiner unbekannten Wohltäter ist; denn er erinnert mich daran, daß ich ein Bettler bin und nicht ins Café gehöre.
Bettler! Das ist das rechte Wort, das mir in den Ohren braust und mir die brennende Röte der Scham, Demütigung und Wut in die Wangen treibt.
Vor sechs Wochen setzte ich mich hier an den Tisch; mein Theaterdirektor setzte sich zu mir und nannte mich lieber Meister, die Journalisten überliefen mich mit ihren Interviews, der Photograph bat mich um die Ehre, meine Bilder verkaufen zu dürfen ... und heute, was bin ich heute? Ein Bettler, ein Gezeichneter, ein Verbannter der Gesellschaft.
Gestäupt, gehetzt, zum äußersten getrieben, laufe ich wie ein nächtlicher Herumstreicher den Boulevard entlang und heim zu meinen Aussätzigen. Da endlich und nur da, in meinem Kerker, fühle ich mich heimisch.
Wenn ich mein Los überdenke, erkenne ich wieder jene unsichtbare Hand, welche mich züchtigt und geißelt, ohne daß ich noch den Zweck errate. Will es mein Ruhm, daß mir die Welt ihre Ehren verweigert, muß ich gedemütigt werden, um wieder aufgerichtet, erniedrigt, um wieder erhöht zu werden?
Und der Gedanke kommt wieder und wieder: Die Vorsehung plant etwas mit dir, und dies ist der Anfang deiner Erziehung.
Im Februar verlasse ich das Krankenhaus, ungeheilt, aber genesen von den Versuchungen der Welt.
Zum Abschied habe ich die Hand der treuen Mutter, die mich ohne viel Worte den Weg des Kreuzes gelehrt hat, küssen wollen, aber ein Gefühl der Ehrfurcht wie vor etwas Geweihtem hat mich davon zurückgehalten.
Möge sie nun im Geiste diese Dankbezeugung eines Fremden empfangen, dessen Spur sich im fremden Lande verloren und verirrt hat.