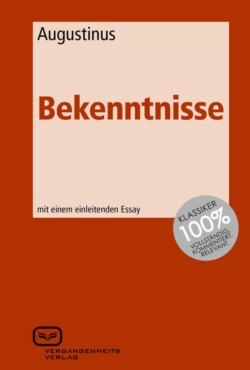Читать книгу Bekenntnisse - Augustinus - Страница 5
Einleitendes Essay
ОглавлениеVom Saulus zum Paulus
„Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche” – so lautet der Titel der 1954 erschienenen Doktorarbeit des Theologen Joseph Ratzinger. Der Doktorand von damals ist heute Papst und der Heilige Augustinus immer noch der Lieblingstheologe Benedikts XVI. In einer Generalaudienz im Januar 2008 nennt er ihn sogar den „bedeutendsten und im christlichen Abendland einflussreichsten Kirchenvater”. Der Theologe und Philosoph Augustinus, der an der Schwelle von der Antike zum Mittelalter lebte, verfasste viele Schriften, die uns zum größten Teil erhalten geblieben sind. In ihnen bildet der christliche Glaube die Grundlage zu Erkenntnis – Credimus ut cognoscamus: Wir glauben, damit wir erkennen.
Nicht immer war Aurelius Augustinus, so sein voller Name, ein mustergültiger Christ. 354 n. Chr. wurde er im nordafrikanischen Thagaste im heutigen Algerien als Sohn eines römischen Heiden und einer gläubigen Christin geboren. Die Mutter erzog den nicht getauften Augustinus im christlichen Sinne, außerdem erhielt er eine klassische Ausbildung, unter anderem in Grammatik und Rhetorik. Anschließend gelang es den Eltern, einen Gönner für ihren begabten Sohn zu finden, der sein Studium der Rhetorik finanzierte. Ab 370 genoss der junge Augustinus das Studentenleben in Karthago, nahm sich eine Geliebte, die dem gerade 19-jährigen einen Sohn gebar. Sie nannten das Kind Adeodatus – von Gott geschenkt.
Alles deutete auf einen gesellschaftlichen Aufstieg des jungen Augustinus aus einfachen Verhältnissen hin – doch dann begegnete er einem gewissen Cicero, zumindest auf dem Papier. Er bekam ein Buch des berühmten Römers mit dem Titel Hortensius in die Hände: Es enthielt die Aufforderung, sich der Philosophie zu widmen. „Jenes Buch führte eine Wende in mir herbei”, schrieb Augustinus später. Doch nicht alle seine Fragen, vor allem die nach dem Ursprung des Bösen, werden bei den alten Philosophen beantwortet. Augustinus wendete sich den Manichäern zu – einer Sekte, wie sie Cornelius Mayer, Leiter des Zentrums für Augustinusforschung in Würzburg, nennt. In dieser mythologisch besetzten Religionsgemeinschaft stehen sich die Mächte der Finsternis und des Lichts gegenüber; um zur Erlösung zu gelangen, müsse man sich aus der Schattenwelt befreien. Augustinus blieb neun Jahre Mitglied, schloss sich jedoch nie dem auserwählten inneren Kreis an.
Nach verschiedenen Lehrtätigkeiten in Karthago und Rom wurde Augustinus 384 zum Professor der Rhetorik in Mailand berufen. In dieser Zeit distanzierte er sich von den Manichäern. Seine Mutter Monnica, die Augustinus zwischenzeitlich erfolglos zum Manichäismus zu bekehren versuchte, folgte dem nunmehr „vernünftig gewordenen” Sohn nach Rom und drängte ihn, seine langjährige Freundin zu verlassen. Nur eine standesgemäße Heirat ermöglichte zu dieser Zeit einen gesellschaftlichen Aufstieg. Er schickt seine Geliebte in die Heimat zurück und verlobte sich mit einer erst 10-jährigen. Da sie erst in zwei Jahren das heiratsfähige Alter erreichen würde, tröstete er sich in der Zwischenzeit über die erzwungene sexuelle Enthaltsamkeit mit einer Konkubine hinweg.
Die Bekehrung
Wie wird nun aus dem Lebemann Augustinus einer der einflussreichsten Kirchentheologen der Welt? Durch eine radikale Bekehrung – eindrucksvoll schildert Augustinus sie in seinen Bekenntnissen: Nach dem Rückzug von den Manichäern war er enttäuscht, sein Leben wurde Augustinus immer mehr zur Last. Aufgewühlt in einem Garten soll er sich niedergelassen haben, sich selbst bedauernd, bis er ein Kind singen hört: „Nimm und lies! Nimm und lies!” Der Sinnsuchende deutete das Kinderrufen als Befehl Gottes, lief ins Haus, wo er in einer Paulus-Abschrift folgende Zeilen las: „Nicht in Gelagen und Zechereien, nicht in Schlafkammern und Unzucht, nicht in Hader und Eifersucht, ziehet vielmehr den Herrn Jesus Christus an und pflegt nicht das Fleisch zur Erregung eurer Lüste.” Fortan schwörte Augustinus den weltlichen Versuchungen ab, er gab seinen Lehrauftrag auf, um an eigenen Schriften zu arbeiten. Liebe, Karriere oder Geld hatten für ihn fortan keine Bedeutung mehr. Bald darauf, im Jahr 387, ließ er sich im Alter von 32 taufen.
Sein Plan, ein zurückgezogenes, asketisches Leben zu führen, ging nicht auf. Schnell entdeckte man die Begabung des Neugetauften. Innerhalb der Kirchenhierarchie ging es fortan steil bergauf. Er kehrte nach Nordafrika zurück und wurde um 391 bei einem Gottesdienstbesuch in Hippo Regius, einer Küstenstadt im Norden Algeriens, zum Priester geweiht. Um 396 übernahm Augustinus als Bischof die Leitung der Diözese. Über 40 Jahre wird er das Bischofsamt ausüben, circa 600 Predigten von ihm sind überliefert, was nur einem Zehntel des ursprünglichen Volumens entspricht. Er verwaltete außerdem das Kirchenvermögen, spendete die Sakramente, übte Seelsorge und sogar Rechtssprechung aus, wozu christliche Bischöfe zu dieser Zeit ermächtigt waren. Augustinus blieb in Hippo bis zu seinem Tod im Jahr 430. Er starb zu einer Zeit, als die Stadt von Vandalen umlagert und erobert wurde. Seine Gebeine befinden sich heute in der norditalienischen Stadt Pavia. In den Westkirchen wird er als Heiliger verehrt, als Gedenktag in römisch-katholischen und anglikanischen Kirchen gilt der 28. August, dem Tag seines Todes.
Augustinus Vermächtnis
Augustinus hat das Denken des Abendlandes wesentlich geprägt – er wird als Kirchenvater bezeichnet, einer jener Kommentatoren der Heiligen Schrift, die in den ersten Jahrhunderten nach Christus wirkten und entscheidend zur christlichen Lehre und zum Selbstverständnis beitrugen. Die umfassende Auseinandersetzung mit seinem Werk ist vor allem dem Umstand zu verdanken, dass das Werk Augustinus im Großen und Ganzen erhalten blieb. Schon kurz nach dem Tod des Gelehrten wurde sein Werk gesammelt und verbreitet, in mittelalterlichen Schulen gehörte es zum Unterrichtskanon. Kurz nach der Erfindung des Buchdrucks erschien 1506 die erste Gesamtausgabe seines Werks. Auch kritische Betrachtungen kamen im Laufe der Jahrhunderte dazu. An Aktualität scheinen seine Schriften nicht verloren zu haben. So sind auch heute noch die Schriften des Papstes wesentlich von Augustinus’ Lehre durchdrungen. Mehrere hundert, zumeist wissenschaftliche Arbeiten ergänzen jährlich die auf rund 50.000 Titel geschätzte Sekundärliteratur zu Leben und Werk des Kirchenvaters.
Als eines der Hauptwerke seines Wirkens gelten Augustinus „Bekenntnisse”, die confessiones, ein autobiografisches Werk, das zur Weltliteratur wurde. Von 397 bis 401 verfasste der damalige Bischof 13 Bücher, die von seinen anfänglichen „Irrwegen” bis zur Hinführung zu Gott berichten. Dabei stehen zunächst weniger historische Ereignisse im Vordergrund, als vielmehr der Weg seiner eigenen geistigen Entwicklung. Erst das 11. Buch widmet sich philosophischen Betrachtungen seiner Zeit, Teil 12 und 13 einer Lobpreisung auf Gott. Der Titel seiner Memoiren ist dabei doppeldeutig – sowohl als Schuldbekenntnis, confession, als auch Glaubensbekenntnis, confessio, kann der Titel verstanden werden.
Weiterführende Empfehlungen
Literatur:
Ausführlich wissenschaftlich-philosophische Einführung in Augustinus Denken:
Flasch, Kurt, Augustin – Eine Einführung in sein Denken, 3. bibliographisch ergänzte Auflage, Stuttgart 2003.
Grundlagenwissen zu Leben und Werk des Augustinus:
Fuhrer, Therese, Augustinus, Darmstadt 2004.
Fiktiver Briefwechsel der ehemaligen Geliebten an Augustinus:
Gaarder, Jostein, Das Leben ist kurz – Vita Brevis, München 1996.
Das Augustinus-Lexikon des Zentrums für Augustinusforschung:
Mayer, Cornelius u.a. (Hrsg.), Augustinus-Lexikon, Basel 1994ff.
Papst Benedikts XIV. Dissertation zu Augustinus Lehren:
Ratzinger, Joseph, Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche, München 1951.
Links:
Zentrum für Augustinusforschung in Würzburg (ZAF), www.augustinus.de