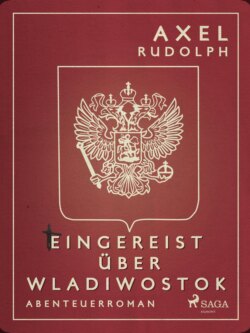Читать книгу Eingereist über Wladiwostok - Axel Rudolph - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Kapitel
ОглавлениеKalt weht der Wind über Wladiwostoks niedrigen Dächern. Dennoch wundert sich Helle Beier erheblich über die dicken Pelze und Mäntel, in denen die Russen bereits vermummt gehen. Es ist schließlich erst Ende September und noch keine „sibirische“ Kälte. Sie selber findet gar keinen Grund, einen Pelzmantel über ihr warmes, dickes Reisekostüm zu ziehen.
Das ist also Fernost, das Ausfalltor Rußlands gegen das Japanische Meer. Helle Beier findet ihre Annahmen im großen und ganzen bestätigt und ist guten Mutes. Zwar ist es etwas sonderbar und unangenehm, daß man im Bahnhofsrestaurant stundenlang auf das Essen warten muß, weil das Bedienungspersonal eben seine Freizeit hat, und unter den Gesichtern, die ihrem Blick begegnen, sind viele bedrückte, scheu und ängstlich dreinschauende Mienen. Aber — die Reise auf dem russischen Dampfer war ganz angenehm, und auch bei der Paßkontrolle hat man ihr keine besonderen Schwierigkeiten gemacht. Keine Leibesvisitation, keine mißtrauischen Verhöre. Die Zigaretten rauchenden Beamten haben nur ihr Visum genau geprüft, ihren Koffer einer Durchsicht unterzogen und ihr dann mit einem gleichgültigen „Choroscho!“ den Weg freigegeben.
Allerdings, von Soldaten und Polizisten wimmelt es hier. Auf der kurzen Fahrt vom Hafen zum Bahnhof sind ihr dauernd Militärpatrouillen begegnet, und an jeder Straßenecke steht ein bis an die Zähne bewaffneter Milizionär. Aber das ist in Japan auch nicht viel anders. Und schließlich ist Wladiwostok Festungsgebiet.
Nun, Helle Beier geniert das wenig. Sie hat kein Interesse an militärischen Anlagen und daher auch keinen Versuch gemacht, etwa abseits von der Hauptstraße in Wladiwostok auf Entdeckungsfahrten zu gehen.
In dem überheizten Wartesaal ist eine dumpfe, stickige Luft. Helle nimmt, gleich nachdem sie etwas gegessen hat, ihren Handkoffer und geht wieder auf den Bahnsteig hinaus. Im Speisesaal waren nur wenig Menschen, fast durchweg europäische Herren, die das alleinreisende hübsche Mädchen mit neugierigen und, wie ihr scheinen wollte, etwas mißtrauischen Blicken betrachteten. Es waren ein paar sehr nett und solide aussehende angelsächsische Gentlemen darunter, und Helle hat sich ein bißchen gewundert, daß keiner dieser Herren auch nur den leisesten Versuch machte, eine Unterhaltung mit ihr anzuknüpfen. Sonst hat ihre schlanke Erscheinung, ihr hübsches, eigenwilliges Gesicht oft genug mitreisende Herren bewogen, eifrig eine kleine Reisebekanntschaft anzuknüpfen. Und grade hier hätte Helle nichts dagegen gehabt, mit einem sympathischen Herrn ein paar Stunden der langen Fahrt zu verplaudern. Merkwürdig, daß die Gentlemen so übermäßig zurückhaltend sind!
Waren im Wartesaal nur verhältnismäßig wenige Reisende, so wimmelt es dafür hier auf dem Bahnsteig von Menschen. Russen, die ihre Betten und den halben Hausrat mit sich schleppen, ganze Klumpen von dürftig gekleideten Männern und Frauen, die sich, den unentbehrlichen Teekessel in der Hand, um den „Kipjatok“, den großen Warmwasserbehälter, drängen. Dazwischen armselige, in schmutzige, durchlöcherte Schafpelze gehüllte Gestalten, die gruppenweise mit stumpfem Gesichtsausdruck auf ihren Kisten und Ballen kauern, und schlitzäugige, schmutziggelbe Mongolengesichter: Burjäten, Tungusen, Tartaren. Natürlich auch eine Menge von Soldaten der fernöstlichen Armee, hohe Gestalten, die in ihren tadellosen Stiefeln und dicken, schönen Mänteln von den dürftig gekleideten Zivilisten stark abstechen.
„Stoi!!“
Helle wendet sich bei dem lauten Ruf um und sieht zu ihrer Verwunderung, wie ein schlanker, hochgewachsener Mann, der in ihrer Nähe gestanden hat, plötzlich in langen, wilden Sätzen den Bahnsteig entlang saust und sich wie ein Sturmbock gegen die Gruppen wirft, die ihm den Weg versperren. Ein paar Minuten gibt es hinter der rasch zusammengeströmten Menschenmasse ein wüstes Getobe und Geschimpfe. Helle kann nicht sehen, was dort vorgeht. Sie hört nur laute Stimmen und sieht über die Köpfe ein paar Polizeihelme ragen. Dann teilt sich die Menge, und der Mann, der vorhin davonjagte, kommt wieder zum Vorschein. Wahrhaftig, er kommt direkt auf sie zu!
„Hier ist Ihr Koffer, Genossin,“ sagt eine sympathisch warme Stimme. „Ich sah eben, wie der Kerl sich damit aus dem Staube machen wollte.“
„Mein Koffer?“ Helle sieht fassungslos auf das Gepäckstück in der Hand des Mannes und entdeckt erst jetzt zu ihrem Entsetzen, daß der Handkoffer, der dicht neben ihr gestanden hat, verschwunden ist. „Das ist doch ... Ich hab’ nicht einmal bemerkt, daß jemand ... Vielen Dank, mein Herr!“ Helle hat von Kola Dobkin im Laufe der Zeit genügend russisch gelernt, um sich in dieser Sprache einigermaßen verständlich machen zu können, aber in der Aufregung sprudelt sie unbewußt die Sätze auf deutsch heraus. Der unerwartete Helfer lächelt vergnügt.
„Ach, Sie sind eine Deutsche? Das ist ja sehr schön. Da können wir ebensogut deutsch reden.“
„Sind Sie denn etwa auch ...?“
„Pawel Karlowitsch Gentzer heiß’ ich.“ Der Mann lüftet ein wenig seine Lammfellmütze. „Bin zwar in Sibirien geboren, aber mein Vater war aus Deutschland.“
Eine Glocke schlägt gellend an. Prustend und fauchend schiebt sich die lange Wagenreihe des transsibirischen Expreß an den Bahnsteig. Ein Höllenlärm hebt an. Schreiend, rufend, scheltend drängen sich die Menschen mit ihren Koffern, Ballen und Kisten durcheinander. Soldaten fluchen und brechen sich mit rücksichtslosen Ellbogenstößen Bahn. Um die schmalen Türen der Wagen ist ein Drängen, Stoßen und Schreien, als sei eine Panik ausgebrochen.
Pawel Karlowitsch hat sich durch ein paar knappe Fragen über das Reiseziel Helles vergewissert und geleitet sie sachkundig und umsichtig zu einem Abteil der „Fremdenklasse“.
„Haben Sie nochmals recht herzlichen Dank!“ Dem Wirrwar auf dem Bahnsteig glücklich entronnen, sieht Helle sich aufatmend in dem sehr bequem und luxuriös eingerichteten breiten Abteil um und streckt ihrem Helfer die Hand entgegen. „Reisen Sie auch nach Irkutsk, Herr Gentzer?“
„Genosse Gentzer,“ verbessert Pawel Karlowitsch ruhig. „Nein, aber bis Werchni Udinsk habe ich das Vergnügen, mit Ihnen reisen zu können. Darf ich in Ihrem Abteil Platz nehmen?“
Dreimal inerhalb der ersten Stunden der Fahrt wird kontrolliert. Zweimal erscheinen im Abteil Soldaten, die nicht nur die Pässe, sondern auch das Gepäck revidieren. Das dritte Mal ist es ein zivilgekleideter Polizeibeamter.
„Man gewöhnt sich daran,“ sagt Pawel Karlowitsch achselzuckend, als Helle zum dritten Male ihren kostbaren Reisepaß eingesteckt hat. „Hier in Fernost lebt man seit Jahren sozusagen im Kriegszustand. Es ist kein reines Vergnügen, mit der transsibirischen Bahn zu reisen.“
Helle kuschelt sich behaglich in die Polster. „Aber sehr elegant sind die Wagen hier, das muß man gestehen. Ich hätte das kaum erwartet.“
Pawel Karlowitsch zieht ein etwas spöttisches Gesicht. „Nun, es gibt auch andere Wagen. Ich würde Ihnen nicht raten, in der dritten Klasse zu reisen. Aber das war schon früher so in Rußland. Hochelegante, bequeme Wagen für die wohlhabenden Fremden und schmutzige, vollgepfropfte „Maximkas“ für diejenigen, die nicht zahlen können. Darin hat sich bei uns nicht viel geändert.“
„Und Sie leben also immer hier in Sibirien, Herr — Verzeihung: Genosse Gentzer?“
Pawel Karlowitsch lächelt gutmütig. „Von mir aus können Sie mich nennen, wie Sie wollen. Aber ich rate Ihnen, sich ganz allgemein den amtlichen Ausdruck ‚Towarischtsch‘ im Gespräch mit jedermann anzugewöhnen, solange Sie in Rußland sind. Man macht sich sonst leicht verdächtig, ausgenommen, wenn man einen Kommissär oder Offizier versehentlich mit dem verpönten ‚Herr‘ anredet.“
„Danke. Ich werde es mir merken.“
„Ja, ich lebe in Fernost,“ fährt Pawel Karlowitsch fort, „und bedeutend lieber als in Moskau oder Leningrad. Hier sind die Lebensmittel billiger.“ Er wartet gar keine Frage seiner Reisegefährtin ab, sondern beginnt sofort, ausführlich seine Verhältnisse auseinanderzusetzen.
„Mein Vater war einer der deutschen Pioniere hier in Sibirien, schon im Anfang des Jahrhunderts eingewandert. Er betrieb ein Sägewerk am oberen Jenissei. Als der Krieg ausbrach, versuchte er, nach Hause zu gelangen, um seine Pflicht als Soldat zu erfüllen. Man holte ihn aus dem Zug und internierte ihn. Als er auch aus dem Internierungslager floh und verfolgt wurde, verbarg ihn eine junge deutschstämmige Frau auf ihrem Bauernhof. Sie wurde meine Mutter. Eines Tages war dann die Gefahr vorüber. In Rußland ging alles drunter und drüber. Aber — in Deutschland sah es nicht viel besser aus. Der Krieg war verloren, und als mein Vater von jenem Hexenreigen von Unwürdigkeit, Schmach und Schmutz erfuhr, der damals durch Deutschland tobte, blieb er, wo er war.“
„Ihre Eltern leben also auch hier in Sibirien?“
„Sie sind beide tot. Im großen Hungerjahr ... nun, reden wir nicht davon! Das ist vorbei. Mein Vater hatte den Bauernhof verkauft und dafür in Selenginsk, nahe bei der mongolischen Grenze, ein Sägewerk errichtet. Nach den bestehenden Gesetzen gehört es jetzt dem Staat, aber man hat mich trotz meiner Jugend zum Leiter ernannt, und so konnte ich bleiben. Zu klagen habe ich nicht. Meine Stellung ist praktisch vollkommen selbständig, denn die örtlichen Behörden in Selenginsk haben nicht viel Ahnung vom Holzgeschäft. Mit dem Gehalt hapert es zwar. Manchmal bleibt die Löhnung für meine Arbeiter und mich monatelang ganz aus. Nitschewo. Hier in Sibirien fühlt man das nicht so. Man hilft sich selbst, nimmt ein paar Schläge Wald und verkauft sie unter der Hand. Oder man geht auf die Pelztierjagd. Seitdem ich die Lieferungen für die fernöstliche Armee habe, Holzbaracken und so weiter, kann ich auch über das Geld nicht mehr klagen. General Blücher zahlt pünktlich. Ich war eben jetzt wieder in Wladiwostok, um über neue Lieferungen zu verhandeln. Aber nun bitte erzählen Sie auch, Genossin Beier! Was führt Sie denn mutterseelenallein nach Rußland?“
Einen Augenblick ist Helle daran, dem jungen, sympathischen Mann alles zu erzählen, aber dann überkommt sie die Erinnerung an all die Warnungen, die man ihr mit auf den Weg gegeben hat, und das Mißtrauen meldet sich. Dieser Pawel Karlowitsch verkehrte so sicher und selbstbewußt vorhin mit den kontrollierenden Beamten. Sie schienen ihn auch gut zu kennen, denn der Polizist warf kaum einen Blick auf seinen Ausweis. Wer weiß denn, ob dieser Pawel Karlowitsch nicht ein Agent ist, der sie zu überwachen und auszuhorchen hat?
„Ich reise nach Irkutsk, um meinen Verlobten aufzusuchen,“ sagt sie kühl.
„Oh, Sie haben einen Bräutigam in Irkutsk? Einen Deutschen? Dann müßte ich ihn eigentlich kennen.“
Helle merkt ganz deutlich, Pawel Karlowitsch wartet darauf, daß sie den Namen nennen und weitererzählen soll, und beschließt, ihm den Gefallen nicht zu tun. Auch ihr Reisegefährte scheint die absichtliche Zurückhaltung zu merken und schlägt ein anderes Thema an.
„Haben Sie viel Scherereien mit Ihrem Visum gehabt?“
„Gar keine. Man hat mir auf dem Tokioter Paßamt anstandslos die Einreise bewilligt.“
Pawel Karlowitsch zieht die Brauen hoch. „Das wundert mich eigentlich. Oder hatten Sie Empfehlungsbriefe? Ich meine: Konnten Sie sich auf jemand in Deutschland berufen, der — sagen wir mal — der Sowjetunion nahesteht?“
Es stimmt. Er will mich aushorchen! — denkt Helle belustigt und schüttelt den Kopf. „Ich habe mit derartigen Kreisen absolut keine Verbindungen.“
„Dann verstehe ich nicht recht ... Es ist für Deutsche sonst nicht leicht, Einreiseerlaubnis nach Fernost zu erhalten. Nach Moskau oder Leningrad schon eher. Hier oben hat man zu viel Angst vor Spionen.“
„Ich bin aber keine Spionin, Herr Gentzer!“
„Gewiß nicht. Aber es ist doch merkwürdig, daß man Sie so leicht einreisen ließ. Sie haben keine Ahnung, wie mißtrauisch die Behörden hier sind. Ich selber habe vor zwei Jahren auf Grund meiner nachweislich rein deutschen Abstammung um die Erlaubnis nachgesucht, meine Stellung aufzugeben und nach Deutschland auszuwandern. Was meinen Sie, was ich da erlebt habe! Wenn sich die örtlichen Behörden in Selenginsk nicht hinter mich gestellt hätten, säße ich heute an der Murmanküste oder in einem Gefängnis. Das Gesuch wurde natürlich glatt abgelehnt.“
Helle schürzt ein wenig die Lippen. „Warum wollten Sie denn nach Deutschland? Sie sind doch hier in Rußland geboren und kennen Deutschland gar nicht!“
„Das ist wahr.“ Pawel Karlowitsch macht ein nachdenkliches Gesicht. „Ich habe die Heimat meiner Eltern nie gesehen und fühle doch, daß es auch meine Heimat ist. Merkwürdig, nicht? Vielleicht kommt es daher, daß bei uns zu Hause immer nur deutsch gesprochen wurde. Aber ich ...“
Pawel Karlowitsch kommt nicht weiter. Ein harter Stoß läßt ihn fast vornüber von seinem Sitz fallen, und auch Helle fühlt ihren Kopf durch den plötzlichen Ruck schmerzhaft gegen die Rückwand schlagen.
Der Zug hält auf offener Strecke.
„Ein Unglück? Zusammenstoß?“ Unwillkürlich greift Helle wie hilfesuchend nach dem Arm ihres Begleiters. Pawel Karlowitsch hat das Gleichgewicht wiedergefunden und sich aufgerichtet. Seine Brauen sind finster zusammengezogen.
„Nein! Ein Überfall! Hören Sie nicht?“
Ja, jetzt hört Helle es auch. Irgendwo draußen hämmert ein Maschinengewehr in kurzen, trockenen Schlägen. Stiefel trampeln auf dem Kies des Bahndamms, kurze, scharfe Rufe in einer fremden Sprache.
„Vom Fenster weg!“ Pawel Karlowitsch reißt Helle, die unwillkürlich nach dem Öffner gegriffen hat, jäh zurück. „Ganz ruhig bleiben! Allen Befehlen Folge leisten! Haben Sie Juwelen bei sich?“
„Nein.“ Helle faßt erschrocken nach ihrem Handtäschchen. „Nur etwas Geld und einen Kreditbrief!“
„Um den kümmert sich die Bande nicht! Tun Sie genau, was ich tun werde!“
Es ist keine Zeit zu weiteren Erklärungen. Das Maschinengewehr draußen schweigt. Dafür sind im Zuge selbst erschrockene Stimmen laut geworden. Energische Schritte kommen den Korridor entlang. Abteiltüren werden aufgerissen.
„Ausweise!“
Ein großer, starkknochiger Mongole in einer unbestimmbaren, halb europäischen Militäruniform steht in der Abteiltür. Hinter ihm zwei gleichfalls militärisch uniformierte Gelbe, die schußbereite Gewehre in den Händen halten.
„Russe?“ Der Banditenführer wirft Pawel Karlowitsch den vom Kommando der fernöstlichen Armee gestempelten Ausweis wieder zu. „Sie können weiterfahren! Die Frau kommt mit!“
Helle will entsetzt auffahren, aber Pawel greift warnend nach ihrer Hand und hält sie fest. „Die Frau ist in meiner Begleitung. Haben Sie etwas dagegen, General, daß ich gleichfalls mitkomme?“
„Meinetwegen!“ Der „General“ scheint eine wichtigere Beute zu suchen. Er zuckt nur flüchtig die Achseln und wendet sich dem nächsten Abteil zu. Seine „Soldaten“ machen Miene, Helle aus dem Abteil zu ziehen, aber Pawel Karlowitsch hat sich breit in der Tür aufgepflanzt.
„Nur langsam, Freundchen! Wir kommen freiwillig!“
Die Soldateska zwitschert, schimpft und zetert durcheinander aber ein scharfer Ruf des Anführers reißt sie weiter nach vorn. Helle schreit unwillkürlich auf. Irgendwo da vorne im Wagen knallen zwei Pistolenschüsse. Ein heiserer Todesschrei gellt auf und bricht jäh wieder ab.
„Um Gottes willen,“ stammelt Helle angstvoll, „um Gottes willen ...“
„Das da vorne geht uns nichts an. Kommen Sie, Genossin!“ Pawel Karlowitsch ist die Ruhe selbst. Keine Bewegung an ihm verrät Besorgnis oder gar Furcht. Eilig, aber ohne Aufregung hilft er Helle den Koffer aus dem Netz heben und den Mantel anziehen.
Da steht schon wieder ein Gelber an der Tür, aufgeregt schimpfend und befehlend. Pawel nimmt Helles Koffer und schiebt sie selber aus dem Abteil. Wie im Traum taumelt sie durch den engen Korridor, an wildblickenden, bewaffneten Banditen vorbei. Pawel muß sie fast herunterheben von dem hohen Trittbrett.
Überfall am hellichten Tage! Die Nachmittagssonne steht noch über den endlosen Steppen, aber rings um den Zug wimmelt es von Mongolen. Ein paar alte Lastautos harren drüben. Vorne an der Lokomotive hält eine Gruppe Banditen das Zugpersonal und die russische Begleitwache in Schach. Die Telefondrähte längs der Bahn sind zerschnitten.
„Fliehen ist zwecklos!“ sagt Pawel Karlowitsch leise, die Gedanken Helles erratend. „Man würde uns doch einholen oder uns ein Dutzend Kugeln nachsenden. Bleiben Sie nur ja ruhig stehen!“
Bewaffnete springen wie Katzen von den Eisenbahnwagen. Einige von ihnen schleppen Koffer und Aktentaschen mit. Ein paar Reisende, die protestierend nachdrängen wollen, werden mit Bajonetten bedroht oder mit Kolbenstößen zurückgetrieben.
„Keine Gefangenen!“ stellt Pawel Karlowitsch halblaut fest. „Wir sind die einzigen. Das heißt: Sie. Denn mich wollten die Brüder ja weiterreisen lassen.“
Zitternd klammert Helle sich an seinen Arm. „Lassen Sie mich nicht allein, Herr Gentzer! Nicht allein mit den ... den Menschen!“
„Ich bleibe bei Ihnen! Nur ruhig Blut! Ich glaube, es ist kein Grund zur Besorgnis!“
Nun kommt auch der Anführer der Räuberbande aus dem Zug, ein befriedigtes Lächeln um die dünnen Lippen. Seine Befehle scheuchen die Banditen zu den Lastwagen zurück. Nur die Gruppe mit dem Maschinengewehr bleibt im Anschlag am Bahndamm. Vorne bei der Lokomotive ist noch ein lebhaftes Parlieren und Verhandeln zwischen den Banditen und dem Zugpersonal. Dann steigen die Beamten hastig auf. Die Wagenreihe zieht an, setzt sich in Bewegung.
„Hier sind wir, General.“ Pawel Karlowitsch hat sich eine Zigarette angezündet und vertritt dem vorüberhastenden Anführer den Weg, während Helle, halb bewußtlos vor Angst und Entsetzen, den Zug davonrollen sieht. „Gewähren Sie mir eine kleine Unterredung!“
„Nachher!“ schnarrt der „General“. „Keine Zeit jetzt! Machen Sie, daß Sie mit der Frau zu den Autos kommen!“
Pawel Karlowitsch führt die Zitternde hinüber zu den Lastwagen und hilft ihr aufsteigen. Im Nu sind die Kraftwagen von sich drängenden, krächzenden, schimpfenden Mongolen überfüllt. Eingepreßt zwischen den übelriechenden Gelben, drückt Helle sich, erschauernd, dicht an Pawel Karlowitsch, der sie gelassen auf eine der primitiven Holzbänke zieht und schützend den Arm um sie legt. Drüben bei dem zweiten Lastwagen werden noch Koffer und Kisten unter Geschrei aufgeladen. Und noch etwas hat man aus dem Zug gebracht und wirft es jetzt brutal auf den Wagen. Unter einer Decke zeichnen sich deutlich die Umrisse einer menschlichen Gestalt ab. Ein Paar kleine, zierliche Füße, mit Lackschuhen bekleidet, ragen seltsam steif und starr unter der Decke hervor.
Ein Toter!
Helle schließt erschauernd die Augen.
*
Es ist spät in der Nacht, als die Lastwagen ein Burjätendorf erreichen. Wie runde Erdbuckel stehen die Jurten in der hellen Nacht. Gespenstisch wehen an langen, dünnen Holzstangen die bunten Fetzen der Gebettücher. Durchrüttelt und gerädert von der langen Fahrt, läßt Helle sich von Pawel Karlowitsch herunterheben und sinkt drinnen in einer Jurte willenlos auf einen Haufen Strohmatten. Die Luft ist heiß und stickig hier drinnen, aber die Aufregung der letzten Stunden läßt die ermüdeten Nerven Helles vollständig erschlaffen. Noch während die Mongolen durch die niedrige Tür hineindrängen und sich ringsum, so wie sie sind, auf Erdboden und Matten zum Schlaf hinwerfen, ist Helle Beier in einen schweren, tiefen Schlaf gesunken. Pawel Karlowitsch aber steckt sich eine neue Zigarette in den Mund, verteilt die übrigen freigebig unter die gelben Banditen und schlendert hinaus, um den „General“ aufzusuchen.
Was zwischen ihm und dem „General“ drüben in der Jurte, die das Hauptquartier des Bandenführers bildet, verhandelt wird, weiß niemand. Aber zwei Stunden später, als das erste Tagesleuchten über die Steppe geistert, rüttelt eine Hand kräftig an Helles Schulter. Mit einem unterdrückten Schrei fährt sie aus ihrem Schlaf auf und setzt sich aufrecht. Ringsum schnarchen die bewaffneten Männer. Zum Ersticken, Übelkeit verursachend ist die verbrauchte warme Luft in der Jurte. Pawel Karlowitsch steht vor dem entsetzten, nach Atem ringenden Mädchen und lächelt beruhigend.
„Alles in Ordnung, Fräulein Beier. Der ‚General‘ hat uns freigegeben. Aber kommen Sie schnell! Wenn die Brüder da aufwachen, gibt es endlose Verhandlungen und vielleicht neue Schwierigkeiten. Sie hoffen auf ein großes Lösegeld für Sie und werden nicht damit einverstanden sein, daß der ‚General‘ Sie laufen läßt.“
Draußen steht einer der primitiven Burjätenkarren, auf dem ein in dickwattierte Röcke verpackter alter Burjäte wartend sitzt. Kaum halb wach, läßt Helle sich hastig in die Decken und Strohmatten wickeln, die der Wagen birgt. Erst als die Jurten am Horizont versinken und der Karren knarrend über die Grasnarbe rumpelt, kommt ihr richtig zum Bewußtsein, daß sie den unheimlichen, bewaffneten Banditen wirklich entronnen ist.
„Etwas Brot hab’ ich gerettet,“ hört sie neben sich die ruhige Stimme Pawels, der ihr ein großes Stück Weißbrot anbietet. „Sie müssen vorlieb nehmen.“
Mechanisch bohren sich ihre Zähne in das Brot. Ihre Augen suchen den Reisegefährten. „Ich verstehe gar nichts von alledem, Herr Gentzer! Warum hat man uns aus dem Zug verschleppt? Warum hat man uns jetzt freigelassen? Haben Sie ... haben Sie dem Räuberhauptmann Lösegeld für mich gegeben?“
„Nein!“ schüttelt Pawel ruhig den Kopf. „Ich trage auf meinen Reisen nur wenig Geld bei mir. Ich hab’ dem ‚General‘ auseinandergesetzt, daß er mächtige Unannehmlichkeiten mit der fernöstlichen Armee bekommen würde, wenn er uns festhielte. Schließlich sah er es ein. Über meine Person und meine russische Staatsangehörigkeit konnte ich mich ausweisen. Von Ihnen hab’ ich ihm erzählt, daß Sie zwar Deutsche sind, aber — ein bißchen schwindeln mußte ich schon, um uns loszueisen — daß Sie auf der Reise zu Ihrem Bräutigam sind, der Offizier der fernöstlichen Armee sei.“
„Und das hat er geglaubt?“
Pawel zuckt die Achseln. „Jedenfalls hat er’s für möglich gehalten. Und vor der russischen Armee haben die Burschen Respekt. Sie werden schon von den Japanern und Mandschus hier tüchtig gejagt. Setzen sie sich außerdem noch einer Verfolgung durch die Fernost-Armee aus, so sind sie verloren. Das wissen die Brüder ganz genau.“
„Glauben Sie, daß wir die Bahnlinie wieder erreichen?“
Pawel zieht die Brauen hoch. „Das würde uns wenig nützen, denn wir können keinen Zug auf offener Strecke zum Halten bringen. Wir fahren südwärts und müssen versuchen, den nächsten japanischen Grenzposten zu erreichen. Von dort gelangen wir sicherer nach Charbin oder Manchuria.“
Stunde um Stunde humpelt der Karren dahin. Helles Augen gehen beklommen über die endlosen Steppen, jeden Augenblick darauf gefaßt, mongolische Reiter irgendwo am Horizont auftauchen zu sehen. Aber niemand stört die Fahrt. Nur das große Schweigen Sibiriens ist um sie, ungeheure, tote Weiten, ferne Höhenzüge, die gewaltige Talkessel umschließen, Talkessel, die aussehen wie riesige trockengelegte Meere. Kein Wald, kein Haus, selten nur, daß in der Ferne die Buckel einiger Jurten auftauchen.
„Schlachtfelder der Zukunft!“ sagt Pawel ernst. „In diesen Steppen wird vielleicht einmal die große Entscheidung fallen.“
*
Gegen drei Uhr nachmittags dreht der schweigsame Burjäte sich um, deutet mit dem Peitschenstiel auf eine kleine, langgestreckte Erdwelle, die weit voraus aufgetaucht ist, und radebrecht ein paar russische Worte. Zehn Minuten später sieht Helle: Das da vorn ist eine Feldstellung. Über dem kleinen Erdwall tauchen flache Soldatenmützen auf. Ein Arm winkt „Halt!“ herüber. Dann klettern drei, vier kleine, in Mäntel gehüllte Soldaten über die Erdbrüstung und nähern sich dem Karren.
„Sie reisen unter Eskorte nach Charbin!“ entscheidet der japanische Leutnant, der die Vorpostenstellung befehligt. „Das dortige Kommando wird entscheiden, ob Sie Ihre Reise nach Irkutsk fortsetzen können.“
In dem kleinen Unterstand muß Pawel noch einmal genau den Überfall schildern und angeben, wo ungefähr sich das Hauptquartier der Räuberbande befindet. Aber schließlich macht der Japaner eine resignierte Handbewegung. „Es hat wenig Zweck für uns, dorthin vorzustoßen. Die Bande ist bestimmt längst davon und hat einen andern Schlupfwinkel aufgesucht. Bitte, machen Sie sich fertig zur Weiterreise!“
Diesmal ist es ein schon etwas altes Auto, auf dem Pawel und Helle sowie ihr Gepäck verladen werden. Zwei japanische Soldaten nehmen mit ihnen Platz. Sie lächeln vergnügt, denn eine Fahrt von dieser einsamen Feldstellung bis nach Charbin bedeutet für sie eine unerwartete und willkommene Abwechslung.
Viel gibt der Wagen nicht her, aber es geht doch bedeutend schneller als vorher auf dem Burjätenkarren. Am Mittag des zweiten Tages erreichen sie die Lehmmauern der Stadt Charbin und werden durch menschengefüllte, halb chinesische, halb westlich-moderne Straßen zu dem weißen Steingebäude des Generalkommandos geführt.
Im japanischen Generalkommando in Charbin gibt es ein stundenlanges Warten in einem Vorraum. Offiziere eilen bin und her, Ordonnanzen, Kraftfahrer kommen und gehen, würdevolle Beamte des jungen Staates Manchukuo wandern langsam und bedächtig durch den Vorraum und verschwinden hinter einer der vielen Türen. Auch ein europäisches Gesicht taucht plötzlich auf. Ein Herr in Knickerbockers und Sportmütze, einen Fotoapparat umgehängt, kommt aus einem der Büros, stutzt beim Anblick Pawels und Helles und macht Miene, sie anzusprechen. Ein freundlich lächelnder japanischer Wachtoffizier vertritt ihm jedoch unauffällig den Weg und sagt verbindlich einige englische Sätze. Der Journalist muß mit einem enttäuschten Achselzucken seine Absicht aufgeben, die junge europäische Dame da zu interviewen.
Endlich wird Pawel Karlowitsch aufgefordert, in eines der Büros hinüberzukommen. Helle muß weiter warten. Es dauert sehr lange, fast eine volle Stunde, bis Pawel in Begleitung eines Leutnants zurückkommt.
„Darf ich bitten, Madam!“ sagt der Offizier in englischer Sprache, und Pawel nickt der sich zögernd Erhebenden zu: „Ich warte natürlich hier auf Sie!“
*
Zu Helles Erleichterung spricht der japanische Hauptmann, der hinter dem großen, mit Papieren und Karten bedeckten Tisch sitzt, tadellos Deutsch. Er mustert eingehend Helles Reisepaß, besonders das japanische Visum und den Vermerk des russischen Paßamtes in Tokio, und ersucht sie dann höflich, ihm genau und ausführlich die Geschichte des Eisenbahnüberfalls zu erzählen. Als sie geendet hat, nickt der Offizier.
„Ihre Aussagen decken sich mit denen Ihres vorhin vernommenen Begleiters. Sie stimmen auch überein mit der Meldung, die wir bereits gestern erhielten, nämlich, daß eine Räuberbande einen unserer Geheimagenten ermordet und sein Gepäck geraubt hat.“
„Der arme Mensch, den sie tot aus dem Zuge trugen, war also ...
„Ein Offizier unseres erhabenen Tenno! Der ganze Überfall hat wahrscheinlich nur ihm gegolten. Sie, meine Dame, hat man nur mitgenommen, weil man hoffte, von Ihnen ein besonders hohes Lösegeld erpressen zu können.“
„Und doch hat man mich freigelassen?“
Der Japaner lächelt wissend. „Die Banditenhorden hier an der Grenze arbeiten meist Hand in Hand mit den Russen, oft genug sogar im Auftrag der fernöstlichen Armee. Was mir Ihr Begleiter über die Art erzählte, wie er Ihre Freilassung erwirkt hat, erscheint mir nicht glaubhaft, zumal ...“ Ein listiges Blinken ist in den Augen des Offiziers. „Nun, vielleicht hat Herr Gentzer noch eine ganz andere Autorität geltend machen können. Er ist Russe, steht in Verbindung mit der fernöstlichen Armee!“
„Ah! Sie halten ihn für einen russischen Agenten?“
Der japanische Offizier spreizt die Finger. „Wenn wir den geringsten Beweis dafür hätten, würden wir ihn natürlich als Geisel für unsern ermordeten Kameraden hier festhalten. Ich glaube indessen nicht, daß er mit dem Überfall direkt etwas zu tun hat. Wie Sie mir sagen, hat Herr Gentzer ja selbst veranlaßt, daß Sie den nächsten japanischen Wachtposten aufsuchten und sich dort meldeten.“
„Ja, das hat er!“
„Nun, er würde dies nicht getan haben, wenn er an dem Mord unseres Kameraden mitschuldig wäre. Aber verdächtig ist er darum doch. Bitte, bedenken Sie, meine Dame: Herr Gentzer hat durch eine einfache Unterredung, ohne Anwendung von Lösegeld, Ihre Freilassung erreicht.“
„Sie haben recht,“ sagt Helle nachdenklich. „Auch vor dem Überfall kam es mir schon vor, als ob er mich auszuhorchen versuchte. Aber trotzdem: Ich bin ihm zu Dank verpflichtet. Ohne ihn wäre ich jetzt noch in der Gewalt der Banditen.“
Der Japaner machte eine kleine Verbeugung. „Ich bin ganz Ihrer Ansicht. Die letzte Entscheidung trifft General Doihara, aber ich glaube Ihnen jetzt schon versichern zu können, daß von unserer Seite aus Ihrer Weiterreise nichts im Wege steht. Aber — ganz außerdienstlich möchte ich Ihnen zu bedenken geben: Wollen Sie wirklich nach dieser bösen Erfahrung Ihre Reise nach Irkutsk fortsetzen? In Begleitung dieses Herrn Gentzer?“
„Wenn ich an Ihrer Stelle wäre,“ fährt der Japaner fort, als Helle betroffen schweigt, „so würde ich den Plan vorläufig fallen lassen. Ihr Herr Bruder ist noch in Tokio, nicht wahr? Da würde ich an Ihrer Stelle von hier aus erst mal nach Tokio zurückkehren. Setzen Sie sich von dort aus doch mit Ihrem Bräutigam brieflich in Verbindung. Vielleicht können Sie ihn veranlassen, Ihnen entgegenzureisen, Sie in Wladiwostok in Empfang zu nehmen.“
Helle sieht schweigend vor sich hin. Was der Japaner da sagt, ist nicht schlecht. Einen Herzschlag lang hat sie sogar das Gefühl, als böte ihr hier das Schicksal noch einmal warnend die Hand. Aber dann überwiegt in ihr wieder der Trotz. Was werden Heinz und die „Jungs“ in Tokio für Gesichter machen, wenn sie jetzt zurückkehrt! Vorwürfe wird es regnen, Klagen, Spott. Wir haben dich ja gleich gewarnt! Warum bist du so bockig! Und dann — wie lange wird es dann dauern, bis sie die Verbindung mit Irkutsk aufgenommen hat! Am Ende wird gar Kola selber ihr besorgt abraten von der Reise, und sie kann unverrichteter Sache mit Heinz nach Berlin zurückfahren. Jetzt, wo sie nur ein paar Tagereisen vom Ziel steht.
„Ich danke Ihnen, Herr Hauptmann!“ sagt Helle, entschlossen den Kopf hebend. „Ich möchte trotzdem meine Reise fortsetzen!“
„Wie Sie wünschen! Ich werde dem Herrn General Vortrag halten.“
Helle sitzt allein in dem Büro und starrt auf die Tür, hinter der der Offizier verschwunden ist. Der Name „General Doihara“ ist ihr kein Begriff. Sie entsinnt sich zwar dunkel, diesen Namen schon einmal irgendwo in einer Zeitung gelesen zu haben, aber sie weiß nicht, daß hinter der Tür dort der Mann sitzt, der die Politik Japans in Manchukuo und Korea lenkt, der Mann, bei dem alle Fäden des großen, weitverzweigten Spiels zusammenlaufen: General Doihara.
Sporenklirrend kommt der kleine gelbe Hauptmann zurück. Sein Gesicht strahlt vor Freundlichkeit.
„General Doihara läßt Ihnen gute Reise wünschen, meine Dame! Sie können noch heute abend die Fahrt fortsetzen. Ja, und was ich noch sagen wollte: Sie reisen nach Rußland. Darf ich voraussetzen, daß Sie — als Deutsche — mehr Sympathie haben für mein Vaterland als für die Sowjetunion?“
„Das dürfen Sie!“ sagt Helle ehrlich. „Ich bin Ihnen für Ihre Liebenswürdigkeit sehr dankbar, Herr Hauptmann!“
„Vortrefflich! Dann bestünde vielleicht die Möglichkeit einer — hm! — Zusammenarbeit?“
„Wie soll ich das verstehen?“
„Oh, ich wünsche nichts Gefährliches oder gar Schlechtes von Ihnen, meine Dame. Aber Sie reisen nach Irkutsk. Sie werden vielleicht die Möglichkeit haben, dies und jenes von den Kriegsvorbereitungen der fernöstlichen Armee zu sehen. Vielleicht erfahren Sie auch durch Herrn Gentzer allerlei Interessantes. Für uns ist jede Kleinigkeit wichtig. Sie würden meinem Vaterland und mir einen ausgezeichneten Dienst leisten, wenn Sie auf der Rückreise mich hier wieder aufsuchen und Ihre Eindrücke aus Sibirien schildern wollten.“
Helle steht auf. Um ihren Mund liegt ein unmutiger Zug.
„Bedaure! Ich habe nicht die Absicht, Spionage zu treiben. Weder für Rußland noch für Japan oder sonst jemand. Ich will zu meinem Verlobten — weiter nichts!“
„Glückliche Reise!“ Der Japaner macht eine auffallend tiefe Verbeugung. Als er sich wieder aufrichtet, ist sein Lächeln herzlicher und aufrichtiger als vorhin. „Ich beglückwünsche Sie zu diesem Entschluß! Hätten Sie meinen Vorschlag angenommen, so wäre ich genötigt gewesen, die Ausreiseerlaubnis zu widerrufen!“