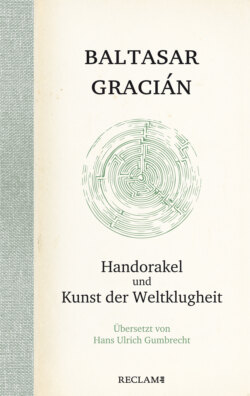Читать книгу Handorakel und Kunst der Weltklugheit - Baltasar Gracián - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zur Lektüre der Übersetzung von Baltasar Graciáns Oráculo Manual y Arte de Prudencia
Оглавление1 Der hier zum ersten Mal seit fast zwei Jahrhunderten vollständig ins Deutsche übersetzte Text des Handorakels von Baltasar Gracián erreicht uns nicht nur aus einer fremden Sprache, sondern auch aus einer fernen Zeit. In seinen Lebensjahren zwischen 1601 und 1658 war der seit 1635 dem Jesuitenorden angehörige Autor den spanischen Landsleuten wahrscheinlich weniger durch sechs unter fremden Namen veröffentlichte Bücher bekannt denn als einer der großen Prediger ihrer Zeit und als herausragender Theologe.
2 Unter Graciáns Werken kommt dem 1647 veröffentlichten Handorakel aus insbesondere zwei Gründen eine Sonderstellung zu: Sein adliger Freund Vincencio Juan de Lastanosa (1607–1681) stellt im Vorwort »An den Leser« das Buch als eine Sammlung von besonders bemerkenswerten Stellen aus früher erschienenen Texten Graciáns vor. Ob tatsächlich Lastanosa diese kurze Präsentation verfasste, entzieht sich unserer Kenntnis, während feststeht, dass nur die ersten 100 der insgesamt 300 vorgestellten Aphorismen annähernd dem Status einer solchen »Blütenlese« entsprechen. Sie alle bewegen sich jedoch in einem Anspielungsraum aus Verweisen und klassischen Zitaten, der in dieser Ausgabe so weit als möglich aufgeschlüsselt wird, um den Horizont abzustecken, zu dem der Gesamttext gehört. Das Handorakel vermochte Könige in Graciáns eigener Zeit (wie Philipp IV. von Spanien oder Ludwig XIV. von Frankreich) in seinen Bann zu ziehen und große Philosophen (wie Arthur Schopenhauer oder Friedrich Nietzsche) zu begeistern. So wurde es zu einem Kanon-Text im europäischen Kulturerbe.
3 Den Text des Handorakels erfassen und eine intellektuell produktive Einstellung ihm gegenüber finden ist schwieriger, als es eine Sammlung kurzer Reflexionen über Probleme und Strategien des Verhaltens im Alltagsleben zunächst vermuten lässt. Dies hat weniger mit dem kulturhistorischen Abstand zu tun, den der Leser überbrücken muss, als mit der Komplexität, dem sich stellenweise zur Obsession steigernden Rhythmus im Denken des Autors und mit der zu Auslassungen wie Abkürzungen neigenden Dichte seines Sprachstils.
4 Langsames, aber anhaltendes Lesen über einen längeren Zeitraum – zum Beispiel zwischen fünf und zehn Aphorismen pro Tag – kann zu anhaltender Freude am Text führen. Dazu gehört das wiederholende Nachvollziehen einzelner Sätze und Absätze – vor allem jedoch Geduld beim Entstehen und Entwickeln eigener Formen des Lesens und Verstehens.
5 Obwohl die 300 Aphorismen des Handorakels nicht nach der Linie eines Arguments oder mit dem Vorhaben aneinandergereiht worden sind, eine systematische Weltsicht zu entwerfen, bietet sich kontinuierliche Lektüre vom ersten bis zum letzten Absatz an, ohne notwendig zu sein: denn sie vermag den Denk- und Schreibprozess des Autors als Ereignisverlauf zu vergegenwärtigen.
6 Eine der für Gracián wichtigen Funktionen seines verdichtenden Stils lag in dem Impuls, den Leser zu aktivem eigenem Denken herauszufordern. Nicht selten entsteht der Eindruck, dass man eine fremde Gedankenbewegung zum Abschluss bringen soll. Daraus können individuelle Reflexionen hervorgehen, die einen Grad der Unabhängigkeit gegenüber dem historischen Text gewinnen. Inhaltlich gesehen verspricht diese Möglichkeit mehr als eine Rekonstruktion und Übernahme von Ratschlägen aus Graciáns Lebenslehre.
7 Lohnend und nicht selten mitreißend ist also neben manchmal faszinierenden Einzelbeobachtungen und der eingängigen Schönheit vieler Sentenzen vor allem ein sichtbar werdender Prozess des Denkens. Der eigentlich legitime Versuch, einzelne Begriffe oder Argumente zu fixieren, um sie ins eigene Leben zu übertragen, mag deshalb mitunter unbefriedigend bleiben, eben weil Gracián alle Elemente seines Gedankenspiels in Bewegung setzt und – ohne wirklichen Abschluss – in Bewegung hält.
8 Anders als Arthur Schopenhauers großartige Übersetzung des Handorakels aus dem Jahr 1832, die bei aller gesuchten Nähe zum spanischen Original dessen Unklarheiten und sprachlichen Unebenheiten meist paraphrasierend glättet, ist meine neue Übertragung an dem Ziel ausgerichtet, die individuell und historisch besonderen Formen von Graciáns Sprache als eine Spur des Denkens so weit als möglich im deutschen Text zu erhalten. Dies gilt für die den Denkrhythmus unterstreichende Interpunktion; für syntaktische Verschiebungen, die auch im Spanischen des 17. Jahrhunderts exzentrisch wirken mussten; für unvollständige Sätze, Formulierungen an der Grenze grammatischer Korrektheit (wie etwa Inkonsistenzen im Gebrauch der Zeitenfolge oder Pronomina); aber auch für die häufigen Wortspiele – und schließt in ihrer Bedeutung trotz aller Verstehensbemühung unklare Passagen ein, welche selbst im Original nicht zu eindeutigen Sinnstrukturen zu führen scheinen. Vor allem soll die enge Anlehnung der Übertragung an den Wortlaut des Originaltexts jenen Lektüreeffekt und jene existenzielle Faszination bewahren, deren Zusammenspiel ich im Nachwort als »Verräumlichung des Denkens« analysiere und beschreibe.
Hans Ulrich Gumbrecht