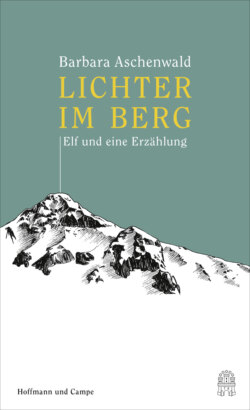Читать книгу Lichter im Berg - Barbara Aschenwald - Страница 4
Lichter im Berg
Оглавление»Hier ist kein Krieg«, sagt Anton und schöpft sich aus der großen Suppenschüssel nach. »Und es kommt auch keiner her. Wir liegen zu hoch.« Er lacht.
In der Suppenschüssel dampft eine Brühe mit Knödeln, Karotten, Kraut und Selleriestückchen. Es schneit. Am Tisch sitzen vier Erwachsene und ein Kind. »Man lebt gern hier oder gar nicht. Es gibt ein paar Zugeheiratete und ein paar Zugezogene, ich kenne hier alle Leute und sehr, sehr viele Geschichten.«
Das Kraut isst man in der Suppe.
Der Gorfen steht wie Christopherus, der den kleinen Jesusknaben auf der Schulter trägt, als Beschützer des Dorfes da, das letzte, gelbe Licht bedeckt seine Hänge und färbt sie wie die Spitzen der Gänseblümchen.
Das Dorf hat es warm und gemütlich in den Stuben und beißend kalt in seinem Wald, den Wiesen und den Feldern. Alles, was hier wohnt, scheint im Stillen, ganz für sich, ein Wort zu sagen: Trotzdem.
Es ist nichts flach hier.
»Es hat ausgereicht«, sagt Renate. Ihr Haus ist das kleinste, steht aber mitten im Ort zwischen den großen Hotels, es ist rot gedeckt, die Fenster zeigen nur die Hälfte von dem, was man durch die riesigen Scheiben der Hotels sieht. Das Drinnen ist deutlicher bei ihr.
»Ich wohne hier alleine. Magst du einen Lebkuchen?« Er liegt in dem geflochtenen Körbchen auf dem Tisch. »Nimm dir, nimm dir!«, sagt sie.
Ihr Haus ist zufrieden. Es will auch kein Hotel sein und keine großen Fenster haben. Hinter dem Haus ist ein kleiner Blumengarten mit einer Bank, sie schaut zum Gorfen. Die Blumen sagen: Rot! Gelb! Orange!
»Es reicht auch jetzt noch aus, und ich brauche nicht mehr«, sagt sie. »Was für eine Krankheit, dass der Mensch immer mehr haben will und weniger wissen.«
Sie sagt, sie lebt immer schon hier.
In ihren Augen ist ein Licht.
Im letzten Ort des Tales stehen die Häuser zum Schutz hinter großen Mauern. Lupinen in Violett, Weiß und Rosa wachsen in den Mauern, als wären sie dafür da. Sogar das grüne Gras, das hier in den Futterwiesen wächst, aus denen mühsam jeder Stein aufgesammelt wurde, sagt: Trotzdem.
»Zu Renate kommt man hier durch«, sagt Franz und geht durch sein großes Hotel, durch die Küche, wo alles sauber ist und glänzt; der Edelstahl ist poliert, die Front zur Straße hin aus Glas. »Das muss man so haben«, sagt er, »als Gastbetrieb.«
Seine Frau legt den Schlüssel hin. »Für den unteren Stock«, sagt sie. »Geh nur schwimmen, ins Warme, es ist kalt! Neinnein, lass das Geld stecken, geh nur, geh!«
Das Hotel ist modern, schön und groß. Aber es will nicht größer sein. Eine Lampe flackert auf dem Weg nach unten, als würde sie gleich ein Geheimnis verraten wollen.
Auf dem Friedhof zittern die Flammen in den Windlichtern. Es ist nicht viel Platz, es ist eng zwischen den Bergen. Der Spazierweg des Dorfes liegt fast auf tausendsiebenhundert Metern, er führt am Berghang über dem Dorf entlang.
Er führt durch die Lawinenkegel.
»Irgendwann muss es genug sein«, sagt Mary Lou. »Das verstehen die Leute auch. Am Weihnachtstag ist ab acht Uhr Ruhe. Es gibt kein Feiertagsdiner. Wir haben zwei kleine Kinder, und unser Heiligabend steht nicht zum Verkauf. Die Leute kommen trotzdem. Und es kommen die richtigen.«
Das Haus war früher eine kleine Frühstückspension. Es ist größer jetzt, elegant, und sie haben es sich zu eigen gemacht.
»Das hier war nicht mein Lebenstraum«, sagt Mary Lou, »sondern der meines Mannes. Ich hätte auch nein sagen können, ich habe es mir lange überlegt. Man muss sich in seinem Leben so gut es geht einrichten.«
Ihr Gesicht ist hell und freundlich, ihre Augen sind überlebensklug. »Ich mache es auf meine Art. Willst du eine Praline im Glas?«, fragt sie. »Das war meine Idee.«
In ihrem Garten blühen im Sommer üppig duftende Rosenbüsche. Auf der Treppe, die ins Haus führt, brennen in Gläsern kleine Lichter.
Hier verkauft man Betten, Essen, Wein, Tageskarten zum Skifahren. Aber nicht alles.
»Die werden alle recht«, sagt Karl. »Zu mir kommen immer viele Eltern und fragen, ob es denn gut sei, wenn der Sohn weggeht und Mechatronik studiert oder Informatik oder weiß der Kuckuck was, ob es denn nicht besser sei, er werde hier Elektriker oder Gastwirt. Ich sage dann immer, die werden alle recht. Wir können das Leben nicht begreifen, leben müssen wir es so gut es geht.«
In der kleinen Ortskirche brennt ein rotes ewiges Licht.
»Du trinkst doch einen Kaffee?«, fragt Andreas. Es schneit, als hätte der Himmel alle anderen Wetter vergessen und wolle nicht mit dem Schneien aufhören. »Die Gäste kommen erst morgen. Man kommt nicht durch und das freut sie sehr.« Vor ihm ist ein frisches, immergrünes Gesteck mit Blumen und bunten Kugeln. »So etwas fällt heute nur noch auf, wenn es fehlt«, sagt er. »Die schönen Sachen, das Silberbesteck, die Kerzen, Untertassen, polierten Gläser und die bedruckten Servietten schätzt niemand, es sei denn, das alles fehlt. Dabei freut man sich doch als Wirt, wenn jemand sagt, dass alles schön hergerichtet ist. Vielleicht liegt das aber auch an den großen Hotelketten, die es überall gibt. Da ist alles viel anonymer, da ist so ein Haus eine seelenlose, lebendige Maschine. Aber ich wollte das nie so haben. Sonst kann ich gar nicht so viel erzählen. Magst du noch einen Kaffee?«
Im Schnee sitzen kleine Lichter, die durch eine geheime Kraft aufflammen und wieder erlöschen.
Durch das Dorf führt eine einzige, zweispurige Straße, die, nachdem sie das Dorf verlassen hat, über den Rücken des Berges und aus dem Blick läuft. Und als wären sie aus den Wolken gefallen, liegen da und dort kleine Weiler, die so tun, als würden sie das Dorf gar nicht brauchen.
Der kleine Vorgarten bei den Häusern heißt hier Büntali. Man hat alle Steine aus ihm herausgesammelt.
Es gibt nur drei warme Monate.
»Hier gab es einen Gastwirt, der hat sich schwer verkalkuliert und einfach alle Reservierungen für sein Haus angenommen, die er bekommen konnte. Zwei Tage, bevor der Ansturm kommen sollte, hat er angerufen und gesagt, er sei abgebrannt. Es war nur blöd, dass die Leute dann im Hotel gegenüber gewohnt und auf das angeblich abgebrannte Haus geschaut haben. Das ist lange her, die Geschichte kennt hier aber jeder«, sagt Elisabeth. In ihrem Haus steht eine geschnitzte Wiege, darüber ist ein Bild von der Muttergottes mit dem Jesusknaben. »Da war ich noch drin«, sagt sie, »das hat man aber heute nicht mehr.«
Der Jesusknabe, der auf den Schultern vom Gorfen sitzt, der ihn trägt, schaut herunter, aber seine Wiege ist viel größer. Es sind die Berge, die Wälder, die Böden und die grünen Matten. Man hat alle Steine aus ihnen herausgeräumt.
»Ich habe das alles zusammengetragen«, sagt Siegfried, der vor seinem Schreibtisch sitzt. »Geschichten über das Dorf und berühmte Leute, die hier waren, Legenden und Sagen, das war eine Arbeit! Hier oben zum Beispiel«, und er zeigt zum Fenster hinaus, »da gibt es unter der Erde große Rohre mit Löchern, wo ein Kind ganz leicht hineinfallen kann. Jetzt wohnt in den Rohren aber die Dorfhexe Jakobina, und seit sie da ist, fällt kein Kind mehr hinein. Du bleibst doch bestimmt zum Essen?«
Seine Frau, weißhaarig und mit einer weißen Schürze, trägt eine dampfende Suppenschüssel mit blauen aufgemalten Blumen herein. »Ja, bleib zum Essen, du bist bestimmt hungrig. Es ist genug da, es reicht auch für einen mehr, Gott sei Dank.«
In den Bergen um das Dorf sind große Seen. Es sind die Waschbecken der Bergriesen. Sie sind gefährlich, sie wälzen Steine ins Tal und Lawinen. Wer sich hier nachts verläuft, kann abstürzen oder, wenn er kein Licht mehr sieht, verlorengehen.
»Hier sind alles Leute«, sagt Helmut, »keine Organisationen, dafür sind wir zu klein. Wenn man hier einen Strafzettel bekommt, war es einer der zwei Dorfpolizisten, wenn man mitten in der Nacht aus der Tiefgarage will, muss man den alten Hausmeister vom Hotel darüber anrufen, der hat den Schlüssel. Aber er hebt nicht immer ab. Wenn jemand hier einen Unfall hat oder etwas dringend braucht, ruft er den Fritz an, er ist der Dorfarzt hier – weil das Rettungsauto eine halbe Stunde braucht, bis es da ist. Wenn es ganz dringend ist, muss sowieso der Hubschrauber kommen. Ein Stück Kuchen wäre noch da, das ist für dich. Und das Dorfbuch nimmst du dir auch mit, das brauchst du bestimmt.«
Am Dorfplatz stehen ein kleiner Brunnen und die Bushaltestelle. »Es ist schon bedrohlich«, sagt ein Gast, als er zu den Bergen hochsieht, »imposant, aber bedrohlich. Ich komme gern her zum Winterurlaub, aber leben wollen würde ich hier nicht.«
Vor den Häusern sind Mauern. Sie beschützen die, die darin leben, vor den Steinen.
Die Berge beschützen die Häuser vor Wind und Wetter.
Die blühenden Lupinen denken sich nichts. Sie wachsen in den Mauern.
»Mein Vater hatte einen Traktor. Das war ganz wichtig, sein Traktor mit der großen Schneeschaufel. Kaum hat es ein bisschen geschneit, war er schon mit diesem Ungetüm mit der Schneeschaufel da. Meine Mutter durfte nicht einmal seine kleine Handschneeschaufel anfassen, das war seine Arbeit. Dann musste alles Platz machen, auch die Autos von den Gästen, damit der Parkplatz geräumt werden konnte. Einmal hat ein Urlaubspaar sein Gepäck vor dem Auto stehenlassen, es wurde samt dem Schnee in der Schaufel in den Bach geschoben. Mein Vater war ganz verwundert, dass ihm da auf dem Weg zum Bach so ein gutgekleideter Herr nachrennt und mit den Armen fuchtelt.« Franz lacht, er sitzt in seiner Gaststube, sie ist neu hergerichtet, er lacht herzlich, seine Frau sitzt bei ihm. »Wo wohnst du denn? Wenn hier etwas frei ist, kannst du auch hier wohnen. Du hast ja auch etwas zu tun hier.«
In seinem Lachen ist das Trotzdem.
»Ich habe einen neuen Wein bekommen, heute war der Lieferwagen da. Den probierst du sicher«, sagt der Herr Karl. »Ich habe das Geschäft vor ein paar Jahren aufgemacht, weil ich mir dachte, so etwas gibt es hier noch nicht. Ich habe ausgezeichneten Käse da und Räucherwurst und verschiedene Konfitüren, das wird alles hier hergestellt. Natürlich kaufe ich auch manches zu, aber am meisten interessieren mich die heimischen Sachen. Und die Gäste geben dafür auch lieber Geld aus als für die gesichtslose Massenware. Trotzdem habe ich fünf magere Monate im Jahr – zwischen den Saisonen. Aber ich kann leben. Und Scherereien hat man doch überall.«
In seinem kleinen Geschäft riecht es nach Trüffeln, Salami, scharfem Käse und schwer nach Rotwein. Es gibt hausgemachte Limonade und Kaffee und zwei kleine Tische, davor je zwei Sessel mit großen Polstern an den Lehnen, auf den Tischen brennen Kerzen.
»Willst du einen Käseteller dazu?«, fragt er. »Du arbeitest, du musst doch auch essen.«
»Die Fenster waren blind«, sagt Daniela. »Der Schneestaub hat alles zugedeckt, es war so ein Unglück, aber alles hat geholfen. Der Ort war halb verwüstet, abgeschnitten vom Rest der Welt, aber alle Türen waren offen, alle Küchen, alle Zimmer. Die Helfer, die damals hier waren, kommen heute noch manchmal her auf Besuch. Es gab keinen Strom, wir mussten Lichter anzünden.«
In den Gärten, den Köpfen und Herzen, in den Geschichten und den aufgeräumten Feldern hier wohnt das Trotzdem.
Und im Schein der schimmernden Lichter wohnt das Leben.