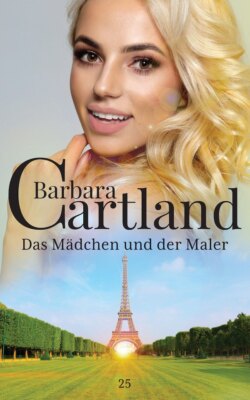Читать книгу Das Mädchen und der Maler - Barbara Cartland - Страница 2
1880 ~ 1.
ОглавлениеDie Osterblumen leuchteten im Schatten der alten Eichen so golden wie die Frühlingssonne. Die Vögel zwitscherten, ein leichtes Lüftchen spielte im jungen Laub der Bäume.
Margret summte ein Lied. Sie hatte es heute nicht eilig. Unerwartet früh war sie im Schloß fertig geworden und brauchte nicht wie sonst durch den Park zu hasten. Wie sie diesen Weg zum Dorf liebte! Zwischen den Baumstämmen schienen die Träume ihrer Kindheit zu hängen, und manchmal glaubte Margret, sie würden doch noch Wirklichkeit werden.
Sie war so in Gedanken versunken, daß sie die Staffelei erst im letzten Moment bemerkte. Oh Gott, dachte Margret, Mr. Oliver malt schon wieder ein Bild.
Mr. Oliver war pausenlos in finanziellen Schwierigkeiten, und Margrets gutherziger Vater, der Vikar, kaufte die Bilder, um dem Mann zu helfen. Das Geld für einen neuen Wintermantel war in Mr. Olivers Tasche gewandert, und das Hemdblusenkleid, auf das sich Margret nun schon seit Wochen freute, sah sie jetzt auch dahinschwinden. Ein gutes Dutzend von Gemälden stand schon auf dem Speicher, und eines war schlechter als das andere.
„Guten Tag, Mr. Oliver“, sagte Margret. „Schon wieder an einem Meisterwerk?“
Zu Margrets großem Erstaunen war der Mann, der hinter der Leinwand auftauchte, nicht etwa der kleine, grauhaarige Mr. Oliver, sondern ein Fremder.
„Tut mir leid, Mademoiselle“, sagte er. „Ich bin nicht Mr. Oliver.“
„Gott sei Dank nicht!“ rief Margret spontan.
Der Fremde lächelte. Er sprach offensichtlich fließend Englisch, hatte aber einen leichten Akzent. Außerdem hatte er Margret mit Mademoiselle angeredet.
„Ich habe Sie durch den Park kommen sehen“, sagte er. „Wie eine kleine Göttin sind Sie plötzlich aufgetaucht und über das Moos geschwebt.“
Zwei Grübchen bildeten sich in Margrets Wangen.
„Dabei bin ich ein ganz normaler Mensch mit einem ganz normalen Namen. Ich heiße Margret.“
„Das ist ein besonders schöner Name“, antwortete der Fremde.
Margret spürte, wie sie rot wurde. Noch nie hatte ein Mann sie mit so offenem, direktem Blick angesehen. Sie schätzte ihn auf achtundzwanzig. Er war groß, hatte breite Schultern und dunkle Haare, die glatt aus der Stirn gekämmt waren. Seine Züge waren klar, sein Mund energisch. Er sah blendend aus, der Fremde, in seinem grünen Samtanzug und der lässig gebundenen Krawatte.
„Sie sprechen ausgezeichnet Englisch, Sir“, sagte Margret, um von sich abzulenken. „Sie sind Franzose, nicht wahr?“
„Ja“, antwortete er, „aber meine Großmutter war Engländerin. Et vous, Mademoiselle, parlez-vous Français?“
Margret lächelte.
„Oui, Monsieur“, antwortete sie auf Französisch. „Meine Großmama war Französin.“
„C’est extraordinaire!“ rief der Franzose. „Ich hatte eine englische Kinderfrau. Sie vielleicht eine französische?“
„Ja“, erwiderte Margret. „Aber sie hielt nicht sonderlich viel von den komischen Leuten auf der anderen Seite des Kanals.“
Der Fremde lachte, und Margret stimmte in das Lachen ein. Plötzlich wurde ihr jedoch klar, daß sie sich sehr frei benahm, und wieder versuchte sie abzulenken.
„Ich darf Sie nicht von Ihrer Malerei abhalten“, bemerkte sie und wollte weitergehen.
„Bitte!“ rief der Fremde. „Sie dürfen mich nicht schon wieder allein lassen. Ich möchte noch so viel von Ihnen wissen.“
„Ich glaube, ich muß aber gehen“, antwortete Margret, Unsicherheit in der Stimme.
Der Fremde interessierte sie, aber gleichzeitig wußte sie, daß ihre Mutter mit ihrem Benehmen nicht einverstanden gewesen wäre. Mit einem Mann zu plaudern, dem man nicht vorgestellt war, das gehörte sich nun einmal nicht.
„Ein Jammer, daß die Zeit der Kinderfrauen längst vorbei ist“, meinte der Fremde, als habe er Margrets Gedanken gelesen. „Sie hätten uns bestimmt bekannt gemacht - und wenn nur, um miteinander klatschen zu können. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Paul Beaulieu.“
Der Fremde deutete eine leichte Verbeugung an. Margret machte einen Knicks.
„Margret Lynton.“
„Und Sie sind die Prinzessin, die im Schloß wohnt?“ fragte Paul Beaulieu.
Margret schüttelte den Kopf.
„Nein“, antwortete sie. „Ich bin bloß die arme Verwandte.“
„Die arme Verwandte?“ wiederholte Paul Beaulieu.
„Ja. Die Prinzessin, wie Sie sie nennen, ist Lady Clementine Combe. Sie wohnt im Schloß und steht in dem Ruf, das schönste Mädchen Englands zu sein.“
„Und Sie?“ fragte Paul Beaulieu.
„Ich bin ihre Cousine und wohne im Dorf. Mein Vater ist der Vikar.“
Paul Beaulieu bewunderte die Bescheidenheit, mit der das Mädchen sprach. Margret hatte ein herzförmiges Gesicht mit großen graublauen Augen. Die hohe Stirn war von goldblonden Haaren umrahmt. Das schon etwas verwaschene Leinenkleid, aus dem Margret fast herausgewachsen war, unterstrich die gerade erblühte Figur des jungen Mädchens.
„Ich möchte Sie malen“, sagte Paul Beaulieu spontan. „Einem Künstler bietet sich selten die Chance, der Göttin des Frühlings zu begegnen. Bitte, gehen Sie noch nicht.“
„Aber Sie wollten doch sicherlich das Schloß malen“, antwortete Margret schnell. „Darf ich mir das Bild anschauen?“
„Ich bitte darum.“ Paul Beaulieu trat zur Seite.
Margret hatte schon viele Gemälde gesehen, auf denen der Blick auf das Schloß festgehalten war. Durch die Jahrhunderte hindurch war es von berühmten Künstlern gemalt worden. In der Bildergalerie des Schlosses hing eine ganze Reihe von diesen Gemälden.
Bei dem, was sich jetzt Margrets Blick bot, stockte ihr fast der Atem. Das Schloß, das auf den meisten Bildern wie auch in der Natur beinahe furchterregend aussah, wirkte auf dem Gemälde des Franzosen wie aus einem Märchen. Durch das Leuchten der Farben im Vordergrund wurde das Auge wie auf magische Weise zu der mystischen Großartigkeit des Schlosses hingeführt, dessen Turm sich stolz in den klaren Himmel streckte.
Paul Beaulieu hatte auf der Leinwand eine Atmosphäre eingefangen, die das Herz höher schlagen ließ. Die Farben schienen zu jubeln, jeder Stein schien durch das Licht, das auf ihn fiel, zu vibrieren.
„Sie sind ja Impressionist!“ rief Margret begeistert.
„Sie kennen die Impressionisten?“ fragte Paul Beaulieu erstaunt.
„Ich habe zumindest über sie gelesen“, antwortete Margret. „Und von Papa weiß ich, daß sie in Paris abgelehnt werden.“
„Und was halten Sie von dem Bild?“
„Es ist wunderschön.“
„Ist das ehrlich gemeint?“
„Natürlich. Bei etwas so Wichtigem würde ich nie schwindeln, nicht einmal, um Ihnen zu schmeicheln.“
„Ich hätte nie gedacht“, sagte Paul Beaulieu, „daß eine Engländerin das anerkennen würde, was ein paar revolutionäre Künstler auf der Leinwand festzuhalten versuchen.“
„Von Papa weiß ich“, erwiderte Margret, „daß der Salon und die meisten Kunsthändler in Frankreich die Meinung vertreten, man könne erst dann von Kunst sprechen, wenn der entsprechende Maler nicht das festhält, was er sieht, sondern was man zu sehen hat. Und Sie, glaube ich, malen, was in Ihrem Herzen ist.“
„Sie haben sehr viel Einfühlungsvermögen“, meinte Paul Beaulieu bewundernd. „Bitte, lassen Sie sich von mir malen.“
„Ich muß aber doch nach Hause gehen. Sie warten auf mich.“
„Bitte! Sie würden mir einen großen Gefallen tun. Sie wissen gar nicht, wie sehr ich mir wünsche, Ihr Gesicht auf der Leinwand festzuhalten. Ich habe nie in meinem Leben ein lieblicheres Mädchen gesehen.“
Das Kompliment trieb Margret die Röte ins Gesicht. Vielleicht wollte ihr Paul Beaulieu aber auch bloß schöntun, weil er sich kein Modell leisten konnte.
Hatte ihr Vater nicht erzählt, daß die Impressionisten am Hungertuch nagten? Vielleicht verzichtete auch Paul Beaulieu auf Fleisch, um Farben kaufen zu können.
„Aber lange kann ich nicht bleiben“, sagte Margret.
Mit schlechtem Gewissen dachte sie an die Hühner, die gefüttert werden mußten. Die Pferde warteten auf das Heu, und im Haus gab es auch immer eine Menge zu tun.
Zum Glück war sie an diesem Tag im Schloß zeitig fertig gewesen. Cicely hatte sich eine Stunde früher hingelegt, weil ihr Bruder William am Abend aus Paris zurückerwartet wurde. Baron Cottesford war im Diplomatischen Dienst und meistens im Ausland.
Mama erwartet mich erst in einer halben Stunde, dachte Margret.
Paul Beaulieu hatte schon die Staffelei weiter in den Park hineingetragen und eine neue Leinwand aufgespannt.
„Und wo soll ich mich hinstellen?“ fragte Margret.
„Vor die Tannen“, antwortete Paul Beaulieu. „Ich möchte, daß es so aussieht, als kämen Sie aus dem Sonnenschein in die Kühle des Waldes.“
Er bat Margret, sich auf den moosbewachsenen Stamm eines gefällten Baums zu setzen. Ein Sonnenstrahl, der schräg durch die Zweige fiel, streifte ihr goldenes Haar und ließ ihre Augen im Grün der Bäume leuchten.
Paul Beaulieu hob die Palette aus dem Gras auf.
„Sprechen Sie“, sagte er. „Sie brauchen nicht unbeweglich dazusitzen. Erzählen Sie von sich. Warum sind Sie die arme Verwandte - wie Sie sich ausdrücken.“
„Mein Onkel Lionel, der Graf von Vinchcombe, ist Mamas Halbbruder“, erklärte Margret. „Er ist ein ziemlich strenger Mann und sehr einflußreich und wohlhabend. Papa und Mama hatten sich verliebt und durften nach langen Jahren des Wartens endlich heiraten. Aber wir sind sehr arm.“
„Macht es Ihnen etwas aus, arm zu sein?“ fragte Paul Beaulieu.
„Nein. Ich habe fast alles, was mein Herz begehrt. Meinem Bruder Bernhard fällt es nicht so leicht wie mir, denn er würde gerne zur Armee gehen, aber Papa kann das nicht bezahlen. Und dann habe ich noch zwei Schwestern - sie sind Zwillinge und heißen Emily und Edith. Die beiden jammern oft, daß es bei uns so bescheiden zugeht.“
„Aber es müßte für Sie doch ganz einfach sein, reich zu werden“, meinte Paul Beaulieu.
„Für mich? Wie denn?“
„Sie können einen reichen Mann heiraten.“
Margret lachte.
„Ich würde doch nie des Geldes wegen heiraten“, erwiderte sie.
„Also aus Liebe?“
„Nur“, sagte Margret.
„Und wenn Sie sich nie verlieben?“
„Dann muß ich eben als alte Jungfer sterben.“
„Um Gottes willen!“ rief Paul Beaulieu. „Das wäre ein Verbrechen gegen die Natur. Aber Sie werden sich eines Tages verlieben, und dann wird Ihr Leben voll von Leidenschaft, Hingabe und Treue sein.“
„Woher wissen Sie das?“ fragte Margret leise.
„Ich sehe es Ihrem Mund und Ihren Augen an“, antwortete Paul Beaulieu. „Frauen mit Lippen wie den Ihren schenken dem Mann, den sie lieben, Herz, Körper und Seele.“
Margret senkte die Augen. Die Röte stieg ihr in die Wangen.
„Sie sollten nicht mich malen, sondern meine Cousine Clementine“, sagte sie, um das Thema zu wechseln. „Sie ist wirklich hübsch.“
„Hübscher als Sie kann sie nicht sein“, bemerkte Paul Beaulieu mit völlig sachlicher Stimme.
„Sie wollen mich bloß necken“, sagte Margret. „So hübsch bin ich gar nicht. Aber Clementine sollten Sie sehen. Ihre Züge sind völlig regelmäßig, ihre Augen tiefblau und ihr Haar ist wie reifes Korn.“
„Sie scheinen sie wirklich zu bewundern“, sagte Paul Beaulieu. „Mögen Sie Ihre Cousine auch gern?“
Margret zögerte einen Moment.
„Clementine ist älter als ich“, antwortete sie dann, „und bewegt sich in den besten Kreisen. Wir haben wenig gemein. Wen ich wirklich von Herzen mag, das ist Cicely.“
„Und wer ist Cicely?“
„Sie ist Clementines Schwester - Lady Cicely Combe. Sie hatte vor einem Jahr einen Reitunfall und muß seitdem das Bett hüten. Die Ärzte hoffen zwar, daß sie eines Tages wieder gehen kann, aber sicher ist es noch nicht.“ Margret stieß einen kleinen Seufzer aus. „Die arme Cicely. Es ist ein schweres Schicksal. Können Sie sich vorstellen, wie hart das sein muß, wenn man mit sechzehn ans Bett gefesselt ist, während die anderen ausreiten und tanzen und all das tun, wonach man sich selbst sehnt?“
„Und deshalb leisten Sie ihr Gesellschaft?“
„Ja, ich sitze oft stundenlang an ihrem Bett und erzähle ihr. Cicely will alles wissen, was innerhalb und außerhalb des Schlosses passiert. Und ich lese ihr vor. Cicely ist ein sehr gescheites Mädchen. An ihr ist ein Junge verloren gegangen. Latein macht ihr nicht die geringsten Schwierigkeiten, und Griechisch bringe ich ihr gerade bei. Wir lesen zusammen Molière, Balzac und Goethe. Und natürlich auch Dickens und die Geschwister Brontë.“
„Das freut mich“, sagte Paul Beaulieu. „Ich meine, daß Sie auch die Geschwister Brontë erwähnen. Ich hatte schon Angst, daß Sie und Cicely zu den Blaustrümpfen gehören.“
„Würde Sie das schockieren?“ fragte Margret. „Mama sagt immer, daß Männer kluge Frauen hassen. Bei Partys soll man liebenswürdig und weiblich sein, meint sie, und bloß nicht zeigen, was man weiß.“
„Und folgen Sie ihrem Rat?“
Margret lachte und wieder tauchten die Grübchen auf.
„Ich gehe nur ganz selten zu Partys“, antwortete sie. „Und wenn ich einmal auf einer bin, dann vergesse ich, liebenswürdig und weiblich zu sein. Vielleicht habe ich deshalb so wenig Verehrer.“
„Sind die Männer in England denn blind?“ fragte Paul Beaulieu.
„Nein. Aber sie haben nur Augen für Clementine. Ihnen ginge es auch nicht anders, wenn Sie sie sehen würden. Sie würden nicht mehr mich, sondern meine Cousine malen.“
„Das bezweifle ich“, entgegnete Paul Beaulieu. „Ich bin Ihnen sehr dankbar, meine kleine Göttin, daß ich Sie malen darf.“
„Vielleicht würde ein Impressionist Clementines Schönheit gar nicht gerecht werden“, sagte Margret.
„Eben. Sie sollte in weißer Seide mit Perlen und Rosen in der Hand gemalt werden. Die goldblonden Haare und die tiefblauen Augen kommen vor einem blauen Samtvorhang am besten zur Geltung.“
Der Sarkasmus in der Stimme des Franzosen entging Margret nicht.
„Genauso ist sie bereits portraitiert worden“, sagte sie lachend. „Zweimal sogar. Die Gemälde hängen im Schloß. Ich wollte, ich könnte sie Ihnen zeigen.“
„Ich würde sie gerne sehen. Sie sind bestimmt das beste Beispiel dafür, wie man am schnellsten zu einem Namen und Vermögen kommt.“
„Wollen Sie es denn zu einem Vermögen bringen?“
„Nein, nicht unbedingt“, antwortete Paul Beaulieu. „Aber ich möchte, daß mehr Menschen verstehen, was die Impressionisten vermitteln wollen. Der Meister, bei dem ich studiert habe, schaffte es im letzten Jahr, daß ein Bild von ihm im Salon akzeptiert wurde, aber er ist so arm, daß er alles versetzt hat, was nicht niet- und nagelfest ist.“
„Wie schrecklich!“ rief Margret. „Wie heißt Ihr Meister?“
„Claude Monet“, antwortete Paul Beaulieu.
„Tatsächlich? Ich habe eines seiner Bilder gesehen. Natürlich nicht das Original, sondern eine Abbildung davon. Es heißt Frühlingslandschaft.“
„Das Bild hat Monet vor sechs Jahren gemalt. Gefällt es Ihnen?“
„Unheimlich gut“, sagte Margret.
Paul Beaulieu legte seine Palette weg und sah Margret erstaunt an.
„Sie sind nicht nur hübsch, sondern auch ein bemerkenswertes Mädchen.“
Margret blickte den Maler mit großen Augen an. Etwas schwang in seiner Stimme mit, was ihr völlig fremd war. Und plötzlich schien etwas zwischen ihm und ihr zu geschehen, was sie noch nie erlebt hatte, was aber denselben Zauber zu besitzen schien wie das Bild von Monet. Es war etwas Anziehendes und etwas Faszinierendes und gleichzeitig etwas, was Angst einflößte.
Sie stand auf.
„Ich - ich muß jetzt aber wirklich gehen“, stammelte sie. „Mama erwartet mich. Es ist sicher schon spät.“
„Kommen Sie morgen wieder?“
„Ich weiß es noch nicht“, antwortete Margret. „Es kommt darauf an, ob ich Zeit habe.“
„Bitte, versuchen Sie es einzurichten.“
Paul Beaulieu stand plötzlich direkt vor ihr, und sie sah zu ihm auf. Er war ein gutes Stück größer als sie. Sie hatten sich zwar eben erst getroffen, aber Margret hatte das Gefühl, diesen Mann schon ewig zu kennen.
„Bitte kommen Sie“, sagte er und sah ihr direkt in die Augen. „Ich kann Sie nicht gleich wieder verlieren. Vielleicht macht mich das Gemälde berühmt. Wenn es unvollendet bleibt, dann müssen Sie sich vielleicht lebenslang den Vorwurf machen, meine Karriere auf dem Gewissen zu haben.“
Seine Stimme klang ernst, aber in seinen Augen saß der Schalk.
„Sie schmeicheln mir, damit ich von meiner Wichtigkeit überzeugt bin“, entgegnete Margret. „Ich habe Ihnen doch gesagt, daß ich bloß die arme Verwandte bin.“
„Eine Göttin sind Sie“, sagte Paul Beaulieu.
Margret lächelte.
„Ich werde versuchen, zu kommen. Aber möglicherweise kann ich nicht lange bleiben.“
„Ich werde voll Ungeduld auf Sie warten.“
Er nahm ihre Hand und küßte sie.
Sie hatte nicht damit gerechnet. Ein Schaudern lief ihr über den Rücken. Dann eilte sie in den Wald, der an den Park anschloß.
Paul Beaulieu blickte ihr nach, bis sie verschwunden war, dann machte er sich mit Eifer an seine Arbeit.
Es war schon Viertel vor fünf, als Margret im Dorf ankam. Um lästigen Fragen zu entgehen, lief sie direkt in den Hühnerstall, fütterte das Federvieh und sammelte die frischgelegten Eier in den Korb. Anschließend gab sie den Pferden Heu und frisches Wasser, stellte die Eier in der Küche ab und ging ins Wohnzimmer.
Lady Evelyn, ihre Mutter, saß auf dem Sofa und stopfte Strümpfe.
„Da bist du ja, Margret!“ rief sie. „Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wo du nur bleibst.“
„Ich habe die Hühner und die Pferde gefüttert, Mama“, sagte Margret, „und wollte eben Papa daran erinnern, daß sich der Kirchenrat um fünf Uhr trifft.“
„Mein Gott, das habe ich ja ganz vergessen“, rief Lady Evelyn. „Zum Glück hast wenigstens du daran gedacht. Lauf schnell zu Papa, Margret, und achte darauf, daß er eine Krawatte trägt und nicht wieder in Hausschuhen weggeht.“
„Ja, Mama.“
Froh, daß keine Fragen gestellt worden waren, lief sie ins Arbeitszimmer ihres Vaters und erinnerte ihn an seine Pflichten.
„Muß ich denn da hin?“ fragte der Vikar unwillig. „Ich bin gerade an einem sehr interessanten Gedankengang, und wenn ich herausgerissen werde ...“
„Du mußt, Papa“, fiel ihm Margret ins Wort. „Die Kosten für die Reparatur des Kirchturms stehen auf der Tagesordnung, und das ist wichtig. Laß dich bloß nicht von der gräßlichen Lady Boddington mundtot machen. Sie will sich immer bloß aufspielen.“
Der Vikar legte widerstrebend die Feder weg.
„Ich bin gerade beim Einfluß der Ägypter auf die frühgriechische Zivilisation, und das ist ein höchst interessantes Thema.“
„Du mußt mir vorlesen, was du geschrieben hast, Papa“, sagte Margret. „Aber nicht jetzt.“
„In Gottes Namen.“ Der Vikar seufzte. „Dann gehe ich eben. Daß ich aber auch immer im wichtigsten Moment unterbrochen werden muß! Das macht mich rasend!“
„Ich weiß, Papa. Aber es ist nun einmal nicht zu ändern.“ Margret wollte ihren Vater gerade aus dem Zimmer schieben, als sie den Korb stehen sah. „Papa?“ fragte sie. „War Henry Gordon nicht heute da und hat von seiner Mutter etwas ausgerichtet?“
„Doch, ich glaube schon“, meinte der Vikar.
„Aber Papa“, sagte Margret und schüttelte verzweifelt den Kopf. „Du hättest ihm doch die Tinktur mitgeben sollen, die Mama extra für Mrs. Gordon gemacht hat.“
„Ach, du meine Güte!“ Er faßte sich an den Kopf. „Das habe ich total vergessen.“
„Dann bringe ich ihr es schnell“, sagte Margret. „Mrs. Gordon schwört auf Mamas Kräutermixtur.“
Wenn Margret schnell ging, konnte sie in zwanzig Minuten dort sein, und ihre Mutter merkte dann vielleicht nicht, daß ihr Vater wieder einmal total in seiner Welt versunken gewesen war und alles um sich herum vergessen hatte. Nicht, daß Lady Evelyn ihrem Mann je böse gewesen wäre. Sie liebte ihn wie am ersten Tag, war jedoch manchmal traurig, daß er wegen des Buchs, das er gerade schrieb, die Dorfbewohner vernachlässigte.
Wenn Papa mit seinen Büchern wenigstens etwas Geld verdienen würde, dachte Margret, als sie mit dem Korb am Arm quer über die Felder ging. Doch die Gedanken an Geld waren schnell verweht. Sie befaßten sich jetzt mit dem großen, fremden Mann.
Paul Beaulieu war ganz anders, als Margret sich einen Künstler vor gestellt hatte. Kein Bart, kein affektiertes Benehmen, keine Allüren. Der Franzose war selbstsicher, fast autoritär, ohne dabei bestimmend zu wirken. Margret war überzeugt davon, daß ihm alles gelang, was er anpackte.
Vielleicht würde ihn die Welt eines Tages als Genie anerkennen. Vielleicht würde ihr Portrait ihm tatsächlich Ruhm und Vermögen einbringen. Sie mußte ihn wiedersehen! Sie mußte alles versuchen, wenigstens eine Stunde Zeit für ihn zu haben.
Die Sonne stand bereits tief am Himmel, als Margret sich wieder auf dem Heimweg befand. Sie war so in Gedanken versunken, daß sie die offene Kutsche, die vor dem Pfarrhaus stand, erst im letzten Moment bemerkte. Was wollte denn der Schloßherr zu so ungewöhnlicher Stunde bei ihren Eltern? Margret konnte sich den Besuch nicht erklären, war jedoch überzeugt davon, daß es nur Onkel Lionel sein konnte, denn niemand in der Gegend außer ihm besaß ein so teures und elegantes Gefährt.
Vor dem Spiegel in der Diele strich sich Margret schnell die Haare aus der Stirn. Ob sie sich umziehen sollte? Der Saum ihres Kleides war staubig. Ach was, dachte sie. Er ist schließlich mein Onkel.
Margret öffnete die Tür zum Wohnzimmer und ging hinein. Zu ihrem Erstaunen war auch ihr Vater da. Den Mann, der bei ihren Eltern saß, erkannte Margret nicht sofort. Erst als sie die Ähnlichkeit mit Onkel Lionel feststellte, wußte sie, daß es nur ihr Cousin William, der Baron Cottesford, sein konnte, den sie seit drei Jahren nicht gesehen hatte.
Wenn William zu Hause gewesen war, hatte er nie Zeit für seine Cousine Margret gehabt. Sie war ihm lästig gewesen.
„Margret!“ rief Lady Evelyn. „Wo warst du denn?“
„Bei Mrs. Gordon“, antwortete Margret. „Ich habe ihr schnell die Tinktur gebracht, Mama.“
„Das ist lieb von dir, mein Kind“, sagte Lady Evelyn, legte einen Arm um Margrets Schultern und küßte sie.
Nicht nur Margrets Mutter strahlte, sondern auch der Vikar machte einen glücklichen und zufriedenen Eindruck. Sein Blick ruhte auf William, den Margret nie so recht gemocht hatte. Der Cousin sah älter aus. Er mußte inzwischen gut achtunddreißig sein.
Margret hatte sich immer etwas gefürchtet vor William, sie mußte aber zugeben, daß er im Moment so freundlich aussah wie nie zuvor.
„Was ist denn?“ fragte Margret. „Ist etwas passiert?“
„Etwas Wundervolles ist passiert, mein Kind“, antwortete Lady Evelyn. „Etwas, was dich ebenso glücklich machen wird wie Papa und mich.“
„Was ist es denn?“ fragte Margret ahnungslos.
„Dein Cousin William“, erklärte Lady Evelyn, „hat eben bei Papa um deine Hand angehalten.“