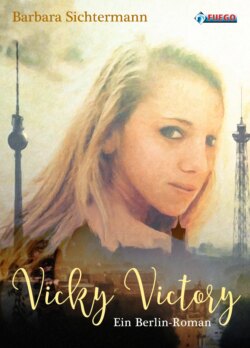Читать книгу Vicky Victory - Ingo Rose, Barbara Sichtermann - Страница 6
2. Kapitel Isaacs Kinder
ОглавлениеIch öffne meine Fenster: Glocken läuten. Was für Glocken? Die der Melanchthon-Gemeinde, der Erlöser-Kirche, der Paulus-Kapelle? Die Stadt ist voll von Gemeinden, aber die Berliner sind kein frommes Volk, Gott sei Dank, sie lassen die Kirchen veröden. Ob Loreley verlangen wird, dass ich sie vor einen Altar führe, um ihr dort mein Ja-Wort zu geben? Hochzeit kommt wieder in Mode. Meine Braut ist höchstens 25, rosablond, mit einer Haut wie Erdbeermilch. Noch sitzt sie auf dem Drehstuhl und erhebt ihre singende Stimme, um »49 Mark 80« oder »fuffzich retour für Sie« zu sagen, aber nicht mehr lange. Heute Abend wird sie abgeschleppt.
Warum bloß bin ich hinter dieser Tussi her? Wird es ein schlimmes Erwachen geben, wenn sie das erste Wort zu mir spricht? Ob sie aus dem Osten ist?
Deshalb muss sie ja nicht blöd sein. Gezeugt auf dem Zentralfriedhof Herzberge, aufgewachsen in der Leninallee 87 und entjungfert unterm Tulpenbaum im Volkspark Wuhlheide, hat sie am 9. November ’89 mit ihrem kurzen, dicken Freund am Brandenburger Tor auf der Mauer gesessen und Westbier aus Dosen in ihren Schlund und über ihre wattierte Fliegerjacke gegossen. Warum er kurz und dicklich war, ihr Freund? Weil es einen Grund gegeben haben muss, dass sie ihn verlassen hat. Der Platz an ihrer Seite ist leer, und ich erscheine im idealen Augenblick.
»Kommen Sie, Frau Rosinski, ja, ich weiß Ihren Namen, weil ich meine Ohren aufmache, wenn ich einkaufe, und weil mich alles interessiert, was Sie betrifft. Nehmen wir doch diesen Tisch am Fenster. Warten Sie, ich zünde die Kerze an. Rauchen Sie? Ich auch nicht. Aber ich trage dieses Feuerzeug bei mir, weil es ein Andenken an meinen verstorbenen Großvater ist.«
Sie wird nicht wissen, was sie dazu sagen soll, und obendrein kriegt die Stimmung zwischen uns zweien, diese von vorgreifendem Jubel durchwärmte starke Stimmung einen Schock, wenn von Tod die Rede ist. Wir werden beide verlegen auf das Tischtuch glotzen und nur zu bald nach Hause gehn. »Mein Opa«, werde ich stammeln, »besaß ein Öllämpchen, das er sehr liebte und mit diesem Feuerzeug …« Aber es ist schon zu spät, sie lässt mich stehen.
Man soll die Wahrheit in Ruhe lassen, wenn man eine Frau jagt. Macht sie was her, die Wahrheit, bediene man sich ihrer, macht sie nichts her, kehre man sie unter den Teppich. Schließlich sage ich auch nicht, dass ich arbeitslos und verlobt bin, da hüte ich mich. Wozu habe ich meine Verstellungsgabe und meine Art, interessant, vielseitig und ungebunden zu wirken? Die Wahrheit! Jeder ernst zu nehmende Philosoph sagt uns heute, dass es sie nicht gibt. Warum sollen wir in Liebessachen unter das Niveau des Jahrhunderts fallen?
Also: Gehen wir nochmal zurück zum Platznehmen am Cafétisch und ziehen wir das Feuerzeug elegant aus dem Gesprächsverkehr:
»Wennse nich roochen, wozu ham Sie dann ’n Feuerzeug mit?«
»Um an einem gesegneten Dienstagabend im Café mit Frau Rosinski - endlich, endlich im Cafe mit Frau Rosinski - die Kerze auf dem Tischchen anzuzünden, damit ihre Augen was zum Widerspiegeln haben.«
Eine komplette Antwort. Da muss das Herzchen lächeln. Steht ihr gut. Alles tritt hervor: das edle Kinn mit der Kerbe darin, die Lücke zwischen den oberen Schneidezähnen, die weiße Nasenspitze mit den rosa Nüstern und der Glanz in ihren Augen, die jetzt, erlöst von Tastatur und Scanner, einen Blick versenden. Und der gilt mir.
»Wer sind Sie eigentlich?« wird sie sagen, »erzählen Sie von sich.«
So was sollte ich sagen. Muss versuchen, schneller zu sein als sie. Oder so kontern:
»Was gibt’s von mir schon zu erzählen! Ich möchte alles über Sie wissen!«
Nein, das ist ungeschickt. Erstens gibt es über mich eine ganze Menge zu erzählen, und zweitens klingt es reichlich abgeschmackt, dieses: »Ich möchte alles über Sie wissen.«
Nie wird so ein Schmus über meine Lippen fließen. Geschworen! Stattdessen:
»Okay. Ich erzähle von mir. Aber nur, wenn danach Sie …«
»Jaja, danach ich. - Sind Sie von drüben?«
»Sieht man das?«
Sie zuckt die Schultern. Augenglanz wird runtergefahren, Blick schweift davon, die Enttäuschung ist offensichtlich. Sie wollte keinen Ostkavalier kennenlernen, von denen hat sie die Schnauze voll.
»Ich bin aber schon seit bald neun Jahren im Westen.«
Augenglanz wird wieder hochgefahren, Nasenspitze einen ganzen Zoll angehoben und die blonde Aureole über der Stirn mit allen zehn Fingern anmutig, aber effektlos zurechtgedrückt.
»Ehrlich?«
»Ich bin ganz legal ausgereist. War persona non grata.«
»Wieviel?«
Ein bisschen Latein macht sich gut bei den Damen. Diese Sprache mit ihrer klanglich faszinierenden Vokalfülle betört das Ohr einer jungen Frau am Feierabend. Es sei denn, sie heißt Loreley und reagiert auf Angeberei mit Verachtung. Besser ich bringe die Persona non grata sofort in Ordnung, sonst ruft sie den Kellner.
Überhaupt der Kellner. Ist er schon an unsren Tisch getreten?. Und wenn ja, was haben wir bestellt? Egal. Es gibt Wichtigeres. Zum Beispiel:
»Wie ist ihr Vorname?«
»Petra.«
So bin ich. Immer auf das Schlimmste gefasst.
☆
Wie sie auch heißen mag - für mich bleibt sie die wiedergeborene Evelyn. Jaja, in die Rosinski hab ich mich verguckt, weil sie einer anderen Blondine ähnelt, Evelyn Mölcharetz, einer kleinen femme fatale, die ich die Ehre habe, seit ihren Kinderjahren zu kennen, als sie zwar auch schon fatal war, aber nicht auf Grund von Weiblichkeit, sondern von abnormer Rotzigkeit. Sie wohnte ebenfalls in der Cecilienstraße, im selben Haus wie ich, uns gegenüber. Sie nannte mich, der ich zwei Jahre älter war und ihr immer an Würden voraus (Schulranzen, junge Pioniere, erste russische Wörter) beharrlich »Stinkstiefel«, schüttete mir Kaninchenköttel in die Anorakkapuze und klaute meine rot-weiß-grünen Nabenputzer. Ich nahm alles gelassen hin, ich brachte es nicht fertig, mich zu wehren. Großvater nannte sie »der kleine Lausbub« und Omi Lenau vom Parterre sagte nur »der Fratz«.
Als sie vierzehn geworden war, verlieh ihr die Natur über Nacht die Aura einer märkischen Diana. Großvater stellte sich auf »die kleine Evelyn von nebenan« um, und Omi Lenau steigerte zu »Fräulein Mölcharetz«. Evelyn hörte auf, mich zu beleidigen, und als wir eines Abends im Hof plauderten, während sie, wie so oft, ein Stückchen bei sich trug, eine Gerte, die sie im Park aus dem Gesträuch riss und mit ihrem Taschenmesser beschnitzte, als wir also plauderten und sie dabei rhythmisch mit ihrer Gerte an die Mülltonnen klopfte und mir - ich hatte etwas gesagt, was ihr passte - auf die Beine schlug, verliebte ich mich in sie. Ich tat es in demselben Augenblick, in dem der leichte Hieb auf meine Oberschenkel niederging. Ich ließ mir nichts anmerken und quasselte fort wie ein alter Freund. In Wahrheit hatte ich mich binnen einer Sekunde vom Nachbarskind zum Liebhaber raus gemacht. Als ich aber gleich darauf versuchte, den Stock zu fangen, um meine frisch erwachte Jagdlust zu befriedigen, warf sie mir einen kalten Blick zu, hob das Kinn und schritt mit ihrer Gerte ins Haus.
☆
Heute tut der Rücken kaum noch weh. Ein bisschen hohl fühlt sich die Nierengegend an, doch Haut, Fleisch und Organe, sie wollen heilen. Juni hat es schlimmer erwischt. Seine Hand ist immer noch verbunden. Zwar war sie nicht gebrochen, aber gequetscht, geprellt, gestaucht, geschwollen und was sonst zum Nachteil einer Hand noch möglich ist. Seine Mutter hat drei Weißkohlköpfe für kühlende Kompressen verbraucht. Und alle unsere Freunde glaubten an die Sterne! Konnte das ein Zufall sein - dass an einem und demselben Tag (einem Freitag!) Juni sich die Kühlerhaube eines Mercedes auf die Hand geschmettert hat und ich beim Geländerrutschen aus dem dritten in den zweiten Stock gestürzt bin und dann auch noch wie ’ne Cartoonfigur voll in Frau Busses Scheuereimer …
Wenn der Mensch krank im Bett liegt, bereut er es nicht mehr, verlobt zu sein. Sonja kam sofort und mit ihr kamen Salbe, Trost, zwei amerikanische Romane (meine Lieblingslektüre) und jede Menge Putenschnitzel mit Püree. Den Salat nicht zu vergessen. Ich zog Sonja zu mir auf das Ausziehsofa und flüsterte: Lass uns das Beste draus machen, aus dieser Bettlägerigkeit, und sie sagte: Bitte sehr, und erwartete den ersten Schmerzenslaut. Meine Hüftbeweglichkeit war schier, gleich Null. Juni ist doch besser weggekommen, fand ich, matt an die Liebste geschmiegt. Wozu braucht der Mensch im Bett Hände? Zumal mir Sonja auf beide draufschlug und behauptete, die Putenschnitzel seien durch.
☆
Heute ist sie bis zum tiefen Abend im Gemeindehaus beschäftigt, meine Sonja, also kann ich unbehelligt auf die Jagd gehen und den Minipreis beschleichen. Ich rutsche sorglos über’s Geländer abwärts, denn ich bin mir meines Gleichgewichtes völlig sicher, und Hauswart Bock, der kann mich mal. Leider schmerzt das Kreuz noch ungemein.
Es ist spätsommerlich mild. Der warme Abendfriede lehrt uns Berliner, das Konzert der Vögel aus dem Verkehrsgesumm herauszuhören und - ja, fast einstimmen zu wollen. Frohgemut schlendere ich zur Darwinstraße rüber, froh und erwartungsvoll, denn heute mach ich es richtig.
Die Hinterfront des Minipreis, die kleinen Fenster und die Glastür, sie schimmern im Ladenschlusszwielicht. Die Werktätigen der Zirkulationssphäre haben ihre Sachen gepackt und treten hervor, um in den Moabiter Feierabend auszuschwärmen. Hier parken des Abteilungsleiters Opel, des Lager-Fuzzis Motorrad und ungefähr ein halbes Dutzend Lieferwagen. Die menschlichen Wesen irren winzig durch diesen Kongress machtvoller Fahrzeuge; man muss achtgeben, dass man keines übersieht, denn sie alle können sich im Schatten der LKW’s entlangdrücken und verflüchtigen. Aber dann - nun danket alle Gott - dringt eine Traube erheiterter Mädchen aus der gläsernen Hintertür, die hängen aneinander, die erzählen sich was und lachen sich scheckig; der ganze Tagesfrust wird hier in Kicherkaskaden ersäuft. Und wie ich näher herantrete, kühn und zielbewusst, verstehe ich sogar, was die eine, die kleine Verwachsene, hervorstößt:
»Nur um zu hupen? Nur um straflos die Hupe durchzudrücken?« Und eine andere quiekt dazwischen:
»Sieht dem Affen ähnlich. Wundert mich überhaupt nicht.«
Und was sagt Loreley?
Denn sie ist auch dabei und mittendrin. Sie lacht, entfesselt, den Kopf im Nacken, ohne Luft, sie hat sich festgelacht und führt die Hand zum Bauch, weil es ihr wehtut.
So hübsch dieser Anblick sich kringelnder Mädchen ist, so froh ich bin, an der richtigen Stelle zu sein und Evelyn-Loreley Rosinski vor mir zu sehen, so ungünstig ist für meine Absichten die Pulk-Form, in der das Frauenvolk sich fortbewegt. Wie komme ich da an eine einzelne heran, wie kann ich meine Blondine aus dem Gewimmel heraus abfangen, ja wie mich überhaupt bemerkbar machen, wo alle durcheinander gackern und Loreley vor lauter Tränen in den Augen und Krämpfen im Zwerchfell überhaupt nichts wahrnimmt?
Schon sind sie an mir vorbei; trotz ihrer humorigen Stimmung haben die Mädels es eilig. Sie schieben und drücken einander vorwärts; die eine verliert ’n Schuh, die andre hebt den Slipper auf und rennt damit weg, alles kreischt, Flüche und Handtaschen wirbeln durch die Luft - wo ist Loreley? Zum Teufel, ihr verdammten Schicksen, wo habt ihr meine Süße hin gescheucht? Ist sie das, da vorn an der Straße, knapp am Kantstein längs spurtend und dem Busfahrer zuwinkend, der eben losfahren will und jetzt charmanterweise die Tür noch mal aufgehen lässt? Nein, das ist sie nicht, aber wo kann sie abgeblieben sein? Die lachenden Supermarktweiber sind auseinandergestoben. In der traulichen Moabiter Dämmerung erkenne ich die Zwergin, wie sie die Darwinstraße überquert, die Dralle, wie sie auf einen Trabi zusteuert und zwei weitere, die untergehakt Richtung Süden davon spazieren, Loreley ist weg. Ein letzter höhnischer Gelächterfetzen weht zu mir herüber, dann ist Stille.
Der Abendwind bläst in das graue Pulver, das hier überall, auf den parkenden Autos und auf dem grünen Kabelverteilerkasten, gegen den ich tief enttäuscht gelehnt stehe, reichlich lagert. Ich nehme eine Prise, atme die von grauem Pulver erfüllte Luft gut durch und warte auf die Offenbarung. Aber mir fällt nur ein: Kommen und Gehen. Und: Heteronome Insemination. Keine großartige Ausbeute.
In solchen Lebenslagen gedenkt man ihrer mit doppelter Zärtlichkeit: der Stammkneipe und des Genies, das sie erfand.
☆
Ich kreuze die Einsteinstraße, in der Veit Prause wohnt, ein Freund aus meinem ersten Westjahr. Ich lernte ihn an der Bushaltestelle kennen, als bei der BVG gestreikt wurde und die Linie von Moabit nach Süden ausfiel. Veit und ich waren die letzten, die davon erfuhren, was bei den damaligen Minusgraden ein heroisches Versäumnis war. Statt in Dahlem landeten wir in Veits mit schweren alten Möbeln vollgestopfter Hinterhauswohnung und tranken einen Rumtopf, den mein Gastgeber im Steingutkrug auf dem Dach seines mächtigsten Schrankes vorrätig hielt.
Noch nie zuvor war mir ein alkoholisches Getränk in dieser Konzentration bekommen. Ich gewann Veit, als ich ihm erzählte, dass ich alte Sprachen hatte studieren wollen - und Architektur, was er mir erst nicht glaubte, dann hoch anrechnete und mit der Darlegung seiner Jugend in der Pfalz vergalt. Wir blieben am Ende der fünfziger Jahre, mitten in Veits Einschulung, stecken, ziemlich angeheitert. Ausgiebig schilderte mein Freund seine elektrische Eisenbahn, mit der er daheim und zu Weihnachten heute noch spielt. Morgens um acht wollte ich gehen. Aber Veit hielt mich zurück.
»Raus mit der Sprache. Wie bist du über die Mauer? Legal? Mit ’m Schlepper? Durch die Spree geschwommen?«
Und ich erzählte ihm meine Geschichte.
Es tat mir leid um Veit, dass sie nicht dramatisch war, die Geschichte meines Legalverzugs, sondern bloß bürokratisch und entsprechend trocken. Ich überlegte kurz, ob ich eine aufregende Fluchtgeschichte erfinden sollte und setzte sogar dazu an, doch dann begannen die Spatzen in Veits Hof zu palavern, und das Morgenlicht badete seine Buffets und Kommoden in weißen Wellen. Die Stimmung für ein Märchen war dahin.
»Ich hatte einen Antrag gestellt«, begann ich erneut, »und …«
»Warum?« rief Veit. Er zappelte betrunken mit den Armen. »Warum bloß?« - Nach seiner Einschätzung war das Honecker-Regime Anfang der achtziger Jahre noch reformfähig, und oppositionelle Kräfte hätten deshalb, statt in den korrupten Westen auszurücken, lieber zur Stärkung des Sozialismus …
»Lamm Gottes«, seufzte ich.
»Du stammst aus einer katholischen Familie?«
»Ja schon, aber wir waren nicht kirchlich aktiv.«
»Was sagten deine Eltern zu deinem, hick, Ausreisebeschluss?«
»Ich hatte keine Eltern mehr. Meine Mutter ist gestorben, da war ich fünf. Meinen Vater habe ich gar nicht gekannt. Aber mein Opa, der war mir mehr wert als ein ganzes Elternpaar, er war mein Ein und Alles.«
»Du wolltest werden wie er?«
»Natürlich.«
Meine Initiation in die Welt der Schrift und der Gedanken war weniger der Schuleintritt als mein zehnter Geburtstag, zu dem mir Opa seine weinrotgoldene Homer Ausgabe schenkte - sowie seine Bereitschaft, mich alles zu lehren, damit ich dieses Buch verstünde. Und er tat es, jawohl. Aber als ich die Schule Verließ, wurden gerade keine Altphilologen gebraucht und Architekten schon gar nicht. Stattdessen Rechnungsführer für die LPG’s und Ökonomen für die VEB’s. Meine Enttäuschung über dieses Nein zu meinem Lebenszweck wütete wie ein Brand in meinem Ego. Ich war nicht zum Rebellen geboren, aber erst recht nicht zum Buchführer. Und so pfiff ich erstmal auf jegliche Ausbildung. Und vor allem auf die Nationale Volksarmee.
»Oho«, röhrte Veit, »das war nicht gern gesehen, was?«
»Es bedeutete, dass ich praktisch mit einem Bein im Knast steckte.«
»Noch ’n Schluck?«
Es bedeutete, dass ich für die Volkssolidarität Essen ausfahren musste, mit dem Rad, aber das war mir lieber als sozialistisches Rechnungswesen. Zumal ich zwei der alten Leutchen, die ich verköstigte, bald ins Herz schloss: Beau Schuster, einen homosexuellen Komponisten, der zu Unrecht vergessen ist, und Oma Köpcke, die arabisch konnte. Beide hatten keinen großen Appetit. Was sie liegen ließen, durfte ich verzehren. So kam ich billig durchs Leben.
»Erzähl von deiner Flucht, Igor. Wie lief das? Du bist durch den Spreetunnel …«
»Das war ’n Scherz. Ich habe einen Antrag gestellt. Das einzig Aufregende daran war Frau Bremers Oberweite.«
»O weia.«
»Ich schrieb an den Rat des Stadtbezirks, Abteilung Inneres, mit Rückantwort. Ich musste jedes Wort wägen. So ein Ausreiseantrag durfte keinesfalls nach einer Herabwürdigung des Staates klingen.«
»Und der Schlepper?«
»Hab nie einen Schlepper gesehen. Hab in meinen Antrag reingeschrieben, dass ich ’ne Waise, auf die Suche nach meinem Vater gehen wollte, der im Westen verschollen war, und Frau Bremer hat mir das abgekauft.«
»Das war die Beamtin, die dich …«
»Genau: Ich kriegte circa alle sechs Wochen meinen Termin bei ›Inneres‹, das heißt bei Frau Bremer, und ich freute mich jedes Mal doppelt. Einmal, dass meine ›Entlassung aus der Bürgerschaft« ein Stück näher rückte, und zum Zweiten auf Frau Bremers Busen. Er war so riesenhaft, dass er den Stempelständer umriss, wenn sie sich vorbeugte, um mir in die Augen zu sehen.«
»Keine Schikanen?« flüsterte Veit und kniff ein Auge zu. »Keine Pressionen und Drohungen?«
»Eigentlich nicht. Ich erzählte ihr mein Leben und glotzte auf ihren Pullover. Sie machte sich Notizen und sah mir in die Augen. Quälte mich höchstens durch außergewöhnlich lange Abstände zwischen zwei Terminen. Und dann, nach einem knappen Jahr, kriegte ich meinen Laufzettel.«
»Da kannste mal sehen«, erklärte Veit befriedigt. »Is doch ne menschliche Prozedur. Und hier im Westen machense aus der DDR das reinste Alcatraz.«
»Vorsicht, Veit. Ich hatte immer das Gefühl …«
»?«
»… dass es mit mir anders lief als sonst.«
»Und wieso?«
»Ich weiß es nicht. Zwei Gründe kommen in Frage. Erstens: Ich war persona non grata. Die Bürokratie witterte in mir ihren geborenen Feind und schob mich lieber ab, als sich mit mir anzulegen.«
»Aber sonst bist du bei Trost?«
»Oder Frau Bremer sah keine andere Möglichkeit, ihre Ehe zu retten.«
Da lachte Veit so konvulsivisch, dass er sich verschluckte und leider danach übergab. Ich brachte; ihn zu Bett und schlief auf seiner Chaiselongue.
☆
Inzwischen ist das alles viele Jahre her, und ich bin längst ein naturalisierter Westberliner, ebenso zu Hause auf dem Kudamm wie in der Hasenheide, genauso gern gesehen auf dem Victoria-Luise-Platz wie im Tiergarten. Nur selten denke ich an Frau Bremer; Beau Schuster und Elsbietha Köpcke hab ich im Grunde vergessen. Nicht aber, die Cecilienstraße, nicht Evelyn - obwohl es noch länger her ist, dass ich beide das letzte Mal sah.
In der DDR hielt man Jugendliche de facto auch dann noch in geschlechtlicher Unwissenheit, wenn sie de jure schon Familien gründen konnten. Sex ließ sich längst nicht so gut vom Klassenstandpunkt aus treiben wie Sport, Singebewegung und Subotniks.
Niemand hat Evelyn und mich ermutigt, mit dem Händchenhalten rechtzeitig anzufangen, und hinzukam, dass wir seinerzeit viel rohes Unglück durchzustehen hatten. Was mich ängstigte, waren Großvaters Krankheiten: Zustände von Atemnot und Schmerzen in der Brust, die er beharrlich als »Zipperlein« herunterspielte. Einmal kam Evelyn und brachte Weißdorntee, der solle helfen. Sie selbst litt auch, denn Bernd, ihr großer Bruder, ein hochbegabter Mechaniker, hatte (es?) in den Westen rüber gemacht, und niemand wusste, wie. Jetzt gab es keinen Puffer mehr zwischen Evelyn und ihrer älteren Schwester Annegret, einer angehenden Bibliothekarin mit Parteibuch, die nach der Flucht ihres Bruders den Zorn der gesamten Arbeiterklasse auf die Familie herab beschwor. Frau Mölcharetz hatte ihre Älteste stets den anderen Kindern vorgezogen. Aber es war ihr nicht recht, dass Annegret in die Partei eintrat, und weil sie sich nicht traute, ihre geliebte Tochter deswegen abzumahnen, ließ sie ihren Unmut an Evelyn aus. Papa Mölcharetz war lange schon verstorben; dass nun auch der Sohn sich abgesetzt hatte, war zu viel der Verluste, und in das Haus mit der schiefen Laterne zog ein finsterer Dämon ein.
Evelyn war immer aufsässig gewesen, jetzt wurde sie jähzornig. Manchmal hörte ich durch die Wände, wie Mutti Mölle und ihre Tochter miteinander rumbrüllten, auch rumpelte und barst Mobiliar. Großvater schüttelte den Kopf, atmete tief ein und murmelte: Odi profanum vulgus. Er schickte mich aus dem Haus, Brot und Eier holen, damit ich nicht hören sollte, wie meine Nachbarinnen einander die Stuhlbeine durch die Frisuren zogen.
Meine Liebe zu Evelyn versank in diesem Meer von Harm, das in die Cecilienstraße geschwappt war. Aber sie wartete unter den Wogen auf ihre Stunde, und so viel ich auch tat, sie mir aus dem Kopf zu schlagen, sie siegte am Ende.
☆
Die Einsteinstraße hat nicht viel zu bieten, außer Veit, immerhin. Ich kehre um und schlage den Weg zu meinem Kumpel ein. Veit gehört zu denen, die bei »Bella Ciao« verkehren, doch wir zwei treffen uns auch einfach so; was ihn an mir reizt, ist der DDR-Bürger in mir, jenes melancholische Geschöpf, das Loreley abschrecken wird; und das auch sonst nicht auf sehr viel Interesse stößt, außer wenn es mir gelingt, es mit meiner erworbenen West-Frechheit in den Schatten zu stellen. »Man merkt dir gar nicht an, dass du drüben aufgewachsen bist«, ist das größte Kompliment, das die Welt für mich übrig hat, und ich weiß auch nicht, warum ich’s nicht ganz so gern höre.
Jetzt klingele ich bei Prause. Habe ich Schwein, ist Veit da und bereit, zu »Bella« mitzugehen. Womöglich aber hat er Besuch von Janett F. Niemann seiner Freundin, die von Beruf Lehrerin und permanent empört ist über den Lauf der Welt. Oder er muss einen dringenden Auftrag erledigen: einen Forschungsbericht, ein Drehbuch, eine Doktorarbeit in seinen Computer tippen. Davon lebt er. Gelernt hat er Buchhändler, und sieben Jahre war er in einem Laden in der Hardenbergstraße tätig. Dann wurde er gefeuert, weil er im Lagerraum des Geschäfts ein Quartier für zwei minderjährige libanesische Flüchtlinge eingerichtet hatte, die auch noch weiblichen Geschlechts waren und dort - so erzählt es Juni - nicht allein genächtigt haben. Veit leugnet. Er sagt, er habe einen Betriebsrat gründen wollen und sei als untragbar entlassen worden. Mich kümmert nicht, welche Lesart richtig ist. Ich steh zu Veit, er ist okay.
Da kommt er zur Tür, späht durch sein Guckloch, das macht er immer, und ich schneide immer ein Gesicht, so auch heute. Ich runzle die Stirn, drücke die Nasenspitze mit dem Zeigefinger in Himmelfahrtsposition und biege die Zunge runter bis auf’s Kinn. Veit entriegelt die Tür und öffnet. Er steht im Bademantel vor mir, mit einem Schal um den Hals und hustet kunstvoll.
»Ich hab die Grippe, Alter, aber komm rein, Alter. Hast du gehört, was in Hoyerswerda passiert ist? Bei mir tagt gerade eine kleine Versammlung. Wir sind der Meinung: Es muss etwas geschehn.«
Er verspricht mir Tropfen, damit ich mich nicht anstecke: »Unter die Zunge träufeln.« Öffnet mir dann die Tür zu seinem stickigen Wohnzimmer, und - wie ich schon ahnte, denn »kleine Versammlung« heißt: Sie ist da - Janett F. Niemann thront auf dem Schreibtisch, neben ihr im Drehstuhl sitzt ein Schwarzer, der gerade stürmisch in die Hände klatscht und gegenüber im Ohrensessel hockt ein schmaler Typ mit Brille, der in ein Notizbüchlein starrt.
»Ich darf euch Igor Marenge vorstellen«, erhebt Veit seine Krächzstimme. »Er ist absolut vertrauenswürdig und kann uns vielleicht bei der Einschätzung der Lage behilflich sein, denn er kommt von drüben.«
Fast als sei er stolz darauf, einen ehemaligen DDR-Bürger persönlich zu kennen, legt Veit mir die Hand auf die Schulter und schnieft:
»Igor, hier rechts sitzt Futu aus Zaire, und das ist Janetts Kollege Tom.«
»Hallo«, mache ich verlegen. Folge dann Veit; der kriecht auf die Chaiselongue unter sein Federbett, ich nehme am Fußende Platz. Futu und Tom nicken mir zu. Janett tut so, als sei ich nicht da und verkündet:
»Der Adressat ist Bonn!«
Das haben die andern erwartet, und sie sind nicht einverstanden. Man schüttelt den Kopf (Tom), rauft sich das Brusthaar (Veit) und bläst die Backen auf (Futu). Schließlich sagt Tom:
»Warum nicht gleich der Weltsicherheitsrat!«
»Eins muss klar sein«, schnarrt die Niemann, »die Verantwortung liegt beim Innenministerium, da beißt die Maus …«
»Wenn schon, denn schon«, röchelt Veit.
»Das kannst du doch nicht wegdiskutieren«, sagt Tom, »die Schmierereien von Weißensee sind der weit größere Skandal! Ich meine: das spricht Bände. Vierzig Jahre ruht dieser Friedhof in Würde, dann kommt die Wiedervereinigung, und die antisemitischen Parolen prasseln nur so auf die historischen Grabmäler …«
»Immerhin hat die jüdische Gemeinde Mittel, sich zu wehren«, wendet Futu ein. »Aber wer spricht für die Flüchtlinge? Niemand. Nur ein paar Grüne und die GEW.«
»Was war denn los in Hoyerswerda?« frage ich. Es ist mir etwas peinlich, zuzugeben, dass ich nicht informiert bin. Deshalb füge ich schnell hinzu, ich hätte verletzt im Bett gelegen. Ein Sportunfall.
»In Hoyerswerda haben Rechtsradikale das Asylantenheim in Brand gesteckt«, erläutert Veit, während Janett geschmerzt an die Decke starrt. »Ein Kind schwebt in Lebensgefahr.« Und gestern haben sie hier am Ostkreuz einen Farbigen aus der U-Bahn gestoßen. Der Mann hat das Becken gebrochen.«
»In der DDR war so was undenkbar«, erklärt Janett.
Pause. Man wartet auf meine Zustimmung. Aber ich kann dieser Person nicht recht geben, und wenn ich bestreiten müsste, dass sich die Erde dreht. Für den Anfang stelle ich klar:
»Es gab ja keine Ausländer. Wir - …«
»Stimmt nicht«, schneidet Janett ein. »Ich denke, du hast da gelebt? Dann hättest du doch mal ’n Vietnamesen sehen müssen. Oder einen Afrikaner. Oder einen Kubaner. Oder einen Russen.«
»Die Russen waren verhasst«, entgegne ich. »Die anderen nicht beliebt. Wie man mit denen umgesprungen ist, das kam natürlich nicht in die Zeitung.«
»Ach Igor«, stöhnt Veit, »Du und deine subjektive Perspektive.«
»Vielleicht war es besser so«, brummt Tom. »Manche Idioten überfallen Wehrlose, bloß damit sie in die Zeitung kommen.«
»Zur Sache«, mahnt Veit. Er hält ein Blatt Papier in die Höhe: »Ich habe hier unsere Optionen aufgelistet.«
Jetzt, wo sich die ersten unerfreulichen Folgen der Wiedervereinigung zeigen, hält Veit seine Stunde für gekommen. Jede neue Arbeitslosenstatistik, jeder frischgebackene Skinhead aus Mecklenburg oder Sachsen-Anhalt, jede Immobilien-Schieberei zugunsten bayrischer Mittelständler oder schwäbischer Bankiers ist Wasser auf seine Mühle. Dieser feinfühlige Bücherwurm kann vor Empörung kochen, wenn es um seine Schützlinge geht: die armen Zonis, Opfer zweier deutscher Diktaturen und der geballten Brutalität westlicher Marktwirtschaft. Er ist rot vor Wut und Fieber und hustet in sein Federbett.
Ich kann mich keineswegs so erregen wie er, was daran liegt, dass ich viel weniger von der Welt erwarte. Veit ist verwundbar, denn er glaubt an das Gute. Wird sein Vertrauen aber enttäuscht, so entlädt sich sein Frust in schaurigen Verwünschungen, und die Menschheit, ob in Berlin oder Hoyerswerda, sinkt in seiner Achtung klaftertief, tiefer als je in der meinen.
Ich weiß, ich bin zu milde, ich sollte über Ausschreitungen wie die, von denen Veit jetzt spricht, in Entrüstung aufstehen, aber in meiner Brust regt sich nichts, und ich würde mich am liebsten davonstehlen. Doch das empfiehlt sich nicht, wenn Veit geladen ist, man riskiert eine Gardinenpredigt. Nachdem er seine »Optionen« verlesen und alle Anschläge und Übergriffe der letzten Wochen aufgezählt hat, wendet er sich an mich:
»Wie war das, Igor, gab es in der DDR eine Erziehung zur Völkerverständigung, oder gab es sie nicht?«
»Es gab eine Erziehung zur Folgsamkeit. Was richtig war, stand vorher fest. Man durfte es nicht selbst herausfinden.«
»War vielleicht besser so«, bemerkt Tom. »Wenn jeder selbst bestimmen wollte, was richtig ist …«
»Es gibt eine Sehnsucht«, beharre ich, »über Richtig und Falsch nachzudenken, ohne dass das Ergebnis feststeht: Diese jungen Skinheads probieren aus, ob Rechtssein für sie richtig ist …«
»Jesus«, schnappt die Niemann, »der verteidigt diese Mörder!«
»Keineswegs. Ich …«
»Eine Resolution gegen Ausländerfeindlichkeit«, unterbricht Tom unduldsam, »die den Antisemitismus nicht einbegreift und zwar ausdrücklich …«
»Alle meine Entchen«, quiekt plötzlich Futu mit Kopfstimme, »Und was ist mit den Schwulen?«
»Der Adressat ist Bonn.« Janett haut mit Veits versilbertem Brieföffner auf Veits empfindlichen Monitor. Der Kranke zerbeißt krachend ein Stück Blockmalz und fuchtelt mit den Armen:
»Igor, ich versteh dich nicht. Was soll’n wir deiner Meinung nach tun? Die Skinheads ruhig ausprobieren lassen, wie es sich anfühlt, rechtsextrem und gefährlich zu sein?«
»Jahahahu«, lacht Tom. »Was sollen wir tun?«
Ich bin dran. Shit. Habe über diese Frage noch nicht gründlich nachgedacht. Und jetzt ist dafür keine Zeit. Also sag ich aufs Geratewohl:
»Da hilft nur eins: Zurückschlagen.«
»???«
»Geht rüber nach Ostkreuz, dahin, wo die Typen sich treffen und verpasst ihnen einen Denkzettel.«
Das war natürlich die falsche Idee. Außer Futu, der laut in die Hände klatscht, sind alle dagegen. Aber ich meine es. Wer zu feige ist, die eigene Rübe hinzuhalten, soll nicht an der Polizei rummeckern. Doch ich komme nicht dazu, meinen Standpunkt klarzumachen. Janett guckt an die Decke, was so viel heißt wie: Wann räumt dieser unqualifizierte Marenge endlich das Feld?, und Veit reagiert auf den Wink. Er krabbelt aus dem Bett und legt mir die Hand auf die Schulter.
»Komm mit«, sagt er, »ich geb dir die Tropfen.« Und er führt mich hinaus in die Küche. Schnäuzt sich dabei und niest dann.
»Weißt du, Igor, ich gönne der Regierung den Schlamassel, wenn die Jungs in Hoyerswerda nicht von selbst auf die Idee gekommen wären, hätte man glatt nachhelfen müssen.«
Veit ist gegen die Wiedervereinigung, er war es von Anfang an. Heute, ein knappes Jahr nach dem Vollzug der Einheit, jammern alle über die Folgen, aber die Sache selbst mag kaum einer ungeschehen machen, auch nicht in Worten, als Wunsch. Veit hat diesen Mut. Er findet, die DDR hätte um ihren Fortbestand kämpfen müssen, anstatt bedingungslos zu kapitulieren. Ich verstehe seine Gründe. Er kommt aus dem Pfälzischen, hat das Land, in dem er erzogen wurde, nie recht gemocht und sich eingebildet, die kleine mundtote DDR sei tieferer Sympathien würdig. Unsere Debatten über diesen Irrtum haben des öfteren den Tag versinken und wieder aufgrauen sehen, ohne dass er seinen Wahn und ich meine subjektive Perspektive, wie er das nennt, aufgegeben hätte.
»Die Leute drüben waren vor ’89 nicht besser, Alter«, murmele ich rechthaberisch. »Das glaub man nicht. Die hatten bloß Schiss.«
Veit aber ist überzeugt von den Charakter verderbenden Auswirkungen des DM-Imperialismus, schwenkt dann über auf die Arbeitslosenversicherung und endet bei seinem Kleinkrieg mit dem Weddinger Finanzamt, das von ihm verlangt, er möge seine Tipp-Honorare versteuern, obwohl er das doch nebenbei und illegal macht, um die Stütze nicht zu verlieren. Sein eigener Charakter, bekennt er zwischen zwei Hustenattacken, sei im Begriff, durch Mangel an D-Mark korrumpiert zu werden.
»Scheißsystem«, sagt er durch die Nase. »Es macht uns alle zu Mammon-Jüngern, wir vergeuden unsere besten Kräfte auf der Jagd nach dem Erfolg, und nichts bleibt übrig für die Menschlichkeit.«
»Ich jage nicht nach Erfolg«, versetze ich, »sondern nach dem Schicksal der Menschen. Ich möchte wissen, was in ihrem Innern schlummert.«
»Das kann ich dir sagen: ein Scheißdreck. Aber warum bist du eigentlich gekommen?«
»Ich wollt dich zu Bella mitnehmen. Wenn Malte da ist, zocken wir.«
Er zögert. Dann legt er sich die Hand auf die Brust und zieht die Mundwinkel weit runter:
»Du siehst ja selbst, ich muss ins Bett. Janett lässt da nicht mit sich spaßen.«
Und er bittet mich, zwei Briefe für ihn in den Kasten zu werfen.
»Sonst klingelt mich die Sau wieder aus’m Bett«, womit er das Finanzamt meint, genauer eine Sachbearbeiterin mit Namen Schuller, von der er annimmt, sie komme aus dem Osten.
»Reines Sächsisch«, vermerkt er kennerisch. »Warum bloß stellt ein Westberliner Finanzamt Leute ein, die keine Ahnung haben?«.
Als ich mich zum Gehen wende, fragt er mich nach Sonja. dass er meine Freundin bei ihrem Vornamen nennt, berührt mich unangenehm, denn ich kann mich nicht revanchieren. Den Namen Janett brächte ich nie über die Lippen, um keinen Preis. Das schiene mir zu vertraulich bei so einer blöden Person. Sie beim Namen nennen hieße, ihre Tonlage akzeptieren. Ich sollte Veit mal stecken, dass sie nichts für ihn ist. Aber da er krank ist und ich ihn schonen will, sage ich nicht:
»Wie hältst du bloß die Hippe aus?«, sondern: »Sonja geht’s gut.«
»Wann heiratet ihr?«
»Ich weiß nicht. Vielleicht nächstes Jahr.«
»Warum so spät? Hat sie ’n andern?« Der Gedanke ist mir unsympathisch. Ich nehme das gerührt zur Kenntnis, schlussfolgernd, dass meine Liebe zu Sonja lebt und loht wie eh und je, den Reizen einer gewissen Kassiererin zum Trotz.
»Ich glaube nicht, dass sie ’n andern hat.«
»Hast du sie gefragt?«
»Warum soll ich sie auf Ideen bringen?«
»Auch wieder wahr. - So, und jetzt träufeln. Zehn Tropfen. Schön lange im Mund lassen.«
Das Zeug schmeckt wie schales Bier. Veit zuliebe behalte ich es drin, ziehe stumm ab und spucke die Dosis diskret neben die Fußmatte. Denn ich bin gottlob nicht anfällig.
☆
Ein stilles Wunder: die Sterne. Sie machen mich immer verrückt. Der Mensch ist ein vorkopernikanisches Geschöpf und nicht dazu begabt, astronomische Maße und Gewichte in seiner Vorstellungskraft unterzubringen. Vermutlich sind Computer diejenigen unter den dienstbaren Geistern des technischen Zeitalters, die eine solche Leistung erbringen können. Für die Simulation des Flugs ins All jedenfalls taugen sie unbedingt. Hauptsache, ich muss es nicht machen. So, und nun rein mit euch in die gelbe Box, zuerst du, Liebesbrief an Frau Schuller, Wedding, und dann du, Werbeantwort an die Firma Rotermund, Steglitz, Antik-Möbel, Ankauf und Restauration.
Ich sah mal einen Meteor über den Nachthimmel ziehen. Vielleicht war es auch ein Sputnik. Ich sage mal: ein Meteor. Denn das Ding wurde größer in der Nähe des Horizontes, den ich es nur nicht mehr erreichen sah, weil meine Freunde, die Häuser, sich davor drängten, und wie üblich gleich wieder in Massen. Ich nannte das Gestirn »Igor Eins« und suchte eine Zeit lang verstohlen in Marzahn-Bürknersfelde nach seinen Bruchstücken im Erdenschoß. Offen gestanden suche ich noch immer. Ich spähe die Rinnsteine rauf und runter und schnüffele in der Luft nach schwefeligen Anteilen als Hinweis auf das weitgereiste Steinstück. Von wegen: suchet, so werdet ihr finden. Finden tut man schon, alles mögliche, aber es ist nie das, was man gesucht hat. Schließlich nimmt man vorlieb. In Marzahn fand ich eine Lesebrille ohne Bügel und zwei ungarische Kleinmünzen, und heute Abend, mitten im eindunkelnden Moabit, ist es ein Gutschein für den Friedrichstadt-Palast.
☆
Hier stehe ich mit dem Gutschein in den Fingern, und eh ich mich’s versehe, ist es mein Dasein, das ich halte, mit beiden Händen, wie ein Stück Papier. Es ist am Dasein des Igor Marenge, der im Licht einer Moabiter Straßenlaterne einen Gutschein entziffert, nichts Besonderes, außer dass es meine Existenz ist, die sich hier unter blassen Sternen ihrer Anwartschaft auf Größeres bewusst wird. Sie wünscht sich die glückliche Stunde, Kairos, Erfüllung im Morgengrauen, das Mädchen vom Minipreis und - ja, ein Pud grauen Pulvers. Aber sie kriegt nur einen Gutschein für den Friedrichstadt-Palast, ein Unter-der-Laterne-Stehen, ein angelegentliches Erblicken von Sternschnuppen und ein Bier bei Bella. Sie gibt sich damit nicht zufrieden, sie verachtet solche Kinkerlitzchen, sie will die spannenden Verwicklungen und die unmöglichen Komplikationen, wenn schon nicht als Hauptdarsteller, dann doch als akkreditierter Beobachter.
Ach, hätte ich das graue Pulver auf der Hand, was für Einsichten könnt ich daraus kochen! Ja, lach, du nur, du frischgebackener Opel-Fahrer aus Finsterwalde, du bist von derselben Sucht nach Bedeutung und großer Form geplagt wie ich, und wenn du es abstreitest, dann nur, weil du betrunken bist und also deine Wünsche für erfüllt hältst.
Da beginnt die Turmstraße. Da blinkt die Stammkneipe.
☆
Das »Bella Ciao« ist ein altes Wirtshaus mit getäfelten Wänden und einer unter dunkelbrauner Ölfarbe schwitzenden Decke, aus deren Mitte ein gewaltiger Kronleuchter seine Arme segnend über die Gemeinde breitet. Die Glühbirnen in dieser Lampe gehören zu den schwächsten, vielleicht auch sind es die senffarbenen Pergament-Schirmchen, die jede Helligkeit zurückhalten. Bei »Bella« sind immer alle Lampen an, und trotzdem ist es schummrig. Das sichert dem Ort die Ausstrahlung familiärer Wohnlichkeit, ohne ihm das obligatorische Halbdunkel einer Gaststätte älteren Typs zu missgönnen.
Bei allen Stammgästen schlicht als »Bella« bekannt, wird diese Kneipe nicht, wie man spontan vermutet, von einer Wirtin gleichen Namens geführt, sondern von einem Herrn, genauer gesagt einem Amerikaner Anfang 50, der einst an der FU Theologie studierte und sich dann eines besseren besann: Isaac. Wir alle, die wir die Nächte bei »Bella« beschließen, sind seine Kinder, und er tut für uns mehr, als dass er nur anschreibt. Ich selbst bin - auf dem Papier - fünf Jahre bei ihm Kellner gewesen, ohne dass ich je einen Zapfhahn in der Faust gehabt hätte. Aber ich beziehe legal Arbeitslosengeld und muss - denn für Übersetzer gibt es sowieso null Stellen - dann und wann begründen, warum ich einen Job im Hotel- und Gaststättengewerbe nicht antreten kann.
Ach, Isaac, dein grauer Bart und deine gelben Ziegenaugen sind es: eigentlich, warum ich immer wiederkomme, gar nicht so sehr das Bier. Obwohl es ausgezeichnet ist. Isaac zapft es selbst und lächelt, wenn ein Gast ungeduldig wird, mit seinem linken Mundwinkel in ein Grübchen hinein. »Siebeneinhalb Minuten braucht ein gutgezapftes Pils«, sagt er mit pfleglich bewahrten Resten eines US-Akzentes. Heute herrscht Hochbetrieb. Johanna, die Schankhilfe, ist rot im Gesicht und stimmungsmäßig kurz vor’m Umkippen ins Kurzangebundene. Aber meine Freunde sind alle da und ziemlich munter. Juni hat sich Schorschi Köhler geschnappt, einen bärtigen Typen, der eigentlich nicht zu unserem Stammtisch gehört, aber gern mal mitmischt. Gerade lernt Schorschi, dass Berlin die Stadt der Katakomben ist, ein märkisches Rom sozusagen, denn die Stasi hat Geheimgänge unter der Mauer durchgebuddelt, mannshohe Tunnel mit verputzten Wänden, um ihre Agenten hindurchzuschleusen und vor allem dort die Preziosen vor dem Klassenfeind in Sicherheit zu bringen.
»Was für Preziosen?« fragt Schorschi und drückt sich die Schaumbläschen in seinen Bart.
»Gemälde!« intoniert Juni mit Gusto.
»Echter Barock, aus enteigneten Landsitzen abgeschleppt, tiefgelagert und dann von Zeit zu Zeit zur Aufbesserung der Parteikasse in den internationalen Kunsthandel geschmuggelt. Was glaubt ihr: Haben die ’89 Ruhe gehabt, alle Wertstücke zu bergen? Die einzigen, die Genaues wussten, sitzen jetzt im Knast! Lageplan und Spitzhacke hab ick schon besorgt. Was noch fehlt, is’n Bergmannshelm mit ’ner Latüchte vorne dran. Wer von euch kann so was auftreiben? - Hallo Igor, Leute, einen Stuhl für Igor, komm, rutsch zwischen.« - Und er winkt kollegial mit seiner verbundenen Hand. Als ich Platz nehme, knurrt er kaum hörbar:
»Kein Wort über Niederschönhausen.«
Juni hat seine Kumpels dabei, Schwager Mecki, auf dessen Namen die Kfz-Werkstatt läuft und seinen Neffen Chagdas. Die beiden sind gerade mitten in der Rekonstruktion eines Fußballspiels, Hertha BSC gegen VfB Leipzig, zweite Halbzeit, und schenken nun mir ihre glänzenden Blicke. Wie wunderbar, wenn man erwartungsvoll willkommen geheißen wird. Ich glaube fast, es gibt nichts Schöneres nach der Umstellung der Uhren auf die Winterzeit.
Mit am Tisch sitzen Malte Fuchs, Pächter eines Kopierladens, der seit kurzem nach Pankow expandiert und Detlev, genannt Wenzel, angestellt bei der KWP-Versicherung, aber sonst ein sympathischer Typ. Malte erklärt Wenzel seinen neuen Xerox 5090 Hochleistungsdruckkopierer; der erstellt zwo Kopien pro Sekunde und verarbeitet die Bögen im On-Line-Verfahren zu gehefteten Sätzen. Per Vakuum. Ja, so’n Gerät macht seinen Weg auf dem Markt, ist aber leider störanfällig.
»Für Pankow soll es der Bubble-Jet sein.« Malte zündet sich einen Zigarillo an. »Im Osten muss man gleich richtig einsteigen. Die Leutchen durften doch ’n halbes Jahrhundert nicht mal Visitenkarten drucken. Jetzt geht’s los, jeder kopiert da sein Ego in Farbe, und zwar mit dem digitalen Blasen-Tintenstrahlsystem in meinem Laden.«
Malte bestellt in Vorfreude auf seinen Pankower Reibach gleich noch ein Helles und trägt mir einen Job an: ob ich nicht Lust hätte, mich mit der Arbeit am Bubble-Jet anzufreunden?
»Farbumwandlung, Multibahnkopien, Spiegelbildtechnik, das hast du schnell raus.«
Ich kriege pro Bella-Abend mindestens einen Job angeboren, und ich weiß das zu schätzen. Ich nicke immer mit demselben Ernst, als wollte ich sagen: So eine existenzwendende Entscheidung will wohl überlegt sein.
Am liebsten möchte Malte in das Hardware-Geschäft einsteigen; in ihm stecke ein verhinderter Ingenieur, behauptet er, und gemeinsam mit Juni könne er eine neue Generation von Laser-Druckern entwickeln. Juni hat sich so ein Gerät von Malte ausgeliehen, hat’s bei sich zuhause in der Küche aufgestellt und arbeitet in seinen freien Stunden an der Verbesserung der Digitaltechnik.
Schorschi Köhler möchte viel lieber über das Fußballspiel mitdebattieren, und ob nun der Leipziger Stürmer eine Chance gehabt hätte oder nicht, aber Juni hat ihn am Kanthaken und dringt in ihn, er müsse doch jemand beim Tiefbauamt kennen, denn schließlich, der Köhler ist Rohrleger.
Als Mecki den Namen des umstrittenen Stürmers: »Olli Scharnweber«, einmal über die mittlere Lautstärke hinaus hervorstößt, merkt Malte auf, lässt vom digitalen Blas-System ab und sagt ruhig:
»Der ist stasibelastet.«
Alles stockt, als sei der Gott-sei-bei-uns durch die Tür getreten. Malte mag solche Momente verlegener Stille. In sie hinein lässt sich jede Dreistigkeit mit verdoppelter Wucht platzieren. Jetzt erklärt er:
»Ich werfe dem Jungen das nicht vor. Man muss die Spielregeln einhalten, überall, ob nun beim Fußball oder sonst wo. Und die Spielregeln hießen drüben: Haltet unsern Staat sauber. So war’s doch. ’N wohlerzogener Mensch sah das ein.«
Juni hat Angst, dass der Stammtisch auf ein politisches Thema überspringt und fuchtelt lautstark zu Johanna hin, damit sie ihm noch’n Futschi bringt. Dann sagt er:
»Scheiße. Ich glaub, ich hab mir in der Sauna ’n Fußpilz eingefangen.«
Aber so lässt sich Malte nicht stoppen:
»Die Spitzelei war nicht nur die Regel«, hebt er wieder an, »sie war das Spiel selbst. Ich sage euch, denen fehlt jetzt was da drüben. Die hatten doch ihren Krimi täglich frei Haus. Unsereiner muss sich schon ins Freie trauen, um ’n bisschen Spannung ins Leben reinzukriegen, die drüben, die brauchten bloß das Fenster aufzumachen und raus zurufen: ›Scheiß Staat‹ und schon ging ’n klasse Thriller los mit ihnen selbst als Helden. Da drüben bricht der große Frust jetzt aus, weil alles vorbei ist, weil denen der Schwung im Leben fehlt, das tägliche Theater. Arbeitslosigkeit ist doch nicht der Punkt, wer will schon arbeiten gehen, und verhungern tut keener. Denen fehlt die Stasi drüben, is doch sonnenklar. Wat sagst du dazu, Igor, du kennst doch den Laden von innen. Hab ich nicht recht?«
Ich sag dazu, dass meine siebeneinhalb Minuten rum sind und Johanna mein Pils nun mal könnte rüberwachsen lassen.
»Wer war Otto Nuschke?« fragt Juni. Er leckt sein Futschi-Glas aus. »Weiß das einer?«
»Die andere Hälfte der Bevölkerung«, fährt Malte fort, »die Jäger des verlorenen Schatzes, die Schnüffler-, Schleicher- und Arschkriechertypen, die sind erst recht betuppt, klarer Fall. Die ham ja nun niemand mehr, in dessen Müll sie wühlen können und niemand, der ihnen auf die Schulter klopft und ihnen ’n Orden an die Kappe klebt. Na, wenn das keen Verlust ist, wenn das keen Zusammenbruch von Lebensperspektiven ist! Mein Vorschlag zur Güte: man macht die ›Firma‹ wieder auf, mit allem Drum und Dran in der Normannenstraße, und auf Los geht’s los, meine Damen und Herren, wer will noch mal, wer hat noch nicht ’ne Wanze in sein’ Klo.«
»Und was soll nu ausgespitzelt werden«, fragt Wenzel, »wo der Klassenfeind rehabilitiert ist?«
»Is doch piepegal«, versetzt Malte, »war doch vorher auch egal. Oder glaubst du, das hat im Ernst jemand interessiert, wat so’n Ingenieur von Bergmann Borsig oder so’n Elektriker aus Babelsberg abends im Bett für’n Westbuch liest? Es war völlig egal, aber es wurde ausspioniert und aufgeschrieben und abgeheftet und mit’m Top-Secret-Stempel versehen, damit die Leute ’ne Spannung im Leben hatten, damit überhaupt was los war und sie nich alle miteinander vor Langeweile abgekratzt sind.«
»Wer war … hab ich … Ottmahlske … woBonz … Futschlett..«
Das sind Juni und Schorschi, die zur gleichen Zeit reden, einer immer aufgeregter als der andre, und es kostet sie ordentlich Mühe, ihre Stimmen auseinanderzuzurren und die Reihenfolge zu klären. Juni darf zuerst:
»Wer war Otto Nuschke?« fragt er. »Und wo bleibt mein. Futschi?«
Dann kommt Köhler:
»Hab ich doch kürzlich in Mahlsdorf ’ne Villa saniert und dabei ’n eingesargtes Skelett im Garten gefunden.«
»Is nich wahr!« Alle sind platt.
»Stellte sich raus«, - Köhler kichert und vergisst, die Schaumbläschen in seinen Bart zu drücken, sodass sie jetzt auf dem Gestrüpp wie Pusteblumen sitzen bleiben.
»Stellte sich raus, dass der angrenzende Friedhof irgendwie durch 'ne Erdverschiebung in das Grundstück des Kunden rübergerutscht war …«
Johanna kommt mit neuem Stoff und horcht offenen Mundes auf das Schauerstück.
»Mir egal«, brummt Chagdas, »ob der Scharnweber Dreck am Stecken hat. Er is nun mal der einzige Spielführer, der sich auch im Westen behaupten könnte.«
»Im Westen niemals«, fährt Mecki dazwischen, »dafür fehlt’s denen drüben am sechsten Sinn für Taktik.«
»Wer war Otto Nuschke?« ruft Juni. »Igor, du musst das doch wissen, sag mal ’n Ton.«
»Wozu willst du wissen, wer Otto Nuschke war?« fragt Wenzel, der Versicherungstyp, der leider plant, nach Köln umzuziehen.
»Wegen der Otto-Nuschke-Straße: die wird jetzt umbenannt. Und ich muss wissen, ob es sich lohnt, das alte Schild zu kassieren.«
»Wozu?«
»Um Kasse zu machen, du Dämlack, denn diese Schilder haben einen marktgängigen Symbolwert.«
»Mit sowas handelst du?« fragt Schorschi, nicht ohne einen Unterton der Verachtung für Junis Müllwelt.
»Man muss die Arbeitsplätze, die der Osten ehrlich schafft, besetzen«, gluckst Juni. »Die Mauer ist in Stücken ein Vermögen wert.« Er selbst hat zwei Blöcke nach München verkauft und eine Ladung mit Brocken nach Istanbul.
»Arbeitsplätze sind ’ne feine Sache«, fängt Malte wieder an, »aber die Arbeit muss auch Spaß machen, Geld alleine reicht nicht zum Leben. Was ist spaßig an der Maloche, wo du die Überstunden nicht bezahlt kriegst und wo ständig Feierschichten geschoben werden, weil niemand echt zuständig ist, denn der Betrieb gehört dem Staat? Um diese Öde ein bisschen bunter zu gestalten, hamse die Stasi erfunden gehabt, und die hat dafür gesorgt, dass die Zeit schneller vergeht und ein großangelegtes Versteck- und Fangenspiel sozusagen breitensportmäßig die ganze Belegschaft der DDR erfasst hat.«
»Wer war Otto Nuschke?« lallt Juni, sichtlich benusselt. Und ich, der ich’s gern höre, wenn Juni diese Frage stellt, aber auch stolz darauf bin, seine Neugier stillen zu können, ich packe nun mein Wissen aus:
»Ein Blockflötenmann der ersten Stunde. Von der CDU.«
»Stasi-belastet?«
»Was spielt das für ’ne Rolle?«
»’Ne Riesenrolle. Ich krieg das Doppelte für sein Straßenschild, wenn er ein Schurke war.«
»Also, diese Aasgeierei«, sagt Schorschi angewidert, »die find ich tragisch.«
»Nicht, mit mir«, murmelt Chagdas, aber keiner versteht, was er damjt meint.
»Was Neues schaffen«, fährt Schorschi, zu Juni gewendet, fort, »fällt jemand wie dir nicht ein. Immer nur alte Schüsseln aufpolieren, das würde mir auf Dauer nicht reichen als … als Perspektive. Und nun noch in die Abfalltonnen greifen.«
»Das siehst du ganzfalsch.« Juni fängt an, heftig mit dem Stuhl zu kippeln. »Neues Schaffen ist völlig abgesagt. Es gibt nämlich schon zu viel Neues auf der Welt. Zu viele Autos, zu viele neue Straßen samt Schildern und zu viele Schorschi Köhlers. Recycling ist das Gebot der Stunde.«
»Und wann recyceln die Türken mal wieder in ihre Heimat«, knirscht Schorschi, »und machen wieder Platz für unsereins?«
Das ist die Stunde des Wirts. Isaacs Stärke liegt in seiner amerikanischen Autorität, die da heißt: Leibesfülle und Sinn für Fairness. Er nimmt alle mit gewissen Obertönen ausgesprochenen Sätze in den Winkeln von »Bella« wahr und wirft sich ins Mittel, vom Tresen her. Er tut das immer mit Maß und mit einem Geschirrtuch in der Faust. Aus seinen Augen blitzt der Triumph des Dompteurs:
»Grrroße Worte nach 23 Uhr sind genehmigungspflichtig, werrter Herr«, sagt er.
Wunderbarerweise durchdringt seine warme Stimme den Kneipenlärm. Juni erstickt seine Wut in einem Kicheranfall und quietscht mir zur Freude:
»Wer war bloß Otto Nuschke … wer war bloß dieses blöde Otto-Nuschke-Schwein?«
Schorschi widmet sich seinem Bier. Damit keiner sieht, wie verzogen seine Mundwinkel sind und wie schwer es ihm fällt, sie wieder auf normal zu stellen, versenkt er die Lippen im Schaum. Eine Weile spricht niemand. Nicht mal Malte sagt was, aber er grinst. Da geht, mitten in das Schweigen der Runde hinein, die Kneipentüre sachte auf und, vom bellatypischen Halbdunkel und von den Rauchschwaden anfangs verhüllt, darin zu uns rüberwinkend, nickend und so doch erkennbar, tritt eine Gestalt ein, die niemand anders ist als unser aller Freund Veit, der gute, dem Krankenbett entronnen und der Versammlung. Mit seinem Schal um den Hals kommt er näher, Lachen, Krakeelen und Poltern auslösend, als man einen Stuhl sucht und den späten Gast angemessen begrüßt. Nun sind alle beisammen.
»Ich hab das Rumliegen nicht mehr ausgehalten«, sagt Veit, »hab mir gedacht: am besten hilft doch ein Cognac.« Er ruft Johanna seine Wünsche zu.
»Hier, wer Angst hat vor Ansteckung, soll sich das Zeug unter die Zunge träufeln.«
Jetzt stürzt sich Malte, angefeuert durch das Erscheinen Veits, dieses Parteigängers der Deutschen Demokratischen Republik, mit erneuerter Streitlust in seine Stasi-Tirade, aber er blitzt ab. Veit muss sich erst mal über das Wetter, die Viren und das Finanzamt auslassen und reibt sich ausgiebig die Hände. Juni mag sowieso nicht politisieren; er zieht Chagdas und mich in ein Palaver über Terrier und Miniröcke, und es bleibt für Malte nur Wenzel übrig, von dem er aber nicht ernstgenommen wird. Zumal Mecki mit Schorschi über die Promillegrenze zu streiten anfängt.
»He, Genosse«, stichelt Malte, der noch nicht aufgibt, in Veits Richtung, »warste auch’n Inoffizieller? Haste in der Normannenstraße Bescheid gesagt, wenn Isaac Junis Köter in die Küche gelassen hat zum Restefressen?«
»Ach leck mich«, knurrt Veit. Er führt aus, dass es vor allem die Asozialen, die Kriminellen und die Faulpelze gewesen seien, die sich gegen den Staat gestellt hätten und deshalb überwacht werden mussten, und das sei überall in der Welt so. Und dass er, Malte, bloß nicht so tun solle, als seien alle, die von der Stasi beschattet worden wären, selbstlose Freiheitskämpfer und verhinderte Reformer gewesen. Solche Leute gebe es erfahrungsgemäß in einer Bevölkerung höchstens zu zwei Prozent.
»Die sogenannten Opfer«, sagt Veit mit brechendem Organ, »haben genauso ’n Interesse daran, ihre Akten verschwinden zu lassen wie die sogenannten Täter. Leck mich am Arsch.«
Aber Malte hat keine Lust, sich zu wehren, jetzt, wo nicht mehr er es ist, der im Mittelpunkt steht. Er winkt Johanna zu, weil er zahlen will. Danach träufelt er sich schön langsam die Immuntropfen unter die Zunge und schielt dabei zu Johanna rüber, ob sie wohl Interesse an seinem geöffneten Mund zeigt. Wenzel legt mir seine Hand auf den Kopf und sagt vertraulich: »Warum biste rüber damals, hattste öffentlich zur Unzucht aufgerufen?«
Alle wissen hier, warum ich rüber bin, ich habe es mehrfach erklärt. Aber ich erzähle es gerne noch mal, wenn die Mitternacht eingerückt ist.
»Ich bin rüber, weil das Mädchen, in das ich verliebt war, mich hat sitzen lassen. Zudem war mein Opa verstorben.«
»Is nich wahr«, flüstert Juni und bettet seinen Kopf an Chagdas’ Schulter. Er schließt langsam seine Augen, ich sehe an seinem Gesichtsausdruck, dass er an Kurt denken muss. Es ist Zeit aufzubrechen. Malte lehnt am Tresen und spricht mit Isaac über die Polizeistunde. Das ist die große Sorge der Berliner Gastwirte, dass jetzt, wo die Stadt sich normalisiert und mit der Mauer die importierten Straßennamen, die Stasi und die Besatzungssoldaten verschwinden, dass jetzt womöglich eine Sperrstunde eingeführt wird.
»Und wenn, dann interpretieren wir sie in unserm Sinn«, schmunzelt Isaac. »Wir sagen den Bullen: Polizeistunde ist, wenn wir auf euer Wouhl anstoußen.«
»He Igor«, ruft Juni und wischt sich eine Träne aus rotem Auge. - »Wenzel hier besorgt mir ’n neuen Hund. Was meinste: nenne ich ihn Otto oder Nuschke?«
Die Mehrzahl am Tisch ist für Nuschke. Malte schlägt noch »Vöfreu« vor, als Abkürzung von »Völkerfreundschaft«. Das ist uns denn doch zu weit hergeholt.