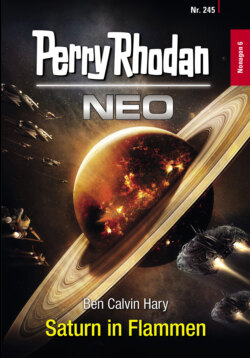Читать книгу Perry Rhodan Neo 245: Saturn in Flammen - Ben Calvin Hary - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2.
Ronald Tekener
Ausgerechnet zwei Asse!
Eigentlich war es ein zu gutes Blatt, um die Partie zu schmeißen. Aber Ronald Tekener spielte nicht, um zu gewinnen. Meist spielte er, um zu überleben – diesmal jedoch, um seine Schwester zu retten.
Tekener legte die beiden Spielkarten verdeckt vor sich ab. »Sie sind am Zug.« Noch galt es, den Schein zu wahren. Hätte er bluffen müssen, wäre es ihm dennoch leichtgefallen. Das Spiel selbst interessierte ihn nicht. Es war nur ein Zeitvertreib, während er das Personal belauschte und nach Spuren suchte.
Ihm gegenüber, hinter einem Holztisch in biederem Nussbaumfurnier, saß ein Mann mit schütterem Haar und blutunterlaufenen Augen. Eine Nadel steckte in seinem Handgelenk. Daran angeschlossen war ein Schlauch, der sich an einem mannshohen Metallständer emporschlängelte. Tropfen einer klaren Flüssigkeit sickerten aus einem Beutel an der Spitze des Ständers. Der Mann trug einen hellblauen Kittel – dieselbe Kleidung wie Tekener.
»Zwanzig.« Der alte Mann legte sein Blatt ebenfalls ab und fasste in einen Stapel bunter Plastikscheiben. Er warf sie in die Mitte des Tischs, wo sie mit sprödem Klacken liegen blieben. Der Schein einer Kunstsonne fiel durch ein großzügiges Oberlicht, verfing sich in seinem Haarkranz.
Hinter dem Glassit war das Ringsystem des Saturn zu sehen, ein weiter Bogen aus Eis und Geröll. Davor zog ein Ring aus acht Projektorstationen seine Bahn: der Situationstransmitter, Ausgangspunkt der »Straße der Container« zwischen dem Solsystem und dem Planeten Olymp. Fahle Leuchteffekte verrieten, dass der Durchgang aktiv war. Gegen das Kunstlicht waren sie nur schwach erkennbar.
Tekener hatte keinen Sinn für das Schauspiel am Himmel. Unauffällig schirmte er die Augen vor der Helligkeit ab, linste seinem Mitspieler über die Schulter und behielt den Raum im Blick. Nichtssagende Aquarellholos hingen an lindgrünen Wänden. Durch die offen stehende Tür konnte er den Gang überblicken. Draußen huschte eine Gruppe Pfleger mit tragbaren Analysegeräten und piependen Diagnostikmonitoren umher.
Jessica. Wo steckst du? Tekener hielt seine Finger im Zaum, um nicht auf dem Tisch zu trommeln. Er atmete durch, roch sterile Luft. Beinahe vermisste er den Gestank von Zigarren und Alkohol. Aber man konnte nicht alles haben. Dies war der Aufenthaltsraum eines Krankenhauses. Und er durfte eigentlich gar nicht da sein.
Es war der 29. Mai 2090. Ronald Tekener hielt sich im Solsystem auf. Genauer, in einer Spezialklinik des medizinischen Forschungszentrums MIMERC auf dem Saturnmond Mimas. Dort war seine Schwester nach ihrer Befreiung aus der Hand Iratio Hondros untergebracht worden. Zu Untersuchungszwecken, wie es geheißen hatte, und um Spätfolgen der Beeinflussung auszuschließen. Die Ärzte ließen niemanden zu ihr. Wachleute und Sicherheitspersonal schirmten sie ab. Tekener versuchte seit Tagen, sie zu besuchen, wurde aber stets mit Ausflüchten abgespeist. Er machte sich Sorgen.
Auffordernd nickte ihm der Glatzkopf zu. »Spielen Sie!«
Tekener grinste. Er nahm zwei Münzen vom Stapel und schob sie neben den Einsatz des Alten.
»Hm.« Der Mann hob den Rand seiner Karte und spähte darunter, als hätte er ihren Wert bereits vergessen. Er kratzte sich am Kopf.
Gegen Ende der Partie – Tekener wollte schon abbrechen und sich etwas Neues überlegen – tat sich endlich eine Spur auf. Zwei Ärztinnen gingen über ein medizinisches Positronikpad gebeugt durch den Gang und unterhielten sich. Gesprächsfetzen wehten ins Aufenthaltszimmer: »Derartige Auffälligkeiten habe ich noch nie gesehen. Es ist ein vollkommen neues neurologisches Phänomen.«
»Sie ähneln den Tics, die wir von Tourettepatienten kennen. Ich sehe ein komplett neues Forschungsfeld vor mir.«
»Tics, ausgelöst durch geistige Beeinflussung? Spannend, ein Präzedenzfall. Da sind noch weitere Untersuchungen nötig.«
Der Glatzköpfige saß mit dem Rücken zur Tür. Als die Stimmen ertönten, raffte er hastig die Karten und den Wetteinsatz zusammen und beugte sich darüber, um den Tisch vor möglichen Blicken zu verbergen. Der Schlauch verhedderte sich an seiner Stuhllehne.
»Ihnen ist klar, dass die Pfleger das Spiel konfiszieren, wenn sie mitbekommen, dass wir um echtes Geld spielen?«, flüsterte der Mann.
»Natürlich.« Tekener lauschte. Es wäre ihm sogar lieb gewesen, wenn die Ärztinnen hereingekommen und das Spiel unterbrochen hätten. Dann hätte er sich ihre Gesichter merken und ihnen durch das Gebäude folgen können. Doch ihre Schritte entfernten sich bereits. Die Stimmen verhallten auf dem Gang.
Seine Gedanken rasten. Geistige Beeinflussung? Alles in ihm drängte danach, aufzuspringen und die beiden zu verfolgen. Das war der Hinweis, auf den er gewartet hatte, weswegen er sich überhaupt in die Klinik geschlichen und unter die Patienten gemischt hatte.
Lange war ihm die Vorsicht des Personals verständlich gewesen. Der ehemalige Obmann von Plophos hatte Jessica Tekener geistig versklavt und für seine Zwecke eingesetzt. Sie stellte eine potenzielle Gefahr dar. Ronald Tekener wusste aus eigener Erfahrung, wie es sich anfühlte, Hondros Marionette zu sein. Dass man sich dabei vorkam wie ein Fahrer hinter den Kontrollen eines selbststeuernden Gleiters. Man saß am Instrumentenpult, glaubte, jederzeit eingreifen und umkehren zu können, doch den Kurs bestimmte ein anderer. Er wünschte das niemandem. Schon gar nicht seiner Schwester.
Nun aber war sie von Hondros Einfluss befreit. Was also hielt die Ärzte davon ab, sie zu entlassen? Etwas stimmte nicht, und Tekener war entschlossen, der Sache nachzugehen.
Vorsichtig hob der Alte den Oberkörper, schob Karten und Spieleinsätze wieder an ihren Platz. »Sie sind dran.« Er erhöhte um zwanzig. Seine Chips kullerten über den Tisch.
»Natürlich.« Widerwillig riss sich Tekener aus der Konzentration und ging mit. Es hatte ihn kaum Mühe gekostet, sich unter falschem Namen als Besucher anzumelden, ebenso wenig, das Pokerset nach Mimas und ins Gebäude zu schmuggeln. Die Spezialklinik war keine Hochsicherheitseinrichtung. Auch einen Mitspieler zu finden war einfach gewesen. Die Patienten des MIMERC waren ernste, oft hoffnungslose Fälle, die sich über jede Ablenkung freuten.
Nun aber hielt ihn sein Gegenüber auf. Tekener lauschte nach den Stimmen der beiden Ärztinnen, doch selbst wenn sie noch zu hören gewesen wären, hätte das Gemurmel von Kranken und Pflegern ihre Worte übertönt. Hatte er die Gelegenheit verpasst?
Ein komplett neues Forschungsfeld, echote es hinter seiner Stirn. War das der Grund, warum sie Jessica weiterhin festhielten? War sie ein Versuchskaninchen? Von Tics als Folgen von Hondros Beeinflussung wusste er nichts; wäre ihm selbst nach seiner Befreiung Derartiges widerfahren, hätte er es bemerkt. Seine Sorge wuchs.
»Ich will sehen!« Erneut kullerten Chips über den Tisch. Der Patient warf seine Karten daneben, diesmal offen: zwei Könige.
Es war ein gutes Blatt, aber nicht gut genug gegen Tekeners Asse. In jedem ernsthaften Spiel hätte er sich diebisch gefreut. Stattdessen warf er scheinbar frustriert seine eigenen Karten auf den Stapel in der Mitte des Tischs und schob dem Alten den Gewinn zu. »Behalten Sie's!«
»Aber ...«
Tekener ignorierte das verdutzte Gesicht des Alten. Er stand auf, richtete seinen Patientenkittel, den er aus einem Behälter für schmutzige Wäsche gestohlen hatte, und beeilte sich, den Aufenthaltsraum zu verlassen.
Die Spezialklinik war innen wie außen ein eintöniger Bau. Grauer Kunststoffbelag bedeckte die Böden der Korridore. Grün lackierte Wände streckten sich gleichförmig ins Gebäude. Raumnummern huschten an Tekener vorbei, während er vordrang. 272.1., 272.2., 273.1 ... und so weiter. Sie boten keine Orientierungshilfe. Wer auch immer diesen Teil des MIMERC entworfen hatte, war offenbar mit dem Ziel vorgegangen, seine Besucher architektonisch zu Tode zu langweilen.
Tekener schob sich an einer alten Patientin vorbei, an deren Oberarm ein spinnenförmiges Dialyseimplantat beunruhigende Brummtöne von sich gab, und machte einen Bogen um eine Gruppe junger Assistenzärzte.
»Hey, hier wird nicht gerannt!«, rief ihm einer von ihnen hinterher.
Tekener hastete dorthin, wo die beiden Ärztinnen verschwunden waren.
Hinter einer Ecke stieß er auf eine zweiflügelige Schwingtür, die den Gang nach etwa zehn Metern abschloss. Soeben hielt ein Mann in Zivilkleidung eine Schlüsselkarte gegen einen Sensor über dem Schloss. Die Tür öffnete sich, und der Mann eilte hindurch. Tekener erblickte einen Schopf brauner, gegelter Haare, bevor die Flügel behäbig in ihre Ausgangsposition zurückschwangen.
Tekener handelte, ohne zu überlegen. Waren die beiden Ärztinnen hinter dieser Pforte verschwunden? Zwischen dem Warteraum und der Schwingtür gab es keine Abzweigung. Wenn sie tatsächlich über seine Schwester gesprochen hatten und Jessica das Opfer seltsamer Experimente wurde, spielten sie sich da drinnen ab. Warum sonst sollte der Bereich abgesperrt sein?
Tekener eilte dem Braunhaarigen hinterher und erreichte die Türflügel, kurz bevor sie einrasteten. Hastig schlüpfte er durch den verbliebenen Spalt.
Hinter ihm klickte es, als die Sperre sich endgültig schloss. Prüfend rüttelte er am Griff, doch der regte sich nicht. Er war eingesperrt. Ohne eine Schlüsselkarte, wie der Braunhaarige sie besaß, würde Tekener nicht mehr nach draußen gelangen.
Auch gut. Wo ist der Spaß, wenn Fluchtmöglichkeiten offenstehen? Er sah sich um.
Nach der Tür schloss sich ein weiterer gleichförmiger Gang an; derselbe lindgrüne Lack klebte an den Wänden, derselbe neutralgraue Untergrund streckte sich wie eine Zunge aus gewalztem Kunststoff vor ihm aus.
Der Braunhaarige verschwand gerade hinter einer Biegung am Ende des Korridors. Von fern glaubte Tekener, Frauenstimmen zu vernehmen. Waren es die beiden Ärztinnen? Sprachen sie noch immer über Jessica? Er würde es herausfinden! Leise folgte er dem Mann.
Hinter der Biegung prallte er mit einer massigen Frau zusammen.
»Wer sind Sie? Patienten haben hier drin nichts verloren!« Die Frau stellte sich breitbeinig in den Gang und verschränkte die Arme. Sie trug eine dunkelblaue Uniform, die sie als Angehörige des MIMERC-Sicherheitsdienstes auswies. Ein Kommunikationsgerät hing an einer Schlaufe vor ihrer Brust. Darunter prangte ein Aufnäher mit einem osteuropäisch klingenden Namen: »Nowak«.
»Patienten?« Tekener blickte an sich hinab. Beinahe hatte er vergessen, dass er einen entsprechenden Kittel trug. Wieder grinste er. »Ich verrat's keinem, wenn Sie auch den Mund halten. Darf ich vorbei?«
»Wie ich sehe, habe ich es mit einem Witzbold zu tun.« Die Frau legte die Hand auf ein Holster, das von einem Ledergürtel an ihrer Hüfte hing. Darin zeichnete sich ein klobiger Umriss ab. Tekener tippte auf einen Paralysator, den sie als Ausrüstung mit sich führte. »Versuchen Sie, Ärger zu machen?« Ihr Tonfall war lauernd.
»Nichts liegt mir ferner«, log Tekener. Er hob beide Arme, wie um sich zu ergeben. Dabei suchte er den Gang ab. Tür reihte sich an Tür, doch sie waren mit Sensorschlössern versehen und würden sich wahrscheinlich nur mit dem richtigen Fingerabdruck oder einer Karte öffnen. Ein kastenförmiger Schwebecontainer, zur Hälfte mit benutzten Bettlaken gefüllt, stellte die einzige Deckung dar.
Die Frau legte den Kopf schräg. Sie schien zu überlegen. Plötzlich erhellte sich ihr Gesicht.
»Ich kenne Sie!« Unvermittelt zog sie den Paralysator. »Sie sind Ronald Tekener, der Bruder von Patientin sieben! Meine Abteilung wurde über Sie informiert. Ich muss Sie auffordern, das Gebäude zu verlassen.«
Zwei Informationen steckten in diesen Worten. Tekener wusste nicht, welche davon ihn mehr beunruhigte; dass die Ärzte um Jessicas Zustand offenbar so viel Aufhebens machten, dass sie ihr einen eigenen Codenamen verliehen hatten – oder dass das Sicherheitspersonal vor ihm gewarnt worden war. Irgendwas wurde da gespielt, und das missfiel ihm.
Er überlegte nicht. Mit einer blitzschnellen Bewegung holte er aus und schmetterte der Sicherheitsfrau die Faust gegen den Unterarm.
Die betätigte den Auslöser, bevor die Wucht von Tekeners Schlag ihr die Waffe aus der Hand fegte. Der Schuss traf ihn ins Knie, dann schepperte der Paralysator gegen die Wand.
Tekener schrie auf. Sein Kniegelenk wurde taub und gab nach. Er stürzte zu Boden. Schmerzhaft prallte er mit dem Kinn auf den Kunststoffbelag. Kreise tanzten vor seinen Augen.
Die Frau bückte sich gelassen nach ihrem Paralysator, gleichzeitig zog sie das Komgerät von ihrer Brust.
Tekener gönnte sich keine Gelegenheit, die Qual zu überwinden. Er wirbelte herum, so gut die Lähmung es ihm gestattete. Mit dem unversehrten Bein trat er der Frau gegen den Knöchel, sodass sie taumelte.
Das Komgerät fiel ihr aus der Hand. »Hey!«
Schon streckte er sich nach dem Paralysator, der vor eine der vielen Türen gefallen war. Er berührte ihn mit den Fingerspitzen. Die Waffe lag um Millimeter außerhalb seiner Griffweite. Als er vorankroch, machte seine Gegnerin einen Ausfallschritt und stellte ihm den Fuß in den Rücken. Ihr Gewicht drückte ihn nieder. Scheinbar tonnenschwer presste sie ihm die Luft aus den Lungen.
Die Sicherheitsangestellte packte ihn am Kragen und rammte ihm den Ellbogen zwischen die Schulterblätter. Dumpfer Schmerz breitete sich in Tekeners Oberkörper aus, überlagerte einen Augenblick lang jedes Empfinden. Er rang nach Atem, versuchte, sich aus dem Griff der Frau zu befreien. Sie war stärker als er. Kaum verwunderlich, wenn man ihren Beruf bedachte. Tekener betete, dass niemand auf den Gang kam und ihr auch noch zu Hilfe eilte.
Das Kommunikationsgerät knackste.
Sekundenlang hielten sie inne, starrten zum Kom, das vor dem Wäschebehälter liegen geblieben war. War es aktiv? Hörte jemand mit?
Die Sicherheitsangestellte ächzte. Überraschend ließ sie Tekener los und hastete zum Container, um das Gerät aufzuheben.
Innerlich triumphierte Tekener. Ihre Entscheidung, wohl im Affekt getroffen, war die falsche. Im selben Moment drückte er sich mit dem gesunden Fuß ab und schob sich den Gang entlang. Zehn Zentimeter nur, aber es genügte, um den Paralysator zu fassen.
Die Frau hob das Komgerät auf. »Nowak hier. Ich habe einen Code neun ...«
»Fallen lassen!« Tekener hob den Lähmstrahler. Er wollte nicht feuern. Die Frau machte nur ihre Arbeit. Es war nicht ihre Schuld, dass das mit seinen Plänen kollidierte.
Ihre Blicke trafen sich. Ein Feuerwerk aus Emotionen huschte über das Gesicht der Frau: Enttäuschung, Wut, Hass – und die Erkenntnis, dass sie einen Fehler begangen hatte. Das Gerät in ihrer Hand zitterte.
Tekener drückte ab. Das Risiko, sie bei Bewusstsein zu lassen, war zu groß.
Betäubt sank seine Gegnerin in sich zusammen, ohne ihren Funkspruch zu beenden. Das Komgerät polterte neben ihr auf den grauen Bodenbelag.
Tekener gönnte sich einen Augenblick, um zu Atem zu kommen. Dann rappelte er sich auf und hüpfte einbeinig zu der Bewusstlosen. Das gelähmte Bein zog er hinter sich her. Zwar hatte ihn der Schuss nur gestreift, doch das Knie und der Unterschenkel waren trotzdem nicht zu gebrauchen. Er hoffte, dass die Paralyse innerhalb der nächsten Stunde abebben würde.
Das Komgerät war noch aktiviert, als er es aufhob. Jemand auf der Gegenseite mochte das Gerangel gehört haben. Verstärkung war vermutlich schon unterwegs. Tekener musste sich beeilen, wenn er Jessica finden wollte. Er schaltete die Apparatur ab.
Dann kniete er sich neben die Bewusstlose, hielt sich dabei am Wäschebehälter fest, um das Gleichgewicht zu wahren. »Wohin mit dir?«
Er konnte die Frau unmöglich zurücklassen. Selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass niemand am Ende der Komverbindung gewesen war und den Kampf belauscht hatte – wenn jemand eine reglose Person in der Uniform des Sicherheitsdienstes fand, war ein Alarm nur eine Frage der Zeit.
Es war eine Sache, Jessica erst mal zu finden. Eine andere war, anschließend mit ihr ins Freie zu gelangen, und das würde unmöglich sein, wenn das MIMERC einem Wespennest glich. Von der Idee, dass er das Ganze ohne ein Husarenstück würde schaffen können, hatte er sich daher längst verabschiedet.
Die Bewusstlose in den Wäschecontainer zu verfrachten, kostete Ronald Tekener schier übermenschliche Anstrengung. Er verlor Zeit damit, Laken so auf ihr zu drapieren, dass ihr massiger Körper darunter nicht zu erahnen war. Sein Schuss hatte sie frontal in die Brust getroffen, die Paralyse würde also sicher zwei Stunden anhalten. Er bezweifelte aber, dass ihm überhaupt so viel Zeit blieb. Grimmig dachte er an das Komgerät.
Er hob noch einmal das Laken und benutzte es, um seine Fingerabdrücke vom Paralysator zu wischen. Dann schob er ihn zurück ins Holster der Bewusstlosen. Die Waffe mitzunehmen, schien ihm zu riskant. Wenn in den Wänden dieses Trakts entsprechende Sensoren verbaut waren – schon in »normalen« Kliniken auf Terra war dies mittlerweile üblich –, würden sie ihn damit anmessen und noch mehr Sicherheitsleute auf den Plan rufen. Sorgfältig schloss er die Klappe des Holsters.
Weiter unten im Gang ertönte ein leises Summen.
Tekener erschrak. Rasch schlug er das Laken erneut über sein »Opfer« und zog sich hinter den Container zurück. Dabei prallte sein taubes Knie gegen die Behälterwanne. Er dämpfte das Scheppern des Blechs mit den Händen und starrte in sein eigenes, verbissen grinsendes Gesicht, das ihm aus der spiegelnden Wandung entgegenstarrte. Hatte jemand den Knall gehört?
Gangabwärts öffnete sich eine Tür. Ein junger Mann in Ärztemontur kam heraus. Die Tür schwang automatisch hinter ihm zu. Tekener erkannte den Braunhaarigen wieder, dem er in diesen Bereich gefolgt war, und der eben noch in Zivil gewesen war.
Tekener beschloss, sein Glück zu versuchen. Der Raum musste eine Umkleide sein. Womöglich fand er darin eine geeignetere Tarnung als die Krankenkluft – schließlich hatten »Patienten hier drin nichts verloren«, und eine zweite Begegnung mit dem Sicherheitspersonal wollte er vermeiden. Stumm dankte er dem Himmel, dass der Braunhaarige offenbar weder den Kampflärm noch den Knall von Tekeners Knie gegen das Metall gehört hatte. Die Türen mussten schalldicht sein. Sonst wäre auch sicher jemand auf seinen Kampf mit der Sicherheitsfrau aufmerksam geworden.
Er wartete, bis der junge Arzt in einem Zimmer auf der gegenüberliegenden Gangseite verschwunden war. Dann zwang er sich auf die Beine und klammerte sich am Rand des Containers fest.
Der Behälter schwebte auf einem Antigravkissen. Tekener nutzte ihn als provisorischen Rollator, um sich zu der fraglichen Tür zu quälen. Er stöhnte. Schweiß trat auf seine Stirn. Es waren nur etwa zwölf Meter, schätzte er, doch der Weg kostete ihn Kraft. Er kam nur humpelnd voran.
Endlich erreichte er die Pforte. Der Biosensor, der neben dem Türrahmen angebracht war, bestand aus einer dunkelgrauen, berührungsempfindlichen Fläche. Den eigenen Daumen aufzulegen, wagte er nicht. Das hätte zweifellos Alarm ausgelöst.
Nach kurzem Grübeln hob er das Laken erneut und fasste nach dem Handgelenk der Bewusstlosen. »Würde es Ihnen etwas ausmachen, mir Zutritt zu gewähren? Vielen Dank.« Er zerrte den Container zum Sensor. Die Kiste glitt auf ihrem Antigravkissen näher.
Tekener nahm den Daumen der Frau, presste ihn gegen die Sensorfläche und hoffte, dass das Sicherheitspersonal zu sämtlichen Bereichen im MIMERC Zutritt hatte. Zumindest schätzte er das Risiko eines Alarms bei einem unbefugten Zugriff durch Miss Nowak als geringer ein als bei einem Fremden.
Er hatte Glück. Ein grünes Licht leuchtete über dem Sensor auf. Von irgendwo aus dem Innern des Türblatts ertönte ein leises Klicken, dann schwang die Pforte auf.
Hastig vergewisserte sich Tekener, dass niemand ihn beobachtete, dann schob er den Wäschecontainer durch die Öffnung, huschte hinterher und ließ die Tür hinter sich behutsam ins Schloss fallen. Geschafft!
Drinnen sank er ächzend auf den Kachelboden und massierte sein Knie, in der widersinnigen Hoffnung, dass bessere Durchblutung die Betäubung schneller beheben würde. Natürlich wusste er, dass Paralysatoren so nicht funktionierten. Diese Waffen behinderten die biologische Informationsweiterleitung auf molekularer Ebene. Ein zu stark eingestellter Paralysator konnte einen Menschen ebenso töten wie eine konventionelle Energiewaffe, indem er das zentrale Nervensystem lähmte und die Atmung unmöglich machte. Kommerziell erhältliche Modelle waren dazu jedoch zum Glück nicht leistungsfähig genug.
Während sich Tekener ausruhte, sah er sich einmal mehr um. Dieses Lager erwies sich als Glücksgriff. An den Wänden reihten sich Regale aneinander, vollgepackt mit medizinischem Zubehör, Medikamentenkisten und positronischen Wirkungsinduktoren. An einer waagerechten Stange befanden sich eine unüberschaubare Anzahl Kleiderbügel, von denen sauber gebügelte Ärztekittel hingen.
Wieder kämpfte er sich auf, legte die Patientenkluft ab, streifte einen der lindgrünen Kittel vom Bügel und hüllte sich so in die typische Kleidung der auf Mimas tätigen Mediziner. Aus einer Kiste zog er blind ein Namensschild und heftete es sich an die Brust. »Doktor Rolf Daniels, Assistenzarzt«, stand darauf.
»Schön, Sie kennenzulernen, Doktor Daniels.« Tekener benutzte die silbrige Oberfläche des Schwebecontainers als Spiegel, um den Sitz des Namensschilds und der Kleidung zu prüfen. Missmutig betrachtete er sein Gesicht, fuhr sich über die Wangen. Der Kittel würde ihm im Zweifelsfall nur Sekunden verschaffen. Wenn das Klinikpersonal tatsächlich vor ihm gewarnt worden war, würden ihn spätestens seine Pockennarben verraten.
In einer zweiten Kiste an der gegenüberliegenden Wand entdeckte er einen Gegenstand, der an einen Handstrahler erinnerte, und den er nach kurzer Untersuchung als hyperphasischen Emitter identifizierte. Sein Wissen über medizinische Geräte hielt sich in Grenzen, aber aus seinem Ingenieurstudium und der Zeit als Experte für Ortungs- und Kommunikationstechnik auf Pluto hatte er genügend technisches Verständnis, um sich die Wirkungsweise in etwa zu erschließen.
Der Zufall spielte ihm in die Hände; dies war genau das Utensil, das er brauchte! Das Gerät würde die Paralyse nicht neutralisieren, aber ihren Effekt zumindest so stark mindern, dass er wieder auftreten konnte. Es war nicht ideal, aber besser als nichts.
Kurzerhand richtete er den Emitter auf sein Knie und betätigte den Auslöser. Ein schwach flimmernder Strahl löste sich aus der stumpfen Spitze. In seinem Bein breitete sich ein Prickeln aus. Nach der Taubheit der vergangenen Minuten empfand er es zunächst als angenehm.
Der Schmerz kam jäh und unerwartet. Das Prickeln verstärkte sich, bis Tekener glaubte, jemand würde ihm ein heißes Messer ins Bein stechen. Mit einem Aufschrei ließ er das Gerät fallen, hielt sich zitternd das Knie. Er zwang sich, ruhig zu atmen. Der scharfe Geruch aggressiver Putzmittel schien ihm übermächtig.
Die Zeit drängte. Noch ehe die Pein vollständig abgeklungen war, räumte er den Emitter in die Regalkiste zurück.
Prüfend belastete er das Knie, genoss das zurückgekehrte Gefühl und den Schmerz. Die Lähmung hatte nachgelassen, verschwunden war sie erwartungsgemäß jedoch nicht. Er würde weiterhin humpeln. Mit etwas Glück mochte es einem zufälligen Beobachter aber nicht auffallen.
Einigermaßen zufrieden ging er aus der Kammer nach draußen. Den Container mit der Bewusstlosen ließ er zurück. Miss Nowak würde noch mindestens anderthalb Stunden friedlich schlummern und sich dann aus eigener Kraft befreien können. Um sie sorgte er sich nicht.
In den folgenden Minuten durchstreifte Ronald Tekener den abgesperrten Bereich auf der Suche nach seiner Schwester. Auch in diesem Teil der Klinik reihte sich Flur an Flur. Hinter geöffneten Türen lagen Patienten. Das Summen positronischer Medogeräte drang aus den Zimmern. Etliche Apparaturen, die er im Vorbeigehen erspähte, präsentierten ungeschlachte Komponenten mit wirren Kabelverbindungen.
Die Kranken hinter den Zimmertüren boten ihm eine Galerie des Schreckens. Schläuche verschwanden in reglosen Körpern. Atemmasken umschlossen Gesichter, ließen nur Partien panisch zuckender Augen frei. Körperteile fehlten, waren durch Prothesen und kybernetische Gliedmaßen ersetzt.
In einem Operationssaal, in den er durch ein vergittertes Fensterchen starrte, setzten Ärzte ein menschliches Gehirn in eine Kapsel ein. Daneben ruhte ein menschenähnliches Skelett aus nacktem, mattgrauem Metall. »Sinclair«, stand in serifenlosen, weißen Lettern auf seiner Brust. Die Mediziner versiegelten die Metallkapsel und pflanzten sie in eine Aussparung am Kopf des Robotkörpers.
Eine Ganzkörperprothese. Tekener erschauerte. In welches Horrorkabinett hatte er sich verirrt? Und ausgerechnet in diesem Trakt der Spezialklinik war Jessica untergebracht?
Wut stieg in ihm auf. Seine Schwester war kein Versuchskaninchen, und dass die Verantwortlichen des MIMERC eine solche Entscheidung trafen, ohne die Verwandten – ihn! – zu informieren, war ausgeschlossen. In der modernsten Behandlungseinrichtung des Solsystems wurden keine Menschenversuche vorgenommen. Hatte sich Jessica also freiwillig darauf eingelassen? Oder verhinderte jemand anderes, dass Informationen über ihren Zustand nach außen drangen?
Er setzte seine Suche mit umso mehr Verbissenheit fort. Nur noch wenige Menschen begegneten ihm: Mediziner, Pfleger, Reinigungskräfte und immer wieder Sicherheitspersonal. Hinter einer Biegung erspähte er schließlich ein Dutzend Männer in dunkelblauen Uniformen.
Hastig wandte er sich ab, studierte zum Schein die Medodaten auf einer in die Wand integrierten Positronikkonsole. Niemand durfte sein Gesicht sehen! Ohnehin rechnete er jeden Moment mit einer Entdeckung.
Die Männer kamen in seine Richtung. Tekener grüßte die Vorbeieilenden beiläufig. Er blätterte durch holografische Patientenakten und Behandlungsempfehlungen. Halb hoffte er, über den Eintrag seiner Schwester zu stolpern – doch es waren Hunderte Datensätze, und seine Paranoia warnte ihn davor, mit einer gezielten Suche irgendwelche Spürprogramme zu alarmieren.
Die Männer hasteten an ihm vorbei, ohne ihn zu beachten. Erleichtert desaktivierte er die Wandkonsole.
Nach einer gefühlten Ewigkeit – in Wahrheit, schätzte er, vergingen bestenfalls viereinhalb Minuten – hörte er hinter einer weiteren der unzähligen Gangbiegungen die Stimmen der beiden Ärztinnen. Sein Herzschlag beschleunigte sich.
»Ihre Tics stellen ein Phänomen dar, das wir untersuchen möchten«, sagte die erste.
»Das ist nicht der einzige Grund«, beschwichtigte die zweite. »Ihr Zustand ist außerdem bedenklich. Wir müssen sichergehen, dass eine Entlassung ohne Risiken bleibt.«
»Risiken für wen?«, fragte eine dritte Frau. »Ich fühle mich bestens. Kann es sein, dass die Terranische Union mich hierbehalten will? Isoliert man mich, weil man mir misstraut? Ich versichere Ihnen, dass ich nicht länger unter Iratio Hondros Einfluss stehe.«
Ein Knoten löste sich in Ronald Tekeners Brust. Er kannte diese Stimme, sie war ihm so vertraut wie seine eigene. Die Frau, die da sprach, war Jessica Tekener. Und tatsächlich wurde sie gegen ihren Willen festgehalten – auch wenn das offenbar aus ehrlicher Sorge geschah.
Er grübelte. Also gibt es hier wahrhaftig keine Menschenversuche. Nur unheilbare Fälle sowie beunruhigte und übereifrige Ärzte. Was also hindert Jessica daran, sich einfach bei mir zu melden?
Es war so weit. Tekener rüstete sich innerlich für die gemeinsame Flucht. Wie viele Sicherheitsleute hatte er unterwegs gesehen? Wie viele würden sich ihnen in den Weg stellen? Im Geiste vollzog er den Herweg nach, legte sich die kürzeste Fluchtroute zurecht. Auch die Tür mit dem Sensorschloss am Eingang des separaten Trakts war ein Hindernis. Plötzlich bedauerte er, den Paralysator nicht mitgenommen zu haben. Er ballte die Hände zu Fäusten und setzte sich in Bewegung.
Gerade als er im Begriff war, um die Ecke zu stürmen, ertönte eine vierte Stimme. Tekener erstarrte.
Der Sprecher war männlich. Sein rauer Befehlston duldete keinen Widerspruch. »Sie werden den Verantwortlichen mitteilen, dass Miss Tekener keine weitere Beherbergung wünscht. Als ihr Mitarbeiter bin ich bereit, Gewalt anzuwenden, sollten Sie auf Ihrem Standpunkt bestehen.«
Wer zum ...? Tekener sträubten sich die Nackenhaare.
»Aber ...« Die Stimme der zweiten Medizinerin. Ihre Kollegin keuchte entrüstet.
»Sie haben meinen Vertrauten gehört!«, rief Jessica, und Tekener kam es vor, als drohe sie den Ärztinnen. »Mister Saquola spricht keine leeren Worte. Ich erwarte meine Entlassung in den kommenden vierundzwanzig Stunden. Meine anstehenden Aufgaben sind zeitkritisch.«
Ronald Tekener hatte genug gehört. Einen »Mister Saquola« kannte er nicht, und warum er und Jessica plötzlich Vertraute waren, war ihm ebenso unbekannt wie die »zeitkritischen Aufgaben«, von denen sie sprach. Der Fremde war ein unberechenbarer Faktor. Ronald würde sie nicht mit ihm allein lassen.
Er trat um die Ecke.
Schräg gegenüber sah er durch eine offen stehende Tür in ein luxuriös eingerichtetes Zimmer, das an ein Penthouse erinnerte. Durch die großformatige Fensterscheibe fiel sein Blick auf das Außengelände des MIMERC: eine grüne Parklandschaft unter einer transparenten Kuppel, die den Klinikkomplex vor dem Vakuum abschirmte. Dahinter türmten sich zerklüftete Felsen. Das Ringsystem des Saturn schmückte den Himmel.
Dicht beim Fenster war eine komfortabel anmutende Krankenliege, umringt von Analyseholos und Konsolen voller blinkender Kontrolllichter. Das unvermeidliche Schlauchgewirr spannte sich von den Geräten zum Körper einer jungen Frau, die aufrecht im Bett saß und mit ausdrucksloser Miene ihren Gesprächspartnern entgegenstarrte. Neben dem Bett stand ein untersetzter Ferrone.
»Jessica!«, rief Tekener.
Die Medizinerinnen wirbelten herum. »Wer sind Sie?«, rief eine von beiden, eine zierliche Rothaarige mit einer randlosen Brille. »Ich habe Sie hier noch nie gesehen.« Als sei er das vordringliche Problem, als habe der Ferrone ihr nicht eben unverhohlen Gewalt angedroht.
Tekener scherte sich nicht um sie. Er platzte in den Raum, schob die Rothaarige beiseite, als sie sich ihm in den Weg stellte, und fuchtelte in Richtung des Ferronen – zweifelsohne Saquola. »Wer ist dieser Kerl?«
Wenn Jessica über seine Ankunft erfreut war, ließ sie es sich nicht anmerken. Entspannt saß sie in ihrem Bett und legte den Kopf schräg, als lausche sie auf etwas. Ihre Mundwinkel zitterten. War das einer der Tics, von denen die beiden Ärztinnen gesprochen hatten?
»Jessica?« Ihr Verhalten irritierte ihn. Er hatte mit einem Lachen gerechnet, damit, dass sie ihm erleichtert in die Arme fiel und sich sofort gemeinsam mit ihm auf die Flucht begab. In seinem Bauch rumorte es.
»In einem hat Doktor Kern recht, Mister Tekener.« Saquola wies auf die Rothaarige und grinste. »Dies ist kein geeigneter Aufenthaltsort für Sie.«
Beiläufig registrierte Ronald Tekener, dass Saquola ihn offenbar kannte. Jessica musste von ihm erzählt haben. Es spielte keine Rolle.
»Nimm ihn mit oder lass ihn hier. Wir verschwinden!« Noch während er mit seiner Schwester sprach, riss Tekener die Türen der Einbauschränke auf, die an der Breitseite des Raums aufgebaut waren, um ihre Kleidung zusammenzuraffen. Er stutzte. Die Fächer waren leer.
Er sah zu den Ärztinnen. »Wo sind ihre Sachen?«
Die beiden Frauen wirkten mit einem Mal seltsam teilnahmslos.
Draußen ertönten Schritte. Obwohl Tekener mit Besuch gerechnet hatte, fühlte er sich überrumpelt. Jessicas abweisende Reaktion war zu viel.
Die Sicherheitsleute waren plötzlich da. Zu sechst stürmten sie in den Raum. Drei von ihnen hielten Ronald Tekener mit Paralysatoren in Schach, während zwei andere ihn an den Armen packten. Der sechste zwang ein Paar Fesselfeldringe um seine Handgelenke.
»Wir haben den Eindringling aufgegriffen, der Nowak überwältigt hat.«, rief einer von ihnen in sein Kommunikationsgerät.
Sie hatten ihre Kollegin also entdeckt. Das war schnell gegangen!
»Was soll mit ihm geschehen?«, fragte der Sicherheitsmann, der ihm die Fesselringe angelegt hatte. Zu Tekeners Überraschung richtete er die Frage an Saquola.
Was zum ...?
Das Grinsen des Ferronen wuchs in die Breite. »Er hat in nobler Absicht gehandelt. Leider ist sein guter Wille fehlgeleitet. Bringen Sie ihn zum Landefeld, und stellen Sie sicher, dass er Mimas verlässt. Und dann helfen Sie uns bitte, die Entlassung von Patientin sieben zu erwirken. Das Klinikpersonal zeigt sich unkooperativ.« Er legte den Arm auf den von Jessica Tekener, und sie ließ es zu.
Der Sicherheitsmann bestätigte und gab seinen Kollegen einen Wink. Die Medizinerinnen wirkten weiterhin apathisch – als ob ein unsichtbarer Einfluss von Ihnen Besitz ergriffen und sie gelähmt hätte.
Grob wurde Tekener zur Tür gezerrt. Wieder rief er den Namen seiner Schwester, kämpfte gegen den Griff der Häscher und die Fesselfelder, gab dann aber auf. Er wusste, wann er verloren hatte, begriff aber nicht, was geschah. Welche Rolle spielte der Ferrone? Warum gehorchten die Sicherheitsleute ihm und nicht dem Klinikpersonal? Und warum setzte Saquola ihn vor die Tür, anstatt ihn einzuweihen? Schließlich war Ronald doch ein möglicher Verbündeter aufseiten von Jessica.
Tekener kam ein furchtbarer Verdacht. »Seid ihr etwa Li...« Eine Hand presste sich auf seinen Mund, verhinderte, dass er das Wort aussprach.
Wieder reagierte Jessica Tekener nicht, abgesehen von ihrem schräg gelegten Kopf und dem steten Zucken der Mundwinkel. Sie begegnete Ronalds flehendem Blick, als löse sein Erscheinen nichts in ihr aus. Als sei er ein vollkommen Fremder für sie.
Es war das Letzte, was Ronald Tekener von ihr sah, bevor sie ihn nach draußen brachten.