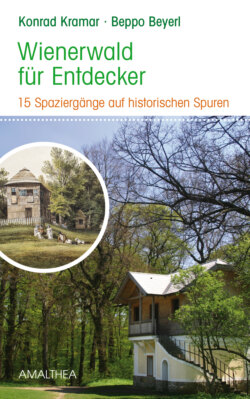Читать книгу Wienerwald für Entdecker - Beppo Beyerl - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Vom Urmeer zur Ruckerlbahn
ОглавлениеKahlenberg und Leopoldsberg
Eine Wanderung auf den Kahlenberg und den benachbarten Leopoldsberg ist in einem Buch wie diesem einerseits unumgänglich, andererseits ziemlich kompliziert. Nicht nur, dass es sich um die beiden Wiener Hausberge handelt, sie sind auch beide mit Geschichte und Geschichten gepflastert, und zwar in jedem Winkel. Für unsere Erkundung gilt also noch mehr, was für das ganze Buch gnädigerweise gelten möge: Auf einer Wanderung lässt sich nur ein Bruchteil von all dem entdecken, was da oben zwischen Weinbergen und Buchenwäldern verborgen liegt. So wird das, was wir uns vornehmen, immer nur eine kleine, ganz persönlich getroffene Auswahl sein.
Allein die Namensverwirrung um die beiden Waldhügel, die den westlichen Wienerwald gewissermaßen an der Donau verankern, ließe sich nur in mehreren Abhandlungen aufklären. Für den Wanderrucksack genügt vorerst einmal die Kurzversion, nämlich, dass der heutige Leopoldsberg zuerst Kahlenberg hieß und der heutige Kahlenberg ursprünglich Sauberg. Erst als der Polenkönig Jan Sobieski die Türken aus Wien – samt berühmtem Sturm vom Kahlenberg (dem damaligen Kahlenberg) – vertrieben hatte, ließ der Habsburgerkaiser Leopold auf dem (heutigen) Leopoldsberg eine Kapelle errichten. Deshalb musste ein Namenstausch her. Denn das weithin sichtbare Schmuckstück wurde natürlich dem Namensvetter des Kaisers, dem heiligen Leopold, geweiht. Der – eigentlich ein ganz konventioneller Babenbergermarkgraf – ist bis heute Landespatron von Niederösterreich und auch der Berg durfte von da an seinen Namen behalten.
Wir ahnen also jetzt schon, während wir uns noch im D-Wagen Nußdorf nähern, dass sich da oben einiges abgespielt hat. Kahlenberg und Leopoldsberg haben Türkenbelagerungen erlebt, ebenso wie die wildesten Auswüchse des Technikwahns im späten 19. Jahrhundert. Hier haben äußerst geschäftstüchtige Mönche ihre Spuren hinterlassen, ebenso wie ziemlich skrupellose Spekulanten. Man stößt auf legendär-verruchte Schönheiten aus der Zeit Napoleons, kann einiges über einen »rosaroten Prinzen« erfahren und findet Erinnerungen an Hitlers seltsame Hassliebe zu Wien, schamvoll verborgen in einem bemerkenswert seltsamen Denkmal. Leider versperrt heute ein Bauzaun den Weg dorthin.
Am einfachsten, zumindest nach Meinung der Autoren, ist es noch, sich für den richtigen Ausgangsort zu entscheiden. Denn es geht kaum bequemer, als mit dem bereits erwähnten D-Wagen nach Nußdorf zu zuckeln, so wie das schon die Ausflügler vor mehr als hundert Jahren taten, wobei die meist die Franz-Josefs-Bahn wählten. Die hatte damals schon einen eigenen Bahnhof vor Ort. Wir sehen das typische Bahnhofsgebäude aus der Spätzeit der Monarchie rechter Hand, wenn wir die letzte Kurve zum Nußdorfer Platz nehmen.
Die leichte Erreichbarkeit macht also Nußdorf als Ausgangspunkt zur ersten Wahl. Doch wenn wir einmal am Nußdorfer Platz die Bim verlassen haben, wird uns recht bald klar, dass für den Start unserer Wanderung hier noch einiges mehr spricht. In dem uralten Weinbauerndorf hat sich an mehreren Stellen die mittelalterliche Struktur weitgehend erhalten. Wir reden nicht nur von den wuchtigen, geduckten Winzerhäusern der Weinbauern, sondern von jenen Gebäuden, die die ersten Großgrundbesitzer, die es in diesen Weinorten gab, errichtet haben: die katholischen Orden. Von Nußdorf, wie von so vielen anderen heutigen Vororten Wiens, wurde der Wienerwald bewirtschaftet, wurden Weinbau und Forstwirtschaft im großen Stil vorangetrieben. Wenn wir vom Nußdorfer Platz aus ein Stückerl die Greinergasse bergauf gehen, zweigt rechts die Hackhofergasse ab und gleich am Eck steht ein Wirtschaftshof der Dominikanermönche aus dem späten Mittelalter.
Bevor wir unseren Weg in der Hackhofergasse auf der Spur der Mönche fortsetzen, sollten wir einen Blick auf ein Stück jüngere Vergangenheit werfen. Einen kleinen Umweg ist es allemal wert. Aus dieser jüngeren Vergangenheit ist heute in Nußdorf deutlich weniger zu sehen als aus dem Mittelalter. Die Zahnradbahnstraße beginnt ein paar Schritte oberhalb des Nußdorfer Platzls und auf Nummer 8 steht das Gebäude, das die Erklärung zum Straßennamen liefert. Das »Gasthaus zur Zahnradbahn« trägt diesen Namen auch ganz zu Recht, ist es doch die ehemalige Talstation ebendieser Zahnradbahn. Da es denkmalgeschützt ist, betritt man heute noch die nur geringfügig umgebauten Räumlichkeiten, in denen sich Kartenschalter und Wartesaal befanden. Ruckerlbahn haben sie die Wiener genannt, weil sich die Züge aufgrund des gewaltigen Kraftaufwands, den die Dampfmaschinen der Lokomotiven zu leisten hatten, immer mit einem ordentlichen Ruck in Bewegung setzten. Schon das machte das imposante technische Spielzeug aus der fortschrittsverliebten Gründerzeit zu einem Liebling der Wiener. Fast 200 000 Personen traten in den Jahren nach der Eröffnung jährlich mit der Zahnradbahn die Reise auf den Kahlenberg an. Das lag natürlich auch daran, dass Ausflüge in die Natur und vor allem in die Berge damals gewaltig in Mode waren. Und wer es aus finanziellen, konditionellen oder anderen Gründen nicht so richtig in die Berge schaffte, der leistete sich zumindest am Wochenende die auch nicht ganz billige Fahrt auf den Kahlenberg. Auf dem war also damals schon fast so viel Trubel wie heute.
Wer sich für die Zahnradbahn näher interessiert, kann sich in dem übrigens sehr gut und kulinarisch ambitioniert geführten Gasthaus nicht nur zum Essen niederlassen, sondern auch die zahlreichen Ausstellungsstücke zum Thema Zahnradbahn in den Gasträumen inspizieren. Da gibt es Fotos, alte Fahrpläne und vieles andere, das einem dieses Eisenbahnprojekt ziemlich lebendig vor Augen führt. Und das ist gut so, denn erstaunlicherweise ist von dem groß angelegten Unternehmen, das immerhin von 1874 bis in die Zwanzigerjahre des letzten Jahrhunderts lief, kaum etwas übrig geblieben. Es ist dem engagierten Döblinger Heimatkundler Wolfgang Schulz und seinem Döblinger Heimat-Kreis zu verdanken, dass die Erinnerung an diese technische und touristische Meisterleistung heute wieder gepflegt wird. Eisenbahnenthusiasten und ambitionierte Lokalhistoriker erfahren mehr auf Schulz’ Homepage (www.döbling.com) und in einer eigens produzierten DVD, auf der er sich auf die Zahnradbahn-Spurensuche begibt. Dafür muss man aber nicht nur gut zu Fuß, sondern vor allem phantasiebegabt sein, denn es sind wirklich nur noch recht schäbige Reste der Bahn zu finden. Wer sich eine der vielleicht noch deutlichsten Spuren der alten Bahn gleich hier in Nußdorf anschauen will, der muss die Zahnradbahnstraße weitergehen. Sie folgt der alten Bahntrasse. Nach ein paar Hundert Metern quert die inzwischen zum Zahnradbahnweg degradierte Straße die Kahlenberger Straße, oder, besser gesagt, sie würde es, wäre die alte Eisenbahnbrücke über die Kahlenberger Straße heute nicht längst abgebrochen. Immerhin kann man dort noch die alten Brückenfundamente deutlich sehen.
Abfahrt vom Kahlenberg: Die Ruckerlbahn war über Jahre ein wahrer Tourismusmagnet, kam aber dann rasch aus der Mode.
Auf dem Kahlenberg kann man heute noch einen Waggon der alten Zahnradbahn bewundern. Viel mehr ist von der imposanten Anlage nicht geblieben.
Wer nicht so viel Gehzeit für Errungenschaften der Gründerzeit vergeuden will, kann gleich bei der ehemaligen Talstation kehrtmachen und wieder zum Anfang der Hackhofergasse und dem dortigen Dominikaner-Domizil zurückkehren. Wir wollen ohnehin in der Hackhofergasse weitergehen, ist sie doch eine jener Gassen, in der sich – wie vorher erwähnt – die alte Baustruktur weitgehend erhalten hat. Auf den Nummern 17 und 18 liegen einander zwei weitere Gebäude gegenüber, in denen die Geschichte von Nußdorf und den umliegenden Wäldern steckt. Links liegt der Zwettlhof, ein prächtiges barockes Schlösschen, dessen Geschichte weit ins Mittelalter zurückreicht. Denn schon damals erkannten die geschäftstüchtigen Mönche des nicht umsonst wohlhabenden Zisterzienserstifts Zwettl im Waldviertel, was es hier zwischen Wienerwald und Donau zu holen gab. Man war im Wettlauf der Orden lange vor den Dominikanern da, denen wir vorher begegnet sind. (Es gibt übrigens direkt am Stephansplatz ebenfalls einen Zwettlhof, nur als weiteren Beweis für die Finanzkraft dieses Stiftes.) Auch heute noch ist der Zwettlhof im kirchlichen Besitz, er gehört dem Schottenstift.
Das sogenannte Lehár-Schlössl auf Nummer 18 ist weit kleiner, aber ebenfalls von einem Orden als Wirtschaftshof gegründet worden. Ansonsten steckt, wie der Name deutlich macht, in diesem Haus eher Musikgeschichte. Dass der Komponist Franz Lehár hier einige Jahre lebte und ein paar ziemlich populäre Operetten verfasste, ist bei diesem Namen wenig überraschend. Deutlich früher aber wohnte hier schon Mozarts Libretto-Schreiber Emanuel Schikaneder. Mozart ließ sich nicht weit von hier auf dem Cobenzl für seine Zauberflöte inspirieren (siehe Kapitel »Von drei verschwundenen und einem ›gefälschten‹ Schloss«), deren Libretto ja Schikaneder verfasst hatte. Mozart, ebenso wie sein fürstlicher Gastgeber auf dem Cobenzl, und auch Schikaneder waren Freimaurer. Also muss man nicht allzu viel herbeidichten, um sich ein konspiratives Treffen aller drei Herren am Cobenzl, oder eben in Nußdorf, vorzustellen. Schikaneder konnten übrigens weder der enorme Erfolg der Zauberflöte noch seine Beziehungen zu den Freimaurern vor dem Absturz in die Armut bewahren. Das schicke Nußdorfer Schlössl war er irgendwann los und er beendete in einem ärmlichen Winkel des Wiener Alsergrunds sein Leben.
Mit einem Blick rechts auf die Donau, der wir hier in der Hackhofergasse fast zum Greifen nahe kommen, lassen wir die Vorstadt allmählich hinter uns und kommen in die mehr oder minder freie Natur. Denn obwohl wir inzwischen in der Eichelhofstraße ziemlich steil bergauf gehen und damit eigentlich im Wienerwald sein sollten, ist von dem hier noch nicht viel zu merken. Denn der Nußberg, quasi der Vorhügel zum Kahlenberg, hat seinen Waldbestand – jetzt kommen wieder die eifrigen Mönche ins Spiel – schon im Mittelalter weitgehend eingebüßt. Die Lage auf den steil zur Donau abfallenden Hügeln war günstig für Weinbau. Also ging man diesen gleich großflächig an. Das Erste, was wir in der Eichelhofstraße davon bemerken, sind mächtige alte Steinmauern auf beiden Seiten. Sie stützen die Weingärten ab, die sonst bei jedem Unwetter die Straße verschüttet hätten. Oberhalb dieser Steinmauern gab es übrigens noch in den Dreißigerjahren nicht nur Weingärten, sondern auch eines der bekanntesten Ausflugsrestaurants am Nußberg, den sogenannten Bockkeller. Dessen Keller ist übrigens heute noch erhalten, nur dass jetzt Luxusappartements darübergebaut sind.
Doch wir wollen ja ohnehin nicht einkehren, wenn wir noch so viel Steigung vor uns haben, und arbeiten uns deshalb die Eichelhofstraße weiter bergauf. Das nächste bemerkenswerte Stückchen Wienerwaldgeschichte auf unserem Weg ist zwar ein wenig älter als dieser Bockkeller, nämlich ein paar Millionen Jahre, aber trotzdem bedeutend besser erhalten. Im steilen Hang links von der Straße zeigen sich von großen Steinen umrahmte Öffnungen, die so angeordnet sind, als ob sie dort bewusst abgeladen worden wären. Wer sich die Mühe macht, zur ersten und größten der Öffnungen ein paar Meter den Hang hinaufzuklettern, findet dort eine Erklärung, welche Naturgewalt die Steine hierhergeschafft hat: Es war das sogenannte Badener Meer, das hier vor 15 Millionen Jahren seine Küste hatte und die Steine anschwemmte. Wer sich ein bisschen Zeit zur genaueren Betrachtung nimmt, findet rasch die Abdrücke fossiler Algen und mit ein bisschen Glück sogar von einer Muschel. Von der Tafel urzeitlich gut informiert, bemerken wir beim Vorbeigehen, wie viele dieser prähistorischen Gesteinsformationen in der steilen Wand zu sehen sind.
Wir aber wollen auf den Nußberg hinauf, und der öffnet sich, wenn wir die Steigung einmal hinter uns gelassen haben und aus der Eichelhofstraße in den Eichelhofweg abgebogen sind. Eindrucksvoll liegen vor uns Weinberge, wohin man schaut, rechter Hand tief unten die Donau und vor uns der Kahlenberg und der Leopoldsberg. Das Plateau, über das wir jetzt gemächlich weiter bergauf steigen, bietet tatsächlich einen der schönsten Ausblicke von Wien. Kein Wunder, dass das Heurigen-Angebot hier oben inzwischen ansehnlich ist. Man kann an Sommerwochenenden beim Mayer am Nußberg sogar im Liegestuhl Spritzer und Schinkenbrot zu sich nehmen. Der Klassiker am Nußberg aber bleibt der Heurige Sirbu, der sich dank seinem atemberaubenden Ausblick offensichtlich schon bis China und Japan herumgesprochen hat. Es macht manchmal Spaß zuzuschauen, mit welcher Begeisterung die zahlreichen asiatischen Touristen sich auf eine Blutwurst stürzen können – ansonsten ist das Lokal ein angenehm schlichter und authentischer Heuriger geblieben.
Wer sich bei so viel Gastronomie und Trubel in seiner Nußberg-Beschaulichkeit gestört fühlt, sollte wissen, dass hier vor 70 Jahren weit mehr los war als heute. Damals waren es Großgaststätten, wie der bereits erwähnte Bockkeller, die hier Wochenende für Wochenende Tausende Ausflügler versorgten. An das Wirtshaus »Zur Kleinen Schweiz« etwa, das einst am Eichelhofweg stand, erinnern heute nur noch die alten Bäume des Gastgartens, die sich am Wegrand bemerkbar machen. Von der Weberhütte ein Stückchen weiter oben sind nur ein paar Steine geblieben. Inzwischen sind wir auf der alten Kahlenberger Straße unterwegs. Wenn man die erste Kurve nimmt, zweigt rechts ein Weg ab, der den Namen des inzwischen verstorbenen Nachtclub-Königs Heinz Werner Schimanko trägt. Das ist zwar hier oben an der frischen Wienerwald-Luft auf den ersten Blick etwas seltsam, hat aber auch mit einem Gastronomiebetrieb zu tun. Der hieß »Zur Eisernen Hand«, so wie heute noch die Gasse, die vom Heinz-Werner-Schimanko-Weg steil hinunter ins Kahlenbergerdörfl führt. Dort stand eines der populären Ausflugsgasthäuser am Nußberg, berühmt vor allem für seine Terrasse mit dem Ausblick über die Donau. Und diesen Ausblick wollte eben auch Heinz Werner Schimanko genießen, allerdings ohne andere Gäste. Er kaufte den inzwischen verfallenen Gasthof, ließ die Auflagen zur Wiedereröffnung Auflagen sein und richtete dort ein privates Domizil ein. Döbling ließ es sich trotzdem nicht nehmen, dem ehemaligen Elitesoldaten des Bundesheeres ebendiesen Weg zu widmen.
Am Krapfenwaldl machte die Zahnradbahn Station: Dort wartete ein beliebtes Restaurant, das später Teil des heutigen Freibades wurde.
Prominente haben sich rund um den Kahlenberg schon lange vor Schimanko wohl gefühlt und einigen der bemerkenswertesten werden wir ein paar Serpentinen weiter oben begegnen. Dort kommen wir nämlich am alten Kahlenberger Friedhof vorbei. So nahe einem berühmten Ausflugsziel wie dem Kahlenberg so malerisch verfallen zu bleiben, das ist schon etwas, das nur einem Wiener Friedhof passieren kann. Schon das verrostete, quietschende Eisentor, durch das man den Friedhof – er liegt rechter Hand der Kahlenberger Straße – betritt, würde einer Geisterbahn alle Ehre machen. Viele Gräber findet man zwischen den alten Bäumen nicht. Verständlich, es wurden seit 1874 keine Toten mehr beigesetzt. Ausnahmen hat man nur für ein paar Mönche gemacht, die die St. Josefskirche oben am Kahlenberg betreuen, und für einen weiteren, prominenten Diener Gottes: Prälat Leopold Ungar, langjähriger Chef der Caritas und einer der großen fortschrittlichen Geister in der katholischen Kirche des späten 20. Jahrhunderts, liegt hier begraben – wunschgemäß. Der Kahlenberg war einer der Lieblingsorte des Geistlichen.
Doch wir wollen uns hier an diesem weltvergessenen Ort anderen Herrschaften widmen, die hier schon viel, viel länger liegen – und umso märchenhaftere Geschichten zu erzählen haben. Gleich links vom Eingang liegt Karoline (Lottchen) Traunwieser. Wenn man einen Blick auf ihren Grabstein und damit auch auf das Sterbedatum wirft, denkt man als Erstes, dass das bedauernswerte junge Ding wohl nicht viel vom Leben gehabt hat. Sie starb nämlich 1815 im Alter von 20 Jahren. Doch ihr Beiname – er ist in einem erklärenden Text an der Seite des Grabes vermerkt – lässt dann doch anderes vermuten. Der »Schönsten Schönere« nannte man sie. Den Ehrentitel verlieh man ihr in einer Zeit, in der es in Wien reichlich viele Schöne aus ganz Europa zu bewundern gab. 1815 war das Jahr des Wiener Kongresses und auf dem waren bekanntlich die schönen Damen, wie etwa die russische Fürstin Bagration, die wichtigsten Schaltstellen der Diplomatie. Für wen das junge Fräulein Traunwieser diplomatische Dienste leistete und mit wem sie dafür im Bett war, ist nicht bekannt. Wie viele an Schwindsucht, also an Lungentuberkulose, leidende Menschen – nachzulesen unter anderem in Thomas Manns Roman Der Zauberberg und damals in der Medizin weit verbreitete Lehrmeinung – scheint sie völlig überhitzte erotische Begierden gehabt zu haben. Bekannt ist heute nur ein Verehrer, den sie allerdings definitiv nicht erhörte: Joseph von Hammer-Purgstall. Der Gründer der Akademie der Wissenschaften beschrieb das Lottchen in seinen Erinnerungen an die Zeit des Wiener Kongresses: »Auf einem Balle bemerkte ich in einem hinteren Winkel des Tanzsaales ein besonderes Gedränge. Ich drängte mich ebenfalls hin und war das erste und einzige Mal in meinem Leben von einer wirklich himmlischen Schönheit ergriffen, wie nie vorher und seitdem …«
Auch die Grabinschrift stammt von Hammer-Purgstall und ist ähnlich schwärmerisch: »In ihr ward offenbar, was Schönheit, Jugend, Anmut, Unschuld, Talent und Güte vermag …« Mit der Unschuld jedenfalls lag der Orientalist Hammer-Purgstall ziemlich daneben. Einer der möglichen Liebhaber der jungen Dame liegt nur ein Stückchen weiter unten in einem weit größer angelegten Grabmal – mit seiner ganzen Sippe. Charles Joseph de Ligne, Generalfeldmarschall in der Armee Maria Theresias und in dieser Funktion ziemlich erfolgreich. Wie es sich für einen Adeligen, der etwas auf sich hielt, damals gehörte, war Ligne nebenbei auch Schriftsteller und verfasste unter anderem ziemlich geistreiche Erlebnisbücher, aus denen wir einiges über sein Privatleben erfahren – und das war ziemlich turbulent. Im adeligen, oder auch nicht adeligen, Wiener Nachtleben nannte man Ligne nämlich den »rosaroten Prinzen«, weil er sich ständig mit Damen von nicht ganz untadeligem Ruf herumtrieb, und das offensichtlich zu nicht gerade bürgerlichen Tageszeiten. Auch auf dem Wiener Kongress war der als geistreicher Spötter bekannte Ligne von Anfang an dabei. Von ihm stammt übrigens das berühmte Bonmot über die besagte Veranstaltung: »Der Kongress tanzt, aber er geht nicht weiter.« Ligne starb bald nach Beginn des Kongresses.
Erinnerung an »der Schönsten Schönere«: Die gerade einmal 18-jährige Karoline Traunwieser verzauberte den Wiener Kongress und vermutlich so manchen Diplomaten.
Dass der Herr Generalfeldmarschall hier oben liegt, hat mit einer weiteren seiner Leidenschaften zu tun: dem Kahlenberg. Na ja, eigentlich gefiel es dem inzwischen pensionierten Militär auf dem Leopoldsberg besser und darum ließ er sich dort, in der Burg, die wir später noch umrunden werden, einen Sommersitz errichten. Und weil die Höhenstraße im späten 18. Jahrhundert noch nicht gebaut war und man als Adeliger nicht so einfach durch den Wald laufen konnte, ließ sich Ligne seinen eigenen Weg auf den Leopoldsberg bauen, den Nasenweg. Der hat bis heute dank mehrerer respektvoller Restaurierungen noch weitgehend den barocken Charakter, den Ligne ihm gab. Und er ist auch bis heute genauso steil. Wer später diesen Abstieg wählt, wird die Serpentinen und Aussichtsterrassen mit Blick auf die Donau genießen können. Leider nicht mehr erhalten ist das Lusthäuschen, das sich der Fürst knapp unterhalb des Gipfels im Stil eines Tempelchens bauen ließ. Wir wollen jetzt nicht darüber spekulieren, wozu es diente. Die »Eiserne Hand« übrigens – wir sind dem Namen ja schon in der Eisernenhandgasse begegnet – geht auch auf Ligne zurück. Er ließ tatsächlich am Nasenweg einen Wegweiser in der Form einer eisernen Hand aufstellen.
Lassen wir es mit diesen beiden Friedhofsbewohnern vorerst einmal gut sein. Schließlich haben wir noch ein gutes Stück Weg zurückzulegen. Dieser führt uns jetzt über zwei weitere Serpentinen oder sogar direkt, über den Abschneider durch den Wald, auf den Kahlenberg hinauf. Über den Gipfel und das Plateau, auf dem wir jetzt stehen, gibt es so viel Historisches zu erzählen, dass wir uns – auch weil das meiste davon hinlänglich bekannt ist – auf die etwas ungewöhnlicheren Details stürzen wollen. Wir lassen also die Kirche St. Josef und all die daran und darin enthaltenen Erinnerungen an den Sieg über die Türken 1683 beiseite, auch weil sich ohnehin genügend patriotische Touristen aus Polen für das Gebäude interessieren. Immerhin war es ja ihr König Sobieski, der vom Kahlenberg aus – mit tatkräftiger Unterstützung des jungen Prinzen Eugen – die Befreiung Wiens einleitete. Dass Sobieski übrigens in Lemberg geboren wurde und damit heute eigentlich Ukrainer wäre, sollte man gegenüber etwaigen polnischen Bekannten lieber nicht erwähnen.
Nur im Vorbeigehen schauen wir auf das Restaurant und die umliegenden Gebäude. Der Kahlenberg hat eine endlose Folge von Großprojekten und gastronomischen wie touristischen Katastrophen hinter sich gebracht. Das, was wir heute hier vorfinden, ist zwar passabel, hat aber mit dem Wienerwald, den wir auf unseren Spaziergängen entdecken wollen, nur wenig zu tun. Ein kurzer Blick über den Wienerwald und die Kleinen Karpaten von der Aussichtsterrasse aus ist auf jeden Fall ein paar Minuten wert. Wenn wir von dort wieder heruntersteigen, stehen wir mehr oder minder direkt vor dem wuchtigen Denkmal für die Wiener Höhenstraße. Der Teil, der hier oben auf dem Kahlenberg endet, wurde 1935, im austrofaschistischen Ständestaat, eröffnet. Bundeskanzler Dollfuß hatte 1934 den ersten Spatenstich gesetzt, wenige Monate, bevor er von den Nationalsozialisten während deren gescheiterten Putschversuchs ermordet wurde. Die Höhenstraße war ein Prestigeprojekt der Austrofaschisten und das Denkmal ist ein mustergültiges Beispiel für deren Stilempfinden. Nicht umsonst erinnert das Ganze an faschistische Denkmäler aus der Mussolini-Ära in Italien.
Gleich dahinter findet man die Kaiserin-Elisabeth-Ruhe, der wir aber keine weitere Aufmerksamkeit widmen müssen. Denn erstens ist die im Wienerwald ohnehin omnipräsent (Stichwort Sisi-Kapelle) und zweitens gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Elisabeth irgendein Naheverhältnis zum Kahlenberg hatte. Also gehen wir gleich weiter den Hügel hinauf und kommen so über einige Stiegen, die uns durch den Wald führen, zur Stephaniewarte. Diese könnte man als typische Wienerwald-Aussichtswarte abtun: aus der Spätphase der Monarchie stammend und daher mit dem Namen eines Habsburgers, in diesem Fall Stephanie, der Frau von Kronprinz Rudolf, ausgestattet. Doch mit der Stephaniewarte wollten die Erbauer keineswegs das Herrscherhaus feiern, sondern vielmehr ihren eigenen technischen und ökonomischen Triumph.
Eigentlich ein Siegesdenkmal: Die Stephaniewarte ließ die Zahnradbahn-Gesellschaft aus den Trümmern des in den Konkurs getriebenen Konkurrenzunternehmens errichten.
Damit sind wir wieder bei dem Thema angelangt, mit dem wir unseren Weg auf den Kahlenberg begonnen haben: der Zahnradbahn. Neben der Warte war nämlich die Berg- und Endstation der Bahn. Weil die, wie das meiste von der Bahn, fast spurlos aus dem Wienerwald verschwunden ist, bleibt die 1887 errichtete Stephaniewarte die eindrücklichste Erinnerung an die Bahnlinie. Was heißt Bahnlinie, Bahnlinien! Denn die Steine der Warte hatte die Eisenbahngesellschaft, um ihren Triumph ganz besonders deutlich zu machen, aus der Konkursmasse eines anderen Unternehmens herausgekauft: der Drahtseilbahn auf den Leopoldsberg. Diese von den Wienern liebevoll »Zuckerlbahn« getaufte Anlage, die im Kahlenbergerdorf ihre Talstation hatte, war nach einigen erfolgreichen Jahren der Konkurrenz der Zahnradbahn nicht mehr gewachsen und musste 1885 zusperren. Wahrscheinlich war den Wiener Ausflüglern das Rucken der Ruckerlbahn lieber als das Zucken der Zuckerlbahn. Das muss nämlich ziemlich unsanft gewesen sein; wenn sich die Waggons der Drahtseilbahn in Bewegung setzten, sollen die Insassen wild durcheinandergepurzelt sein.
Wer sich, wie viele Eisenbahn-Enthusiasten, auf der alten Trasse noch ein wenig auf die Suche nach Spuren im Wald machen will, kann von der Stephaniewarte aus den Weg entlang der Höhenstraße nehmen. Der Waldrücken, auf dem wir marschieren, ist die überwachsene alte Trasse. Steine und Mauerstücke daraus findet man mit ein bisschen Geduld. Alles Weitere wurde nach dem Konkurs der Zahnradbahn feinsäuberlich demontiert und Stück für Stück verkauft, die Gläubiger wollten eben lieber Geld sehen als ein paar unnütz gewordene Schienen im Wienerwald.
Eigentlich aber sollten wir, falls die Kondition noch reicht, auf den Leopoldsberg überwechseln. Der erste Teil des Weges bis zur Josefinenhütte ist nicht nur uncharmant asphaltiert, sondern bei schönem Wetter von einer international besetzten Touristen-Karawane bevölkert. Ähnlich viel los ist auch in der Josefinenhütte, die zu den wenigen wirklich empfehlenswerten gastronomischen Angeboten in diesem Teil des Wienerwaldes gehört – wenn man einen Platz findet. Auch wenn wir keinen finden, sollten wir uns davon nicht die Wanderlaune verderben lassen. Denken wir daran zurück, was hier erst los war, als die Zahnradbahn noch täglich Besucher auf den Berg hinaufschaufelte. Die Josefinenhütte stammt übrigens nicht aus der Zeit der Zahnradbahn. Damals stand hier ein weit größeres Wirtshaus, das interessanterweise Schweizerhaus hieß – vermutlich wegen des alpinen Flairs, das man vermitteln wollte. Die weit kleinere Josefinenhütte wurde erst gemeinsam mit der Höhenstraße hierhergestellt und sollte, quasi als Kontrast zur zukunftsweisenden Höhenstraße, ein bisschen älplerische Gemütlichkeit vermitteln, für die man ja gerade im austrofaschistischen Ständestaat etwas übrig hatte.
Von der »Zuckerlbahn«, der Drahtseilbahn auf den Leopoldsberg, und ihrer Talstation im Kahlenbergerdorf sind nur ein paar verborgene Schächte im Wald geblieben.
Wer auf dem weiteren Weg in Richtung Leopoldsberg statt vieler Touristen lieber ein einsames, dafür umso geschichtsträchtigeres Waldstück passieren möchte, muss sich in der großen Serpentine der Höhenstraße nach der Josefinenhütte ein bisschen genauer umschauen. Rechter Hand sieht man, wie sich die sportlicheren oder noch nicht volljährigen Touristen durch den dort eingerichteten Hochseil-Klettergarten arbeiten. Linker Hand biegt ein blau markierter Weg von der Straße direkt in den Wald ab. Ist man erst auf diesem gelandet, sind die Hunderten Spaziergänger auf einmal verschwunden. Der Weg verzweigt sich mehrfach, aber wenn man sich entlang des Höhenrückens hält, kann man das Ziel, den Leopoldsberg, nicht verfehlen. Doch schon nach etwa hundert Metern erhebt sich im Wald eine Kuppe, auf deren linker Seite es auffallend steil durch den Wald hinuntergeht. Der Gupf mitten im Wald ist kein Zufall, sondern die inzwischen vom Waldboden verschluckte Bergstation der bereits erwähnten Drahtseilbahn, die vom Kahlenbergerdorf heraufkam. Wer es nicht glaubt, kann ein paar Meter die steile Flanke hinabsteigen, er findet dort rasch Mauerreste, ja sogar Eisenanker der Bahnstation. Vor ein paar Jahren gab es hier noch zwei Eisendeckel im Waldboden zu sehen, durch die ambitionierte Höhlenforscher in eine Zisterne vordrangen: der Wasserspeicher für die Drahtseilbahn, die ja mit einer Dampfmaschine betrieben wurde. Die Gemeinde hat die Öffnungen endgültig verschließen und mit Erde bedecken lassen, da die Gefahr für übereifrige Laienforscher zu groß war. Wir müssen uns also heute mit den Mauerresten im Waldboden zufriedengeben.
Setzen wir unseren Weg Richtung Leopoldsberg fort, dann landen wir kurz vor der dortigen Burg wieder auf der Höhenstraße und stehen sehr bald vor einer Gruppe von drei ziemlich exotisch aussehenden, lebensgroßen eisernen Herren. Das Denkmal erinnert an die ukrainischen Kosaken, die in der Armee des polnischen Königs bei der Befreiung Wiens angeblich besondere Heldentaten vollbrachten, und ist erst ein paar Jahre alt. Aufstellen ließ es ein damals in Wien residierender ukrainischer Oligarch, der das nötige Kleingeld für ein bisschen Patriotismus im Wiener Exil ohne große Mühe aufbrachte.
Wenn wir uns die letzten Meter hinauf zur Burganlage begeben, sollten sich die, die schon länger nicht mehr auf dem Leopoldsberg waren, auf ein Ärgernis vorbereiten. Die gesamte Anlage, Kirche, Burg und Restaurant, ist seit Jahren gesperrt und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Ein Wiener Architekt hat ein 100-jähriges Baurecht auf die ganze Anlage und lässt sich mit der offensichtlich mittendrin abgebrochenen Restaurierung Zeit. Um uns nicht mit Ärger über so viel Willkür aufzuhalten, die den Wienern und ihren Gästen eine der wichtigsten touristischen Anlagen der Stadt vorenthält, lassen wir den Namen des Herrn und die näheren Umstände an dieser Stelle unerwähnt. Wir beschränken uns darauf, die Burg zu umrunden, die unglaubliche Aussicht auf die Donau zu genießen und die eine oder andere der hier angebrachten unendlich vielen Gedenktafeln zu entdecken. Diese reichen von Markgraf Leopold – dem Babenberger, der die Anlage gründete und zum Landespatron von Niederösterreich wurde – bis zu einer der unvermeidlichen Elisabeth-Gedenktafeln. Die Kaiserin war tatsächlich 1896 einmal hier oben. Dabei hat sie, wie die Tafel in ehrfürchtigem Ton vermerkt, »weite Umschau« gehalten.
Nicht nur die kühnen Kosaken, sondern auch ein paar Gedenktafeln erinnern hier an die Befreiung von den Türken. Womit wir wieder beim Thema vom Anfang dieses Kapitels wären: der Frage nämlich, von welchem Berg herunter die tapferen Retter Wiens 1683 wirklich gestürmt sind. Die meisten Historiker geben dem Leopoldsberg – der hieß damals gerade noch Kahlenberg – den Vorzug. Doch wissen es die Tausenden Polen, die drüben auf dem heutigen Kahlenberg ihren Helden Sobieski besuchen, nicht besser?
Wir lassen uns auf die Debatte nicht ein und versuchen bei unserem Rundgang um die Burg zumindest einen Blick auf ein ebenfalls in der Endlos-Baustelle verstecktes Denkmal zu werfen. Es ist vielleicht das interessanteste in der Anlage. Eine große Steinschale, die auf einer Säule steht, ist der einzig sichtbare Teil dieses »Heimkehrer-Denkmals«, das unmittelbar nach Ende des Zweiten Weltkrieges hier errichtet wurde. Wer das Glück hatte, den Leopoldsberg noch zu kennen, bevor er zur ewigen Baustelle verkommen ist, kann sich an das seltsam riesenhafte Rondeau mit seinen zahlreichen Marmortafeln und den dazugehörigen pathetischen Inschriften erinnern. Das ursprünglich dort befindliche Denkmal, das die riesenhaften Proportionen vorgab, war nicht den Heimkehrern und Vermissten des Krieges gewidmet, sondern dem, der diesen Krieg angezettelt hatte: Adolf Hitler. Die Inschrift, die die NS-Architekten hier hinterließen und die nach dem Krieg ziemlich rasch entfernt wurde, lautete: »Diese Stadt ist in meinen Augen eine Perle, ich werde ihr jene Fassung geben, die dieser Perle würdig ist. Adolf Hitler.«
Mit dem beruhigenden Wissen, dass zumindest dieses Erinnerungsstück an schreckliche Zeiten aus dem Wienerwald entfernt worden ist, machen wir uns allmählich auf den Heimweg. Wer es gerne steil und zeitsparend hat, kann jetzt auf dem bereits erwähnten Nasenweg ins Kahlenbergerdorf absteigen. Wer keinen Schritt mehr machen möchte, wartet hier einfach auf den Bus 38A, der einen über den Kahlenberg und den Cobenzl nach Grinzing bringt. So kann man das rumpelnde Höhenstraßen-Pflaster genießen. Wer sich dabei noch ein paar Minuten Zeit für eine kuriose Anekdote, die mit der Höhenstraße unmittelbar zusammenhängt, nehmen möchte, steigt, kurz bevor der Bus von der Höhenstraße in Richtung Grinzing abbiegt, an der Ecke Krapfenwaldgasse aus. Genau am Eck steht nämlich ein auf den ersten Blick rätselhaft großer Steinsockel, der sonst nichts zu bieten hat. Einst stand darauf eine Statue des heiligen Engelbert. Der wäre als Heiliger von nicht allzu großer Bedeutung, aber er ist ein Namensvetter von Engelbert Dollfuß, dem bereits erwähnten Bundeskanzler im autoritären Ständestaat. Dollfuß hat genau an dieser Stelle den ersten Spatenstich für die Höhenstraße getan, und weil er sich selbst bei aller Eitelkeit nicht auf das dazugehörige Denkmal stellen lassen konnte, entschied man sich eben für den Heiligen. Natürlich mit einer Gedenktafel, die ausführlich an Dollfuß’ hiesige Ruhmestat erinnerte. Die Nationalsozialisten ließen den Heiligen und damit die Erinnerung an Dollfuß entfernen – und das Rote, sozialdemokratische, Wien hatte nach dem Krieg auch keine allzu große Lust, an dieser Stelle an den politischen Todfeind zu erinnern. Darum steht heute auf dem großen Steinklotz nur noch ganz klein – und nicht ohne leise Häme – »Vermessungspunkt«.
Tipps für die Wanderung:
Anfahrt am besten mit der Straßenbahnlinie D bis Nußdorf, Heimfahrt entweder vom Kahlenberg beziehungsweise Leopoldsberg mit der Autobuslinie 38A oder ab Grinzing mit der Straßenbahnlinie 38. Zum Einkehren besonders empfehlenswert sind die Heurigen am Nußberg, entweder der Klassiker Sirbu oder die Dependance des Heurigen Mayer am Pfarrplatz – vor allem wegen der bequemen Liegestühle – oder der etwas weiter oben gelegene Hirt. Ebenfalls gut, wenn auch an Wochenenden etwas überlaufen, ist die Josefinenhütte zwischen Kahlenberg und Leopoldsberg.
Für die Runde zu beiden Gipfeln inklusive Heimkehr nach Grinzing sind etwa drei Stunden zu veranschlagen, steile Anstiege, etwa von Nußdorf Richtung Kahlenberg, machen den Ausflug durchaus anspruchsvoll.