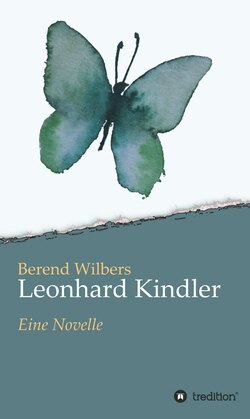Читать книгу Leonhard Kindler - Eine Geschichte auf den Spuren des dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte in der Gegenwart - Berend Wilbers - Страница 5
ОглавлениеI
Kindler war wie immer bestens gelaunt, als er sich am frühen Montagmorgen auf den Weg zur Arbeit machte. Zu einer Tageszeit, der die meisten Menschen nichts Vergnügliches abgewinnen können, pulsierte in seinen Adern längst das blühende Leben, eine Stimmung, die sich allmorgendlich schon auf dem Weg vom Bett unter die Dusche einstellte und die auch im Laufe des Tages nur selten umschlug. Während andere noch widerwillig die Bettdecke über den Kopf zogen und sich gegen das frühe Aufstehen wehrten oder sich durch die Zeitungslektüre den Tag verhageln ließen, genoss er den ersten Kaffee und die frische Luft auf dem Balkon seiner kleinen Wohnung und war voller Vorfreude auf den Tag. Selbst die Beschwernisse eines Berufs, der ihn gelegentlich mit unzufriedenen, teilweise auch aufgebrachten Mitmenschen zusammenführte, und der bedauerliche Umstand, dass er von Zeit zu Zeit aus unerklärlichen Gründen unter Schlafstörungen litt, trugen nicht dazu bei, dass sich seine Stimmung merklich eintrübte.
Angesichts einiger ewig schlecht gelaunter Zeitgenossen beschäftigte ihn schon ab und an die Frage, was wohl der Grund seines permanenten Hochgefühls sein mochte. Einer bewussten Entscheidung oder besonderer Erfahrungen hatte es jedenfalls nicht bedurft. Solange er sich zurück erinnern konnte, von frühster Kindheit an, war es so gewesen. Das sonnige Gemüt sei ihm mit in die Wiege gelegt worden, versuchte seine Frau Mama zu erklären, wenn er den Widrigkeiten des Lebens, die auch ihm nicht erspart geblieben waren, seinen schier unerschöpflichen Optimismus und eine gute Portion Humor entgegen setzte. Der an sich eher positiven Eigenschaft den Makel eines Geburtsfehlers anzuhaften, war allerdings keine Vorstellung, mit der er sich anfreunden mochte, genauso wenig wie mit der Diagnose seiner Ex, einer Medizinstudentin im zweiten Semester, die darin die Vorzeichen einer bipolaren Störung zu erkennen meinte und deshalb vermutlich das Weite gesucht hatte. Das unerwartete Ende seiner ersten großen Liebe rief zwar die Fragen nach seiner Gemütsverfassung auf unangenehme Weise wieder wach; am Ende amüsierte ihn aber die verwunderliche Feststellung, dass selbst ein Überschuss an Glückshormonen für eine hoffnungsvolle Beziehung als Trennungsgrund geeignet zu sein schien. So beließ er es schließlich bei der Erkenntnis, dass es allemal besser sei, seine Zeit gut gelaunt zu verbringen, anstatt Bekannten und Freunden mit griesgrämiger Miene den Tag zu beschweren.
Kindler war mit sich und seiner Welt im Reinen und glücklich, sich zu den Menschen zählen zu können, denen das Leben lebenswert und verheißungsvoll erschien.
Auf dem Weg zur Arbeit machte er noch einen kleinen Umweg durch die Oststadt, parkte seinen Wagen vor einem malerischen Fachwerkhaus in der Humboldtstraße und stieg aus. Zu dieser frühen Stunde wirkte die enge Gasse leblos und verschlafen. Nur eine einsame Fußgängerin überquerte auf hohen Absätzen mit vorsichtig trippelnden Schritten das holprige Kopfsteinpflaster. Für einen kurzen Augenblick gab Kindler sich der morgendlichen Ruhe hin und bewunderte wie schon so häufig die prächtigen Fassaden der Gebäude beiderseits der Straße. Keine Frage, die Humboldtstraße war das Schmuckkästchen der historischen Altstadt. In den kunstvoll gearbeiteten Fenstern der hohen, in blassem Gelb oder Weiß gestrichenen Häuser spiegelte sich der Glanz früherer Generationen. Sie hatte wie durch ein Wunder die Kriege ohne großen Schaden überstanden und war jetzt die Attraktion jeder Stadtführung. Mit den meisten Häusern verbanden sich Geschichten, die gerne laut und lachend erzählt wurden, andere dagegen eher leise und hinter vorgehaltener Hand. Kindler hatte sie alle mehr als einmal gehört und konnte sie den einzelnen Fassaden zuordnen, hinter denen sie sich zugetragen haben sollten. Er ließ seinen Blick dem Verlauf der Straße folgen, hielt kurz inne bei dem ein oder anderen sehenswerten Detail, einer aufwändig gearbeiteten Laterne, der geschwungenen Eingangstür mit dem auffälligen Messingknauf, dem alten gusseisernen Briefkasten am Zauntor der Nummer 7, dem ehemaligen Wohnhaus des Rabbiners einer kleinen jüdischen Gemeinde, die es heute nicht mehr gab. Er nahm die Bilder in sich auf, ruhig und gedankenverloren.
Das bösartige Knurren eines fernen Hundes holte ihn zurück.
In der geöffneten Tür des Fachwerkhauses mit der Nummer 3 wurde er bereits erwartet. Eine betagte Dame mit tadelloser Figur und in kerzengerader Haltung lächelte ihm entgegen. Sie trug ein bodenlanges, dunkelblaues Kleid, das keine Schuhe erkennen ließ und den Anschein erweckte, als schwebe sie über den mit Jugendstilmotiven verzierten Fliesen des Hausflures. Ein buntes Seidentuch, kunstvoll um den Hals geschwungen, unterstrich das strahlende Weiß ihrer vollen Haarpracht und verwehrte zudem zu tiefe Einblicke in den etwas gewagten Ausschnitt. Kindler war wie immer fasziniert von ihrem Anblick. Auch wenn das Alter seinen Tribut gefordert hatte, war augenscheinlich, welche ausgesprochene Schönheit sie in jungen Jahren gewesen sein musste. Ihrem unwiderstehlichen Charme und ihrer Ausstrahlung hatten die fast 80 Jahre nichts anhaben können.
Die Bekanntschaft der alten Dame verdankte Kindler seiner Mitarbeit in einem Verein, der sich um alleinstehende Senioren in der Stadt kümmerte. Er hatte schon als Jugendlicher damit begonnen, sich für ältere Menschen zu engagieren. Wenn sie die Dinge des täglichen Lebens nicht mehr allein bewältigen konnten, ging er ihnen zur Hand oder leistete ihnen von Zeit zu Zeit Gesellschaft. Männer wie Frauen, die ihren Ehepartner verloren hatten, freuten sich über seine Besuche, weil er ein angenehmer Gesprächspartner war, der interessiert zuhören, aber auch selber kurzweilig erzählen konnte. Der Verein, dem er vor nun schon mehr als zehn Jahren beigetreten war, stellte den organisatorischen Rahmen und bot eine Reihe weiterer Hilfen an.
Vor etwa zwei Jahren hatte man ihn gebeten, sich um „die alte Frau Thiel aus der Humboldtstraße“ zu kümmern. Bis heute konnte er sein Glück kaum fassen. Sie war einfach umwerfend. Entgegen allen üblichen Gepflogenheiten und Regularien nutzte er jede Gelegenheit für kurze Besuche, erledigte ihre Einkäufe und Behördengänge oder fuhr sie mit seinem Wagen zum Besuch einer alten Freundin in die Nachbarstadt. Wann immer sie ihn um etwas bat, war er zur Stelle, weil er jede Begegnung mit ihr als bereichernd empfand. Er war glücklich und dankbar, diese Aufgabe übertragen bekommen zu haben, war sie doch mehr als eine bloße Entschädigung für die nervige Arbeit im Vereinsvorstand, dem er seit kurzem als Schriftführer angehörte.
„Guten Morgen, Frau Thiel, Sie sehen mal wieder entzückend aus. Hatten Sie ein gutes Wochenende?“
Die grazile alte Dame nickte zur Antwort freundlich lächelnd in seine Richtung. Dann hob sie wortlos in einer fließenden Bewegung ihren rechten Arm, streckte ihn leicht angewinkelt ab und drehte dabei ihre Hand, so dass die offene Handfläche einladend auf den jungen Besucher zeigte.
Kindler lächelte und wusste, was zu tun war.
Ihre Blicke trafen sich und ließen nicht mehr voneinander ab. Ganz langsam ging er auf sie zu und hielt, bei ihr angekommen, kurz mit einer galanten Verbeugung inne. Mit seiner linken Hand umschloss er zärtlich, aber fest die rechte Hand der alten Frau. Für einen Moment verharrten beide, halb auf der Straße, halb in der Tür stehend, in dieser Haltung. Schließlich schob er seine Rechte unter den inzwischen ebenfalls leicht angehobenen linken Arm und legte seine Hand unterhalb des Schulterblatts auf ihren Rücken. Mit leichtem Druck zog er sie kaum merklich etwas näher zu sich. Sie lächelte unentwegt. Und als führte eine unsichtbare Hand Regie, drangen die Klänge eines langsamen Walzers durch die geöffnete Wohnzimmertür an ihre Ohren. Behutsam, fast vorsichtig setzte sich das ungleiche Paar in Bewegung. Mit langsamen Drehungen ging es durch den breiten Hausflur in das geräumige Wohnzimmer. Dort angekommen wurden die Schritte leichter, beschwingter, verschmolzen ihre rhythmischen Bewegungen mit dem Takt der Musik. Unzählige Male umkreisten sie den mahagonifarbenen Teetisch in der Mitte des Raums, einerseits getragen von schönen Erinnerungen, anderseits von der aufkeimenden Hoffnung auf glückliche Zeiten. Erst als nach einer Weile die Musik verstummte, hielten sie inne und sie lehnte für einige Sekunden ihren Kopf an seine Schulter.
„Wunderbar“, flüsterte er.
Und tatsächlich nahm ihn der Zauber dieses Begrüßungsrituals, das sie hin und wieder inszenierte, jedes Mal aufs Neue gefangen. Der reizenden alten Dame gelang es mühelos, vermutlich unterstützt durch das antike Ambiente des großzügigen Hauses, eine ihm fremde Welt zu öffnen, die eine unglaubliche Anziehungskraft auf ihn ausübte. Ihre vornehme Sprache, die Eleganz ihrer Bewegungen, ihre Mimik, geprägt durch ein gelegentliches Auf und Ab der Lider über den immer noch leuchtend blauen Augen, ihr ganzer Habitus faszinierten ihn derart, dass er sich anfangs über sich selbst gewundert und sich lange, letztlich aber erfolglos innerlich dagegen zu wehren versucht hatte. Inzwischen besuchte er sie häufig auch ohne besonderen Grund, ließ geschehen, was die Besuche bei ihr in ihm auslösten und erlaubte sich, ihre Nähe ohne inneren Widerstand zu genießen. Unbeschwert von störenden Gedanken hatten ihre Begegnungen seither eine Intensität, die sie die Zeit vergessen ließ. Sie konnten stundenlang zusammensitzen, erzählten, was sie bewegte oder versetzten sich mit einer Platte aus ihrer großen Sammlung musikalisch in die Zeit ihrer Jugend.
Nach einem dieser langen Abende hatte sie sich beim Abschied überschwänglich bei ihm bedankt und nachdenklich angefügt, sie werde ihm die Zeit, die er mit ihr verbringe, kaum angemessen vergüten können. Zum ersten Mal traute er sich daraufhin, sie in den Arm zu nehmen, eine Gefühlsbekundung, die sie überraschend herzlich erwiderte, und versicherte ihr, er genieße jede Minute ihres Zusammenseins wie ein Geschenk des Himmels, unerwartet und erfüllend zugleich.
„Einen Wunsch hege ich aber doch seit langem“, hatte er sich schließlich mit einem schelmischen Lächeln vorgewagt. „Sie haben mir erzählt, wie gerne Sie in jungen Jahren getanzt haben. Mir fehlte bisher der Mut, einen Tanzkurs zu belegen. Mit Ihnen als Lehrerin würde ich dieses kleine Abenteuer nur zu gerne in Angriff nehmen.“
Sie ließ sich ohne zu zögern darauf ein und führte ihn in den folgenden Wochen und Monaten mit viel Geschick und wachsendem Vergnügen in die Welt der klassischen Tänze ein. Zu seiner eigenen Überraschung erwies sich Kindler als gelehriger Schüler, der schnell Fortschritte machte. Und als er längst alle Tänze sicher beherrschte, animierten die beglückenden Momente, die beide im Tanz erlebten, sie dazu, auch weiterhin einen großen Teil ihrer gemeinsamen Zeit im Gleichklang von Rhythmus und Bewegung zu verbringen. Die Abende endeten zumeist mit einem Glas Wein und langen Gesprächen. Bisweilen benahmen sie sich bei alldem wie ein frisch verliebtes Paar, ohne allerdings die Grenzen des Anstandes auch nur zu berühren. Ein Beobachter hätte sich zweifellos und angesichts des Altersunterschiedes sicherlich leicht irritiert gefragt, ob in Mimik und Gestik der beiden nicht mehr zu lesen war als bloße Sympathie. Die Blicke, die sie einander zuwarfen, die zarten, wie zufällig erscheinenden Berührungen, konnten leicht auch als Bestätigung dafür verstanden werden, dass Liebe nicht an den Grenzen der Altersgruppe haltmacht. Darauf angesprochen, hätte die spielerische Leichtigkeit, mit der sie solche Abende durchlebten, vermutlich gelitten.
So aber blieb dieses kleine Geheimnis ein dauerhaftes, ungetrübtes Glück.
*
Als Kindler an diesem Morgen das Foyer des Bürogebäudes betrat, in dem er arbeitete, waren die Eindrücke der frühen Begegnung mit der vitalen alten Dame noch allgegenwärtig. Die kurze Wegstrecke von dem Haus in der Humboldtstraße reichte kaum aus, um reibungslos den Übergang aus der verträumten, analogen Welt der Frau Thiel in seinen digitalisierten Alltag zu schaffen. Auch der ästhetische Kontrast zwischen der künstlerisch verspielten Jugendstilvilla und der nüchternen Architektur des Verwaltungsgebäudes konnte größer nicht sein.
In dem grell erleuchteten, schmucklosen Treppenhaus traf er zu seiner Überraschung auf Hubert-Karl Graf von Kranzwegen, der von allen nur „HvK“ genannt wurde. Diese banale Ableitung seines adligen Namens verdankte der Kollege der Angewohnheit, sämtliche Schriftsätze aus seiner Feder aus leicht nachvollziehbaren Gründen mit eben diesem Kürzel zu zeichnen. Er entstammte einer alten südhessischen Adelsfamilie, mit der ihn nach eigenem Bekunden nur noch wenig verband. Allgemein wurde vermutet, es habe in der Vergangenheit Streitereien gegeben, die zum Bruch und HvK in den Norden geführt hatten. Von ihm selbst war darüber nichts zu erfahren.
Kindler hatte sich mit ihm in den ersten Jahren seiner Berufstätigkeit ein Büro geteilt. Der etwas knorrige, ältere Herr, etwa zwei Köpfe kleiner als er selbst, war dem jungen Berufsanfänger von Anfang an mit Sympathie begegnet und ihm eine echte Hilfe gewesen. Obwohl er sein Studium als einer der Besten des Jahrgangs mit fundierten Kenntnissen der komplexen Materie abgeschlossen hatte, zeigten ihm die Anforderungen der Praxis gelegentlich Grenzen auf. Wann immer er in den Anfangsjahren nicht mehr weiter wusste, konnte er sich der kollegialen Unterstützung des Grafen sicher sein. Ganz nebenbei entwickelte sich über den beruflichen Kontakt hinaus ein fast freundschaftliches Verhältnis. In Anbetracht der wirklich völlig unterschiedlichen Charaktere war das so von niemandem erwartet worden und alles andere als selbstverständlich. Natürlich ergibt sich fast zwangsläufig eine gewisse Nähe zwischen Personen, die den größten Teil des Tages zu zweit in einem Büro verbringen. Die Eigenheiten und Marotten des jeweils anderen hätten aber leicht auch das genaue Gegenteil bewirken können. Nach Einschätzung aller Kollegen war es vor allem dem immer freundlichen und gut aufgelegten Kindler zu verdanken, dass das gute Verhältnis der beiden schon nach kurzer Zeit als beispielhaft galt und für die These herhalten musste, dass ein kollegiales Miteinander sehr wohl gelingen kann, auch wenn im Vorfeld alles dagegen zu sprechen scheint. Vermutlich war es deshalb nicht nur eine Anspielung auf den Größenunterschied, der eine wohlmeinende Kollegin veranlasste, den beiden mit „Pat und Patachon“ einen Beinamen zu geben, der schnell im ganzen Haus verbreitet war.
Nach zwei gemeinsamen Jahren hatte HvK eine neue Herausforderung gesucht und sich in den Außendienst versetzen lassen. Seither begegneten sie sich nur noch selten. Der Graf sorgte allerdings seit einigen Monaten im Kollegium für Gerede, weil er sich an exponierter Stelle in einer neuen Partei engagierte, die dem rechten politischen Spektrum zugerechnet wurde. Die massive Kritik, die von Kranzwegen dafür im Haus, aber auch in der lokalen Presse einstecken musste, war für Kindler nur schwer auszuhalten. Das schlimme Bild, das jetzt von dem geschätzten Kollegen gezeichnet wurde, wollte so gar nicht zu seinen eigenen Erfahrungen aus den Tagen der Bürogemeinschaft passen. Er hatte bisher vergeblich nach einer Gelegenheit gesucht, darüber mit ihm näher ins Gespräch zu kommen. Die Begegnung im Treppenhaus schien dafür wenig geeignet. So beließ er es bei einer kurzen Unterhaltung, in der die gewachsene Nähe unbelastet von kritischen Nachfragen spürbar blieb.
Noch nachdenklich betrat Kindler sein Büro und nahm an seinem Schreibtisch Platz. Schon als auf dem großen Flachbildschirm die Eingänge seines Email-Kontos sichtbar wurden, zeigten die entspannten, fröhlichen Züge wieder das allen vertraute Gesicht eines jungen Mannes, der den Tag willkommen heißt.
*
Ohne anzuklopfen öffnete sie die Tür, trat ein und saß im nächsten Moment auf dem Besucherstuhl neben seinem Schreibtisch.
„Hallo Leo! Na, schon wieder in bester Stimmung am Montagmorgen?“
„Die Woche hätte kaum besser beginnen können“, erwiderte Kindler lächelnd, „ich hoffe, du hast nicht die Absicht, daran etwas zu ändern.“
„Warum sollte ich? Schließlich bin ich hier, um mich von deiner guten Laune anstecken zu lassen.“
„Als ob du das nötig hättest. Wenn ich mich nicht ganz täusche, hast du schon gestrahlt, als du durch die Tür gekommen bist.“
„Woran das wohl liegen mag….“
Ohne äußere Anzeichen genoss sie still die leichte Verlegenheit, die sich mit dieser Andeutung auf das Lächeln ihres Gesprächspartners legte. Ihr war überhaupt nicht daran gelegen, weitere Bestätigungen für die betörende Wirkung zu erhalten, die sie auf ihr männliches Umfeld hatte. Unverhohlen zweideutige Komplimente und zunehmend lästig werdende Annäherungsversuche, derer sie sich fast täglich erwehren musste, ließen sie langsam daran zweifeln, dass ihre betont weibliche Ausstrahlung bei der Suche nach einer festen, liebevollen Beziehung, nach der sie sich sehnte, besonders hilfreich war. Sie wusste, dass von Leonhard Kindler nichts dergleichen zu befürchten stand. Er war seit langem der Erste, dem es mühelos gelang, ihr im Gespräch offen und zugewandt in die Augen, und nur in die Augen zu sehen. Vermutlich hätte es sie nicht einmal gestört, wenn er sich ab und an ein wenig hätte ablenken lassen, denn sie fühlte sich seit der ersten Begegnung von dieser unbändigen Lebensfreude, der lebhaften Sprache und dem unaufdringlichen Wesen ihres Kollegen magisch angezogen. In den letzten Monaten hatte sie bei ihm zudem eine äußerliche Verwandlung beobachtet, die sie sich nicht erklären konnte und die ihren Wunsch, ihn näher kennenzulernen, noch verstärkte. Seine Körperhaltung war aufrechter, spannungsvoller geworden, seine Bewegungen leichtfüßiger, fast tänzelnd, seine ganze Körpersprache hatte an Ausdruck gewonnen, eine Wahrnehmung, die die junge Frau – bewusst oder unbewusst – immer häufiger seine Nähe suchen ließ. Auf den eigentlichen Grund ihrer Zuneigung angesprochen, hätte sie allerdings ohne Frage seine wohltuend zurückhaltende, fast schüchterne Art betont, mit der Kindler auch jetzt die kleine Anspielung unbeantwortet ließ.
Er musste sich nicht einmal dazu zwingen.
Die Bemerkung hatte ihm zwar geschmeichelt; den Gedanken aber, Elisabeth Körber könnte an mehr als einem guten kollegialen Verhältnis interessiert sein, mochte er nicht ernsthaft zulassen. Sie spielte für ihn in einer völlig anderen Liga. Abgesehen von ihrer äußerst attraktiven Erscheinung, die ihm natürlich nicht entgangen war, entstammte sie der wohl angesehensten Familie in der Gegend. Ihr Onkel war erst vor kurzem in das Amt des Oberbürgermeisters gewählt worden, ihr Vater leitete das Familienunternehmen, einen großen Industriebetrieb der Elektronikbranche. Es stand kurz davor, mit Veranstaltungen über mehrere Tage das 50-jährige Firmenjubiläum zu begehen. Mutter Körber, wurde erzählt, sei in jungen Jahren eine begehrte Schauspielerin gewesen, die ihre Karriere nach der Heirat aufgegeben habe, ihrem Mann zuliebe oder weil so etwas damals eben üblich gewesen sei. Die Familie wohnte etwas außerhalb in einem großzügigen Anwesen, das aufgrund der aufwändigen Architektur und einem wunderschönen, parkähnlichen Garten sofort ins Auge fiel, wenn man sich von Südwesten her der Stadt näherte. In dieser Welt der Schönen und Reichen, überkam Kindler eine väterliche Erkenntnis, konnte es für ihn, den Sohn eines kleinen Handwerkers vom Dorf, keinen Platz geben.
„Liebste Lisa“, versuchte er augenzwinkernd vorsichtig das Gespräch zu beenden, „es tut mir leid, aber ich habe heute Vormittag eine Verhandlung, auf die ich mich noch vorbereiten muss…“
Sie strahlte ihn immer noch an.
„Sag das nochmal!“
„Bitte. Mach es mir nicht schwerer, als es ohnehin schon ist. Ich würde ja gerne noch mehr Zeit mit dir verbringen, aber“
„Nicht den Rausschmiss, nur die Anrede!“
„Liebste Lisa…?“
„Siehst du! Es geht doch.“
Sie stand auf und hatte im nächsten Moment das Zimmer verlassen, genauso schnell und unvermittelt, wie sie gekommen war.
*