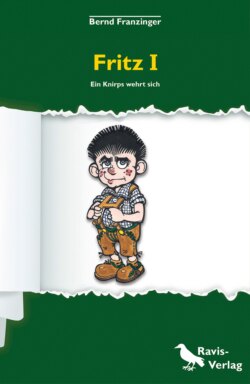Читать книгу Fritz I - ein Knirps wehrt sich - Bernd Franzinger - Страница 6
1. Kapitel
Оглавление»Trofnih, ho Tiehleknud, ho Tiehleknud«, presste Friedrich Karl Eckstein mitten in einer Presswehe über die zahnlosen Kiefer.
Er war sehr ungehalten. Kein Wunder, denn es ging kaum voran. Wie ein Pfropfen steckte er im Geburtskanal fest. Bei jeder Wehe durchlitt er Höllenqualen. Und dazu auch noch diese unerträglichen, animalischen Laute seiner Mutter. Wo doch gerade er so sehr die Stille liebte. Wie gerne hätte er an die fleischigen Wände getrommelt. Aber er konnte noch nicht einmal eine Faust ballen, so eng war es in seinem Gefängnisschlauch.
Plötzlich spürte er einen kalten Gegenstand an seinem Kopf, dann ein lautes Knacken. Dieses Geräusch hatte er schon einmal gehört. Und zwar an Weihnachten, als Hubi einen Truthahn zerlegte.
Endlich gab der Muskelring über seiner Schädeldecke nach und das Köpfchen glitt hinaus ins Freie. Doch der Rest des Körpers blieb in der engen Höhle eingesperrt. Der kleine Fritz fühlte sich wie eine neugierige Schildkröte. Allerdings steckte sein faltiger Kopf nicht in einem Panzer, sondern im blutenden Schoß der Mutter.
Fritz schlug die Augen auf und schaute sich verwundert um.
»Riw nebeil neseid nenielk Mruw, re driw nedrew sersnu Snebel Mrut«, brabbelte er.
Wie oft hatte er diesen Spruch in den letzten Wochen gehört. Nun musste er ihn einfach zum Besten geben. Seine biologischen Erzeuger hatten dieses Mantra mehrmals täglich heruntergeleiert.
Zweck: Aufbau einer positiven Emotionalität.
Zielperson: Er, Friedrich Karl Eckstein, die ungeplante Leibesfrucht.
Diese Autosuggestion war auch bitter nötig gewesen. Denn je näher der Geburtstermin heranrückte, umso weniger euphorisch blickten Bea und Hubi ihrem Nachwuchs entgegen.
Von Gewissensbissen zermartert, hatten die beiden Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe aufgenommen. Dort erhielten sie den entscheidenden Tipp: Konsultation eines Psychotherapeuten, seines Zeichens ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der pränatalen Elternprogrammierung.
Fritz bekam bei diesen Sitzungen Kopfweh, der Therapeut einen dicken Geldbeutel.
Das als Gedankenstopp konzipierte Mantra fand stets dann seine litaneiartige Anwendung, wenn die beiden Zellenspender wieder einmal ein gemeinsames Klagelied anstimmten. Und das passierte recht häufig, um nicht zu sagen andauernd.
Die werdende Mutter jammerte oft und sorgte sich um vieles, auch um ihre knackige Figur.
Der werdende Vater dagegen trauerte eher still, vor allem um das schöne Cabrio.
»Haben Sie das eben gehört?«, stieß die feiste Hebamme aus.
Niemand reagierte, auch der Arzt nicht, der war mit seinen Gedanken schon auf dem Fußballplatz. Und die niederkommende Erstgebärende vernahm lediglich ihr eigenes, brunftähnliches Stöhnen.
Doch der kreidebleiche Mann neben ihr hatte kein offenes Ohr für diesen emphatischen Auswurf. Er saß auf einem Hocker und schnaufte synchron mit der Frau, mit der er zwar nicht verheiratet war, die er aber trotzdem als seine Frau bezeichnete.
Tapfer hatte er das solidarische Mithecheln in einem Geburtsvorbereitungskurs eingeübt. Aber nun geriet das rhythmische Schnauben aus dem Rhythmus und löste einen Sauerstoffüberschuss aus.
Dr. Hubert Wollenweber begann zu zittern, Gänsehaut spross auf seinem dichtbewaldeten Arm. Vor seinen zuckenden Augen baute sich eine riesige schwarze Wand auf. Sein Oberkörper neigte sich bedrohlich zur Seite.
Zu Hubis großem Glück schielte der Arzt. Denn so wurde er auf ihn aufmerksam, obwohl er eigentlich seinen Blick auf Fritz gerichtet hatte. Geistesgegenwärtig stürzte er sich auf den ohnmächtig werdenden, werdenden Vater. Er fing ihn noch rechtzeitig ab und schleppte ihn zu einer Liege.
»Herr, Herr Doktor, der, der Kleine hat eben etwas vor, vor sich hingestammelt«, stammelte die Hebamme.
Gemessenen Schrittes begab sich der Arzt zu der korpulenten Frau und legte ihr eine Hand auf die Schulter.
»Beruhigen Sie sich, meine Liebe. Mir scheint, Sie sind ein wenig überarbeitet«, säuselte er. Sanft tätschelte er die teigige Speckwulst in ihrem Nacken. »Schon die fünfte Geburt hintereinander. Und dann auch noch Zwillinge dabei. Da hört jeder irgendwann einmal Stimmen.«
Die Hebamme rieb ihre feuchte Stirn und schüttelte den Kopf. »Daran muss es wohl liegen, Herr Doktor. Das kann ja auch überhaupt nicht sein.«
Der Stationsarzt lachte auf. »So ist es, meine Liebe.«
Angesichts dieser offenkundigen Ignoranz seiner frühkindlichen Sprachkompetenz entschloss sich Friedrich Karl Eckstein dazu, fortan zu schweigen.
»Wie ich sehe, mag sich unser neuer Erdenbürger noch nicht so recht hinaus in die Freiheit wagen«, meinte der Arzt schmunzelnd. »Schon merkwürdig. Das hab ich wirklich noch nie erlebt: Das Köpfchen ist draußen …«
Er stockte, beugte sich hinunter zum Ohr der Hebamme und fuhr wispernd fort: »Aber trotz Dammschnitt geht es nicht weiter. Der Kleine hat anscheinend stocksteife Schultern – wie eine Vogelscheuche.«
Das war nun aber wirklich zu viel des Guten, fand jedenfalls der kleine Fritz und erbrach sich.
Es sollte nicht das letzte Mal in seinem Leben sein.
»Oh Gott, Herr Doktor, was ist denn das?«, keuchte die Hebamme. »Das sieht ja aus wie Kindspech.«
Der Gynäkologe setzte eine skeptische Miene auf. »Kindspech aus dem Mund?«, flüsterte er. »Unmöglich! Dieses Sputum kann kein Mekonium sein.«
Mutups? Muinokem? Ehetsrev niek Trow!, kommentierte Fritz tonlos. Anschließend drückte er mit der Zungenspitze den Rest der zähflüssigen schwarzen Masse über seine Lippen hinweg.
»Dies käme wohl einem anatomischen Wunder gleich«, erklärte der Arzt unterdessen. »Jedenfalls muss die Sache dringend diagnostisch abgeklärt werden.«
Ein weiterer Schnitt mit der Geflügelschere – und Friedrich Karl Eckstein flutschte hinaus in eine Welt, die noch sehr viel Freude an ihm haben sollte.
Nachdem Beatrice Eckstein den sperrigen Quälgeist nun endlich ausgespien hatte, verschwanden die verhärmten Züge aus ihrem Antlitz. Zum ersten Mal nach vielen Leidensmonaten feuerte sie sogar ein kleines Lächeln in Richtung ihres eingeborenen Sohnes ab. Sie hob ein wenig den Kopf, spähte durch ihre zum Victoryzeichen gespreizten Beine. Trotzdem konnte sie ihn nicht sehen.
Er sie auch nicht – was der frischgebackene Erdenbürger Friedrich Karl Eckstein nicht sonderlich bedauerte.
Hören konnte sie ihn ebenfalls nicht. Denn Fritz schrie nicht. Fritz schrie nie – aus Prinzip. Schreien verabscheute er zutiefst. Er empfand diese nervtötende Kräherei als primitiv, disziplinlos und vulgär. Deshalb verzichtete er gänzlich darauf.
Dann sollte der kleine Fritz abgenabelt werden.
Hubi war dazu nicht in der Lage, lag er doch regungslos auf der Liege.
Und Bea wollte nicht. Das sei ihr zu eklig, meinte sie angewidert.
Nun wurde es der Hebamme zu blöd. Sie nahm die Sache, besser gesagt die Schere, selbst in die Hand und kappte ritsch-ratsch die Versorgungsleitung. Anschließend packte sie Friedrich Karl Eckstein in eine kuschelweiche Decke und trug ihn weg.
Diese überhastete Maßnahme missfiel Fritz sehr, denn eigentlich wollte er sich noch in aller Ruhe von seiner Plazenta verabschieden. Schließlich hatte ihn der Mutterkuchen seiner Mutter monatelang ernährt. Er war ihm in dieser Zeit regelrecht ans Herz gewachsen.
Den obligaten Lungenfunktionstest bestand er auf Anhieb, weil er wie ein Miniaturwalross ein paarmal kräftig schnaubte. In Anbetracht dieser beeindruckenden Vorführung blieb er von weiteren Foltermaßnahmen verschont. Allerdings nicht lange, denn die moderne Postnataldiagnostik wetzte bereits ihre Messer – im übertragenen Sinne versteht sich.
Das Ultraschallgel war glibberig und kalt. So kalt, dass sich alles an und in ihm zusammenkrampfte. Aber Friedrich Karl Eckstein weinte nicht. Er presste die zahnlosen Kieferchen aufeinander und ließ die Tortur tapfer über sich ergehen.
Selbst als ihm ein verkleideter Vampir brutal in die winzige Ferse stach und mehrere Tropfen dringend benötigten Lebenssaftes herausquetschte, schrie er nicht. Obwohl er wirklich allen Grund dazu gehabt hätte.
Irgendwann brachte man ihn zurück in den Kreißsaal, in dem sich aber zum Glück keine Kreissägen befanden.
Seine Mutter war noch da. Von Plazenta und Kindsvater jedoch keine Spur. Ersteres bedauerte er.
Obwohl er dem akademischen Oberrat Dr. Hubert Wollenweber die Hälfte seiner genetischen Grundausstattung verdankte, hegte er ihm gegenüber ein recht angespanntes, um nicht zu sagen feindseliges Verhältnis. Denn auch er hatte nach ihm gestochen. Sogar häufig, beinahe täglich. Zwar nicht mit einer Kanüle, aber trotzdem hatte er dabei Todesängste ausgestanden.
Normalerweise konnte sich Fritz durch eine geschickte Körperdrehung vor diesen Attacken rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nur ein einziges Mal hatte er so tief und fest geschlafen, dass er den Eindringling zu spät bemerkte.
Ohne jegliche Rücksicht hatte ihm dieser lustmolchige Kerl die Spitze seines langen Gummiknüppels in die Fontanelle hineingerammt, obwohl dies anatomisch angeblich gar nicht möglich war. Aber Hubi hatte es irgendwie geschafft. Damals war in Friedrich Karl Ecksteins Kopf einiges durcheinandergeraten. Seitdem dachte und sprach er die Worte rückwärts.
Zumeist war der werdenden Mutter das forsche Drängen des werdenden Vaters unangenehm gewesen. Doch dieser triebgesteuerte Wüstling hatte es immer wieder geschafft. Bis zuletzt. Selbst gestern noch.
»Das Tier in mir, es lechzt nach dir«, hatte er mit lüsterner Stimme geraunzt. Und das mehrmals hintereinander!
Bea zierte sich nur kurz, dann gewährte sie ihm Einlass. Auf Friedrichs Bedürfnisse nahm niemand Rücksicht. Er wurde heftig durchgeschüttelt – und dann auch noch diese tierischen Geräusche. Wie gerne hätte er zugebissen.
Als die ekstatischen Leibesübungen endlich beendet waren, tastete die werdende Mutter den prallen Bauch ab und forschte nach einem Lebenszeichen ihrer Leibesfrucht. Aus Wut über diesen barbarischen Akt bewegte sich Friedrich Karl Eckstein keinen Millimeter mehr.
Aber nur so lange, bis Beas Herz losraste. Dann sandte er Klopfzeichen und planschte ein bisschen im Wasser herum. Schließlich wollte er jegliche Panik vermeiden.
Aus gutem Grund, denn seine Mutter war psychisch nicht sonderlich belastbar. Das hatte er in den letzten Monaten oft genug mitbekommen. Während der gesamten Schwangerschaft war sie in psychotherapeutischer Behandlung. Und Fritz war stets dabei, obwohl er das gar nicht wollte. Aber danach hatte keiner gefragt.
Offensichtlich wurde er der Hebamme lästig, denn sie legte ihn auf dem schwabbeligen Bauch der Mutter ab. Fritz öffnete die Augen. Was er sah, begeisterte ihn nicht sonderlich. Also schlug er die Lider wieder nieder. Trotzdem begann er zu schmatzen. Denn er hatte Hunger, Bärenhunger.
Beatrice Eckstein jedoch machte keinerlei Anstalten, sein dringliches Bedürfnis zu stillen. Statt ihres Klinikleibchens schob sie ihren Sohn beiseite.
»Seine spitzen Knochen drücken mir ganz doll in den Bauch«, klagte sie mit Blick auf Fritzchens stocksteife Schultern. Danach begann sie zu jammern. Und zwar eine ganze Weile.
Die Hebamme konnte dieses Drama nicht länger mitansehen und erlöste die Wehleidige, indem sie den Neugeborenen auf den Arm nahm – im ursprünglichen Wortsinne.
Nun lag Fritz nur wenige Zentimeter von ihrer Achselhöhlenkloake entfernt. Ein unerträglicher Schweißgeruch kroch ihm in die Nase und setzte sich wie eine modrige Klette darin fest. Der Gestank war kaum zu ertragen.
Notgedrungen stellte Friedrich Karl Eckstein auf Mundatmung um. Am liebsten wäre er in einen Bottich mit warmem Fruchtwasser gesprungen und nie mehr aufgetaucht. Auch wünschte er sich sehnlichst seine Plazenta herbei. Doch die blieb weiterhin verschollen.
Anstelle des Mutterkuchens kehrte der Vater zurück.
Sogleich wollte die Hebamme Fritz an den fast zwei Meter großen Samenspender weiterreichen. Aber der zeigte ihr abwehrend die Handflächen und tönte:
»Nein, nein, das lassen wir mal lieber bleiben. Ich hab Angst, dass ich ihm wehtun könnte. Der sieht so mickrig aus. Und dann diese abartigen Schultern.« Der frischgebackene Spätvater bedachte den Arzt mit einem fragenden Blick. »Das ist doch nicht normal, oder?«
Friedrich Karl Eckstein hatte genau hingehört. Zur Strafe übergab er sich – mitten hinein in Hubert Wollenwebers fliederfarbenes Seidenhemd.
In Hubis Gesicht frästen sich tiefe Gräben der Abscheu. »Igitt, was ist denn das für ein ekliges Zeug?«, spuckte er angewidert aus.
Der Medizinmann klatschte sich an die Stirn »Ach, das hätte ich ja fast vergessen«, erklärte er. »Bei der Ultraschalluntersuchung haben wir eine ungewöhnliche Ausstülpung entdeckt. Quasi so etwas wie einen Appendix, allerdings an der falschen Stelle.«
Xidneppa? Saw tsi sad?, fragte sich der kleine Fritz.
Anscheinend konnte dieser Arzt nicht nur Geflügelscheren bedienen, sondern auch Gedanken erraten, denn er übersetzte sogleich: »Ein Wurmfortsatz – zwischen Magen und Zwölffingerdarm. Allerdings können wir noch nicht mit Bestimmtheit sagen, ob diese ungewöhnliche Anomalie«, er stockte, schürzte angewidert die Lippen und zeigte auf Huberts besudeltes Hemd, »für die Produktion dieser merkwürdigen Substanz verantwortlich ist.«
Mit einem verstohlenen Blick taxierte Fritz die beiden Männer. Auch sie begutachteten ihn, allerdings wie einen Aussätzigen. Aber das war ihm zu diesem Zeitpunkt ziemlich egal. Es gab etwas viel Wichtigeres für ihn: Er hatte nämlich noch immer nichts zu essen bekommen. Demonstrativ begann er zu schmatzen, und zwar so laut es ging.
Die Hebamme reagierte postwendend. »Wollen Sie Ihren Kleinen denn nicht endlich stillen?«, forderte sie mit Nachdruck. Offensichtlich hatte sich gerade ihr Mutterinstinkt zu Wort gemeldet.
Ganz im Gegensatz zu seiner eigenen Mutter, die nicht reagierte, nur weiter vor sich hin wimmerte. Während der gesamten Schwangerschaft war sie nie in einen Brutrausch verfallen, nicht eine einzige Sekunde lang.
»Geben Sie ihm jetzt endlich die Brust!«, befahl die korpulente Frau.
Beas Kinnlade fiel herunter. Aus Schock vergaß sie sogar einen Moment lang ihre postnatale Depression. »Stillen? Oh nein, mein schöner Busen.«
»Oh nein, ihr schöner, schöner Busen!«, pflichtete der akademische Oberrat Dr. Hubert Wollenweber eiligst bei, um die Katastrophe noch zu verhindern.
Kopfschüttelnd stürmte die Hebamme aus dem Kreißsaal. Kurz darauf kehrte sie mit einem Plastikfläschchen zurück. Ohne Vorwarnung drückte sie dem kleinen Fritz den Latexsauger zwischen die Lippen.
Reflexartig saugte er daran, schließlich hatte er noch immer einen Bärenhunger. Aber der Geschmack war so widerlich, dass er die Kunstnahrung umgehend wie mit einem Wasserzerstäuber aussprühte – direkt auf die Brillen der beiden Fleischbeschauer.
Der anschließende Kampf um die Mutterbrust währte den gesamten restlichen Tag. Friedrich Karl Eckstein obsiegte.
Es war nicht der letzte Sieg in seinem Leben.
Fritz verstand nicht, weshalb seine Mutter unbedingt im Krankenhaus bleiben wollte. Er jedenfalls hatte die Nase gestrichen voll. Dieses öde Zimmer, dieses ständige Wehklagen – und diese fette Hebamme, die immer so grob an ihm herumhantierte.
Vor allem, wenn er nackend war.
Einmal wurde es ihm zu bunt und er schoss ihr einen gelben Strahl ins Gesicht.
Während Bea am liebsten nie mehr aus ihrem Bett gekrochen wäre, wollte er so schnell wie möglich weg von hier. Er war unheimlich gespannt auf sein neues Zuhause – das ja zugleich sein altes war. Denn gelebt hatte er dort ja bereits mehrere Monate, aber gesehen hatte er es noch nicht. Genauso wenig, wie er darin herumgeschnüffelt hatte, worauf er sich besonders freute.
Doch Beatrice Eckstein weigerte sich. Obwohl sie maßgeblich dafür verantwortlich war, musste er als Begründung herhalten. Zuerst waren es weitere diagnostische Maßnahmen, mit denen man ihn drangsalierte.
Und dann begann ihre linke Brustwarze zu bluten.
Einfach so!
Das beeinträchtigte seine materielle Grundversorgung. Aus Wut darüber bekam er Gelbsucht. Ihm gefiel die neue Hautfarbe. Den Ärzten dagegen weniger.
Die Probleme mit seiner dauerpiensenden Nahrungsquelle verschärften sich. Bea begann sofort zu weinen, wenn sie Friedrich Karl Eckstein erblickte. Deshalb musste er unzählige Stunden in einem Säuglingsgefängnis verbringen.
In diesem Wartesaal des Lebens standen viele Babyställe herum. Manche waren sogar verglast und sahen aus wie Aquarien. Wasser war aber keins darin. Was Fritz zutiefst bedauerte. Denn seine Altersgenossen schrien, was das Zeug hielt. Warum, wusste er nicht. Aber der Lärm störte ihn gewaltig.
Nur im benachbarten Gitterkäfig war es still. Der darin eingesperrte Kollege trug ein roséfarbenes Armbändchen am rechten Arm, einen linken hatte er nicht. Er glotzte zu ihm herüber. Aber dieses Glotzen war anders, irgendwie unsymmetrisch. Der kleine Fritz schloss die Augen, er mochte keine Gaffer.
Beatrice Eckstein bekam Antidepressiva verabreicht. Die Medikamente schlugen an. Das freute die Ärzte, Fritzchen dagegen weniger. Denn das Psycho-Doping wirkte auf seine Mutter wie ein Regenguss auf verdörrtes Brachland.
Bei ihr sprossen allerdings keine Blumen, sondern Affenliebe. Und das mit all ihren lästigen Begleiterscheinungen: Urplötzlich fummelte sie überall an ihm herum, streichelte ihn, roch an ihm, küsste ihn. Einmal leckte sie ihn sogar am Arm. Da musste sich der kleine Fritz übergeben.
Die unerwünschten Liebkosungen hatten aber auch ihr Gutes: Sie verschafften Fritz endlich die Möglichkeit, seine Mutter einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Zum ersten Mal übrigens.
Denn vor Einnahme der Psychopharmaka hatte sie ihm beim Stillen stets eine Stoffwindel über den Kopf gelegt. Warum sie ihm den Blickkontakt verweigerte, wusste er nicht. Aber es hatte ihn auch nicht sonderlich gestört. Vielmehr empfand er das gedämpfte Licht und die Geborgenheit unter dem weichen Baldachin als ausgesprochen angenehm.
Nun war das Tuch weg. Dafür waren jetzt zwei riesengroße Rehaugen da, die ihn verzückt begafften. Fritz hatte Angst, in den samtbraunen Bambi-Moloch hineingezogen zu werden. Deshalb schloss er die Augen.
Er öffnete sie erst wieder, als er im Auto saß. Auf der Rückbank versteht sich, denn er hatte ja noch keinen Führerschein. Er lag in einer nagelneuen BSS, einer Baby-Safety-Schale.
Der akademische Oberrat Dr. Hubert Wollenweber hatte fast eine Stunde benötigt, um sie einzubauen. Das Handwerkliche war nicht so sein Ding. Er dachte lieber nach – und zwar über alles Mögliche.
Vor allem über die Möglichkeit, sich so oft wie möglich seinen väterlichen Pflichten zu entziehen.
Seit dem PISA-Schock suchte Hubi mit Inbrunst nach Konzepten, mit denen man die angebliche deutsche Bildungsmisere kurieren konnte. Und dazu musste man sich im Ausland umschauen, einen mutigen Blick über den eigenen Tellerrand werfen – wie er immer wieder mit erregter Stimme in seinen Seminaren betonte.
»Wir werden Hilfe in Finnland finden«, fand er.
Ja, Hubi war oft erregt. Nicht nur im Kopf, nein, auch dort, wo sein Gummiknüppel die meiste Zeit des Tages wie ein schlaffer Gartenschlauch herumbaumelte. Und nicht nur zu Hause, nein, auch an der Universität. Besonders im Sommer, wenn er von den leichtgeschürzten Studentinnen magisch angezogen wurde. Ach, welch ein Schlaraffenland!
Aber zurück zu seinem eingeborenen Sohn: Wie ein zusammengekrümmter Wurm kauerte der kleine Fritz neben seiner Mutter und spähte durch die Kopfstützen. Retreisarnu Legelf, dachte er, als er den Mehrtagesbart seines Zellenspenders entdeckte.
»Wie geht es dir, mein Schatz?«, flötete Hubi mit brünftigem Unterton.
»Gut«, hauchte Bea. Dabei lächelte sie wie ein bekifftes Honigkuchenpferd in den Rückspiegel.
»Ich hab für uns beide heute Abend einen Tisch bei Franco bestellt«, verkündete Hubi strahlend.
»Fein. Das ist eine ganz tolle Idee«, lobte Beatrice Eckstein. Doch plötzlich schürzte sie die Lippen und wies mit sorgenvoller Miene auf Fritz. »Aber, was ist mit ihm?«
»Kein Problem, der stört uns nicht. Ich hab deine Eltern angerufen. Sie kümmern sich um den kleinen Balg.«
»Sprich nicht so abschätzig über ihn«, maßregelte Bea. »Fritzchen ist schließlich auch dein Kind.«
»Ja, sicher, mein Schatz, entschuldige«, zog Hubi den Schwanz ein. »Wir kriegen das mit ihm schon irgendwie gebacken.«
Entsetzt riss Fritz die Augen auf, denn gebacken wollte er nun wirklich nicht werden.
»Hoffentlich«, seufzte Beatrice Eckstein unterdessen. »Vielleicht hätte ich damals doch besser den kleinen Eingriff machen lassen sollen.«
»Ach, was«, bemerkte Hubi mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Dafür ist es eh zu spät. Ist auch besser so, sonst müssten wir jetzt mit einem schicken Cabrio durch die Gegend fahren und die Osterferien in Sri Lanka verbringen.« Diese Worte schmeckten bitterer als die dunkelste Schokolade, die er jemals gegessen hatte.
Bea wischte sich eine Träne von der Wange.
Wem sie diese Träne nachweinte, war Fritz nicht so ganz klar.
»Da müssen wir jetzt wohl durch, mein Schatz. Schließlich sind wir beide gleichermaßen für diese fleischgewordene biologische Eskalation verantwortlich.«
»Du aber bedeutend mehr als ich«, meinte Bea vorwurfsvoll. »Wer von uns kann sich denn nie beherrschen?« Sie spitzte die Lippen. »Vor allem, wenn er zu viel Rotwein getrunken hat. Und das ist ja leider meistens so.«
»Von wegen, meine Liebe«, höhnte er. »Wenn ich dich an unseren letzten Toskanaurlaub erinnern dürfte. Da hast du nachweislich mehr gebechert als ich.« Hubi seufzte tief. »Aber es stimmt ja, was du sagst, Bea-Schatz. Nur kann ich leider nichts dagegen tun. Es ist dieser fürchterliche Furor, der allzeit in mir wütet. Mutter Natur hat es mir wirklich nicht leicht gemacht, als sie mich mit diesem unbändigen Fortpflanzungstrieb geknechtet hat.«
»Ach, du mein armer, armer Hubi«, säuselte Bea und warf ihm einen lasziven Blick zu.
»Wenn du willst, könnten wir ihn zur Adoption freigeben«, sagte Dr. Hubert Wollenweber. Seine Stimme war kalt wie ein eisiger Nordwind.
Fritz jagten Frostschauer den Rücken hinunter.
»Was?«, zischte Bea mit entgeisterter Miene.
»War nur ein kleiner Scherz am Rande«, ließ Hubi umgehend die Luft aus seinem Versuchsballon entweichen.
Für derart makabere Scherze war Fritz ganz und gar nicht zu begeistern, ging es doch um nichts Geringeres als um seine Zukunft. Und da verstand er nun mal absolut keinen Spaß. Schließlich hatte er sich viel vorgenommen für sein Leben. Er wollte einiges erreichen, wollte berühmt und vor allem steinreich werden.
Nach alldem, was er durch die Bauchdecke vernommen hatte, schienen die Voraussetzungen dafür durchaus gegeben zu sein. Zumindest, was die bildungsnahen, akademischen Sozialisationsbedingungen betraf, in die ihn die unergründlichen Mächte des Schicksals hineingeworfen hatten – dankenswerterweise.
Die Tatsache, dass er kein Wunschkind war, ignorierte er großzügig. Fritz war froh, überhaupt das Licht der Welt erblickt zu haben. Zudem: Was nutzte es einem, wenn man von einer prekariären Patchwork-Family wegen der pekuniären staatlichen Transferleistungen zwar geplant worden war, man dafür aber in einem bildungsfernen Elternhaus aufwachsen musste? Wo blieben denn da die intellektuellen Anregungen? Wo die maßgeschneiderten Fördermaßnahmen? Und wo die Karrierechancen?
Dann doch lieber bildungsnah-ungeplant!
Friedrich Karl Eckstein hatte großes Glück, denn seine Eltern waren ausgewiesene Bildungsexperten. Sie beschäftigten sich sogar hauptberuflich mit der Erziehung und Bildung von Menschen. Zwar nur theoretisch, aber immerhin! Bea schrieb Elternratgeber, und der akademische Oberrat Dr. Hubert Wollenweber arbeitete am Lehrstuhl für innovative Erziehungswissenschaft an der Münchner Universität.
Kigogadäp – eid Sisab red Noitasiliviz!, rief sich Friedrich Karl Eckstein einen Spruch seiner Eltern ins Gedächtnis. Er hatte ihn jeden Morgen gehört. Ob er nun gewollt hatte oder nicht. Immer beim Frühstück. Seine Chromosomenspender hatten sich an den Händen gefasst und im Chor diese rituellen Worte in den neuen Tag gehaucht. Immer genau fünfmal hintereinander.
Den mehrgeschossigen Neubau hatte man mitten in die Innenstadt hineingepfropft, exakt dort, wo früher das alte Theater stand. Das klotzige Gebäude war trist und kalt, dafür aber konnte es mit einer Tiefgarage aufwarten – und mit einem Aufzug! Was Fritz egal war, den Babysherpas dagegen nicht.
Gleich nachdem sich die Lifttür mit einem schmatzenden Geräusch geschlossen hatte, begann auch Hubi zu schmatzen. In der Wohnung schmatzte er weiter. Ob aus Lust auf ein Stück Fleisch oder aus Fleischeslust vermochte der kleine Fritz zunächst nicht einzuschätzen.
Hubi stellte die Baby-Safety-Schale im Flur ab, direkt neben den Schirmständer. Fritz tat so, als ob er schlief. Dem war aber nicht so.
Während der akademische Oberrat Dr. Hubert Wollenweber stöhnte und grunzte, schnupperte der kleine Fritz. Es roch moderig. Der üble Geruch strömte ihm aus Hubis Halbschuhen entgegen. Voller Abscheu stieß Fritz Luft durch die Nase und drehte den Kopf zur Seite – doch da stand der Eimer mit Biomüll.
Irgendwann kehrte Bea zu ihm zurück. Sie war puterrot und sah ziemlich zerrupft aus. Fritz wurde auf den Küchentisch gehievt. Dort roch es nach Hundefutter. Obwohl es hier überhaupt keinen Hund gab. Denn das hätte er in den letzten Monaten ja wohl mitbekommen müssen.
Oder vielleicht war es auch Katzenfutter? Das wiederum hätte Sinn gemacht, denn eine Katze wohnte hier. Jedenfalls hatte sie hier gewohnt, als er hier als Untermieter seiner Mutter gewohnt hatte.
»Ow tsi eid Eztak?«, brabbelte er vor sich hin.
»Was hast du eben gesagt?«, fragte Bea.
»Ich habe nichts gesagt«, versicherte Hubi.
»Doch, natürlich hast du eben etwas gesagt«, beharrte Bea.
»Und was soll ich gesagt haben?«, fragte Hubi.
»Ich habe nicht verstanden, was du eben gesagt hast.«
»Klar, weil ich nichts gesagt habe.«
Bea fing an zu weinen. »Warum sagst du mir nicht, was du eben gesagt hast?«, jammerte sie.
»Ich habe nichts gesagt, mein Schatz«, stellte Dr. Hubert Wollenweber unmissverständlich klar. Er klatschte in die Hände. Und zwar so unvermittelt und laut, dass Fritz wie vom Blitz getroffen zusammenfuhr.
Sein Oberkörper schnellte nach vorne. Er glitt aus der Baby-Safety-Schale, die allerdings zu diesem Zeitpunkt keine Baby-Safety-Schale mehr war. Wie auch, denn Hubi hatte vorhin den Sicherheitsgurt geöffnet – und nicht wieder verschlossen!
Kopfüber rutschte Friedrich Karl Eckstein über die Tischkante hinweg und stürzte mit den geöffneten Fontanellen voran auf einen ungepolsterten Küchenstuhl. Der Rest seines Leibes folgte den Fontanellen wie ein nasser Sack.
Er weinte nicht. Sie schon – und wie! Obwohl sein Kopf schmerzte, nicht ihrer!
Er bewegte sich auch nicht. Sie schon – wie ein aufgescheuchtes Huhn.
»Bitte, lieber Herrgott, lass ihn nicht sterben«, schrie Bea wie von Sinnen.
Was für ein Unsinn, kommentierte der kleine Fritz tonlos, denn das hatte er nun wirklich nicht vor. Demonstrativ schlug er die Augen auf. Glotz nicht so blöd, schimpfte er, als er das bleiche Gesicht des Gummiknüppelträgers über sich auftauchen sah.
Schlagartig wurde ihm bewusst, dass dieser Sturz etwas ausgesprochen Positives bewirkt hatte: In seinem Kopf war nun wieder alles in Ordnung, und er musste fortan nicht mehr rückwärts denken und sprechen.
»Er lebt!«, stieß Bea erleichtert aus. »Wir müssen ihn sofort zum Arzt bringen.«
Das wollte Fritz unbedingt vermeiden, deshalb strampelte er, was das Zeug hielt. Zudem riss er die Ärmchen hoch und quiekte dazu wie ein Ferkel.
»Quatsch«, meinte Hubi. »Den Sprit können wir uns sparen. Der ist doch quietschfidel. Das sieht doch jeder Blinde.«
Diesen Satz verstand Fritz nicht.
»Vielleicht hat er innere Verletzungen«, setzte Bea nach.
»Mach dir keine Gedanken, mein Schatz, Babys passiert bei solchen Stürzen nie etwas«, behauptete Hubert, der Theoretiker.
Und wenn doch?, dachte Fritz, dem sein triebgesteuerter Erzeuger immer suspekter wurde. Mit funkelnden Augen blickte er ihn an.
Genau in diesem Augenblick läutete es an der Tür. Paula und Karl, beide mit Nachnamen Eckstein, schneiten in die Wohnung herein, und das, obwohl der Winter schon längst vorüber war.
Karl und Paula waren seine Großeltern, mütterlicherseits. Sonst hatte er keine. Denn Hubis Eltern hatten sich bereits vor vielen Jahren bei einer Wüstenexpedition aus dem Staub gemacht.
»Mama, Mama, Fritzchen ist vom Tisch gefallen«, rief Bea und fiel ihrer Mutter schluchzend in die Arme.
»Ist er verletzt?«, fragte Paula Eckstein mit sorgenvoller Miene.
»Nein – ähm, ich weiß nicht.«
»Wie, du weißt nicht? Hast du ihn denn noch nicht untersucht?«
»Nein, Mama. Hubi meint, es sei alles in Ordnung.«
»Na, wenn Hubi meint.« Paulas spöttischer Unterton war nicht zu überhören.
»Per Ferndiagnose, oder wie?«, knurrte es hinter Paulas Rücken.
Fritz wusste, dass diese Laute nicht von einem Hund stammen konnten, denn Hunde konnten ja nicht sprechen. Aber Menschen konnten knurren. Und das tat Opa Karl oft. Vor allem, wenn Hubi in der Nähe war. Denn er mochte Hubi nicht leiden. Und das war Fritz ausgesprochen sympathisch.
Außerdem war er quasi hautnah mit seinem Opa verbunden, schließlich hatte er von ihm seinen zweiten Vornamen erhalten. Gott sei Dank! Sonst würde er nur Friedrich Eckstein heißen. Und das klang ja bei weitem nicht so aristokratisch wie Friedrich Karl Eckstein, nicht wahr?
Opa Karl führte einen Katzenkorb mit sich, den er nun auf dem Küchentisch abstellte. Fritz beobachtete ihn dabei. Hinter dem Metallgitter blitzten zwei gelbe Augen, und aus dem Maul des Ungeheuers fauchte es ihm bedrohlich entgegen.
Vielleicht ist dieses blöde Tier ja eifersüchtig auf mich, dachte der kleine Fritz, der sich eigentlich tierisch auf die Katze gefreut hatte. Oder es hat Angst, dass ich ihm seine Premium-Thunfisch-Häppchen wegesse. Nee, nee, Fisch erinnert mich zu sehr an Hubi.
Oma Paula befreite ihren einzigen Enkel von Strampelanzug und Windel. Anschließend tastete sie ihn vorsichtig ab. Überall. Und das kitzelte – und wie! Fritz konnte diesen taktilen Overkill kaum ertragen. Er krümmte sich und gluckste. Und das alles unter den Augen dieses bösartigen Stubentigers.
Mit dem ist garantiert nicht gut Kirschen essen, sagte Fritz zu sich selbst, obwohl er noch nie Kirschen gegessen hatte. Diese Redewendung hatte er schon oft gehört. Sie gehörte zu Hubis rhetorischem Standardrepertoire.
Wegen dieser Kirschen ist es an der Zeit, rechtzeitig ein abschreckendes Exempel zu statuieren, entschied Friedrich Karl Eckstein. Als Oma Paula ihn auf den Bauch drehte, spie er dem schwarzen Monster einen Schwall Kindspech ins Gesicht. Die Katze schrie Zeter und Mordio. Dabei sollte sie durch diese Aktion gar nicht ermordet werden – noch nicht.
Die Katze war eigentlich ein Kater und hieß Rousseau. Ein komischer Name für eine Katze, fand Fritz, obwohl er strenggenommen nur eine einzige Katze kannte, eben Rousseau. Rousseau war fett und verfressen – und litt unter Depressionen. Manchmal stierte er stundenlang in ein und dieselbe Ecke. Darunter litt Bea beträchtlich.
»Jetzt kotzt dieser Kerl schon wieder«, zeterte Hubi. »Das lasse ich mir nicht weiter bieten. Der muss dringend operiert werden.«
»Aber die Ärzte haben von einer Operation abgeraten, weil sie viel zu gefährlich sei«, wandte Bea ein.
»Quatsch«, zischte Dr. Hubert Wollenweber. »Die sollen mal nicht so’n Gedöns machen. Der übersteht diesen Eingriff garantiert. Der ist zäh wie Leder.«
Diesen Satz verstand der kleine Fritz nicht.
Hubi polterte weiter. »Was für eine Granatensauerei! Mein armer, armer Rousseau.«
»Jetzt reiß dich aber mal zusammen«, donnerte eine tiefe Stimme zurück. »Fritzchen hat das garantiert nicht mit Absicht getan.«
Darin irrte Opa Karl.
Während sich Bea und Hubi liebevoll um Rousseau kümmerten, drehte Paula ihren Enkel wieder auf dem Rücken. Fritz nahm nun seine Großeltern mütterlicherseits etwas genauer unter die Lupe.
Beide hatten Haare auf dem Kopf, Opa Karl jedoch nur an den Seiten. Auf seiner endlosen Stirn spiegelte sich die Deckenlampe. Oma Paulas dichtes graues Haar verschluckte dagegen das Licht. Sie hatte eine kleine Brille, aber eine große Nase. Ihr Mann hatte eine große Nase und eine große Brille – und große Ohren, fast wie Rhabarberblätter. Die beiden sahen ziemlich verwelkt aus und rochen nach ranziger Butter.
Sie sind viel älter als Bea und Hubi, stellte Fritz in Gedanken fest. Aber Opa Karl ist Beas Vater. Um Bea zu machen, muss er mit Oma Paula das Gleiche gemacht haben, das Hubi andauernd mit Bea macht. Damals. Aber heute machen die das bestimmt nicht mehr. Das kann ich mir nun beim besten Willen nicht vorstellen. Er musterte noch einmal seine Großeltern.
Nein, nein, wirklich nicht.
In den ersten drei Lebensmonaten ließ Bea ihrem Sohn lediglich die notwendige materielle Grundversorgung zuteilwerden. Zum einen, weil sich nach dem völligen Ausbleiben jeglicher Schwangerschafts-Brutlaune auch kein postnataler Nestrausch einstellen wollte.
Und zum anderen, weil sie schlicht und ergreifend keine Zeit hatte, sich intensiver um das eigene Gelege zu kümmern. Der Verlag kannte kein Erbarmen und beharrte eisern auf dem vertraglich festgelegten Abgabetermin, an dem sie das Manuskript ihres neuen Elternratgebers vorlegen musste. Es trug den Titel ›Baby-Turbo-Tuning – maximale Förderung bei minimalem Aufwand‹.
Obwohl Friedrich Karl Eckstein nie schrie und deshalb als ausgesprochen pflegeleichtes Baby zu bezeichnen war, wurde er trotzdem fast täglich zu Beas Eltern abgeschoben.
»Wenn er da ist, kann ich mich nicht auf meine Arbeit konzentrieren«, argumentierte seine Mutter.
Der kleine Fritz trug ihr dies nicht weiter nach. Er vermisste sie nicht, Hubi ebenfalls nicht – und Rousseau sowieso nicht. Diesem heimtückischen Stubentiger traute er nämlich nicht über den Weg.
Aus gutem Grund, denn eines Morgens, als er im Flur auf Oma Paula wartete, sprang das haarige Monster auf ihn und erstickte ihn fast mit seinem schweren, massigen Körper. Einfach so, mir nichts, dir nichts. Heimtückische Bestie!
Was tun, was tun?, pochte es unter Friedrich Karl Ecksteins Schädeldecke.
Glücklicherweise hatte der liebe Gott gerade Zeit und flüsterte ihm eine pfiffige Idee ein. Fritz bedankte sich und setzte die Inspiration sogleich in die Tat um: Der kleine Kerl begann zu husten – und wie! Das Gemeine an diesem Husten war die Tatsache, dass es sich wie Hundegebell anhörte. Rousseau reagierte umgehend und suchte das Weite.
Ja, Fritz war eben kein hundsgewöhnliches Baby. Nein, er war etwas ganz Besonderes, ein ganz besonderes Gottesgeschöpf. Fand er jedenfalls.
Seine Eltern waren diesbezüglich offenbar anderer Meinung, denn sie gebärdeten sich ihm gegenüber ausgesprochen kühl und reserviert.
Was zum einen darauf zurückzuführen war, dass Bea die Psychopharmaka absetzen musste.
Und was zum anderen darauf zurückzuführen war, dass Hubi ihn immer noch liebend gerne gegen ein Cabriolet eingetauscht hätte.
Ab und an grübelte Fritz darüber nach, worin wohl der Grund für diese offenkundige Ablehnung der eigenen Brut liegen mochte, denn überall, wo ihm bei den Frischluft-Trips mit Oma Paula andere Babys begegneten, traf er auf fröhliche, stolze und fürsorgliche Eltern. Manchmal hatte Fritz Angst, dass diese Leute aus lauter Liebe ihren eigenen Nachwuchs auffressen könnten.
Warum ist das bei mir nicht so?, fragte er sich dann jedes Mal.
Die Antwort fand er nicht etwa auf dem Kinderspielplatz, sondern bei sich zu Hause, und zwar im Flur. Eines Tages stellte Hubi die Baby-Safety-Schale vor dem Garderobenspiegel ab. Und da sah sich der kleine Fritz zum ersten Mal in seinem Leben so, wie ihn andere Menschen sahen. Schlagartig war ihm alles klar.
Sein äußeres Erscheinungsbild ähnelte noch nicht einmal ansatzweise dem der knuddeligen Babys, die ihm im Laufe seiner ersten Lebensmonate begegnet waren. Sein derbes, kantiges Gesicht und die fast quadratische Kopfform entsprachen so ganz und gar nicht dem standardisierten Kindchenschema.
Zudem waren die tiefliegenden Augen eindeutig zu groß geraten und die kreisrunden, abstehenden Ohren erinnerten an kleine Satellitenschüsseln. Dieses eindrucksvolle Gesamtbild wurde von stracken schwarzen Haaren abgerundet, die über den zusammengewachsenen Brauen aus der Kopfhaut ragten und an eine Wurzelbürste erinnerten.
Im ersten Augenblick reagierte Fritz geschockt auf sein markantes Konterfei. Er wendete den Blick ab und grübelte darüber nach, wie er mit dieser Erkenntnis konstruktiv umgehen konnte.
Da er von Natur aus ein ausgesprochen positiver und optimistischer Mensch war, entschloss er sich, die noch nicht vorhandenen Zähne zusammenzubeißen und zu akzeptieren, dass er auch äußerlich anders war, als alle anderen Babys, die er bislang gesehen hatte.
Eins steht jedenfalls klipp und klar fest, sagte er zu sich selbst: Ich bin etwas ganz, ganz Besonderes.
An einem verregneten Apriltag hatte das Schicksal anscheinend nichts Besseres zu tun, als Friedrich Karl Ecksteins bisheriges Leben radikal auf den Kopf zu stellen. Bea hatte ihr Manuskript auf den letzten Drücker zur Post gebracht und ihn anschließend in die Volkshochschule zu einer sogenannten Krabbelgruppe geschleppt, obwohl er noch nicht einmal richtig sitzen, geschweige denn krabbeln konnte.
Freiwillig hatte sie dies nicht getan. Nein, Kerstin war schuld daran. Beas alte Schulkameradin wurde vor ein paar Monaten ebenfalls zum ersten Mal Mutter. Nach mehreren Jahren erfolgloser herkömmlicher Besamungsversuche hatte erst eine Befruchtung im Reagenzglas zur herbeigesehnten Schwangerschaft geführt.
Seitdem Kerstin in den Olymp der Spätgebärdenden aufgestiegen war, gebärdete sie sich im Gegensatz zu Bea als leidenschaftliche Vollzeitmutter. Mit allem, was dazugehörte: postnatale Megabrutlaune, radikaler Jobverzicht, extremer Stillfetischismus und ausgeprägte Kleinkindapotheose.
Da es ohne Kind und trotz Emanzipation und trotz Frauenförderquote mit ihrer ersten Karriere nicht so richtig geklappt hatte, witterte sie nun eine zweite Karrierechance. Denn mit Kind konnte man schließlich auch Karriere machen: als hyperengagierte und hyperperfekte Premium-Vorzeigemutter.
Bea plädierte in ihrem neuen Elternratgeber emphatisch für alle nur erdenklichen Frühfördermaßnahmen, doch in Bezug auf ihren eigenen Sprössling hielt sie sich in dieser Hinsicht dezent zurück. Und genau mit diesem schändlichen Fehlverhalten hatte sie ihre Freundin konfrontiert.
Vor ein paar Tagen hatte Kerstin Bea aufgesucht und ihr die Vorwurfs-Pistole auf die bereits vor Wochen stillgelegte Brust gesetzt. Schonungslos wurde sie des unverantwortlichen Abstillens angeklagt und darüber hinaus der grob fahrlässigen Kleinkindvernachlässigung bezichtigt.
Und das, obwohl Fritz definitiv nicht angekettet in einem dunklen Kellerverlies gehalten wurde, sondern die meiste Zeit bei seinen Großeltern im Hellen und Grünen aufwuchs. Aber er war eben nicht da gewesen, als Kerstin da war. Und das hatte der Premium-Mutter genügt.
»Ein Säugling, der ohne Mutterbrust aufwachsen muss, ist ein armes Schwein«, echauffierte sich Kerstin. »Wie kann man nur sein eigen Fleisch und Blut freiwillig jemand anderem in die Hände geben?« Sie schüttelte sich wie ein nasser Eisbär.
»Der arme kleine Kerl vegetiert bei diesen alten Leuten doch elendig vor sich hin. Mit Flasche, aber ohne Anregung, ohne Zuwendung, ohne Förderung. Hört ihr denn nicht die Stimme eures Blutes, wie sie euch mahnend in den Ohren dröhnt?«
Den letzten Satz sprach sie im Plural, denn Dr. Hubert Wollenweber war inzwischen zu Hause eingetroffen. Hubi schwieg betreten vor sich hin und ließ die saftige Gardinenpredigt tapfer über sich ergehen.
Was hätte er denn auch Vernünftiges sagen sollen?
Er hatte diese ominöse Stimme des Blutes noch nie vernommen, noch nicht einmal als leises Hintergrundrauschen. Weder im Krankenhaus, noch irgendwann später. Was ihn auch nicht sonderlich verwunderte, denn insgeheim verleugnete er die Vaterschaft. Doch getraute er sich nicht, Bea gegenüber den gravierenden Verdacht einer vorsätzlichen Fremdbefruchtung zu äußern.
Bereits der erste Anblick des verwachsenen, unansehnlichen Säuglings hatte ihn davon überzeugt, dass er diese Ausgeburt der Natur unmöglich selbst gezeugt haben konnte. Bezeugen konnte er diese Vermutung natürlich nicht, denn er war ja nicht dabei, als Fritzchens leiblicher Vater Bea zu Leibe gerückt war.
Schenkte man den ärztlichen Rechenkünsten Glauben, so musste dieser unsägliche Befruchtungsvorgang während des gemeinsam verbrachten vierwöchigen Toskanaurlaubs stattgefunden haben. Doch wer um alles in der Welt konnte für dieses Malheur verantwortlich sein?
Er jedenfalls nicht, dessen war sich Hubi sicher.
In Gedanken ging er alle Männer durch, mit denen er und Bea während dieser Zeit Kontakt hatten, normalen Kontakt versteht sich. So angestrengt Hubi auch über diese Frage nachgrübelte, es wollte ihm partout niemand einfallen, der für Friedrich Karl Ecksteins extreme genetische Grundausstattung verantwortlich gemacht werden konnte.
Aber eines Nachts schreckte Hubi schweißgebadet aus dem Schlaf auf. Es gab da möglicherweise doch jemanden, der als Fritzchens Erzeuger in Betracht kam: ein Maler, der in unmittelbarer Nähe ihres Feriendomizils Porträts von den Urlaubern angefertigt hatte.
Dieser etwa vierzigjährige, ausgesprochen muskulöse Italiener hatte ebenfalls stocksteife Schultern und war bezüglich seines Antlitzes ähnlich erbarmungslos von der Natur vernachlässigt worden wie der kleine Fritz. Aber einen Adoniskörper hatte dieser vierschrötige Kerl – Mann oh Mann!
Eine genetische Analyse würde diese Frage objektiv beantworten, sagte sich Hubi. Aber will ich dieses Testergebnis wirklich wissen? Was ist, wenn ich wider aller Wahrscheinlichkeit doch sein leiblicher Vater bin?
Hubi konnte in dieser fürchterlichen Nacht kein Auge mehr schließen. Im Morgengrauen, das seinem Namen wirklich alle Ehre machte, hängte er diesen schockierenden Gedanken an die Garderobe. Genau neben den Spiegel, vor dem er Fritz einige Tage zuvor wie einen Schirmständer abgestellt hatte. Es war der Tag, an dem sein eingeborener Sohn zum ersten Mal mit seinem Konterfei konfrontiert worden war.
Womit wir wieder bei Friedrich Karl Eckstein angelangt wären.
Der kleine Fritz reagierte geradezu euphorisch auf die Nachricht, dass nun auch er sich am Kelch der frühkindlichen Fördermaßnahmen laben durfte. Er jauchzte vor Freude – und er lächelte zum ersten Mal in seinem blutjungen Leben.
Allerdings misslang ihm dieses Mienenspiel gründlich, denn sein Lächeln geriet ausgesprochen schief. Um ehrlich zu sein, trug es derart hämische Züge, dass der Adressat dieser nonverbalen Kommunikation sich unweigerlich von dem kleinen Knirps veralbert fühlen musste.
Mit anderen Worten: Fritz lächelte einen Menschen nicht an, sondern er machte ihn durch seine spöttische Mimik lächerlich. Der Benutzer eines restringierten Sprachcodes mochte bei diesem Anblick gar von einem saumäßig dreckigen Grinsen sprechen.
Allerdings war Fritz für dieses provokante Gebaren nicht ursächlich verantwortlich, denn nicht er, sondern Mutter Natur hatte beim Zusammenbau seiner Chromosomenausstattung schlichtweg vergessen, in seiner linken Gesichtshälfte einige Nervenbahnen richtig zu verdrahten.
Und somit bewegte sich bei einem entsprechenden neuronalen Impuls zwar der rechte Mundwinkel wie gewünscht nach oben, doch der linke verharrte unbeeindruckt in seiner Ausgangsposition. Dieses ungewöhnliche Phänomen sollte ihm in seinem künftigen Leben noch einige Unannehmlichkeiten bereiten.
Als Bea an diesem verregneten Aprilmorgen in der Volkshochschule eintraf, wurde sie bereits sehnlichst von ihrer ehemaligen Schulkameradin erwartet. »Da bist du ja endlich, du alte Tranfunzel«, pflaumte sie Kerstin an. »Die anderen warten schon.«
»Tut mir leid, aber ich musste in der Post so lange anstehen«, erwiderte Bea, was glatt gelogen war.
Großzügig sah Fritz über diese dreiste Lüge hinweg, schließlich gab es ja so etwas wie eine innerfamiliäre Verschwiegenheitspflicht.
»Du trägst ihn ja immer noch in dieser blöden Transportbox herum«, schimpfte Kerstin. Sie meinte damit offenbar die Baby-Safety-Schale, in der sich Fritz nach seinem Sturz zwar nicht mehr sicher, aber trotzdem recht wohl fühlte.
Wo ist denn eigentlich dein Baby?, sinnierte Fritz und schaute sich suchend nach dem Krabbelkameraden um.
Doch nirgendwo entdeckte er einen Hinweis auf seinen Kollegen.
Komisch, dachte Fritz. Kerstins Sohn muss doch garantiert auch an dieser Fortbildungsmaßnahme teilnehmen. Na ja, vielleicht ist er noch bei seiner Oma.
Dann hörte er einen quäkenden Schrei. Er drang durch einen schweren alten Vorhang, den sich Kerstin quer über den Bauch gebunden hatte.
Will die etwa den armen Kerl ersticken?, fragte sich Fritz, während Kerstin ihren Sohn umständlich aus dem Vorhang schälte.
Er hieß Justus und plärrte wie am Spieß.
Der kleine Fritz war ja so was von aufgeregt, denn er lechzte geradezu nach professionellen Fördermaßnahmen. Im Bauch hatte er schon oft von ihnen gehört, schließlich war er hautnah dabei gewesen, als seine Mutter zu diesem spannenden Thema ein Buch geschrieben hatte.
Während dieser Zeit hatte sie Hubi andauernd von ihrem neuen Elternratgeber erzählt. Und der hatte natürlich ausführlich seinen theoretischen Senf hinzugegeben. Als akademischer Oberrat im Fachbereich Erziehungswissenschaft war das ja wohl auch seine Pflicht!
PEKIP – nein, nicht PEKING! – hatte es Bea offensichtlich besonders angetan, denn wochenlang hatte sie sich mit diesen fünf Buchstaben, die ja gar nicht ihre eigenen waren, beschäftigt.
Friedrich Karl Eckstein hätte gut und gerne einen Vortrag über das ›Prager-Eltern-Kind-Programm‹ und all die anderen von Bea empfohlenen Programme zum ›Baby-Turbo-Tuning‹ halten können. Denn er wusste sehr viel darüber – theoretisch jedenfalls. In dieser Hinsicht stand er Hubi in nichts nach.
Und nun sollte er das segensreiche PEKIP-Programm am eigenen Leib erfahren.
Gott sei Dank!
Als Bea und Kerstin den überhitzten Seminarraum der Volkshochschule betraten, seufzten die versammelten Mütter im Chor gemeinsam auf, dann stöhnten sie den Ankömmlingen »Endlich!« entgegen.
Fritz blickte sich um. Seine Fortbildungskollegen erweckten nicht gerade einen euphorischen Eindruck. Eher war das Gegenteil der Fall. Die meisten der gut ein Dutzend Babys waren übellaunig und quengelten herum. Drei der PEKIP-Kursteilnehmer demonstrierten ihr grundsätzliches Desinteresse an solch einer pädagogischen Zwangsbeglückung, indem sie demonstrativ schliefen.
Aber der kleine Fritz war glockenwach und gut gelaunt. Das änderte sich jedoch schnell, als er der entsetzten Mienen gewahr wurde, die ihn wie einen Aussätzigen anstarrten.
»Ella Neffa Neztolg«, brabbelte er vor sich hin. Wenn er sich zu sehr aufregte, fiel er manchmal in seinen alten Sprechduktus zurück.
Die Mütter reagierten sichtlich geschockt auf seine rhetorischen Fähigkeiten. »Was war das denn eben?«, stieß eine von ihnen entgeistert aus. »Kann der etwa schon sprechen?«
Dabei stach ihr Zeigefinger wie ein Florett auf Fritz ein. Friedrich Karl Eckstein spürte jeden einzelnen dieser Stiche.
»Nein, richtig sprechen kann er in seinem Alter natürlich noch nicht«, erklärte Bea. »Aber mein Fritzchen verfügt über eine vorsprachliche Eloquenz, die unter seinen Altersgenossen ihresgleichen sucht«, protzte sie wie zehn entkleidete Eingeborene.
In einer konzertierten Aktion lupften alle Premium-Mütter gleichzeitig ihre gezupften Brauen.
»Das wurde ihm erst vor Kurzem von einem Linguistik-Professor attestiert«, setzte Beatrice Eckstein den Fangschuss. »Er möchte Friedrich unbedingt in seine Hochbegabtengruppe aufnehmen.«
Auch das war natürlich gelogen – und zwar so doll, dass sich im PEKIP-Seminarraum die Deckenbalken eigentlich hätten durchbiegen müssen. Trotzdem freute sich der kleine Fritz – und zwar diebisch.
Jawohl Bea, diesem blöden Gaffervolk hast du’s eben richtig gegeben, jubilierte er klammheimlich – und wunderte sich darüber, dass niemand dem inhaltlichen Schwachsinn widersprach, den seine Mutter gerade von sich gegeben hatte. ›Vorsprachliche Eloquenz‹ – da lachen ja die Hühner! Aber diesen dummen Hühnern hier kann man wohl alles erzählen.
»Kinder von Spätgebärenden sollen ja angeblich besonders intelligent sein«, bemerkte die einzige junge Mutter im Raum. Im Gegensatz zu den abgeschlafften Tantchen hatte sie augenscheinlich ihre besten Jahre noch vor sich. »Ich hätte wohl auch noch besser einige Zeit mit meiner Schwangerschaft gewartet«, fügte sie zerknirscht hinzu.
»Ja, meine Liebe, das wäre sicherlich für Sie und Ihr Kleines besser gewesen«, posaunte Bea in die Runde der betagten Mütter. »Im Gegensatz zu Ihnen konnten wir uns vorher noch richtig ausleben und das kinderlose Dolce Vita in vollen Zügen genießen.«
Kann man denn mit einem Kind nicht richtig leben, sein Leben nicht genießen?, fragte sich Friedrich Karl Eckstein, während die ihrer Menopause harrenden Mütter aufseufzten und im Gleichtakt nickten.
»Ich denke, wir sollten nun endlich mit dem PEKIP-Programm beginnen«, verkündete eine dickleibige Frau, die anscheinend hier das Sagen hatte.
Sie hatte kein eigenes Baby dabei. Jedenfalls konnte Fritz keines entdecken.
Das hat sie bestimmt zu Hause gelassen, weil sie bei ihrer Arbeit nicht gestört werden will, erklärte sich Fritz diesen Umstand. Oder vielleicht ist sie ja auch in anderen Umständen, wie Oma Paula manchmal über eine Frau mit einem dicken Bauch sagt.
Vielleicht hat sie ja auch gar kein selbstgemachtes Baby, sondern sieht ihre Lebensaufgabe darin, sich um die Kinder andere Mütter zu kümmern. So wie Bea, die eigentlich auch lieber kein Kind hätte und stattdessen noch mehr Elternratgeber schreiben würde.
Ach, sie hat ja doch ein eigenes Baby dabei, stellte Fritz erstaunt fest, als die Gruppenleiterin ihre Tasche öffnete und ein nacktes Beinchen zum Vorschein kam.
Siehst du, Kerstin, selbst die Chefin wickelt ihr Baby nicht in einen alten Vorhang ein. Daran solltest du dir ein Beispiel nehmen.
Nein, der Kollege ist ja gar nicht aus Fleisch und Blut. Das ist ja nur eine Puppe, eine nackige Puppe! So eine hat Hubi auch, allerdings ist die viel größer und hat …
Weiter kam er nicht, denn die Puppenmama schnitt ihm mit ihrer schneidenden Stimme den Gedanken ab. »Wie immer beginnen wir mit der Befreiung unserer lieben Kleinen«, tönte sie wie eine Hamburger Fischverkäuferin.
Befreiung wovon?, fragte sich Fritz verdutzt.
Auch Bea schien im ersten Moment nicht so recht zu begreifen, worauf die Chefin mit dieser Aufforderung hinauswollte, obwohl sie doch eigentlich eine PEKIP-Expertin war – theoretisch zumindest.
Doch dann ging ihr das berühmte Lichtlein auf. Sie nickte und tat es den anderen Müttern gleich: In einer überfallartigen Aktion rissen sie der übertölpelten Brut die Kleider vom Leib. Fritzchen wehrte sich verzweifelt, aber er hatte keine Chance. Noch nicht einmal die Windel durfte er anbehalten.
Nun war er nackt, split-ter-fa-ser-nackt!
Und das vor all diesen fremden Leuten, diesen Gaffern, die ihre aufdringlichen Blicke wie Saugnäpfe auf ihn hefteten.
Fritz wurde rot, puterrot sogar!
Aber das störte diese altersgeilen Fleischbeschauerinnen nicht! Sie glotzten einfach weiter auf die zentrale Stelle seines Leibes, die sich südlich seines Nabels befand. Dorthin, wo er für sein knabenhaftes Alter schon mächtig entwickelt und behaart war. Und zwar mit dem gleichen pechschwarzen Gewächs, das aus seiner Kopfhaut spross.
Die Gafferinnen kicherten wie pubertierende Schulmädchen. Mit einem Mal wurde es Bea zu bunt und sie bedeckte Friedrich Karl Ecksteins entblößte Scham mit der Windel. Fritz warf ihr einen erleichterten Blick zu. Zum ersten Mal in seinem Leben war er ihr richtiggehend dankbar.
Es wäre doch viel lustiger, wenn diese alten Weiber nackig wären, grinste sich Fritz eins. Dieses schlaffe Gammelfleisch …
Er schaute hinüber zu einem Kollegen, der gerade eine schöne Bogenlampe in den Hexenkreis hineinpullerte. Danke, Kumpel, das nenne ich Solidarität!
Kerstins Kopf lief tomatenrot an. »Oh nein, was für eine Sauerei! Meine schöne, teure Babydecke. Und meinen armen Justus hat ihr blöder Balg auch noch vollgepisst«, beschimpfte sie die junge Mutter.
Weinend packte die einzige knackige Mama im Raum ihre sieben Sachen, die eigentlich nur vier Sachen waren, zusammen und flüchtete Hals über Kopf aus dem PEKIP-Refugium.
Nun waren die betagten Mütter mit ihren Senioren-Tamagotchis ganz unter sich. Elf förderbesessene Mütter, alle bereits jenseits ihrer statistisch errechneten Lebensmitte. Mütter, die nichts anderes im Sinn hatten, als das eigene Gelege exzessiv zu tunen.
Selbstverständlich nicht ohne eigennützige Hintergedanken. Denn mit einem optimal programmierten Säugling konnte die PISA-geschockte Elterngeneration am lebenslangen Bildungswettlauf teilnehmen und dabei in aller Ruhe die Konkurrenz beobachten.
Zudem konnte man sich mit einem leistungsstarken Nachwuchs auf dem Jahrmarkt der elterlichen Eitelkeit ins Rampenlicht katapultieren und ausgiebig mit den Leistungen der eigenen Brut herumprotzen.
Schließlich sollten die gedopten Früchtchen die zuckersüßen Früchte vom Baum des Ruhms pflücken, die man selbst nie erreicht hatte – weil die eigenen Arme dafür leider viel zu kurz geraten waren.
Aber zurück zu Fritz. Der weitere Fortgang seines Premieren-Tunings ist schnell erzählt. Nachdem der pullernde Störenfried mitsamt seiner jugendlichen Begleitung den Seminarraum verlassen hatte, beobachteten die späten Mütter mit Argusaugen die Leistungen der verbliebenen Teilnehmer dieser frühkindlichen Konkurrenz-Rally.
Im Vergleich zu seinen Altersgenossen schnitt der kleine Fritz in allen Disziplinen weit unterdurchschnittlich ab. Die diversen Spiel-, Bewegungs- und Sinnesanregungen ignorierte er mit einer totalen Verweigerungshaltung.
Um es auf den Punkt zu bringen: Er machte weder irgendwelche lächerlichen Spielchen mit, noch ließ er sich sonst irgendwie stimulieren, noch war er bereit, mit seinen Kollegen zu interagieren. Die anderen Jungspunde waren ihm nämlich schlichtweg egal. Und dieser Popelkram, mit dem man ihn angeblich intellektuell fördern wollte, rang ihm nur ein schiefes Lächeln ab.
Nachdem alle Spätgebärenden ihren Babys wieder die Leibchen über den Leib gezogen hatten, zog die Chefin der PEKIP-Gruppe eine individuelle Zwischenbilanz. Dabei kam Beas Nachwuchs als einziger ganz schlecht weg, denn die selbsternannte Frühförderungs-Expertin diagnostizierte bei Friedrich Karl Eckstein einen extrem hohen Förderbedarf, besonders bezüglich seines rudimentären Sozialverhaltens – wie sie schonungslos formulierte.
Diese schockierende Bestandsaufnahme zeichnete Bea tiefe Falten auf die Stirn, Kerstin dagegen malte sie ein schadenfrohes Grinsen auf die Lippen.
Fritz beunruhigte dieses Statement allerdings nicht im Geringsten, denn er wusste ganz genau, was für ihn das Richtige war. Selbsttätigkeit hieß das Zauberwort! Er musste sich die für seine optimale intellektuelle Entwicklung wichtigen Informationen besorgen und sich zentrale Kompetenzen aneignen.
Und er wusste auch schon, wo. Auf alle Fälle nicht bei solchen FKK-Lachnummern. Diese affigen Spielchen, dieses alberne Herumgegrapsche an seinem nackigen Astralkörper sollte Förderung sein – mitnichten!
Doch bereits am darauffolgenden Morgen wurde der kleine Fritz zum nächsten Nudistentreffen geschleppt. Wieder handelte es sich dabei um einen dieser unsäglichen Baby-Tuning-Events.
Diesmal fand er allerdings nicht in den überheizten Räumlichkeiten der Volkshochschule statt, sondern woanders. Und warum? Ganz einfach: Weil es in der VHS kein Wasser gab! Nein, Leitungswasser war dort natürlich reichlich vorhanden – aber eben kein Schwimmbecken!
Und das benötigte man ja wohl zum Babyschwimmen, nicht wahr? Wobei der Begriff Baby-Schwimmen nichts anderes war als ein schlechter Wortwitz. Oder musste Fritz demnächst auch noch zum Baby-Skilaufen oder Baby-Surfen?
Heute stand also Babyschwimmen ganz oben auf der Agenda der Säuglings- und Mütterbeschäftigungsindustrie. Kerstin hatte für ihren Justus einen individuellen Förderplan entwickelt, den Bea bereitwillig adaptierte und den es von nun an diszipliniert abzuarbeiten galt.
Schließlich war Beatrice Ecksteins Sprössling gestern von der PEKIP-Expertin als förderbedürftig eingestuft worden. Und das konnte Bea selbstverständlich nicht auf sich sitzen lassen, zumal ihr das hämische Grinsen ihrer alten Schulkameradin nicht entgangen war.
Schon wieder zerrte Bea ihrem eingeborenen Sohn die Kleider vom Leib. Aber dem Himmel sei Dank zur Abwechslung einmal nicht vor den Augen dieser penetranten Voyeure, sondern in einer Umkleidekabine.
Dort war es schön eng und gemütlich. Fritz wäre so gerne dortgeblieben, aber er hatte keine Chance, denn er war Bea nach wie vor auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Auch diesmal durfte er noch nicht einmal die Windel anbehalten.
Bitte, lieber Gott, pass auf, dass sie nicht ausrutscht und mich fallen lässt!, flehte Fritz eingedenk des glitschigen Untergrundes, auf dem sich Bea trotz ihrer Plattfüße nicht gerade sicher, geschweige denn graziös bewegte.
Während eines albernen Begrüßungsgedöns, bei dem die späten Mütter ihre runzeligen Wangen aufeinanderdrückten, sondierte Fritz die Begleitpersonen seiner Schwimmmannschaft. Auch diesmal schienen sie wieder einem Seniorenheim entlaufen zu sein.
Ich hätte sooooo gerne auch so eine frische, knackige Mama, seufzte Fritz in Gedanken, als er im Nichtschwimmerbecken zwei jugendliche Mütter dabei beobachtete, wie sie ausgelassen mit ihren Babys herumtollten.
Ja, herumtollten, nicht herumschwammen! Irgendwie sind junge Leute fröhlicher und cooler als die alten – und sie nerven einen bestimmt auch nicht andauernd mit ihrem Förderwahn.
Auf das Kommando der Chefin hin ließen sich die betagten Mütter in Zeitlupentempo auf die nassen Fliesen nieder und breiteten ihre Badelaken vor sich aus. Dann legten sie ihre Nachkömmlinge darauf ab, fassten sich an den faltigen Händen und sprachen im Chor die Förderhymne:
»Ach, sie sind so klein und zart,
Doch das Leben ist so hart.
Schwestern, reicht mir eure Hände
Lasst sie uns fördern ohne Ende.«
Weshalb glauben bloß alle Erwachsenen, dass Babys am liebsten nackig sind?, protestierte der kleine Fritz in Gedanken. Sein Blick wurde magisch von den prallen Pobacken eines vor ihm liegenden Leidensgenossen angezogen.
»Wir haben unsere Kleinen ausgezogen, weil sie auch im Mutterleib nackig waren«, sagte die neue Chefin, die offenbar Gedanken lesen konnte.
Sie ähnelte der PEKIP-Tante von gestern sehr. Wahrscheinlich sind diese Mütter-Trainerinnen alle geklont, erklärte sich Friedrich Karl Eckstein dieses augenscheinliche Phänomen.
»Warum überhaupt Babyschwimmen?«, fragte die Frau in flötender Tonlage.
Das möchte ich auch gerne wissen, dachte Fritz.
»Der Säugling soll das Element Wasser wiederentdecken. Es ist schließlich dasjenige Element, in dem er die ersten neun Monate seines Lebens verbracht hat«, dozierte die Schwimmlehrerin. »Das Wasser eröffnet ihm einen neuen Erfahrungsraum und fördert seine Kreativität. Sie können meine Argumentation nachvollziehen?«
Allseitiges, braves Nicken.
»Sehr gut«, lobte die Expertin gedehnt. Sie hob den Zeigefinger. »Zudem wirkt sich der enge Kontakt Ihres kleinen Lieblings zu den anderen Säuglingen ausgesprochen positiv auf die soziale Entwicklung Ihres Kindes aus.«
Beas Augen leuchteten erwartungsvoll auf. Kein Wunder, denn die Chefin hatte ihren wunden Punkt getroffen: Friedrich Karl Ecksteins angeblich nur rudimentär ausgeprägtes Sozialverhalten.
Aber das waren noch lange nicht alle Begründungen dafür, weshalb man wehrlose Babys zum Beckenschwimmen nötigte.
»Zusätzlich stimuliert der Aufenthalt in diesem flüssigen Medium die geistige Entwicklung Ihres Kindes«, behauptete die Chefin, »denn es steigert die Fähigkeit zu Konzentration und Koordination. Darüber hinaus stärkt das völlige Ausgeliefertsein des Babys an den erwachsenen Schutzpatron das Vertrauensverhältnis zu seiner Bezugsperson. Und zu guter Letzt sorgt der intensive Körperkontakt für eine innige Beziehung zwischen Eltern und Baby.«
Und wenn man die gar nicht haben will?, grollte Friedrich Karl Eckstein im Stillen.
Bea nahm ihren Sohn auf den Arm und folgte der Mütterprozession ins Wasser. Fritz konnte den stechenden Chlorgeruch kaum ertragen und hielt den Atem an.
Bäh, was für eine pinkelwarme, stinkende Brühe, schimpfte er in Gedanken, als Bea seine Füße ins Wasser eintauchte.
Und dann ließ sie ihn los – einfach so!
Wie ein Stein sackte er nach unten, immer tiefer, immer tiefer. Das Wasser rauschte in seinen Ohren und drückte sich in seine Nasenlöcher hinein. Reflexartig presste er mit Luft dagegen an. Das Blubbern klang wie ein Totengeläut.
In panischer Angst riss er die Augen auf. Direkt vor ihm standen die Unterteile der Mütter wie schwabbelnde Totempfähle im Wasser herum. Aber sie bewegten sich nicht auf ihn zu, sondern verharrten wie festgewachsen an Ort und Stelle. Verzweifelt strampelte er und strampelte. Er schluckte Wasser, übelschmeckendes Chlorwasser.
Sie will mich töten, sie will mich töten! Warum hilft mir denn niemand?, schrie er verzweifelt. Doch es waren stumme Schreie, Schreie, die niemand hören konnte – oder wollte.
Er spürte die welligen Fliesen unter seinem Rücken.
Verdammt, jetzt ist mein Leben schon vorbei, bevor es überhaupt richtig angefangen hat, schoss es ihm durch den Kopf.
Doch urplötzlich war die Todesangst wie weggeblasen. Er war völlig ruhig und gelassen, wohlige Wärmeschauer durchfluteten seinen Körper.
Lieber Gott, ich komme. Ich hoffe, du kannst Schachspielen. Das will ich nämlich unbedingt lernen.
Dann senkte sich ein schwarzer Vorhang über ihn.
Noch nicht einmal im Himmel lässt sie mir meine Ruhe, stöhnte er innerlich auf, als er Beas hysterische Hilfe-Hilfe-Schreie vernahm.
»Haben Sie uns nicht vorhin versichert, dass meinem Baby nichts passieren kann, wenn ich es loslasse?«, plärrte sie.
»Doch, doch«, stammelte die sichtlich geschockte Schwimmlehrerin.
»Beim abrupten Eintauchen ins Wasser würde mein Fritzchen sofort den Atem anhalten und mit Schwimmbewegungen beginnen, die ihn an der Wasseroberfläche halten«, schluchzte Bea. Dabei streichelte sie Fritz am ganzen Körper.
Mit einem Mal erinnerte sie sich daran, dass sie in ihrem neuen Elternratgeber auch einen Text über Erste-Hilfe-Maßnahmen untergebracht hatte, den sie ohne Quellenangabe aus einer Broschüre des Malteser Hilfsdienstes übernommen hatte. Ohne Vorwarnung presste sie ihre Lippen auf seinen Mund und versuchte ihn aufzupumpen.
Pfui Spinne, ist das eklig, stöhnte er innerlich auf.
Fritz trat und schlug wie wild um sich. Daraufhin ließ seine Mutter von ihm ab. Blinzelnd öffnete er die Augen.
Anscheinend bin ich doch nicht tot, stellte er nüchtern fest, denn ich liege in einem Hallenbad am Beckenrand – und werde schon wieder wie ein Außerirdischer angegafft. Im Himmel ist Gaffen garantiert verboten.
Friedrich Karl Ecksteins spontane Wiedergeburt riss die Leiterin des Schwimmkurses schlagartig aus ihrer Apathie.
»Natürlich habe ich das gesagt«, schnauzte sie zurück. »Normalerweise reagiert ein Säugling auch so. Nur bei Ihrem Baby funktioniert dieser natürliche Reflex anscheinend nicht.« Die Frau schürzte die Lippen. »Irgendwie scheint ihr Kind im Kopf nicht ganz normal zu sein. Das sieht man ihm ja auch schon an«, ein Blick in die Runde, »nicht wahr?«
Solidarisches Nicken.
Der kleine Fritz war zwar schon blau, aber nun wurde es ihm endgültig zu bunt. Eine derart unverhohlen zum Ausdruck gebrachte Aversion gegenüber seiner Person konnte nicht ungestraft bleiben.
Fritz fixierte den Wasserdrachen mit einem stechenden Blick. Zeitgleich begann er, stakkatoartig zu husten. Sein dezentes Körperblau wechselte in Rot, in Signalrot! Er zog die rechte Lefze hoch und schenkte der gehässigen Schwimmente sein hämischstes Grinsen.
Dann stoppte er die Schnappatmung, holte tief Luft und spie fontänenartig einen Schwall Kindspech in die Höhe. Besser gesagt, schräg in die Höhe. Er steuerte seine Eruption zielgenau so, dass die schwarze Brühe volle Pulle ins Becken hineinplätscherte.
»Was für eine Granaten-Sauerei«, brüllte die Wasserhexe und schlug entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen.
Bea schämte sich zu Tode. Sie starb jedoch nicht.
Ganz im Gegensatz zum Babyschwimmen. Denn das war nun ein für alle Mal gestorben – zumindest für Friedrich Karl Eckstein, der seinerseits ziemlich munter weiterlebte.
Natürlich hatte der kleine Fritz gehofft, mit dieser gelungenen Darbietung den Förderambitionen seiner Mutter einen vernichtenden Schlag versetzt zu haben. Doch dem war leider nicht so.
Bereits wenige Stunden nach diesem Eklat, von dem sich Bea nur mühsam erholte, holte Kerstin ihre Freundin zu einem weiteren Tuning-Event ab: Shiatsu – nein, nicht Shit-hast-du, sondern Shi-at-su, genauer gesagt: Baby-Shiatsu war angesagt.
Und schon wieder musste Fritz eintauchen. Allerdings nicht in Wasser, sondern in die Esoterik. Dabei wurde man zwar nicht nass, aber trotzdem war dieses Eintauchen mindestens genauso unangenehm wie sein unfreiwilliger Schwimm-Crashkurs.
Denn erstens wurde er schon wieder vollständig ausgezogen.
Zweitens stank es wieder zum Himmel. Diesmal nicht nach Chlor, nein, nach japanischem Massageöl und Räucherkerzen.
Und drittens laberte auch diese Frühförderungstante vom natürlichen Bedürfnis des Babys nach intensiver elterlicher Zuwendung, sprich: nach körperlicher Berührung.
Woher wollen die nur alle wissen, dass wir auf dieses eklige Gefummel abfahren?, protestierte Fritz in Gedanken. Meine Kollegen und ich können auch ohne diese affige Babymassage wachsen und gedeihen. Oma und Opa haben garantiert nicht diesen überflüssigen Hokuspokus mitgemacht und sind trotzdem groß und alt geworden! Und wie groß und wie alt!
»Der Qi-Fluss von Babys ist sehr empfindlich und kann durch schädigende Umweltreize leicht aus dem Gleichgewicht gebracht werden«, säuselte die fleischgewordene Ausgeglichenheit, die in buntem, wallendem Gewand dozierte.
»Der sanfte Druck, der bei dieser jahrhundertealten japanischen Körpertherapie ausgeübt wird, löst Blockaden, beseitigt Störfelder und lässt die Energieströme ungestört durch den kleinen Körper fließen.«
Und schon wieder diese Harmonie-Litanei: »Die heilende Wirkung der Shiatsu-Massage beruht auf der innigen Verbindung, die während der taktilen Reizungen zwischen Eltern und Kind entsteht.
Wenn die Beteiligten dabei Blickkontakt halten, gewinnt jeder vom Qi des anderen – und erlebt das wunderbare Gefühl von Nähe und Geborgenheit. Das sind wahre Glücksmomente der Eltern-Kind-Beziehung. Darüber hinaus stärkt Shiatsu das Immunsystem, fördert den Schlaf und optimiert die Verdauung.«
Amen! Kümmert euch doch gefälligst um eure eigenen Störfelder und um eure eigene Verdauung! Und lasst mich endlich in Ruhe!, schimpfte Fritz tonlos. Und vor allem bringt mich nicht andauernd in Lebensgefahr. Heute Morgen sollte ich ertränkt werden und jetzt soll ich mich anscheinend totlachen? Wie soll man dieses Kitzeln an Händen und Füßen denn nur aushalten?
»An der Reaktion Ihres Sohnes merkt man, dass sein Qi völlig aus dem Gleichgewicht geraten ist«, behauptete die Expertin für fernöstliche Massagetechniken, die eigentlich gar nicht fernöstlich aussah, sondern eher nahgermanisch. »Wie man sieht, ist der Kleine hypersensibel. Seine massiv gestörten Energieströme bedürfen dringend einer intensiven ganzheitlichen Therapie.«
Und warum diese niederschmetternde Diagnose?
Nur weil der kleine Fritz auf dieses unerträgliche Gekribbel und Gekrabbel an seinen Fußsohlen mit einer Geräuschproduktion reagiert hatte, die an einen mittelgroßen Hühnerhof erinnerte.