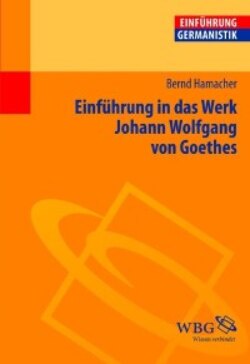Читать книгу Einführung in das Werk Johann Wolfgang von Goethes - Bernd Hamacher - Страница 7
I. Das „Kollektivwesen“ Goethe: Der Autor und seine Aktualität
ОглавлениеJohann Wolfgang Goethe galt lange Zeit als der klassische deutsche Nationalautor. Nach keinem anderen deutschsprachigen Schriftsteller wurde in der Geschichtsschreibung ein ganzes Zeitalter benannt: die ‚Goethezeit‘. Weltweit steht er noch heute stellvertretend für die deutsche Kultur, da die Einrichtungen der auswärtigen Kulturpolitik ‚Goethe-Institute‘ heißen. Schließlich ist auch die Universitätsdisziplin ‚Neuere deutsche Literatur‘ maßgeblich aus der Beschäftigung mit diesem ihrem lange Zeit mit Abstand wichtigsten Gegenstand hervorgegangen. Goethes Persönlichkeit war dabei in der öffentlichen Wahrnehmung oft genauso wichtig wie sein Werk. Vor einhundert Jahren bezeichnete der Philosoph und Soziologe Georg Simmel Goethe als Vorbild für den Menschen schlechthin: „Wir empfinden seine Entwicklung als die typisch menschliche – […] in gesteigerteren Maßen und klarerer Form zeichnet sich an ihm, in und unter all seinen Unvergleichlichkeiten, die Linie, der eigentlich jeder folgen würde, wenn er sozusagen seinem Menschentum rein überlassen wäre.“ (Simmel 1913, 263)
Repräsentativität und Intertextualität
Die Zeiten der Glorifizierung Goethes sind längst vorbei, vorbei aber auch die Zeiten, als eben jene postulierte Vorbildhaftigkeit Goethes vehemente Abwehrreflexe erzeugte. Goethe ist historisch geworden, was sich nicht zuletzt daran zeigt, dass selbst diejenigen seiner Texte, die immer noch regelmäßig auf den gymnasialen Lehrplänen stehen, für jede neue Generation immer fremder werden und schwerer zu verstehen sind. Goethes Stellung im literarischen Kanon bedarf in dieser Situation einer neuen Begründung. Die vorliegende Einführung möchte zum einen Wege zum historischen Verständnis der Texte öffnen, zum anderen aber auch aufzeigen, warum sie trotz des inzwischen immensen Abstands keineswegs nur noch von musealem Interesse sind. Ein aktueller Blick kann bei einer Selbstcharakterisierung ansetzen, die Goethe rund sechs Wochen vor seinem Tod in einem Gespräch vom 17. Februar 1832 mit dem Weimarer Prinzenerzieher Frédéric Soret gab:
Was bin ich selbst? Was habe ich getan? Ich habe alles, was ich gehört, beobachtet habe, gesammelt, benutzt. Meine Werke sind von Tausenden verschiedenen Individuen genährt, Unwissenden und Weisen, Geistreichen und Dummköpfen. Die Kindheit, das reife Alter, das Greisentum, alle haben mir ihre Gedanken, ihre Fähigkeiten, ihre Seinsart dargeboten, ich habe oft die Ernte gesammelt, die andere gesät hatten. Mein Werk ist das eines Kollektivwesens und trägt den Namen Goethe. (Übers. nach GG III/2, 839)
Darin spricht sich zum einen Goethes Selbstbewusstsein seiner epochalen Repräsentativität aus. Das ist zum anderen aber auch eine geradezu sensationell moderne Einsicht in den grundsätzlich intertextuellen Charakter seines Gesamtwerks, die dazu verführen könnte, die an Goethe angeknüpfte Genieideologie und Originalitätsästhetik mit einem Schlag zu erledigen. Modern ist diese Einsicht ferner in Bezug auf die dahinterstehende Identitätsproblematik: Das „Kollektivwesen“ hat so vielgestaltige und heterogene Texte vorgelegt, dass man oft kaum glauben konnte, „daß sie von demselben Schriftsteller entsprungen seien“ (I 14, 11), wie Goethe selbst diesen bereits von Zeitgenossen empfundenen Eindruck der Proteushaftigkeit im Vorwort zu seiner Autobiographie Dichtung und Wahrheit formulierte. Die folgende Darstellung möchte einen Eindruck von der Vielgestaltigkeit vermitteln und gleichzeitig Konstanten aufzeigen, die in ganz unterschiedlichen Kontexten und Konstellationen wiederkehren.
Zitiert werden Goethes Werke, sofern nicht anders angegeben, nach der Frankfurter Ausgabe (FA) unter Angabe von Abteilung, Band und Seite.