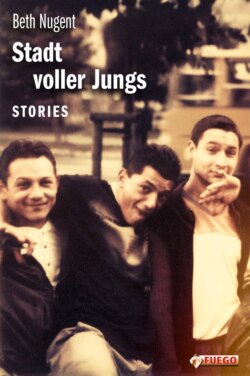Читать книгу Stadt voller Jungs - Beth Nugent - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Cocktailstunde
ОглавлениеMeine Mutter zieht in der Küche die Vorhänge zu, und das Licht im Raum reicht von einem eher matten, blassen bis zu einem dunklen Gelbton.
»Mensch«, sagt sie und sitzt am Tisch. »Mannomannomann. Diesmal sterb ich wirklich.« Sie legt sich die Hand auf die Stirn. »Mensch«, sagt sie noch einmal.
Mein Vater sieht ihr vom Herd aus zu, wo er Rühreier zubereitet. »Weißt du«, sagt er schließlich, »wenn du nicht soviel rauchen würdest, hättest du auch nicht so einen fürchterlichen Kater. Guck mich an«, sagt er, »ich hab nie einen Kater. Und weshalb?«
Er macht eine Pause, als erwarte er eine Antwort von ihr, obwohl sie sich durchschnittlich zweimal pro Woche über dieses Thema unterhalten. Meine Mutter sucht in der Tasche ihres Morgenrocks nach Zigaretten.
»Weil«, sagt mein Vater triumphierend, »weil ich nicht rauche.« Er lächelt, und meine Mutter zündet sich ihre Zigarette an.
»Haben wir Kaffee?«, sagt sie. Mein Vater legt den Pfannenwender hin und gießt ihr eine Tasse Kaffee ein; als er ihr die Tasse bringt, sehen sie sich einen Augenblick lang an, und sie nimmt sie ihm aus der Hand.
»Deine Eier brennen an«, sagt sie, und er dreht sich um und blickt zum Herd hinüber. Meine Mutter sieht ihm zu, während er die Eier in der Pfanne herumschiebt.
»Ich weiß nicht«, sagt er, »die Eier sehen schlecht aus.« Er hält sich die Pfanne unter die Nase und riecht. »Ich glaube, die Eier sind schlecht«, sagt er.
Meine Mutter lehnt sich auf dem Stuhl zurück und zieht die Zeitung zu sich herüber, als mein Vater ihr die Pfanne mit Eiern bringt.
»Was meinst du?«, sagt er. »Meinst du, dass die Eier schlecht sind?«
Meine Mutter sieht sich die Eier an, schaut dann weg. »Ich weiß nicht«, sagt sie. »Zeig mir bloß nichts zu essen.«
Mein Vater hält mir die Eier hin. In leuchtend gelbe Klümpchen und eine farblose Flüssigkeit unterteilt, sehen sie ein bisschen komisch aus, aber bevor ich irgendetwas sagen kann, streift er sie in den Abfall.
»So«, sagt er. »Ich glaube, die Eier waren schlecht. Du wirst mit Cornflakes vorlieb nehmen müssen«, verkündet er mir. »Falls wir welche haben.«
»Liebes«, sagt meine Mutter zu mir. »Sei doch so gut und schau mal, ob einer von den Nachbarn eine Pepsi gegen meinen Kater hat.«
Heute ist Sonntag, in einer Welt, in der die Geschäfte noch nicht den ganzen Tag geöffnet haben. Und meine Eltern verstehen es, sich auf die Hilfe der Nachbarn zu verlassen - besonders bei neuen Nachbarn.
»Schau mal, ob sie auch ein paar Eier haben«, sagt mein Vater.
»Mensch«, sagt meine Mutter und drückt ihre Zigarette im Aschenbecher aus. »Lass die Eier, Liebes. Hol bloß die Pepsi.«
Mein Vater setzt sich an den Tisch, und sie zündet sich noch eine Zigarette an. Beide sehen sie zu, wie der Rauch durch das trübe Licht zieht.
Ich bleibe vor dem Küchenfenster stehen, um mich zu entscheiden, bei welchem Nachbarn ich es versuchen soll, und um zu hören, ob meine Eltern über mich reden, wenn ich weg bin. Sie haben nur ein paar Themen, über die sie sich unterhalten: die Cocktailparty, die sie erst kürzlich gegeben oder besucht haben, die Karriere meines Vaters, das Rauchen meiner Mutter und, seltener, mich. Ich kenne jede dieser Unterhaltungen auswendig.
»Weißt du«, sagt meine Mutter. »Du solltest sie nicht überall um Eier bitten lassen. Sie hat noch nicht mal neue Freunde gefunden.«
»Tja«, sagt mein Vater nach einer Weile, »ich verstehe nicht, wieso das unsere Schuld sein soll.«
Die Unterhaltung stockt hier einen Augenblick lang, und ich stelle mir vor, wie meine Mutter sich dem Kreuzworträtsel in der Zeitung zuwendet und mein Vater auf den Tisch starrt.
»Na ja«, sagt meine Mutter schließlich, »sie ist in einem schwierigen Alter. Vielleicht war dieser Umzug keine so gute Idee.«
Mein Vater schweigt und überlegt sich, welches seiner vielen Gegenargumente er jetzt vorbringen soll. Immer wenn sie diese spezielle Unterhaltung führen, habe ich das Gefühl, als würde ich am Rande eines Waldes stehen, vor mir eine dunkle Mauer aus Bäumen, aber wenn ich mich umdrehe und zurückgehen will, stehen auch hinter mir Bäume und zu beiden Seiten. Ich bin mir meines schwierigen Alters bewusst, obwohl es mir so vorkommt, als ob es kein Alter gegeben hat, das nicht schwierig war für mich, und keinen Zeitpunkt, zu dem ein Umzug eine gute Idee gewesen wäre. Es ist vielleicht möglich, dass das noch keine so große Rolle gespielt hat, als ich noch ein Baby war. Wenn ich unsere Kartons voller Schnappschüsse durchstöbere, finde ich Bilder von mir, ein fremdes Baby, das unbeholfen in fremden Armen gehalten wird, oder ein älteres, verlegen aussehendes Kind vor fremden Häusern in Gesellschaft von Kindern, deren Namen ich vergessen habe. Ich versuche, mich an einen einzelnen Herkunftsort zu erinnern, einen Ort, der mir wie mein Zuhause vorkommt, aber alles, was ich sehe, sind meine Eltern in Liegestühlen, wie sie in die Sonne lächeln, oder auf Cocktailpartys, wie sie fröhlich, mit leuchtenden Augen ihre Gläser erheben. Das sind die Bilder meiner Vergangenheit, und sie wechseln mühelos von Staat zu Staat, genau wie wir, fast ohne Misstöne.
Die Viertel, in denen wir wohnen, sind alle gleich: schmucke, nahezu neue Häuser mit Auffahrten; innen sehen sie auch alle gleich aus, mit hellen Wänden und leichten, hohlen Türen, jedes Schlafzimmer, das ich habe, sieht aus wie alle anderen Schlafzimmer, die ich gehabt habe, und manchmal scheinen mir die Sachen, die ich besitze oder trage oder gern habe, genauso zu den Häusern zu gehören, in denen wir gewohnt haben, wie sie mir gehören. Die Firmen, für die mein Vater arbeitet, erledigen jedes Mal den ganzen Umzug für uns, sodass am Umzugstag plötzlich ganze Zimmer auseinandergenommen werden und verschwinden, um in dem neuen Haus fast in der gleichen Anordnung wieder aufzutauchen. Eine Puppe, die ich seit meiner Kindheit habe, erhält den Vortritt vor mir, wird vorsichtig von dem Kissen auf meinem Bett gehoben, dann wieder darauf gelegt und immer von dem Möbelpacker getragen, der eine kleine Tochter zu Hause hat. Immer wenn ich ein neues Schlafzimmer betrete, ist sie schon da und starrt, das blonde Haar straff und ordentlich, mit ausdruckslosen Puppenaugen zur Tür.
In meinen neuen Schulen bitten meine Lehrer mich manchmal, der Klasse etwas Interessantes über meine früheren Wohnorte zu erzählen, und ich versuche, mich an etwas zu erinnern, aber in Wirklichkeit ist das Amerika, das ich gesehen habe, überall gleich: Franklin, New Jersey, unterscheidet sich aus meiner Sicht nicht im geringsten von Arlington, Virginia oder Syracuse, New York. Die Häuser und die Nachbarn und die Straßen sind alle genau gleich, ohne sich auch nur so weit zu unterscheiden, dass sie mir dabei helfen könnten, mir etwas auszudenken.
Zum Schluss spielt mein Vater seine Trumpfkarte gegen meine Mutter aus, die darin besteht, dass er schließlich wegen seiner Arbeit umziehe, und die Arbeit mache er schließlich unseretwegen. Ihre Unterhaltung endet zuletzt so wie in den meisten Fällen, in einer Art beredtem Schweigen, und ich sehe mich um und frage mich, bei welchem Nachbarn die Wahrscheinlichkeit am größten ist, dass er eine Pepsi hat. Ich habe in dem Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein Mädchen ungefähr in meinem Alter gesehen, also fange ich dort an, und dieses Mädchen ist es, das mir die Tür öffnet. Sie sieht genauso aus, wie ich gern aussehen würde: glattes Haar, schöne lange Nase und lange, dünne Arme und Beine. Sie steht sichtlich auf der Schwelle zum Erwachsenenalter, und wie wir einander so gegenüberstehen, scheinen wir uns vom ungefähr gleichen Ausgangspunkt aus in genau entgegengesetzte Richtungen zu entwickeln. Das Zimmer hinter dem Mädchen liegt im Dunkeln, und sie sieht mich an, sagt aber nichts.
»Habt ihr vielleicht Pepsi da?«, sage ich, aber sie starrt mich nur ausdruckslos an. »Die ist für meine Mutter«, füge ich hinzu. »Sie hat einen Kater.«
Die Augen des Mädchens gleiten von meinem Gesicht zu meinem Oberkörper, zu meinen Beinen und Füßen, wandern dann wieder nach oben, meine Arme entlang, und beurteilen mein äußeres Erscheinungsbild.
»Nein«, sagt sie schließlich, »wir haben keine Pepsi.«
Ich wende mich zum Gehen, aber sie macht die Tür etwas weiter auf und schaut an mir vorbei unser Haus an, als hätte sie irgendetwas darüber gehört; dann tritt sie einen Schritt zurück. »Du kannst reinkommen, wenn du willst«, sagt sie.
Es ist das kleinste Haus im ganzen Block, und bei dem dunklen Zimmer hinter ihr handelt es sich um ein Wohnzimmer, das kaum benutzt aussieht, voll großer, schwerer Möbel und makellos polierter Tische.
»Meine Eltern sind noch nicht auf«, sagt sie, »aber du kannst mit in mein Zimmer kommen.«
Von irgendwo im Haus ertönt ein Fernseher und wir gehen die kurze Treppe zu einem höher gelegenen Stockwerk mit nur zwei Türen hinauf. In dem Zimmer, in das sie mich führt, liegt ein Junge auf einem der beiden Betten. Er hält ein Comic-Heft ein paar Zentimeter vor sein Gesicht und blickt nicht auf, als wir eintreten.
»Verschwinde, Tommy«, sagt sie, und er lässt das Comic-Heft sinken. Er scheint etwa so alt wie sie zu sein, und seine langen Arme und Beine ragen linkisch aus seinem Baumwollpyjama hervor.
»Verschwinde du lieber«, sagt er. Sie starren sich einen Augenblick lang an, und schließlich dreht das Mädchen sich um und geht hinaus. Tommy hält sein Comic-Heft wieder vors Gesicht. Comic-Bände liegen auf dem ganzen Bett und auf dem Fußboden rundherum verstreut, und ein paar brutale Umschlagbilder auf Glanzpapier hängen über seinem Kissen an der Wand. Auf der anderen Seite des Zimmers ist alles in kleinen Stößen an der Wand aufgestapelt.
Ich folge dem Mädchen nach unten in die Küche; das Geräusch des Fernsehers scheint aus dem Keller zu kommen, wo sich bei mir zu Hause das sogenannte Familienzimmer befindet. Das Mädchen macht den Kühlschrank auf, lehnt sich auf die Tür und starrt auf das Essen darin.
»Du hast ein Zimmer mit deinem Bruder zusammen?«, frage ich.
»Und?«, sagt sie. »Hast du keinen Bruder?«
Hinter ihr, im Kühlschrank, kann ich eine ganze Sechserpackung Pepsi sehen.
»Nein«, sage ich.
Sie zieht das Fleischfach heraus und lässt den Blick über den Käse und die Mortadella schweifen,
»Eine Schwester?«, sagt sie.
»Nein.«
Sie dreht sich um und sieht mich an. »Du bist ein Einzelkind«, sagt sie, als wäre sie anhand raffinierter Schlussfolgerungen an diese Information gelangt.
»Macht es dir nichts aus, ein Zimmer mit deinem Bruder zusammen zu haben?«, frage ich und sie wendet sich wieder dem Kühlschrank zu.
»Guck mal«, sagt sie, » wir haben doch noch Pepsi.« Sie zieht eine aus der Sechserpackung und reicht sie mir. »Hier«, sagt sie, ist dann einen Augenblick unschlüssig. »Möchtest du Eis?«, fragt sie.
Ich warte am Tisch, während sie Eis, Löffel und Schälchen mitbringt. Sie gibt mir etwas Eis, löffelt dann den Rest - fast die halbe Packung - in ihr eigenes Schälchen und klatscht ihren Löffel oben drauf.
»Okay«, sagt sie. »Was wäre deiner Meinung nach die schlimmste Todesart?«
Sie hält den Löffel an die Zunge und macht die Augen zu, um alle Möglichkeiten zu durchdenken. Während sie die Augen immer noch geschlossen hält, betritt ein Mann das Zimmer und bleibt in der Tür stehen. Auch er trägt einen Pyjama, dazu noch einen Morgenrock und ein Paar Slipper, die seine glatten weißen Fersen sehen lassen.
»Annie«, sagt er, und sie macht die Augen auf, wartet jedoch kurz, bevor sie sich umdreht und ihn ansieht.
»Wie heißt deine Freundin?«, fragt er, und mir wird bewusst, dass ich ihr meinen Namen nicht genannt habe. Sie starrt mich einen Augenblick lang an.
»Anne«, sagt sie. »Das ist Anne.«
»Also gut, Anne«, sagt der Mann, und er beugt sich über den Tisch und streckt seine Hand aus. »Sehr erfreut, dich kennenzulernen.« Seine Haut ist kalt und trocken, und ich lasse seine Hand schnell los.
Annie zerstampft ihre Eiscreme zu einer Suppe, und ihr Vater steht daneben. Er sieht uns kurz zu, macht eine Schleife in den Gürtel seines Morgenrocks und löst sie wieder, während Annie den Löffel zum Mund führt und ihr Eis aufschlürft.
»Das Eis sieht lecker aus«, sagt er. Er sieht ihr noch einen Augenblick beim Essen zu, dann dreht er sich um und geht.
Annie wirft einen Blick auf mein Eis, bringt ihr Schälchen zum Spülbecken und gießt aus, was übrig geblieben ist. Dann geht sie zur Haustür und stellt sich daneben, ohne mich anzusehen, aber auch ohne irgendetwas anderes anzusehen. Ich habe mein Eis noch nicht fertig gegessen, aber ich stehe mit dem Schälchen in der Hand auf.
»Oh«, sagt sie, »das kannst du da lassen. Tommy isst das schon.«
Sie macht die Tür mit dem Fliegengitter hinter mir zu, und als ich mich auf der Straße umdrehe, um einen Blick zurückzuwerfen, steht sie immer noch da, und die Silhouette von Gesicht, Hals und Kopf hebt sich von dem dunklen Zimmer hinter ihr ab.
Die Pepsi ist warm, als ich zu Hause ankomme, aber mittlerweile ist meine Mutter ihren Kater wieder los, und sie sitzt über das Kreuzworträtsel gebeugt. Als sie mit dem Eis in ihrem leeren Glas klirrt, steht mein Vater auf, um es ihr aus der Hand zu nehmen. Tomatensaft läuft in Schlieren an seiner Innenseite herunter.
»Sally«, sagt meine Mutter, »wir haben uns schon Sorgen um dich gemacht.«
»Hier ist deine Pepsi«, sage ich und halte sie ihr hin.
»Trink du sie, Liebes«, sagt sie. »Ich brauch sie nicht mehr.«
Sie tippt sich mit der Spitze ihres Kugelschreibers an die Lippe, wodurch ein winziges schwarzes Pünktchen zurückbleibt, als sie ihn wieder wegnimmt. »Kennst du ein Wort für Pferderennen mit fünf Buchstaben?«, fragt sie meinen Vater, und er hört auf, Eis in ihr Glas zu geben, und steht still, um zu überlegen. Sein Gesicht ist völlig ausdruckslos. Schließlich schüttelt er den Kopf, lässt das Eis in ihr Glas fallen und gießt dann Tomatensaft drauf, der blass-rosa wird, als er Wodka dazu schüttet.
Ich mache die Pepsi meiner Mutter auf und sitze mit meinen Eltern am Tisch. Meine Mutter starrt auf das Rätsel, trägt gelegentlich ein Wort ein, und mein Vater arbeitet sich durch die Zeitung, indem er jede einzelne Seite auf der Suche nach bedeutsamen Artikeln überfliegt. Er legt die einzelnen Teile der Zeitung auf einen von zwei Stößen: die mit bedeutsamen Artikeln, die er später noch lesen wird, und die ohne. Er sieht sich jede Seite verzweifelt von oben bis unten an und hofft nichts zu finden, womit er sich näher befassen muss, damit dieser Teil des Tages für ihn vorbei ist. Die Pepsi ist zu warm und zu süß, aber ich trinke sie aus der Dose und sehe meiner Mutter dabei zu, wie sie einen Eiswürfel aus ihrem Glas nimmt und ihn sich an die Stirn hält.
»Herrgott«, sagt sie. »Warum müssen die einen immer in so heiße Gegenden schicken?«
Mein Vater blickt von seiner Zeitung auf und sieht dabei zu, wie etwas von dem Eis auf das Rätsel meiner Mutter tropft.
»Verdammt«, sagt sie, tupft einen Tropfen auf, der auf die Zeitung gefallen ist, und verschmiert damit das Wort, das sie gerade eingetragen hat.
»Aber wenigstens ist sie aus gutem Papier«, sagt mein Vater. »Das muss man ihr lassen.«
Sie sagt nichts und reibt sich mit dem Eiswürfel über Gesicht und Hals. Mein Vater sieht dabei zu, wie ihr die Wassertropfen über das zierliche Brustbein in die Bluse rinnen. Dann schaut er weg und steht auf, um noch einen Drink zuzubereiten.
»Liebes«, sagt meine Mutter, »ist dir nicht langweilig? Warum guckst du nicht ein bisschen Fernsehen?«
Genau wie unsere Nachbarn und unsere Häuser, unsere Straßen und unsere Bäume verändert sich das Fernsehprogramm von einem Ort zum Ändern so gut wie gar nicht, und die gleichen Shows und Songs und Gesichter begleiten uns durch das ganze Land. Ich sehe mir einen Film an, den ich schon in zwei anderen Staaten gesehen habe, und durchs Fenster kann ich Annies Haus sehen. Ich male mir aus, wie sie in das Zimmer zurückgeht, das sie sich mit ihrem Bruder teilt, sich auf die Bettkante setzt und ihm dabei zusieht, wie er seine Comic-Hefte liest. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie in jenem Haus sonst tun könnte, es sei denn, sie sitzt auf dem großen, schweren Sofa im Dunkel des Wohnzimmers.
In der Küche ist mein Vater damit fertig, die Zeitung durchzusehen, seufzt auf und wendet sich dem großen Stoß von Artikeln zu, die er jetzt lesen muss. Er starrt lustlos auf jeden einzelnen Artikel, und immer wenn meine Mutter ihn bei ihrem Rätsel um Hilfe bittet, hört er auf zu lesen und stiert geradeaus, um zu überlegen, bis er, unfähig zu helfen, sich wieder seinem Artikel zuwendet und sie zu einer anderen Frage übergeht. So verrinnt der Nachmittag ganz langsam; die meisten Tage vergehen bei uns so, ganz langsam, und immer wieder geschieht das gleiche, und bei dem Tempo, in dem für uns die Zeit vergeht, erscheint es möglich, dass ich niemals erwachsen werde.
Der Film geht zu Ende, ein anderer fängt an, und ich sehe mir auch den noch an, bis meine Eltern sich zu regen beginnen, in Erwartung der Cocktailstunde, die unmittelbar bevorsteht. Die Cocktailstunde macht es erträglicher, dass der Tag plötzlich zur Neige geht, macht daraus ein sanftes Hinübergleiten in den Abend, und sie verändert alles - selbst das Licht nimmt einen gedämpften Goldton an, und es fällt direkt auf meine Eltern. Ich sitze nicht in dem Licht, aber ich bin nahe genug, um seine Wärme zu spüren, zusammen mit dem beißenden Geruch der Martinis meiner Mutter und der gelegentlichen milden Woge von Scotch im Atem meines Vaters, wenn er sich über mich beugt, um meiner Mutter ihren Drink zu reichen.
Mit der Cocktailstunde stellt sich so eine Erregung ein, ein fieberhaftes Gespür dafür, dass alles möglich ist. Die Augen meiner Eltern beginnen zu leuchten, ihre Stimmen erheben sich, ihre Gesten werden weit ausholend und fröhlich. Dann herrscht hier ein grell funkelndes Licht, und wenn ich nach draußen schaue, kommen mir die ganzen anderen Häuser grau und unwirklich vor, nur wie ein Teil der verschwindenden, fahlen Abendlandschaft. Die Familien darin nehmen ihr Abendessen ein und machen die Hausarbeit und sehen zusammen fern. Sie werden heute Abend das gleiche tun, was sie gestern Abend getan haben und was sie auch morgen wieder tun werden. Selbst Annies Haus ist düster, nur von dem kraftlosen, orangefarbenen Sonnenstrahl erleuchtet, der von dem Gebäude dahinter reflektiert wird. Ich wende mich wieder dem Fernseher zu und höre, wie meine Eltern munter werden.
Als ich am nächsten Tag die Haustür aufmache, steht Annie da, ganz unbekümmert an den Türpfosten gelehnt. Sie hat nicht geklopft und vielleicht den ganzen Morgen hier gestanden, möglicherweise schon, seit mein Vater zur Arbeit gefahren ist.
»Oh«, sagt sie, als hätte sie ihre Tür geöffnet und mich davor entdeckt.
»Hi«, sage ich.
»Hör mal«, sagt sie. »Ich hab deinen Namen nicht mitgekriegt.«
»Sally«, sage ich zu ihr, und sie nickt.
»Sally«, wiederholt sie. »In der Schule gibt es schon drei Sallys.«
Sie fasst nach einem Faden, der von ihrem Armelaufschlag herunterhängt, und zieht daran, aber er ist nicht lose, und sie lächelt, als ihr Ärmel anfängt, sich aufzuribbeln. »Ich kann sie alle drei nicht leiden«, sagt sie und blickt in Richtung der Schule, die nicht allzu weit entfernt liegt. Meine Eltern bemühen sich immer, ganz nah bei der Schule zu wohnen, damit ich zu Fuß hingehen kann, und sie bemühen sich auch, bei unseren Umzügen den Schulbeginn mit einzuplanen, damit ich, wie sie es ausdrücken, keinen schlechten Start habe. Die Chance neue Freunde zu finden, sagen sie, ist für mich genauso groß wie für alle anderen. Und das stimmt, ich finde in meinen neuen Schulen immer Freunde, und es sind immer die gleichen: schüchterne Mädchen mit dünnem Haar und Brille und schüchterne Jungs mit blassen, runden Gesichtern. Sie ähneln einander so sehr, dass ich mich kaum von einer Stadt zur nächsten an sie, ihre Namen oder ihre jeweiligen Charakterzüge erinnere. Manchmal schicken wir uns ein paar kurze, hingestammelte Briefe, doch schon bald treten neue Freunde an ihre Stelle, die so reden wie sie, so gehen und aussehen und sich so kleiden wie sie, ja, ihnen so ähnlich sind, dass nur ihr Alter sich ändert, und es ist, als handele es sich um denselben Freundeskreis, der zusammen mit mir älter wird.
Ich finde meine neuen Freunde am Anfang jedes Schuljahrs, und genau wie ich selbst sind sie immer zu finden, wie sie sich am Rand des Klassenzimmers herumdrücken oder in den Fluren die Wand entlang schleichen - an Stellen, wo wir nicht im Weg stehen und beobachten können, wie uns die Spielregeln an der Schule vorgeführt werden. Annie ist ganz anders als meine üblichen Freunde.
»Wie auch immer«, sagt sie jetzt, »was hast du gerade gemacht?«
»Nichts«, sage ich, und sie starrt mich gespannt an.
Sie sagt nichts, also sage ich schließlich: »Ich hab bloß Fernsehen geguckt.«
»Fernsehen?«, sagt sie und wirft einen Blick über meine Schulter. Hinter mir springt der Fernseher übergangslos von einer Show zur Werbung und wieder zu der Show, und sie horcht und versucht zu erraten, was gerade läuft.
»Meine Eltern lassen mich nicht viel Fernsehen gucken«, sagt sie und schaut immer noch an mir vorbei, und bald sitzen wir zusammen auf dem Teppich vor dem Fernseher.
»Oh«, sagt sie, »ich finde diese Show toll.« Sie sitzt nur ein paar Schritte vom Fernseher entfernt, aber ich kann sehen, wie ihre Augen durchs ganze Zimmer wandern. Sie lehnt sich zur Seite und wirft um die Ecke herum einen Blick in die Küche.
»Was macht sie da?«, fragt Annie.
»Ich weiß nicht«, sage ich, »vielleicht ein Kreuzworträtsel.«
Einen Augenblick später kommt meine Mutter ins Zimmer, und als ich ihr Annies Namen sage, wirft Annie mir einen überraschten, etwas misstrauischen Blick zu, da sie ihn mir eigentlich nicht verraten hat, aber sie gibt meiner Mutter die Hand und lächelt.
»Sie haben ein sehr schönes Haus«, sagt sie, und meine Mutter schaut verdutzt drein und lässt dann ihren Blick über die weißen Wände, die schlichten, gediegenen Möbel schweifen.
»Danke«, sagt sie, und als unsere Show weitergeht, steht sie, vornehm an ihrer Zigarette ziehend, hinter uns, während wir es uns wieder vor dem Fernseher gemütlich machen. Annie sitzt ruhig neben mir, aber ich kann sehen, wie sie sich ohne den Kopf zu bewegen immer noch umblickt, und hinter mir atmet meine Mutter den Rauch ein und aus. Sie allein scheint sich die Show anzusehen, und als wieder ein Werbespot kommt, geht sie in die Küche zurück, wobei sie die Zigarettenasche in der Hand birgt.
»Kinder«, ruft sie nach einer Weile, »kennt ihr ein Kinderspielzeug mit sechs Buchstaben?«
Annie sieht mich an.
»Also«, sage ich, »wie ist es hier so an der Schule?« Obwohl ich schon weiß, wie es ist; es ist wie an allen anderen Schulen.
»Oh«, sagt Annie, als eine neue Show anfängt. »Guck mal.« Sie lässt sich weiter auf den Teppich zurücksinken, um zuzuschauen. Sie hat die Ellbogen unbequem hinter sich aufgestützt und starrt mit halb offenem Mund auf den Fernseher.
Als mein Vater von der Arbeit nach Hause kommt, steht Annie sofort auf. Verschämt stellt sie ein Bein schräg hinter das andere und lächelt meinen Vater auf eine Art an, die mir sagt, dass sie nicht anders kann.
»Sie haben ein sehr schönes Haus«, sagt sie, und er lächelt erfreut.
»Tja«, sagt er und rückt die Füllfederhalter in seiner Brusttasche zurecht, zieht sie heraus und steckt sie einen nach dem anderen zurück. Meine Mutter sieht ihm zu und trägt noch ein Wort in ihr Kreuzworträtsel ein. Als er zum Kühlschrank geht und das Gefrierfach aufmacht, faltet sie ihre Zeitung zusammen.
»Liebes«, sagt sie zu mir, »möchte deine Freundin gern zum Essen bleiben?«
Sie sagt das ganz selbstverständlich, als würden wir wie alle anderen Familien zu Abend essen, wenn mein Vater von der Arbeit nach Hause kommt. Die Hand noch auf einer Eisschale dreht er sich zu ihr um, und sie nimmt, ohne eine Antwort abzuwarten, einen Topf aus der Schublade unter dem Herd und macht einen Schrank auf. Annie gibt keine Antwort, und wir sehen alle meiner Mutter dabei zu, wie sie Dosen herausnimmt und sich gut gelaunt die Etiketten anschaut. Schließlich macht sie eine davon auf und wir starren sie wie gelähmt an, während sie eine Dose olivgrüner Erbsen in den Topf schüttet. Als die Dose leer ist, tritt Annie einen Schritt zurück.
»Danke«, sagt sie, »aber meine Eltern werden auf mich warten.« Meine Mutter blickt entgeistert auf; sie hat das alles nur Annie zuliebe auf sich genommen.
»Bis morgen«, sagt Annie zu mir und als die Tür hinter ihr ins Schloss fällt, schaut meine Mutter auf die Dose in ihrer Hand und dann auf den Topf auf dem Herd; schließlich stellt sie die Dose hin und schaltet den Herd aus, während mein Vater Eis in ihr Glas fallen lässt. Ich beobachte Annie, wie sie langsam im Zickzack über die Straße nach Hause geht.
»Du bist nicht hungrig, Liebes, oder?«, fragt meine Mutter, und ich schüttele den Kopf und setze mich wieder vor den Fernseher, während meine Eltern sich der Cocktailstunde widmen. In der ganzen Gegend bereiten sich die Jungs und Mädchen, die meine Freunde sein werden, darauf vor, dass die Schule anfängt; sie essen ruhig ihr Abendessen und fürchten sich vor dem Beginn eines weiteren Jahres, das sie an den Rändern der Dinge zubringen werden.
Als wir schließlich zu Abend essen, sind wir alle etwas träge. Ich habe zu viel ferngesehen und bei meinen Eltern ist die glühende Erregung der Cocktailstunde erloschen. Es ist zu spät zum Essen, sodass wir nur dasitzen und die zartgrünen Erbsen von einer Seite des Tellers zur anderen schieben.
Annie erscheint am nächsten Tag auf die gleiche Art: Sie steht diskret neben der Tür herum, als ich aufmache.
»He«, sagt sie, »nur noch ein Tag bis Schulbeginn.«
Während sie spricht, schaut sie an mir vorbei und auf meine Hände und Füße herunter und auf unser Haus. »Willst du die Schule mal sehen?«, sagt sie. »Willst du doch, oder? Wir können zusammen hingehen.« Sie sieht mich an, als sie das sagt, und nickt dann.
»Komm schon«, sagt sie und dreht sich um, also folge ich ihr und lasse den Fernseher laufen und meine Mutter in der Küche an den Rand ihres Rätsels verschiedene Wortkombinationen kritzeln.
So menschenleer sieht der Schulhof winzig und uninteressant aus, selbst wenn er in nur einem Tag riesig und unkontrollierbar erscheinen wird, voller Kinder, die die Anlaufschwierigkeiten am Anfang jedes Schuljahrs durchlaufen. Annie sitzt auf einer Schaukel, schlingt die Ketten fest umeinander und dreht sich im Kreis; ihre Füße schleifen auf dem Sand und hinterlassen lange Furchen; dann dreht sie sich andersherum und wirbelt die ganze Erde auf.
»Ich weiß was«, sagt sie, »lass uns ein Feuer machen.«
»Ein Feuer?«, sage ich.
Sie schaut mich an und zieht eine Augenbraue hoch. »Hast du noch nie ein Feuer gemacht?«, sagt sie, und ihr Ton bringt mich dazu zu sagen: »Doch, na klar«, obwohl mir noch nie der Gedanke gekommen ist, ein Feuer zu machen.
»Okay«, sagt sie und blickt sich um. Sie fängt an, irgendwelches Zeug aufzusammeln - loses Papier, Blätter, ein paar Büschel trockenes Gras - und häuft alles am Fuß der Schaukelständer auf. Ich reiche ihr alles, was ich gefunden habe, und als an jedem Ständer ein kleiner Haufen liegt, lächelt sie mich an und zündet das erste Streichholz an. Sie kniet sich vorsichtig an jede einzelne Ecke der Schaukel, und als alle vier kleinen Feuer in Brand gesetzt sind, nimmt sie mich bei der Hand, und wir laufen zu dem Zaun am Rand des Schulhofs. Wir ducken uns dahinter, um zu beobachten, wie die Schaukel brennt. Flammen lodern an den schräg stehenden Metallständern hoch und fallen schließlich in sich zusammen. Ich kann Annies Erregung spüren, während sie dabei zusieht und sich an den Zaunmaschen festhält. Als die Feuer erloschen sind, dreht sie sich mit strahlendem Gesicht zu mir.
»War das nicht klasse?« Sie nickt mit dem Kopf. »Das war klasse.« Sie starrt einen Augenblick lang zu der Schaukel zurück, steht dann unvermittelt auf und geht davon. Ich folge ihr nach Hause, aber auf dem ganzen Weg versuche ich mir vorzustellen, wie es sein muss, auf der Schaukel zu sitzen, wenn sie brennt, und die Wärme steigt durch den Metallsitz hoch, und ich mittendrin, aufwärts und wieder zur Erde zurückschwingend, von Flammen umzüngelt.
»Also«, sagt Annie, als wir in unserer Straße ankommen. »Meine Mutter hat gesagt, dass du heute zu uns zum Abendessen kommen kannst. Wenn du willst.« Sie schaut zu unserem Haus hinüber. »Wenn deine Mutter nichts dagegen hat.« Ohne meine Antwort abzuwarten oder mir auch nur die Möglichkeit zu geben, über ihre Einladung nachzudenken, geht sie vor in mein Haus und steht unbeweglich vor meiner Mutter, während ich um Erlaubnis frage.
Meine Mutter lächelt Annie fröhlich an.
»Natürlich, Liebes«, sagt sie und wendet sich wieder ihrem Rätsel zu. Annie sieht sich in unserer Küche um. »Wir können Fernsehen gucken bis zum Abendessen«, sagt sie und geht ins Wohnzimmer um den Fernseher einzuschalten.
Bei Annies Familie gibt es Möhren, Kartoffeln, Hähnchen und Brot zum Abendessen, alles auf einem Teller. Ich sitze neben Annie, gegenüber von Tommy, der einen völlig gleichbleibenden Essrhythmus hat: Jedes mal wenn er einen Bissen zu sich nimmt, sieht er sich das Essen auf dem Tisch an; während er kaut, starrt er Annie und mich an. Die Gesichter von Annies Eltern sind wie aus Plastik. Ihre Haut ist hell und glatt, und ihr Gesichtsausdruck verändert sich kaum einmal. Jeder von uns hat ein großes Glas Eistee neben seinem Silbergeschirr stehen, aber niemand scheint etwas davon zu trinken.
»Es ist schön, dass Annie eine neue Freundin hat«, sagt ihre Mutter zu mir. »Annie hat nicht viele Freunde.«
Annie hält den Kopf gesenkt und isst ihre Möhren. Sie steckt einen Bissen nach dem anderen in den Mund, bis ihre Wange ganz dick ist.
»Annie«, sagt ihre Mutter, »lass das.« Langsam fängt Annie an zu kauen. Ihr Bruder starrt sie an, sagt aber nichts, und als sie die ganzen Möhren in ihrem Mund heruntergeschluckt hat, habe ich meinen Teller fast leer gegessen.
»Du hast einen sehr guten Appetit«, sagt ihre Mutter zu mir. »Ich wünschte, Annie hätte einen so guten Appetit wie du.«
Im selben Augenblick herrscht völlige Stille, und alle sehen auf meinen Teller. Ich versuche mir etwas zu überlegen, was ich sagen könnte, aber mir fällt nichts ein, also trinke ich einen Schluck von meinem Tee, und die anderen fangen wieder an zu essen. Neben mir stopft Annie sich ihr Essen in den Mund, bis beide Wangen voll sind, und hält sich dann ihre Serviette vor den Mund. Auf diese Weise isst sie ihren Teller leer und ich bin erstaunt, dass das niemandem auffällt. Als sie fertig ist, nimmt sie die Serviette mit sich ins Bad.
»Kriegst du keinen Hunger?«, frage ich sie, als das Abendessen vorbei ist und wir in ihrem Schlafzimmer sind.
»Nein«, sagt sie und macht eine Schublade auf, aus der sie eine Tüte Karamellbonbons nimmt. »Ich mag das Essen nicht«, sagt sie. »Ich mag nur Bonbons.«
Sie wickelt ein Karamellbonbon aus und isst es schnell auf, fast ohne zu kauen, bevor sie es herunter schluckt, und wickelt schon das nächste aus, während ihre Kiefer in heftiger Bewegung sind; dann isst sie das auf, dann noch eins, alle mit einem so verzweifelten Blick, als handele es sich um etwas, das sie innerhalb einer bestimmten Zeit ausführen muss. Ich weiß kaum, was ich tun soll, während sie isst, sodass ich die Papierchen aufsammle, glatt streiche und übereinander lege.
Ich habe einen makellosen kleinen Stapel zusammen, als Tommy hereinkommt und sich auf den Rand seines Bettes setzt. Er starrt Annie an, während sie isst. Eine Schweißschicht glänzt auf seiner Stirn, und als er sein Hemd hochzieht, um sie abzuwischen, kommt sein weißer, dünner Bauch zum Vorschein. Ich schaue weg, als er sein Hemd wieder herunterlässt.
»Warum isst du nicht wie ganz normale Leute?«, sagt er, und sie schluckt das Bonbon in ihrem Mund herunter und macht die Tüte zu.
»Halt die Klappe, Tommy«, sagt sie und wendet ihm den Rücken zu. Er sieht uns noch einen Augenblick lang zu, wirft sich dann auf sein Bett zurück und greift nach einem Comic-Heft.
Annie macht die Schublade mit ihren Bonbons zu und lehnt sich an den Kopfteil ihres Bettes zurück. »Du kannst über Nacht bleiben, wenn du willst«, sagt sie. »Meine Mutter sagt, das wäre okay.«
Ich spüre, dass Tommy sich auf dem Bett anders hinlegt, um zu lauschen, und ich versuche mir vorzustellen, wie es nachts in diesem Zimmer wohl sein mag, wenn Annies dünner Körper sich an die Wand drückt, während Tommy das Bettlaken abstreift und wieder hochzieht über sein sehnsüchtiges Fleisch und sich immer wieder auf seinen Comic-Heften hin und her wälzt.
»Das geht nicht«, sage ich. »Nicht, wenn ich am nächsten Tag in die Schule muss.«
»Okay«, sagt sie und verlässt das Zimmer. Ich folge ihr und Tommy sieht zu, wie wir gehen.
Unten im Familienzimmer sitzen Annies Eltern zusammen auf dem Sofa und sehen fern. Alle Lichter sind aus, das Zimmer ist voller Schatten, und das kalte Licht des Fernsehers tanzt an den Wänden wie etwas, das unter dem Anstrich entlang huscht. Wir setzen uns vor den Fernseher, und Annie starrt auf den Bildschirm. Ich kann ihre Eltern hinter uns kaum atmen oder sich einmal bewegen hören, so sehr konzentrieren sie sich aufs Fernsehen. Bei der Werbung steht Annie auf, und wieder folge ich ihr. Ihre Eltern lächeln uns freundlich an, als wir gehen, und wenden ihren Blick dann wieder dem Fernseher zu, um sich den Rest des Werbespots anzusehen.
Annie macht den Kühlschrank auf.
»Möchtest du etwas Eiscreme?«, fragt sie. Sie schwingt die Tür auf und zu. »Kekse?«, sagt sie. »Pepsi?«
»Nein«, sage ich. »Meine Eltern machen sich bestimmt bald Sorgen um mich.«
Sie stellt im obersten Fach ein paar Flaschen um. »Also«, sagt sie, »ich komme dann morgen und hole dich zur Schule ab.«
Als ich gehe, steht sie immer noch vor dem Kühlschrank und dreht sich auch nicht um, um mich Weggehen zu sehen. Draußen ist es dunkel geworden. Meine Eltern werden noch die Cocktailstunde genießen, und von Annies Auffahrt her kann ich meinen Vater in der Küche herumlaufen sehen, wie er Eis zerkleinert und Drinks eingießt. Obwohl meine Mutter nicht zu sehen ist, weiß ich, dass sie am Tisch sitzt, raucht und ihm zuschaut.
Hier im Dunkeln sehen die Häuser genauso aus wie immer, aber drinnen kommt mir nichts - weder Abendessen noch Hausarbeit oder Fernsehen - vertraut vor. Ich bin der einzige Mensch, der nicht hinter einem sicheren, beleuchteten Fenster steckt, und einen Augenblick lang bin ich wie gelähmt, umgeben von einer fremden Welt, unfähig, zu Annie zurück, und ohne Lust, nach Hause zu gehen. Schließlich überquere ich die Straße zu unserem Haus, und vor der Tür mache ich Lärm und warte, um meinen Eltern die Gelegenheit zu geben, ihr übliches höfliches Gesicht aufzusetzen. Als ich hereinkomme, lächeln sie und trinken noch einen Cocktail, aber als ich im Bett liege, horche ich angespannt, und ich bin sicher, neben dem Klirren des Eises in ihren Gläsern zu hören, wie die Haut sich von ihren Gesichtern schält.
Annie und ich gehen auf dem Weg zur Schule an der Schaukel vorbei und sie stößt mich mit dem Ellbogen an. Ein Junge und ein Mädchen haben sich an einen der schräg stehenden Metallständer gedrängt und küssen sich, aber Annie beachtet sie gar nicht, sondern nur das verbrannte Gras zu ihren Füßen.
»Das sind wir gewesen«, sagt sie und lacht, ein seltsames, schrilles Gekicher, während sie mich wegzieht. Der Junge und das Mädchen blicken auf, als ich zu ihnen zurückschaue. Es fällt mir schwer zu glauben, dass wir für die großen Flecken schwarzen Grases unter der Schaukel verantwortlich sind. Annie trödelt herum, als wir zum Eingang kommen, und wartet bis zur letzten Minute, ehe sie hineingeht.
Es ist neu für mich, an einer Schule anzufangen und schon eine Freundin zu haben. Normalerweise begebe ich mich an den Rand des Gedränges und schließe Freundschaft mit denen, die schon da stehen. Dann sehen wir den anderen zu und versuchen uns damit zu trösten, dass wir intelligent sind und in der Schule gut vorankommen. Annie hat keine Schulfreunde erwähnt, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass sie welche hat. Ihr Bruder geht auch an unsere Schule, eine Klasse über uns, aber als wir an ihm vorbei gehen, in einer Gruppe von Jungs vor dem Eingang, sieht er uns nicht an. Die ganzen Jungs tragen dunkle T-Shirts mit Bildern darauf. Annie und ich gehen zusammen den Gang hinunter und sie spricht mit niemandem. Ab und zu fasst sie mich am Ellbogen und flüstert mir erregt ins Ohr, was sie über die Leute weiß, an denen wir vorbei gehen.
»Das ist eine von den anderen Sallys«, sagt sie oder: »Siehst du den Jungen da? Der hat versucht, sich umzubringen.«
Als wir uns trennen, um unsere jeweiligen Klassenzimmer aufzusuchen, bohrt sie ihre Nägel in meine Handfläche. »Wir treffen uns genau hier«, sagt sie. »Zum Mittagessen.«
Während mein neuer Lehrer die wichtigsten Exportartikel Brasiliens aufzählt, die ich schon an meiner letzten Schule auswendig gelernt habe, sehe ich mir die anderen Schüler an und suche mir meine neuen Freunde heraus. In dem Klassenzimmer herrscht die übliche Sitzordnung: Intelligente, wissbegierige Schüler sitzen voller Aufmerksamkeit ganz vorn; gelangweilte, zornige Jungs starren in der hintersten Reihe zum Fenster hinaus; die Mädchen, die einmal - das lässt sich schon absehen - hübsch und beliebt sein werden, sitzen wie ein einziges Energiebündel in der Nähe der Tür. Diejenigen, die meine Freunde sein werden, haben sich da verteilt, wo noch Stühle frei waren, und schätzen sich glücklich, wenn sie an der Seite oder hinten sitzen können, neben niemand bestimmtem. Sie melden sich selten, machen sich jedoch gewissenhaft Notizen. Draußen auf der Straße jenseits des Schulhofzauns fahren Autos vorbei. Nach einer Weile fange ich an, mir Notizen zu machen. Kaffee, schreibe ich, Paranüsse.
Annie steht mitten im Gang und starrt die Tür zu meinem Klassenzimmer an, als ich herauskomme. Zwei Mädchen mit Brille und dünnem braunen Haar blicken mich an, aber als sie sehen, dass eine Freundin auf mich wartet, gehen sie vor uns her den Gang hinunter. Ihre hellblauen Pullover verschwinden in der Menge.
Annie und ich gehen mit unseren Tabletts durch den Speisesaal zu dem freien Ende eines Tischs. Niemand spricht mit uns, und auch wir sprechen mit niemandem. Tommy sitzt an einem Tisch mit lauter Jungs. Er isst in einem fort und blickt zu uns auf, als wir vorbei gehen. Einen Augenblick lang herrscht Schweigen; dann lächelt Annie die Jungs an, und ihre Gesichter erstarren; ihre Gesichter zeigen keinerlei Regung, nicht einmal, als sie ihr Essen auspacken und das Papier zusammenknüllen. Als wir weitergehen, folgen sie uns mit ihren Blicken, aber Annie sieht sich nicht um.
Wir setzen uns auf die zwei Plätze am Ende des Tischs und niemand sieht zu uns auf, als wir uns hinsetzen. Annie hat sich nur Schokoladenpudding zum Mittagessen gekauft, und während sie die Plastikfolie von dem Schälchen entfernt, deutet sie auf ein Mädchen, das an einem Tisch mit lauter Leuten sitzt, bei denen ich mich wohlfühlen würde. Das Haar des Mädchens ist an der Stirn ungleichmäßig geschnitten, und ein langes, rötliches Muttermal zieht sich über ihre Wange.
»Guck mal«, sagt Annie. »Das ist eine von den anderen Sallys. Sie ist adoptiert worden.«
Annie deutet direkt auf das Mädchen, das uns einen nervösen Blick zu wirft und dann wegschaut, aber Annie starrt sie noch einen Augenblick lang an und wendet sich dann wieder ihrem Pudding zu, der sich dunkel in den Falten ihrer Mundwinkel ansammelt.
Nach der Schule, als die Kinder überall Gruppen bilden, zerrt Annie mich auf den Schulhof.
»Lass uns von hier weg gehen«, sagt sie. »Ich bin nicht gern hier.«
Sie wirft mit einem Stein nach der Schaukel, als wir daran vorbei kommen.
»Gehen wir zu dir«, sagt sie. Als wir dort ankommen, blickt meine Mutter von ihrem Rätsel auf und lächelt, während wir die Treppe zu meinem Zimmer hinauf gehen.
»Ist das alles, was deine Mutter macht?«, fragt Annie.
»Nein«, sage ich. »Sie macht eine Menge Sachen.«
Ich versuche, mir meine Mutter bei anderen Tätigkeiten vorzustellen, aber das einzige Bild, das in diesem Augenblick vor mir aufsteigt, ist das, wie sie, über ein Rätsel gebeugt, den Kopf hebt, um in eine Welt voll halb fertiger Wörter zu starren, denen manchmal nur ein oder zwei Buchstaben fehlen, damit sie einen Sinn ergeben.
Annie blickt sich in meinem Zimmer um, das von Männern sorgfältig eingerichtet wurde, deren Gesichter ich niemals sehen werde. »Was für ein langweiliges Zimmer«, sagt sie.
Sie wirft sich auf mein Bett, beugt sich zur Seite und starrt der Puppe, die auf dem Kissen lehnt, in die Augen.
»Du hast noch eine Puppe?«, sagt sie und hebt sie an einem Bein hoch. Sie reibt das dicke Haar der Puppe zwischen den Fingern. »Das würde brennen wie Zunder«, sagt sie.
»Vielleicht ist das sogar Zunder.«
Sie lächelt und zieht ein Päckchen Streichhölzer aus der Tasche.
»Mal sehen.«
»Das geht nicht«, sage ich. »Meine Mutter würde es merken.«
»Stimmt«, sagt sie und lacht. Sie zündet ein Streichholz an, und ich kann nur dabei zuschauen, wie sie es der Puppe an die Haarspitzen hält. Es gibt keine Flamme, nur ein Knistern, während jedes einzelne Haar sich kräuselt und mit einem Zischen auf dem Plastikkopf verglüht.
»Na ja«, sagt Annie, »das war enttäuschend.«
Der Puppenkopf sieht verschmort aus und riecht noch schlimmer. Ich lasse meine Hand über den warmen, hubbeligen Kunststoff gleiten, und Annie sieht mich an. »Tja«, sagt sie, »ich geh dann besser.«
An der Tür dreht sie sich um. »Bis morgen.«
Meine Mutter blickt auf, als ich mich zu ihr an den Tisch setze. »Es muss schön sein, bei Schulbeginn schon eine Freundin zu haben«, sagt sie und blickt nach unten, um ein Wort einzutragen. Das Kratzen des Kugelschreibers auf dem Zeitungspapier ist wie etwas Scharfes, das über meine eigene Haut gleitet.
Das Leben hier nimmt ganz schnell die Form des Lebens an, das wir anderswo geführt haben, außer dass hier Annie meine Freundin ist. Wir gehen gemeinsam zur Schule, und wir kommen gemeinsam aus der Schule, und überall um mich her werden neue Freundschaften geschlossen, während Annie und ich uns darüber hinweg oder daran vorbei oder mitten hindurchbewegen. Die Jungs, die Tommys Freunde sind, beobachten Annie mit einer sonderbaren Aufmerksamkeit. Sie scheinen etwas über sie zu wissen - und, da ich ihre Freundin bin, auch über mich, und selbst wenn ich nicht bei ihr stehe, wenn ich mich über den Trinkbrunnen beuge, um etwas zu trinken, oder vor meinem Schließfach stehe, sehen sie mich mit jenem besonderen Blick an. Sie wissen nicht genau, was sie wissen, aber trotzdem starren sie uns an.
Ich beobachte die Schüler, die normalerweise meine Freunde wären. Sie haben einander schon in den hinteren Sitzreihen und in den Ecken des Speisesaals gefunden, und ich beobachte sie voll Sehnsucht. Ich weiß, worüber wir sprechen, was für Pläne wir schmieden, über welche Fernsehshows wir uns unterhalten würden. Wenn Annie den Gang herunterkommt, fährt sie mitten hinein wie eine Feuersbrunst, und alle treten zur Seite, aber ich sehne mich danach, bei ihnen zu stehen und in den grünen Kacheln an den Wänden aufzugehen. Annie beobachtet mich dabei, wie ich ihnen nachblicke, und sie macht mich auf deren Fehler aufmerksam.
Der einzige freie Tisch steht in der Nähe von Tommy und seinen Freunden, und als wir uns hinsetzen, lachen sie und knuffen einander. Gerade als Annie ihren Kuchen auspackt, landet ein Stück Brot auf ihrem Tablett und bespritzt es mit Senf und kleinen Salatstückchen. Annie starrt darauf, während sie ihren Kuchen isst, und schließlich steht sie auf und bringt es zu dem Tisch der Jungs.
»Tommy«, sagt sie, »das werde ich Dad erzählen.«
Sie lässt das Brot vor ihm auf den Tisch fallen, und seine Freunde grinsen alle, schauen ihn an und warten. Er blickt sich nervös um, sieht seine Freunde an und mich und Annie. Als ich sein Gesicht betrachte, weiß ich, dass ihm tausend Wörter durch den Kopf gehen, aber als er sich schließlich für eins entscheidet, ist selbst er überrascht.
»Fotze«, sagt er, und ich sehe an seinem entsetzten Gesichtsausdruck, dass er das zum ersten Mal gesagt hat. Er braucht einen Augenblick, um sich wieder zu fangen, und dann sagt er es noch einmal: »Fotze.« Er lächelt, und seine Freunde lächeln, und sie schauen zuerst Annie an und dann zu mir herüber.
Wir sind auf allen Seiten von Unschuld umgeben, bis auf diesen winzigen Punkt der Verstörung hier in der Mitte des Speisesaals. Annie kommt an unseren Tisch zurück, und alles geht genauso weiter wie vorher, nur dass die Jungs sich mehr herausnehmen und sich der Sache sicherer sind, die sie zu wissen glauben. Sie ziehen die Schultern hoch und lächeln, aber sie haben Angst und sind wütend, und in ihrer Erregung schlagen sie Dosen platt und bewerfen sich mit Kartoffelchips. Und mittendrin isst Annie ihren Kuchen fertig und starrt geradeaus ins Leere.
Es ist Cocktailstunde, und meine Eltern sitzen fröhlich am Tisch und planen die erste Cocktailparty, die sie in dieser neuen Stadt geben werden. Wenn ich daran denke, wie schnell meine Eltern neue Freundschaften schließen, und das mit meinen eigenen langsamen, absehbaren Fortschritten vergleiche, kann ich mir vorstellen, dass ich ein Adoptivkind bin. Aber genau wie meine ähneln auch ihre Freunde in jeder neuen Stadt denen aus der vorigen: nervöse, hagere Frauen in schwarzen Kleidern und mit langen Fingernägeln und gesichtslose Männer mit sich lichtendem Haar, in weißen Hemden und dunklen Jacketts und Krawatten. Es ist beinahe so, als würden sie uns begleiten, eine Traube von Cocktailgästen, die in einer schwarzen Wolke dahin schleichen, welche uns über den Highway folgt. Schon wenige Wochen nach einem Umzug besuchen oder geben meine Eltern wieder Cocktailpartys, und heute Abend lächeln sie in dem goldenen Licht, während die Erde sich langsamer dreht zu den gleichmäßigen Bewegungen meines Vaters, wenn er aufsteht und sich wieder hinsetzt, und zu dem sanften, erregten Gemurmel ihrer Stimmen, als sie all die Namen ihrer neuen Freunde durchgehen.
Auf dem Weg zur Schule erzähle ich Annie, dass ich mich nicht wohlfühle und heute früher nach Hause gehen werde, damit sie beim Mittagessen nicht auf mich wartet, und mittags bleibe ich in meinem Klassenzimmer, bis sich niemand mehr auf dem Gang aufhält. Von der Tür zur Cafeteria beobachte ich, wie Annie mit ihrem Tablett allein zum Ende eines Tisches geht und ruhig ihr Essen einnimmt. Sie hält den Kopf gesenkt und sieht niemanden an. Ich gehe mit meinem Mittagessen auf die andere Seite des Saals, zu einem Tisch mit lauter Leuten, die normalerweise schon längst meine Freunde wären. An einem Ende ist noch Platz, und ich setze mich. Obwohl sie mich nicht beachten, gleichen wir hier einer Insel, die von einem Meer aus Jungs und Mädchen umgeben ist, die mehr wissen als wir. Ich beobachte, wie Tommy und seine Freunde an Annies Tisch vorbei gehen. Sie stellen sich um sie herum, aber sie blickt nicht auf. Sie stopft sich den Mund langsam mit Kartoffelchips voll und zerkaut sie langsam. Als die Jungs weitergehen, blickt sie auf, sieht sich im Saal um und erblickt mich an meinem neuen Tisch. Die Klingel ertönt, und sie blinzelt; dann stehen wir gemeinsam auf.
»Sally«, ruft sie, »he, Sally«, und all die anderen Sallys drehen sich um, als ihr Name erklingt, aber ich gehe aus dem Saal auf den Gang hinaus, wo ich Annie in dem Lärm der Jungs und Mädchen, die sich miteinander unterhalten, nicht hören kann.
Am Ende des Tages wartet sie vor meinem Klassenzimmer. »He«, sagt sie, »hast du mich nicht gehört?«
»Was?«, sage ich. »Nein.«
»Ich hab deinen Namen gerufen«, sagt sie. »Hast du mich nicht gesehen?«
»Nein«, sage ich und beobachte, wie die Leute sich in Gruppen zusammenfinden. Jede dieser Gruppen wäre großartig, und dann schaue ich wieder Annie an, ihre langen, dünnen Arme und Beine. Sie blickt an sich herunter, um zu sehen, wo ich hinschaue, und sieht mir dabei zu, wie ich den anderen beim Gehen zusehe. Die haben bereits feste Grüppchen gebildet, zu denen ich nicht leicht Zugang finden werde.
»Tja «, sagt sie. »Gehen wir.«
»Ich denke, ich werde noch etwas bleiben«, sage ich. »Um auszuhelfen«, ist alles, was mir als Erklärung einfällt, aber sie nickt und geht davon. Ich halte meine Bücher vor die Brust und beobachte die Jungs, an denen sie vorbeigeht, um zu sehen, ob sie sich umdrehen.
Am Freitag stehe ich nahe bei einer Gruppe stiller Mädchen, die irgendetwas planen, aber sie nehmen keine Notiz von mir und schließlich lösen sie sich in kleinere Gruppen auf, verabschieden sich und gehen leicht beschwingt davon. Mir bleibt nur, nach Hause auf die Party meiner Eltern zu gehen. Ich stehe am Eingang der Schule, bis Annie fast den ganzen Schulhof überquert hat; dann folge ich ihr zu unserer Straße.
Meine Mutter leert Eisschalen aus und füllt sie für die Party wieder auf, und von meinem Fenster aus kann ich Annie in ihrem Vorgarten sehen. Sie starrt zu unserem Haus herüber und schließlich kommt sie über die Straße. Ich warte einige Minuten darauf, dass sie klopft, aber als sie es nicht tut, mache ich die Tür auf und sehe sie in unserem Garten sitzen und einen Grashalm nach dem anderen ausrupfen.
»Oh«, sagt sie. »Hi. Weißt du, dein Vater sollte den Rasen noch mal mähen, bevor es kalt wird.« Sie streicht mit der Hand leicht über die Grasdecke.
»Also«, sagt sie. »Du kannst heute Abend rüberkommen, wenn du willst. Meine Eltern kommen auf eure Party.«
»Ich werde wohl besser zu Hause bleiben«, sage ich. »Du weißt schon, um auszuhelfen.«
»Wir haben Eiscreme«, sagt sie. »Und Kekse. Wir können uns ansehen, was wir wollen.«
»Ich muss jetzt meiner Mutter helfen«, sage ich. »Sie macht Eis.«
»Oh«, sagt Annie, »okay.«
Ich gehe in mein Haus zurück, aber sie bleibt im Garten sitzen und blickt auf das Gras um sie herum.
Meine Eltern ziehen sich um für ihre Party. Mein Vater bringt meiner Mutter ihren Drink und betrachtet sie im Spiegel, während sie sich einen Ohrring ans Ohr hält. Ihre Blicke treffen sich und wenden sich schnell ab. Unten im Wohnzimmer stehen Schälchen mit Kleinigkeiten, die nie jemand anrührt auf diesen Partys: Erdnüsse und Kartoffelchips und Oliven. Vom Schlafzimmerfenster meiner Mutter aus sehe ich Annies Eltern aus ihrem Haus treten und Seite an Seite wie zwei Hunde an der Leine die Straße überqueren. Sie kommen absolut pünktlich, aber mindestens eine halbe Stunde früher als erwartet; abgesehen davon kann ich an der Art, wie sie sich gekleidet haben, sehen, dass das ihre erste Cocktailparty ist. Annies Mutter trägt Rock und Pullover, und ihr Vater hat ein Jackett an, aber keine Krawatte. Ihre Kleider haben die gleiche Farbe wie ihre Haut, ein helles Beige, und sie werden herausragen wie kleine Sandbänke in einem Meer von dunklen Anzügen und Kleidern. Annies Mutter hat sich ihr Haar zu einem festen blonden Ballon frisieren lassen, und sie drückt es unwillkürlich an, als sie den Weg heraufkommen. Ihr Haus hinter ihnen sieht dunkel aus; irgendwo dort drinnen sind Annie und Tommy heute Abend unter sich. Als Annies Eltern klopfen, blickt meine Mutter zu ihrer Schlafzimmertür und mein Vater geht, um aufzumachen.
»Mein Gott«, sagt meine Mutter. »Wer kommt denn schon so früh?« Sie klemmt ihre Ohrringe fest und zeichnet mit einem langen, rosafarbenen Fingernagel die Linie des Lippenstifts um ihren Mund nach.
»Jetzt wollen wir uns mal amüsieren, Liebes«, sagt sie zu mir.
Als ich ihr schließlich nach unten folge, sind schon mehr Gäste eingetroffen. Annies Eltern stehen schweigsam neben dem Couchtisch. Sie stehen mit ihren Drinks in der Hand unbehaglich da und kosten nur mit der Zunge daran, während sie ihre Blicke durch unser Haus schweifen lassen.
»Sie haben ein sehr schönes Haus«, sagen sie beide unabhängig voneinander zu meinen Eltern, während meine Mutter lächelt und mein Vater ihnen behutsam die Drinks aus der Hand nimmt, um neue zuzubereiten. Ich helfe sie wieder hineinzutragen und Annies Vater strahlt mich an.
»Anne ist ein sehr nettes Mädchen«, sagt er zu meinem Vater, der ihn verständnislos ansieht, bis ihm einfällt, dass er es mit Annies Vater zu tun hat.
»Ja«, sagt er, »sie macht ganz den Eindruck.«
»Sie müssen sehr stolz auf sie sein«, sagt Annies Mutter und mein Vater blickt sich verwirrt um, bevor er begreift, dass sie von mir sprechen.
»Ja«, sagt er und sieht mich seltsam an, als wäre es möglich, dass mein Name tatsächlich Anne ist und er ihn all die Jahre hindurch falsch verstanden hat.
»Ja«, sagt er erneut, »das sind wir wohl.«
Sie lächeln mich und einander unsicher an, und mein Vater kann nicht anders, als nach den Drinks zu greifen, die er ihnen gerade erst gegeben hat, um ihnen neue zu bringen. Ich spaziere zwischen den Partygästen herum und halte ihnen kleine Teller mit Crackers und Käse hin. Sie schauen auf mich herab, lächeln kurz und nehmen dann ihre Unterhaltung wieder auf. Als ich wieder zu dem Couchtisch komme, haben Annies Eltern sich nebeneinander aufs Sofa gesetzt und essen Erdnüsse und Kartoffelchips aus den Schälchen auf dem Tisch. Annies Mutter beugt sich vor, um die Oliven anzusehen, betastet eine vorsichtig mit der Fingerspitze und zieht dann ihre Hand zurück. Sie halten ihre Drinks gut fest, an denen sie nur genippt haben, und während sie essen, blicken sie auf und sehen sich die anderen Gäste an, die alle stehen, lachen und sich unterhalten, als wären sie schon seit Jahren miteinander befreundet. Annies Eltern werden sich wohl fragen, wo all diese Leute wohnen und warum sie sie noch nie im Lebensmittelgeschäft oder an der Tankstelle gesehen haben. Durch das Klirren von Eis und Gläsern und den Lärm der Unterhaltung erklingt eine ruhige, eingängige Musik. Ein paar Frauen wiegen sich leicht im Takt. Obwohl man zu keiner Zeit davon sprechen kann, dass richtig getanzt wird, schmiegen sich im Verlauf der Party gelegentlich ein oder zwei Paare aneinander und drehen sich in irgendeiner Ecke im Kreis, während die Ehemänner und Ehefrauen vom Sofa aus zusehen und laute, bitterböse Kommentare abgeben, und mein Vater ihnen neue Drinks bringt. Meine Mutter kommt an Annies Eltern vorbei und lächelt huldvoll auf sie hinab.
»Es ist so schön, dass Sie gekommen sind«, sagt sie zu ihnen. »Ich hoffe, dass Sie sich gut amüsieren.«
Annies Mutter öffnet den Mund, um zu antworten, aber meine Mutter hat sich schon abgewendet, bevor sie ein Wort herausgebracht hat. Sie dreht sich zu ihrem Mann um, aber der hat sich eine Handvoll Erdnüsse genommen, die er sich eine nach der anderen in den Mund steckt. Sie nippt an ihrem Drink und sieht zu, wie meine Mutter sich mit einem Mann in schwarzem Anzug unterhält. Er nimmt ihre Hand, und sein Daumen liegt auf ihrem Ring.
»Es ist sehr schön, Sie in unserer Stadt zu wissen«, sagt er, und meine Mutter lächelt und fängt an, woanders hinzuschauen, aber er lässt ihre Hand nicht los.
»Wirklich«, sagt er. »Das meine ich ernst.«
Damit erringt er ihre Aufmerksamkeit, und sie wendet ihm langsam den Kopf zu und blickt ihn direkt an. Mein Vater ist in der Küche und bereitet Drinks zu, und als ich dorthin gehe, um ihm zuzusehen, lächelt er mich fröhlich an.
»Ist das nicht klasse?«, sagt er. »Sind diese Leute nicht klasse?«
Er setzt die Flasche, aus der er eingießt, an die Lippen und schließt die Augen, während er trinkt. Er zwinkert mir zu, als er die Flasche hinstellt, und geht dann mit einem Tablett voll neuer Drinks.
»Sally«, sagt meine Mutter, als ich an ihr vorbeikomme. Sie fasst mich an der Schulter und dreht mich um, bis ich dem Mann im schwarzen Anzug das Gesicht zuwende.
»Das ist Mr. Wheeler.«
Ich halte ihm einen Teller mit Crackers hin und er lächelt mich nervös an.
»Na«, sagt er. »Du bist ganz bei der Sache, was?«
Meine Mutter lächelt stolz. »Als Sally noch klein war«, sagt sie, »hat sie unsere Partys geliebt. Sie hat immer allen Gästen einen Gutenachtkuss gegeben.«
Mr. Wheeler nickt höflich, aber es stimmt: Ich erinnere mich daran, wie ich von einem Gast zum anderen geschlurft bin wie ein kleines Haustier, an die flüchtige Berührung ihrer Wangen auf meinen Lippen, den Geruch von Rauch und Parfüm und den warmen Duft des Bourbon in ihrem Atem.
Meine Mutter blickt mit der Zuneigung einer Fremden auf mich herab und lässt ihre Hand über mein Haar gleiten. »Sie konnte nicht schlafen gehen, ohne ihnen allen einen Kuss gegeben zu haben«, sagt sie.
»Wie die Mutter, so die Tochter«, sagt jemand hinter uns, und einen Augenblick lang erstarrt das Gesicht meiner Mutter; dann wendet sie ihr Lächeln in Richtung der Stimme.
Mein Vater lacht laut über alle Witze, die er zufällig mitbekommt, während er unermüdlich zwischen Küche und Wohnzimmer hin und her läuft, und die Party funkelt um mich herum wie ein Licht, das ich nicht völlig erfassen kann, weil es am äußersten Rand meines Blickfeldes aufleuchtet. Meine Freunde, die nicht meine Freunde sind, halten sich alle zusammen im Haus von irgendjemandem auf und machen Popcorn oder sehen sich Filme im Fernsehen an. Später nehmen sie vielleicht ihren ganzen Mut zusammen und schlendern in einer kleinen Gruppe zu der Pizzeria, wo sich all die anderen Kinder treffen. Der Mutigste von ihnen besteht darauf zu gehen, und die anderen folgen ihm widerwillig; vielleicht werden sie auf dem Weg dorthin von einer Eisdiele oder einem Film angezogen, und sie bleiben, erleichtert über diese Ablenkung; oder vielleicht gehen sie hin und setzen sich in eine Nische, blicken sich um, während sie ihre Pizza essen, und fragen sich, was vor sich geht. Und auf der gegenüberliegenden Straßenseite sitzt Annie in einem kleinen Kreis aus Dunkelheit vor dem Fernseher und lauscht dem Summen von Tommys Nerven, während er die Seiten seines Comic-Hefts umblättert.
Als das Telefon klingelt, dreht sich meine Mutter von der Unterhaltung mit Mr. Wheeler um, und mein Vater blickt von seinem Tablett voll Drinks auf. Ich nehme an ihrer Stelle ab.
»Oh«, sagt Annie, »ich habe mich gerade gefragt, ob du deine Meinung geändert hast.«
Sie wartet. »Du weißt schon. Darüber, ob du herkommst.«
Ihre Stimme klingt schrill und unnatürlich.
»Ich kann nicht«, sage ich. »Ich muss aushelfen.«
»Oh«, sagt sie, aber sie hängt nicht auf. Ich glaube, aus dem ein Stockwerk tiefer gelegenen Keller das boshafte Gelächter von Jungs zu hören, die fernsehen.
Als ich aufhänge und meine Mutter mich fragt, wer dran gewesen sei, sage ich: »Niemand.«
Bevor ich erwachsen bin, werde ich in einem Dutzend weiterer Häuser wohnen und ein Dutzend weiterer Schulen besuchen. Auch Annie wird bald nur noch ein Gesicht ohne Namen sein; und was auch immer im Augenblick mit ihr vor sich geht hinter den dunklen Fenstern ihres Hauses - ich werde es vergessen.
Ich verlasse die Party, ohne den Gästen einen Gutenachtkuss zu geben. Oben an der Treppe drehe ich mich um und beobachte sie. Meine Mutter lächelt einem Mann, den sie gerade erst kennengelernt hat, direkt ins Gesicht, während mein Vater der Ehefrau des Mannes in der Küche die Zeit vertreibt. Um sie herum stehen Leute ohne Gesichter, die mit schriller, aufgeregter Stimme sprechen, und mitten im Zimmer sitzen Annies Eltern beieinander und werfen mit großen Augen gehetzte Blicke um sich. Ich versuche zu erraten, woran meine Mutter denkt, während sie den Mann anlächelt, ob sie in Gedanken nach einem Wort mit fünf Buchstaben für Bratpfanne oder für Mausefalle sucht.
Von meinem Schlafzimmerfenster aus beobachte ich Annies Haus, in dem alles dunkel ist, bis auf die Küche und das Flimmern des Fernsehers im Erdgeschoß. Ich schalte das Licht aus, als Annie gerade aus ihrem Haus kommt. Sie sieht mich und winkt mich herüber, aber ich trete so weit zurück, dass ich nicht mehr zu sehen bin. Ich kann nicht über die Straße gehen, um mich mit ihr zu treffen; unten ist ein Zimmer voller Leute, die ich nicht kenne, und vor mir liegen weitere Zimmer voller Leute, die ich nicht kenne. Unter der Haut pochen meine Nerven wie winzig kleine Leute, die herauszukommen versuchen. Ich sehe Annie dabei zu, wie sie in ihrem Garten herumläuft, Papier, Zweige, frische Blätter aufsammelt, die sie an der Backsteinmauer ihres Hauses zu ungleichmäßigen Haufen aufstapelt. Sie dreht sich wieder zu mir um, und in der Dunkelheit ist ihr Gesicht ein bleicher kleiner Mond, von dem freudlosen Glauben erleuchtet, dass sie die trockenen Ziegelsteine irgendwie zum Brennen bringen und sich in den Flammen eines Feuers, das niemals ausbrechen wird, erlösen kann.