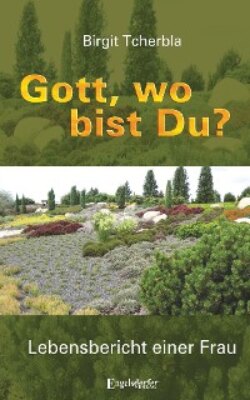Читать книгу Gott, wo bist Du? - Birgit Tcherbla - Страница 10
Elbefluss
ОглавлениеElbefluss, ich lieb dich sehr.
Von der Quelle bis zum Meer
würde ich dir gerne folgen,
überdacht vom Zug der Wolken.
Städte, Dörfer zieh’n vorbei,
fühle mich so leicht und frei.
Schiffe fahren durch die Wellen,
möchte mich dazugesellen.
Strömst durch Auen, manches Tal
bei der Sonne Morgenstrahl,
bei des Abendglanzes Schimmer,
bei des Mondenscheins Geflimmer.
Ewig gehst du mit der Zeit
bis zum Ufer Ewigkeit.
Und das Fernweh will mich fassen,
möcht mich von dir treiben lassen.
Schöne Elbe, schöner Fluss,
ich dich immer lieben muss.
Lass mich träumen, lass dich grüßen,
deine grünen Uferwiesen.
Dresden, diese schöne Stadt, auch Elbflorenz genannt, ist eine Stadt der Musik, der Malerei und der Theater, eine Stadt vieler Museen, Kirchen und Denkmäler, Skulpturen und Kunstsammlungen. Bekannt sind die Frauenkirche, der Zwinger, die Brühlsche Terrasse, der Zoologische Garten, das Albertinum, das Johanneum, die Elbbrücke, die Oper, das Schauspielhaus, das Dresdner Staatstheater und die von Semper erbaute Gemäldegalerie, das japanische Palais und viele andere kulturhistorische Gebäude, die Zeugnis geben vom Prunk der barocken Fürstenhöfe.
Von den Kirchen, außer der Frauenkirche, wären vor allem die Hofkirche, Jakobskirche, Lukaskirche und Kreuzkirche zu nennen.
Im Technischen Museum bekommt man einen Überblick über die Entwicklung der Schreibmaschine seit den Anfängen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute. Und im Hygienemuseum, dessen Ausgangspunkt die Hygieneausstellung im Jahre 1911 war, findet man den Pavillon „Der Mensch“.
Dresden entwickelte sich vom Fischerdorf zu einer fürstlichen Residenz.
Im Jahre 1485, zwei Jahre nach der Geburt des Künstlers Raffael, dessen „Sixtinische Madonna“ knapp 300 Jahre später wesentlich zum Ruhme der Kunststadt beitrug, wurde das Kurfürstentum Sachsen zwischen den Brüdern Ernst und Albrecht aufgeteilt. Albrecht fiel das Herzogtum Sachsen zu und Dresden wurde von ihm zu seiner neuen Residenz erwählt. Es war zu der Zeit noch eine unbedeutende Stadt.
1206 erstmals urkundlich erwähnt, bekam es zehn Jahre später das Stadtrecht. Dresdens Bedeutung beschränkte sich auf eine im Jahr 1200 gegründete Burganlage und auf ihre Handelsstraße zwischen Ost und West. Die Voraussetzung zum Aufblühen war aber schon damals gegeben.
Im Erzgebirge wurden Zinn und Silber gefördert und dies wurde zur Quelle von Wohlstand und Kultur. Bedeutende Handwerker und Künstler waren hier zu Hause, wie zum Beispiel der Naumburger Meister oder die hervorragenden Bildhauer der Goldenen Pforte des Freiberger Doms. Das Kunsthandwerk entwickelte sich. Am Vorabend der Reformation gab es die meisten Städte in Sachsen. Durch den Bergbau bildeten sich neue Gewerke und führten zu reicher Handwerkskultur.
Außerdem fand die lutherische Lehre eine schnelle Verbreitung und mit ihr Lesen und Schreiben. Erste Gymnasien entstanden. Die Lehre Luthers gründete sich neben dem Wort auch besonders auf die Musik. In der 1548 gegründeten Hofkapelle, die noch heute als Sächsische Staatskapelle Weltruhm genießt, agierte der Hofkapellmeister Schütz und schuf die erste deutsche Oper. Johann Sebastian Bach wurde sein Nachfolger und als Kirchenmusiker berühmt.
Herzog Heinrich, der Nachfolger Albrechts, ließ sich von Lucas Cranach d. Ä. auf den ersten ganzfigurigen und lebensgroßen Fürstenporträts Europas darstellen. Sie hängen heute in der Dresdner Gemäldegalerie. Kurfürst August, bekannt als August der Starke, gründete 1560 die Kunstkammer, eine Art Universalmuseum mit Sammlungen aus Wissenschaft und Technik und exotischer Kuriosa (Narwalzahn, Horn des Einhorns).
Ein tiefer Einschnitt in die Entwicklung geschah durch die Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges. Erst fünfzig Jahre später kam es zu einem neuen Aufschwung.
Mit der Thronbesteigung August des Starken 1694 begann das Augustinische Zeitalter und eine wirtschaftliche, künstlerische und geistige Wiederbelebung von ungeahntem Ausmaß. Dresden wurde zur Hauptstadt des Landes Sachsen. Zu Zeiten August des Starken waren bei besonderen Festlichkeiten Tierhetzen und Kampfjagden auf dem Altmarkt an der Tagesordnung. Der Hof amüsierte sich.
Hasen, Rehe und Hirsche sowie einheimische Raubtiere wie Luchse, Wölfe und Bären mussten über die Klinge springen. Seit Mitte des 17. Jahrhunderts gab es auch Löwen in der Elbestadt und auch Junge kamen zur Welt. Der Fürst startete 1731 eine eigene Tierfangexpedition nach Afrika. Mit Löwen, Leoparden und Straußen kehrte man zurück. Tierhaltungen erhöhten das Renommee am Hofe und wurden in wandernden Schaustellungen auf Messen und Märkten vorgeführt.
Die zoologische Sektion Dresden der naturwissenschaftlichen Gesellschaft „Isis“ gründete in Dresden einen Verein für Hühnerzucht, Wasservögel, Stelz- und Greifvögel sowie Säugetiere. Dies wurde vom Publikum angenommen und erfreute sich großer Beliebtheit. Es führte wenig später zur Konstituierung des Aktionsvereins Zoologischer Garten und öffnete im Mai 1861 seine Pforten. Zur Erstausstattung zählten das heizbare Affenhaus, der Bärenzwinger sowie Büffel- und Eulenhaus. Ein Raubtier- und Giraffenhaus folgten. Es stellten sich bald Erfolge ein. Es gelang die Aufzucht von jungen Tigern. So wurde der Zoologische Garten eine Sehenswürdigkeit Dresdens. Der Tierbestand erweiterte sich immer mehr.
Als Kinder waren wir mit unseren Eltern oft Besucher des Zoologischen Gartens. Ich habe mich immer an den vielen großen Glockenblumen erfreut, die zwischen den Bäumen wuchsen.
Manchmal im Herbst gingen wir auch mit unserem großen Bruder allein hin und bauten Laubhütten.
Reich ist die Geschichte Dresdens und groß die Zahl der Persönlichkeiten, die daran mitgeschrieben haben. Vielen von ihnen hat Elbflorenz ein Denkmal gewidmet. Es sind über hundert Denkmale, die man in der sächsischen Kunststadt findet.
Da wäre als Erstes auf dem Neustädter Markt der Goldene Reiter, die kraftvolle Reitergestalt August des Starken mit dem aufbäumenden Pferd und Marschallstab des Kupferschmiedes Ludwig Wiedemann zu nennen, in Kupfer getrieben und feuervergoldet – eines der künstlerisch wertvollsten Denkmale des Barock.
Nahe dem Lieblingsboulevard der Dresdner, in der Straße der Befreiung, findet man das Denkmal von Joseph Fröhlich, des Hoftaschenspielers und letzten Hofnarren am Hofe August des Starken, des Magdeburger Bildhauers Apel, eine Bronzeplastik mit dem spitzen Hut und den Affen zu seinen Füßen. Fröhlich wurde aber auch von verschiedenen anderen Künstlern in Porzellan, Elfenbein, Sandstein, Ton und Ledertapete verewigt.
Viele Denkmale stehen auf der Brühlschen Terrasse. Zwischen Albertinum und der Hochschule für Bildende Künste erblickt man das Denkmal Gottfried Sempers, geschaffen vom Bildhauer Johannes Schilling. Zur Zeit Sempers entstanden zahlreiche Bauwerke: die Synagoge, das erste Hoftheater, der Cholerabrunnen, die Gemäldegalerie. Semperoper und Gemäldegalerie tragen heute seinen Namen. Auch das Denkmal für die Gruft auf dem Inneren Katholischen Friedhof in Dresden-Friedrichstadt entwarf Gottfried Semper.
Zu den ältesten erhaltenen Sandsteindenkmalen der Renaissancezeit zählt das Moritz-Monument an der Dresdner Stadtbefestigung. Die Rede ist von Kurfürst Moritz zu Sachsen. Der Obelisk an der Brühlschen Terrasse stellt dar, wie der 1553 in der Schlacht von Sievershausen tödlich Verwundete seinem Bruder das Kurschwert überreicht.
Dem Bildhauer Ernst Rietschel, dem selbst ein Denkmal gewidmet ist, sind mehrere bedeutende Denkmale zu danken: das Denkmal König Antons, das Monumentalwerk Friedrich August I., Skulpturen an der Gemäldegalerie, das Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar und das Standbild Carl Maria von Webers.
Carl Maria von Weber war Musikdirektor in Dresden sowie erster Kapellmeister, er schuf die Volksoper „Der Freischütz“ und vertonte unter anderem Theodor Körners Freiheitsgedicht „Lützows wilde, verwegene Jagd“. Dem Dichter und Patrioten Körner wurde ebenfalls ein Dresdner Denkmal gewidmet. Sein Schöpfer ist E. J. Hähnel. Es steht an der Kreuzschule, deren Schüler er war. Es wurde beim Großangriff am 13. Februar beschädigt und steht heute in Rathausnähe.
Vor etwa 150 Jahren entstand das Luther-Denkmal auf dem Neumarkt von Rietschel. In der Bombennacht stürzte die Bronzeplastik an der Frauenkirche zusammen. Die Teile wurden dann wieder zusammengesetzt und restauriert. Die Plastik steht seit 1955 vor der Frauenkirche.
Ein Sandsteindenkmal in Dresden-Laubegast erinnert an Caroline Neuber, die Theaterreformatorin, auch „Mutter der Schauspielkunst“ genannt, die in ihren späteren Jahren in Dresden wohnte.
In Prohlis, einst am Rande der Stadt, hat ein Bauer, Johann Georg Palitzsch, der Bauernastronom, ein Denkmal. Es wurde 1877 eingeweiht. Er fand bei seinen Himmelsbeobachtungen den Kometen Halley. In seiner Umgebung baute er die ersten Kartoffeln an und führte den Blitzableiter ein. Eine Schule in Dresden trägt seinen Namen. Der Palitzscher Brunnen ist eine Volkskunstarbeit aus dem 19. Jahrhundert. Auch die Gaststätte „Zum Stern“ erinnert an seinen Namen.
Ein anderes Dresdner Denkmal ist dem Schriftsteller, Armenlehrer und späteren Direktor der Armenschule Gustav Nieritz gewidmet. Das Nieritzdenkmal und eine kleine, enge Straße erhielten seinen Namen.
Der Schutzpatron Dresdens im Zentrum, auch „Goldener Rathausmann“ genannt, ist das höchstgelegene Denkmal der Elbestadt. Es steht auf dem Rathausturm, hat eine Höhe von über fünf Metern und wiegt 34 Zentner. Seine Hülle besteht aus eineinhalb Millimeter starkem Kupferblech, mit der Hand getrieben und vergoldet. Den bärtigen Gesellen schuf Richard Guhr im Jahre 1910. Die linke Hand hält ein Füllhorn mit Äpfeln, der rechte Arm ist zu einer schützenden Geste erhoben, mit dem symbolisch das Böse ferngehalten werden soll. Eine Mauerkrone auf dem Kopf drückt den Zusammenhalt der Stadt aus. Die Bleikassette im Kopfinnern enthält Urkunden und Münzen. Durch den Bombenhagel wurde auch der Schutzpatron schwer beschädigt. Beim Wiederaufbau des Neuen Rathauses erhielt der restaurierte „Goldene Mann“ wieder seinen alten Platz.
Zur Mahnung an die Opfer des Zweiten Weltkrieges entstanden in Dresden mehrere Denkmale, eines für die Kämpfer der Sowjetarmee aus rotem Meißner Granit, enthüllt vom Bildhauer Otto Rost und von Gießern aus Lauchhammer in Metall gegossen, und in der Altstadt steht das 1952 errichtete Denkmal „Trümmerfrau“ vor dem Festsaalflügel des Rathauses. Der Bildhauer Walter Reinhold skizzierte die Arbeiterin Erika Hohlfeld, die bis 1956 Trümmer räumte, als die ersten Neubauten standen.
Auf der Ostseite des Dresdner Rathauses wird die Goldene Pforte von zwei schildtragenden Löwen flankiert, den Wappentieren der Stadt. Vor der Gaststätte „Ratskeller“ steht der Rathausesel. Beim Kellerabstieg bemerkt man die bekannte Skulptur „Bacchus auf dem trunkenen Esel“. Löwen und Esel stammen von dem Bildhauer Wrba Georg.
Zwischen dem Alter meines Vaters und meiner Mutter liegen fast dreißig Jahre. Als ich geboren wurde, war mein Vater 62 Jahre alt, und ich habe noch einen zwei Jahre jüngeren Bruder. Wir fünf Geschwister sind fast immer zwei Jahre auseinander.
Meine Mutter besaß in der Hitlerzeit das Mütterkreuz. Aus meines Vaters erster Ehe stammt nur eine Tochter. Sie war älter als meine Mutter und lebte in Schleswig-Holstein.
Im Jähzorn schlug mein Vater mit dem Ochsenziemer zu. Vor ihm fürchteten wir uns. Wenn wir nicht parierten, brauchte er uns nur anzusehen und wir wussten, was wir zu erwarten hatten.
Die übrige Zeit aber war er gutmütig. Manches Mal, wenn er so wütend war, konnte ich mich verstecken. Als wieder Ruhe eintrat, kam ich herausgekrochen und dann passierte nichts mehr. Ich glaube, ich war sein Liebling.
Trotz seines Alters war mein Vater 1944 noch berufstätig. Er war Abteilungsleiter der Kostümschneiderei am Dresdner Staatstheater und hat die Kleidung für die Schauspieler entworfen. Man nannte es Gewandmeister. Er wurde 1877 in Berlin-Oranienburg geboren und starb mit 77 Jahren in Schlegel bei Hainichen. Zur Zeit Kaiser Wilhelms fuhr er als Matrose zur See und kannte viele Matrosenlieder, das Lied vom Fritze Bollmann („Fritze Bollmann wollte angeln, doch da fiel die Angel rin, Fritze Bollmann wollt sie langen, doch da fiel er selber rin“ usw.) und ein Lied vom Kaiser und der Kornblume. Es geht so: „Unser Kaiser liebt die Blumen, denn er hat ein zart Gemüt, doch vor allem liebt er eine, die in keinem Garten steht. Nicht nach Rosen geht sein Sehnen, stetig pflückt er sie im Feld, diese kleine blaue Blume, die er für die schönste hält.“
Unser Vater war ein uneheliches Einzelkind. Sein Vater blieb im Deutsch-Französischen Krieg. Die ganzen Ersparnisse, die seine Mutter für ihn in die Bibel gelegt hatte, sind durch die Inflation verfallen, denn er war Atheist und hat die Bibel nicht benutzt. Er sagte höchstens zu uns, das Gute im Menschen sei der liebe Gott.
Mit unserer Mutter haben wir manchmal gebetet: „Ich bin klein, mein Herz mach rein, lass niemand drin wohnen als Jesus allein.“ Sie hatte es nicht leicht mit uns, denn wir waren alle sehr lebhaft. Sie war eine mutige und furchtlose Frau, hatte vor nichts Angst. Gehauen hat sie uns fast nie, ganz selten. Nur, wenn es ihr gar zu viel wurde, bekam man plötzlich einen Schlag wie aus heiterem Himmel. Mich als Einzige hat sie lieber ans Tischbein gebunden, ich war zu wilde und der größte Schreihals im Krankenhaus. Sie hat uns gut versorgt, aber wenn wir uns in den schlimmen entbehrungsreichen Nachkriegsjahren über etwas beklagten, dann sagte sie: „Hängt euch doch auf.“
Die ersten Erinnerungen meines Lebens gehen zurück in eine Nacht in Dresden. Wie alt ich da war, weiß ich nicht genau, vielleicht zweieinhalb oder drei Jahre. Es war eine wunderbare Sternennacht. Schnee lag keiner, es muss Sommer gewesen sein. Meine Mutter lief mit uns drei Kleinsten in der Dunkelheit durch einen Park. Mein jüngster Bruder schlief im Sportwagen, wir anderen zwei trippelten nebenher. Zeitweise durfte auch ich mit im Wagen sitzen. Die Nacht war so schön, aber schauerlich. In mir war ein Gefühl, als lauere irgendwo Gefahr. Es war Krieg.
Meine Eltern gingen am Wochenende meistens ins Theater. Das brachte uns viel Vergnügen. Sobald sie fort waren, stellten wir die Bude auf den Kopf, wie man so sagt, und spielten im Dunkeln Gespenster oder anderes mehr.
Meine Mutter besaß eine Nachthaube voller kleiner nackter Porzellanbabys. Einmal bekam mein jüngster Bruder Franz einen Wutanfall und zerschmetterte sie alle.
Unser großer Bruder Horst leistete sich manchmal einen Jux mit uns Mädchen. Wir mussten heulen und wenn Erwachsene uns fragten, warum, mussten wir sagen, wir hätten das Geld verloren und könnten nicht mehr heimfahren, dann gaben sie es uns. Das vernaschten wir.
Sonntags besuchten wir mit den Eltern manchmal das Grüne Gewölbe und den Dresdner Zwinger, machten Ausflüge in die Dresdner Heide und pflückten Blaubeeren oder wir fuhren mit der Straßenbahn zum Wilden Mann. Meine älteste Schwester Charlotte war dort Eiskunstläuferin und wir sahen ihr beim Schlittschuhlaufen zu. Sie war die Sportlichste und Unternehmungslustigste von uns, ein richtiger Junge. Sie hatte die Sammelbüchse beim Spendensammeln immer zuerst voll. Mit neun Jahren schon sprang sie im Schwimmbad vom Zehn-Meter-Turm. Das erregte großes Aufsehen. Soldaten knipsten sie und schrieben darunter: „Wer kennt diese beiden Mädchen?“ Meine Schwester Gerda war auch mit auf dem Bild. Von mir guckten nur die Füße unter der Decke hervor.
Mein Bruder Horst war feiger und traute sich nicht so hoch. Überhaupt war er etwas ruhiger. Mit den Hitlerjungen hatte er Probleme. Mein Vater musste ihn manchmal von der Schule abholen. Bis zur fünften Klasse war er ein ziemlich fauler Schüler, und wenn unser Vater nicht darauf bestanden hätte, wäre er nicht in die Oberschule aufgenommen worden. Dann hat er sich so gut entwickelt und ist heute Dr. päd.
Es ist komisch, von meiner Schule weiß ich gar nichts mehr, nicht, wo sie stand und wie sie aussah, nicht, wer meine Lehrer oder Mitschüler waren, weiß nichts von einer Einschulung oder ob ich eine Zuckertüte bekommen habe. Nur zur Einschulung meiner zwei Jahre älteren Schwester Gerda bekam ich eine kleine.
Es war ja Krieg. Bei jedem Voralarm hatten wir schleunigst die Schule zu verlassen, mussten von Haus zu Haus flüchten, bis wir daheim angekommen waren. Ich kann mich nur an ein Lesestück erinnern, das wir üben sollten. Mein Vater war in der Stube beschäftigt und ich las. Nun wollte ich gern wissen, wie oft ich die Geschichte lesen würde, konnte aber nicht weit zählen. Der Vater sagte: „Mach jedes Mal einen Strich, wenn du durch bist, ich zähle dann zusammen.“ Ich kann heute noch nicht begreifen, dass ich das Stück 85-mal gelesen habe. Es ist verrückt und heute muss ich darüber lachen. Geduldsarbeiten sind meine Stärke und mein Sohn spottet, ich sei die geborene Erbsenzählerin. Er ist genau das Gegenteil.
Dann kann ich mich noch auf ein „Erholungsheim“ in Dresdens Nähe erinnern, wohin ich mit fünf Jahren kam. Es war dort eine Qual für mich. Wenn man nicht essen wollte, bekam man das Essen hineingestopft. Ich weiß nicht mehr, ob das gestimmt hat, es ist mir so, als musste man das Erbrochene erneut essen. Dort bin ich auch ohnmächtig geworden. Ein größerer Junge kam vom Hügel genau auf mich zugestürzt und riss mich um. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, standen viele Erwachsene und Kinder um mich herum.
Dann kam der 13. Februar 1945. Es war Fasching. Wir wohnten zuletzt in der Bergmannstraße. In einer angrenzenden kleinen Grünanlage, wo sich ein Bunker befand, hatten wir Karneval gespielt. Mein Vater kam spätabends, als wir schon schliefen, aus der Versammlung gehetzt und rief: „Alles raus aus den Betten, sofort in den Keller, die Christbäume brennen schon!“
Dort im Keller hockten wir verängstigt zusammen mit den anderen Hausbewohnern. Bei jedem Krachen zuckten wir zusammen. Dann ein Riesendonner. Die Fabrik auf der anderen Straßenseite war getroffen worden. Rauch stieg am Morgen aus den Trümmern. Unser Haus war teilbeschädigt. In der Wohnung herrschte Chaos, alle Möbel umgestürzt, der Fußboden bedeckt mit zersplittertem Geschirr. Am Gehweg lagen die durch die Druckwelle entwurzelten Bäume. Eine Brandbombe ging im Nachbarhaus nieder. Eine Frau schrie, sie war irre geworden. Aus dem brennenden Lazarett an der Ecke sah man Soldaten mit Krücken heraushumpeln. Wie ich später erfuhr, war meine kleine Freundin Renate durch glühenden Phosphor auf der Straße ums Leben gekommen.
Die Verwüstung war groß.
Kein Laden hatte etwas Essbares. Der Bäckerladen war leer. Irgendwo gab es eine Noteinrichtung. Dorthin machten sich unsere Eltern mit uns Kleineren auf den Weg, ausgerüstet mit Schüsseln und Behältnissen. Aber was wir dort erlebt haben, werde ich niemals wieder vergessen: In einer Ecke im Stroh lagen elternlos gewordene Kinder. Ein verrückter alter Mann ging mit einem Messer unter sie und war kaum zu bändigen. Mein Vater und zwei andere Männer fesselten ihn und wollten ihn in ein Heim schaffen, aber sie kamen unverrichteter Dinge zurück, denn es gab keins. Was dann weiter passierte, entzieht sich meiner Kenntnis.