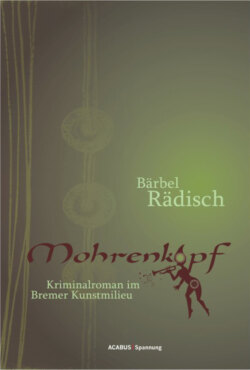Читать книгу Mohrenkopf. Kriminalroman im Bremer Kunstmilieu - Bärbel Rädisch - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2
ОглавлениеBratkes Herz schlug für alte Gemäuer, alte Bücher und alte Autos. Für die meisten Dinge nahm er sich viel Zeit, weil er durch Hektik nicht an Lebensqualität verlieren wollte. Er bewunderte zum Beispiel Dom-Baumeister, die wussten, zu ihren Lebzeiten würde das Gotteshaus nicht fertig gestellt werden. Es hielt sie dennoch nicht davon ab, mit dem Bau zu beginnen. Er kaufte selten ein neues Buch, weil er fand, alte Bücher erzählten viel darüber, was ihnen bisher widerfahren war. Manchmal erfreute er sich daran, es nur zu betrachten, wenn es mitgenommen aussah. Auch Gegenstände des täglichen Lebens verloren ihren Wert für ihn nicht, nur weil sie abgenutzt waren.
Lowinski amüsierte sich, dass Bratke eine Metallhülse benutzte, in die er seine Bleistifte schob, wenn sie durch anspitzen immer kürzer geworden waren. Er hätte den Stummel längst weggeworfen. Und mit einem Bleistift zu schreiben, wäre ihm sowieso nicht in den Sinn gekommen.
Ärgerlich fand er allerdings, wie oft Bratke eine Aussage nach einer Vernehmung durchlas, noch einmal und noch einmal. Er hielt das für Zeitverschwendung, und es nervte ihn. Bratke dagegen nannte es ‚zwischen den Zeilen lesen‘. Dass der zudem viele Dienstwege zu Fuß erledigte, missfiel Lowinski ebenfalls.
Auch heute entschloss Bratke sich, ein Stück zu Fuß zu gehen. Für einen Tag Ende März herrschten fast schon frühsommerliche Temperaturen, und Bewegung würde ihm gut tun. Er grübelte und musste sich eingestehen, dass er zu viel saß, zu wenig Sport trieb, vielleicht das ein oder andere Glas Rotwein am Abend zu viel trank und auch kein Kostverächter war, wenn etwas Leckeres auf dem Tisch stand. Er blieb an der Ecke Contrescarpe/Ostertorsteinweg kurz stehen, warf einen Blick hinüber zum ehemaligen Polizeihaus und wäre beinahe von einem Radfahrer umgefahren worden. Nach einem zweiten Blick auf die ehrwürdige Fassade entschloss er sich, seiner früheren Wirkungsstätte einen Besuch abzustatten. Die Galerie würde er anschließend aufsuchen. Mit der Sekretärin von Mevis & Franklin hatte er keinen Termin ausgemacht, nur gesagt, er käme baldmöglichst vorbei.
Er vermisste das Flair des mächtigen Sandsteinkomplexes des alten Polizeihauses am Wall. Diese besondere Ausstrahlung, die ein Gebäude vermittelt, das eine Seele hat.
Er stellte sich vor, dass dieses Haus über Jahrzehnte unendlich viele Gespräche belauscht hatte und nun jedes Wort hinter dicken Mauern bewahrte wie Pretiosen in einem Banktresor. Aussagen hinter verschlossenen Türen, erhobene Anschuldigungen, verlesene Protokolle. Diebe, Mörder, Vergewaltiger, Schuldige und Unschuldige waren durch die langen Korridore geführt worden. Hinter diesen Mauern kannte man von den Machenschaften eines Kleinkriminellen bis zur groß angelegten Betrugsaffäre eines Konzerns, wo es um Milliarden ging, alle Spielarten.
Wehmütig sah er zum Fenster im dritten Stock hoch, hinter dem er mehr als zwanzig Jahre lang seine Fälle bearbeitet hatte. Trotz mancher Missstände trauerte er seinem alten Arbeitszimmer und der Umgebung nach wie einem guten Freund, der in eine weit entfernte Stadt zieht. Von außen sah das Gebäude aus wie eh und je. Selbst der Schriftzug Polizeihaus prangte noch über dem Eingang, obwohl inzwischen die Stadtbibliothek in die hohen Räume eingezogen war.
Kurzentschlossen einem Impuls folgend, überwand er wie all die Jahre zuvor die Steinstufen mit elastischen Sprüngen und stieß das mächtige Eingangsportal auf. Die klobige Klinke in Form einer Faust herunterzudrücken, bedeutete auch für Männerhände einen Kraftakt.
Bratke war sprachlos. Er hatte das Gebäude seit dem Umzug nicht wieder betreten, wusste aber aus Zeitungsberichten, dass Millionen in den Umbau geflossen waren. Geld, das zu seiner Zeit für Renovierungen immer fehlte.
Niemand interessierte sich damals für undichte Fenster und laufende Toilettenspülungen.
Welche Farbe hatten die Vorhänge an den Fenstern eigentlich gehabt, überlegte er, und entschied sich für neutral. Und erst die Heizung! Entweder es war im Winter zu heiß oder eiskalt in den Amtsräumen gewesen, weil sich nichts regeln ließ. Ein Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus. Die Geräusche der gusseisernen Rippenmonster hatten Besucher oft belustigt, manchmal aber auch peinlich berührte Blicke hervorgerufen wegen der allzu menschlichen Töne. Weniger lustig hatte eine Kollegin die Begegnung mit einer Ratte auf der Toilette gefunden. Durch die Kanalisation war das Tier bis in die höheren Stockwerke im Fallrohr empor geklettert und hatte die Seife am Waschbecken angefressen. Alle Toilettenbecken waren damals mit Metallklappen verschlossen worden, die sich nur bei Spülung öffneten, getreu dem Motto, wo eine Ratte ist, sind hundert andere.
Jetzt fand Bratke sich in einem lichtdurchfluteten Foyer wieder mit Monitoren, an denen sich Leser über die Bestände der Bücherei informieren konnten. Fast jeder Hocker davor war besetzt und am Informationsschalter warteten eine Menge Leute darauf, an die Reihe zu kommen. Auf hellen Treppenstufen, die zu Terrassen im Kreis angeordnet waren, luden blaue Lederkissen zum ungenierten Herumlümmeln ein, wenn man es sich nicht in den überall verteilten kleinen Sesseln bequem machen wollte. Einige Besucher saßen und lasen.
Ein altmodisches rotes Sofa mit Dackelbeinen war mit lauter Buchrücken bekränzt und sah aus, als hätte es einen Faltenkragen. ‚Vorlesesofa für Kinder‘ las Bratke auf dem Schild darüber. Ein großer Fleck auf dem roten Stoff schien Beweis zu sein, dass ein Kind nicht mehr daran gedacht hatte, sein Eis weiter zu schlecken, dachte er im Stillen. Er hatte keine Kinder, sonst wäre ihm vielleicht der Gedanke gekommen, eines hätte alles um sich herum vergessen, als es mit offenem Mund zuhörte, was Albus Dumbledore im Ligusterweg mit einem silbernen Ding, das aussah wie ein Feuerzeug, wohl im Schilde führte.
Bratke wandte sich nach links und blieb stehen. Hier war der Ausgang zum Hof gewesen. Den Innenhof überspannte nun ein Glasdach. Südländisches Flair vermittelten die Palmen in Kübeln, die Rohrstühle und Tische des Restaurants, das jetzt Gäste erwartete, wo die Einsatzfahrzeuge seit Jahrzehnten bei Wind und Wetter bereit gestanden hatten und das Heulen der Martinshörner von den Wänden zurückgeworfen worden war.
Wenn ich schon da bin, kann ich mich auch nach Fachliteratur über Silber erkundigen, dachte er, vielleicht hilft es mir bei meinen Ermittlungen weiter. Literatur über Schweizer Zunftpokale wird es sicherlich nicht geben, aber wer weiß?
Die Bibliothekarin hinter dem Tresen fragte nach seinen Wünschen. Tatsächlich fand sie auch etwas Geeignetes und gab ihm noch mit auf den Weg:
„Erkundigen Sie sich doch auch einmal im Focke-Museum, wenn jemand Bescheid weiß, dann da. Dort sitzen die Bremer Fachleute für Silber.“
Mit einem Stapel Bücher und einigen Vorbestellungen verließ er nach einer halben Stunde das Haus.
Gut zehn Minuten später bog er wieder in die Contrescarpe ein.
Nach ein paar Metern las er über einer Eingangstür „POP TRIFFT ART“, und in kleinen Buchstaben stand darunter: Plakatkunst, Grafik, Lithografie.
Komisch, bisher ist mir nie aufgefallen, dass es zwei Galerien in dieser Straße gibt, dachte er. Ein optimaler Standort, der den Zustrom von Kunden garantierte, war diese Gegend nicht gerade.
Bei dem Wort garantieren sollte jeder vernünftige Mensch zusammenzucken. Bratkes Gedanken begannen zu kreisen. Eine Garantie gibt es für nichts im Leben, aber ein Marketing-Experte würde mit Sicherheit vorschlagen: In einer belebten Einkaufsstraße mit Läden der gehobenen Mittelklasse und zwei, drei Szene-Restaurants würde sich eine Galerie anbieten. Als Gag in der Nähe eine Glasbläserei, und im Gegensatz dazu ein Spezialgeschäft für Zigarren, dessen Inhaber schon Fidel Castro persönlich in Kuba begegnet sein will.
Die Menschen sind heutzutage gierig danach, sich mit mehr oder weniger bekannten Personen anzubiedern, vielleicht um ein wenig Glanz in ihr Alltagsleben zu bringen. Pilgerten manche nicht sogar zu Drehorten von Seifenopern, auch wenn längst alle Szenen im Kasten waren?
Die Tür zu „POP TRIFFT ART“ stand offen. Als Bratke einen Blick von draußen ins Innere warf, dachte er bei dem bunten Durcheinander von Klecksen und Strichmännchen an den Wänden eher an einen Mal- und Basteltreffpunkt für Kinder.
Das war auf jeden Fall nicht seine Welt. Achselzuckend ging er weiter. Am entgegengesetzten Ende der Häuserzeile befand sich das Domizil von Mevis & Franklin, wo er mit Gerlinde Kilian, der Sekretärin, sprechen wollte. Er war schon sehr gespannt, was ihn dort erwartete. Beide Galerien lagen in der Contrescarpe, einer Straße, in der die Gründerzeitvillen ehemaliger Bremer Kaufleute, die mit Bier, Kaffee, Gewürzen, Weinhandel oder Im- und Export um die Jahrhundertwende ihr Geld gemacht hatten und zu Reichtum gekommen waren, vom Prunk vergangener Zeiten kündeten.
Nahezu alle Gebäude waren von den Bomben des Zweiten Weltkriegs verschont geblieben. Pompöse Villen mit unzähligen Zimmern, die für heutige Verhältnisse auf riesigen Grundstücken standen.
Er erinnerte sich daran, wie ihm seine Großmutter einmal erzählt hatte, dass hier früher Großfamilien mit mehreren Generationen unter einem Dach wohnten, inklusive Tanten, Onkel, unverheiratete Cousinen und eine Schar von Kindern und Bediensteten. Die neuen Mieter oder Besitzer der hochherrschaftlichen Räume repräsentierten dagegen Vereine oder tummelten sich in der New Economy; außerdem waren hier mittlerweile auch Büros, Arzt- und Anwaltspraxen untergebracht, und im Haus mit der Nummer 127 präsentierte die Galerie von Lutz Mevis und seiner amerikanischen Partnerin Charleen Franklin ihre Kunstwerke.
Die restaurierte Fassade des Hauses strahlte vanillegelb. Wer nicht wusste, was sich hinter den Sprossenfenstern verbarg, hätte auf ein Wohnhaus getippt.
„Na klar, weil es keine Ladenfront, nicht einmal ein Schaufenster gibt, habe ich von der Existenz der Galerie bisher nichts gewusst“, murmelte Bratke. „Ich bin schon hundertmal hier vorbei gegangen. Ist mir nie aufgefallen. Das nennt man wohl Bremer Understatement.“
Kunstinteressierte und Käufer lockte nur ein schlichtes Messingschild an der Wand neben der Eingangstür aus Eiche. Sie zeigte mit aufwändigen Schnitzereien aus dem Tierreich eine Handwerkskunst, die heute selten geworden war.
Für Bratke bedeutete dieser Fall im Kunstmilieu eine Premiere. Ja, wenn es sich um ein Antiquariat gehandelt hätte, wäre er bestens informiert gewesen. Läden mit alten Büchern waren sein zweites Zuhause. Ein Leben ohne zu lesen konnte er sich nicht vorstellen.
Besonders Bremensien und historischer Lektüre galt seine uneingeschränkte Liebe, und die suchte und fand er oft zu erschwinglicheren Preisen aus zweiter Hand.
Privat besuchte er von Zeit zu Zeit die Kunsthalle, wenn wieder einmal eine spektakuläre Ausstellung lockte. Er machte sich einen Spaß daraus, an solchen Tagen eine Eintrittskarte zu kaufen, wenn er in der Zeitung gelesen hatte, dass zum Beispiel der zwanzigtausendste oder hunderttausendste Besucher erwartet wurde, wie bei der Liebermann-Ausstellung. Ein albernes Spiel, denn außer einem Blumenstrauß und einem Foto im Weser-Kurier brachte es dem Gewinner nichts ein, aber bei Bratke erzeugte es ein kleines Kribbeln in der Magengegend, wenn er das Geld in den Zahlteller an der Kasse legte.
Von Gemälden verstand er allerdings wenig, er konnte lediglich sagen, ob ihm ein Bild gefiel oder eben nicht.
Die Szene der Bremer Kunsthändler kannte er nur vom Hörensagen. Heute betrat er in der Galerie Mevis & Franklin absolutes Neuland, was ihm ein gewisses Unbehagen verursachte, weil er einen Fall gern gut vorbereitet in Angriff nahm.
Als er mit Lowinski darüber sprach, dass er sich in diesem Metier nicht auskenne, beruhigte der ihn mit dem Hinweis: „Du musst ja auch kein Mörder sein, um bei der Mordkommission Fälle aufzuklären.“
Bratke klingelte und nach einer Weile ertönte der Summer zum Öffnen der Tür.
Im Treppenaufgang fiel sein Blick auf ein überdimensionales Stillleben mit Fischen, Austern und Rauchutensilien. Floris van Schoten las er auf einer kleinen Messingtafel am unteren Rahmen. Das Bild war so detailgetreu gemalt, dass Bratke vorsichtig mit dem Zeigefinger darüber strich, weil er dachte, es wäre eine riesige Fotografie.
Das Tafelsilber aus dem Besitz der französischen Königsfamilie und die zahllosen weiteren Gemälde großer Meister an den Wänden im ersten Raum nötigten ihm derartigen Respekt ab, dass er sich ganz klein und unbedeutend vorkam. Die Möbel hatten vielleicht in einem Schloss gestanden. Ähnliche glaubte Bratke einmal im Urlaub in Neu-Schwanstein gesehen zu haben. Ihnen haftete etwas Aristokratisches an. Irgendwie, fand er, ging etwas Hochmütiges von ihnen aus. Die voluminösen Polstersessel und Chaiselonguen im nächsten Raum sandten ihm das Signal: Wage es bloß nicht, dich mit deinem bürgerlichen Hintern auf uns zu setzen. Pokale in Form eines Segelschiffs oder eines Schwans standen in Glasvitrinen neben einer vergoldeten Ecuelle, wie auf einem kleinen Schild stand.
Ein Hochglanzprospekt wies darauf hin, dass die Galerie ihre Exponate auf der Münchner Kunstmesse präsentierte, ebenso wie in Paris auf der Biennale des Antiquaires, in Maastricht und im Dolgorukow-Palais in Moskau.
Keine dieser Städte hatte Bratke je besucht, und die Fülle an Kostbarkeiten in diesen Räumen verursachte ihm ein Gefühl von Enge im Brustkorb.
Während er darauf wartete, dass die Sekretärin, Frau Kilian, ihr Gespräch mit einem Kunden beendete und Zeit für ihn hatte, musste er sich kurz vom Anblick all der Bilder, Möbel, Silberwaren und wertvollen Gerätschaften erholen.
Er warf einen Blick aus dem Fenster auf die Straßenseite gegenüber. Hier hatte in früheren Jahrhunderten die Stadtmauer die Bürger geschützt, jetzt war nur noch der alte Stadtgraben erhalten mit dem Wall, auf dem die Festungsanlagen und Torhäuser gestanden hatten. Als die Torsperren im 19. Jahrhundert aufgehoben wurden, an denen Zoll erhoben und kontrolliert wurde, wer die Stadt betrat oder verließ, galt es für betuchte Bremer Bürger als vornehm, draußen vor der Stadt zu wohnen.
Uralte Platanen mit mächtigen Kronen und ihrem ständig wechselnden Rindenmuster, das Bratke so gut gefiel, säumten die Straße. Als er auf einem Fortbildungslehrgang in Frankfurt war, musste er fassungslos feststellen, dass die Kronen dieser wunderbaren Bäume dort bonsaiartig verstümmelt wurden. Er war dankbar, dass die Gärtner des Bremer Amtes für Öffentliches Grün diese Kastration der Bäume nicht ausführten. Wie oft hatte er in den vergangenen Sommern gesehen, dass die Angestellten aus dem nahen Bankenviertel ihre Mittagspause mit Blick aufs Wasser im Schatten der Bäume verbrachten. Die beiden Verkäuferinnen von Delikatessen Blöchliger, die er immer nur durch die Ladenscheibe bei der Arbeit beobachtet hatte, entspannten sich manchmal nach dem Mittagsansturm ebenso hier.
Auch die Königin der Knöpfe, Schnallen und Spitzenkragen aus dem winzigen Souterrain-Lädchen für Nähzubehör im Feddelhören hatte sich an bestimmten Tagen eingefunden. Gerne hätte er sie damals näher kennen gelernt, wenn seine Scheu sie anzusprechen nicht zu groß gewesen wäre. Er erinnerte sich nicht mehr so genau, wie lange es her war, aber seine Mutter lebte zu der Zeit noch und wusste ihn geschickt davon abzuhalten, sich Hals über Kopf in ein Liebesabenteuer mit einer kleinen Ladenbesitzerin zu stürzen, die in ihren Augen ganz und gar nicht zu einem aufstrebenden Polizeibeamten passte.
Mütter mit kleinen Kindern spielten fast immer auf den Rasenflächen – im Gegensatz zu anderen Städten waren hier keine Schilder mit der Aufschrift ‚Betreten verboten‘ aufgestellt – und im Winter tummelten sich Schlittschuhläufer auf der Eisfläche des Grabens.
Das Theater und die Kunsthalle waren nur einen Steinwurf entfernt, ebenso erreichte man in zehn Minuten zu Fuß das Rathaus, den Marktplatz mit dem berühmten Roland und die Bremer Stadtmusikanten oder die Böttcherstraße, die um 1900 der Kaufmann Ludwig Roselius der Stadt abkaufte und sie restaurieren ließ. Obwohl passionierter Teetrinker, wusste Bratke natürlich, dass ebendieser später weltberühmt wurde durch das Verfahren, dem Kaffee das Koffein zu entziehen. Ach ja, seufzte er in Gedanken, bis vor wenigen Jahren lag mein Arbeitsplatz noch in der Nähe dieses idyllischen Parks. Stimmen rissen ihn aus seinem wehmütigen Rückblick. Bratke drehte sich um. Frau Kilian verabschiedete sich von ihrem Kunden, einem Mann um die siebzig, der in seinem grauen Anzug herausgeputzt wirkte. Fast unterwürfig verbeugte er sich, als sie ihm zuraunte: „Ich verlasse mich auf Sie. Wir regeln alles wie immer. Diskret, versteht sich.“
Sieht so ein Kunde von Mevis & Franklin aus?, dachte Bratke. Er ahnte nicht, dass er den Mann schon bald wieder treffen würde.
Frau Kilian wandte sich nun ihm zu und fragte: „Gibt es Neuigkeiten, dass Sie sich extra herbemühen?“
Bislang hatte er nur mit ihr telefoniert und ihre Art am Telefon schon recht abweisend gefunden. In Stichpunkten hatte sie ihm den Verlust des Kopfes mitgeteilt und eine kurze Zusammenfassung zugefaxt. Er ärgerte sich, auf welche Art und Weise sie ihn hier mit ziemlicher Herablassung behandelte.
„Ich wollte mich gerne einmal bei Ihnen umschauen und einen Termin zur Aufnahme des Protokolls ausmachen. Vielleicht passt es ja jetzt gerade, um ausführlich miteinander zu sprechen.“
„Aber Herr ...“
„Bratke“, half er ihr auf die Sprünge. „Oberkommissar Bratke.“
„Ja, richtig. Das Wesentliche konnten Sie meinem Fax entnehmen. Heute passt es ganz und gar nicht. Ich hoffe nur, Sie sind bereits tätig geworden. Was an Informationen nötig war, liegt Ihnen ja vor.“
Was bildete sich die Dame ein? Bratke musste sich zusammennehmen, damit er ihr nicht eine patzige Antwort an den Kopf warf.
„Wie passt es Ihnen denn morgen?“, fragte er.
Sie ging in den Raum nebenan und blätterte in einem Kalender auf einem kleinen Schreibtisch.
„Nein, kommen Sie übermorgen, pünktlich 10.30 Uhr, da kann ich Sie unterbringen.“
Ganz ruhig, Bratke, ganz ruhig, befahl er sich und wandte sich ihr zu mit dem liebenswürdigsten Lächeln, das er hervorbringen konnte.
„Also übermorgen. Übrigens, mich würde interessieren, was ich unter einer Ecuelle zu verstehen habe. Hier, in dieser Vitrine?“ Er deutete auf den vergoldeten Teller.
Erstaunt sah sie ihn an. „Ein Wöchnerinnen-Geschirr. Darauf richtete man nach der Entbindung kräftigende Speisen an für die junge Mutter aus reichem Hause.“
Ihre Stimme hatte auf einmal einen freundlichen Klang, der aber sofort wieder verschwunden war, als sie fortfuhr: „Eine Kostbarkeit, von der nur der Fachmann auf dem Kunstmarkt Kenntnis hat.“
Dabei zupfte sie an den Manschetten ihrer cremefarbenen Bluse, obwohl die perfekt saßen.
Hochmütig ist sie, die gute Frau Kilian, dachte Bratke, als er wieder auf der Straße stand. Sie sollte es nicht übertreiben.
Zehn Minuten später war er im Schnoor, dem ältesten Bremer Stadtteil, wo sein Auto stand.
Er hatte sich diebisch gefreut, die Ecke am Hochzeitshaus verwaist vorzufinden, seinen alten Parkplatz für den mausgrauen VW-Käfer, der ihn sein halbes Leben begleitete.
„Nein, die Farbe nennt sich Jupitergrau, es ist der Originalfarbton“, berichtigte er jeden, der sich erdreistete, sein geliebtes Vehikel mit so etwas wie einer Maus auf die gleiche Stufe zu stellen.
Während er seinen Bücherstapel auf dem Autodach ablegte und umständlich nach dem Schlüssel in der Jackentasche kramte, überlegte er: Kenne ich irgendjemanden, der schon einmal in Bern war? Wer könnte mir etwas über die Heimat des Zunftpokals erzählen? Endlich fingerte er den Schlüssel hervor, legte die Bücher auf den Rücksitz und rutschte hinter das Steuer.
„Nun komm schon“, ermunterte er den röchelnden Motor und fügte ein befriedigtes „Na, geht doch, altes Mädchen!“, hinzu, als das Geräusch runder und voller wurde.