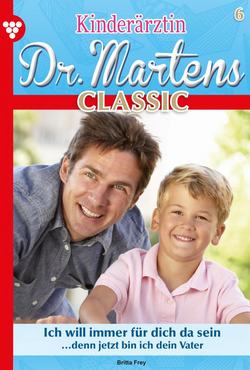Читать книгу Kinderärztin Dr. Martens Classic 6 – Arztroman - Britta Frey - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеEin sanfter Schleier lag noch über der frühmorgendlichen Heide, als Barbara Honert die Haustür öffnete und ins Freie hinaustrat. Das elegante Köfferchen in ihrer Hand wog leicht, denn der Besuch bei Mutter und Söhnchen war wieder einmal kurz gewesen – zu kurz, wie sie nun an deren Gesichtern ablas.
»Mami, warum fliegst du nach Rom?« fragte Daniel und rieb sich die verschlafenen Augen, während er zu seiner Mutter hochblinzelte.
»Ich fliege heute nicht nach Rom, Dani«, sagte Barbara Honert, und ihre gepflegte Hand legte sich einen Moment auf den blonden Lockenkopf ihres kleinen Sohnes, »ich fliege nach New York, und das ist ein bißchen weiter.«
»Und warum fliegst du nach Ne…, und warum fliegst du dahin?« Daniels Augen versuchten einen Halt zu finden an der kühlen beruflichen Eleganz eines Kostüms, das in der korrekten Uniformierung der Stewardessen nur schwer eine Beziehung zuließ.
Barbara Honert stellte das Köfferchen nun doch noch einmal ab und nahm ihren Sohn, der in seinem verrutschten Schlafanzug neben seiner Omi stand, auf die Arme.
»Schau, Mami verdient damit ihr Geld – das verstehst du doch?« Ihr Lächeln, bereits wieder auf den beruflichen Tag gerichtet, war schon etwas fern und flüchtig.
Daniels Augen waren sehr blau und sehr fragend, denn er sollte etwas verstehen, was über seine vier Lebensjahre hinausging. Aber Omi sagte immer, daß er ein kluger Junge sei, und unbewußt ahnte er, daß kluge Jungen keine dummen Fragen stellten. Also nickte er und sah seiner hübschen Mutter in das perfekt geschminkte Gesicht.
»Na, siehst du«, sagte Barbara Honert, und ihre Stimme klang zufrieden. Sie küßte den Kleinen rasch auf seine roten Schlafbäckchen, bevor sie ihn auf den Boden zurückstellte. Und während sie nun eilig das Köfferchen wieder aufnahm, mahnte sie: »Sei bitte lieb und mach der Omi keine Sorgen…«
Daniel nickte und griff automatisch nach der Hand Else Honerts, während er seiner Mutter nachsah, die jetzt unverzüglich in ihren Wagen stieg, um ihn auf die Landstraße zurückrollen zu lassen. Von dort hob sich ihre Hand noch einmal winkend zu den beiden Personen hin, die unter der Tür des kleinen Heidehauses standen, bevor das lange Band der Landstraße sie mit rascher Fahrt aufnahm.
Else Honert schaute dem Wagen mit der Nachdenklichkeit nach, die sie immer überkam, wenn ihre Tochter nach einem ihrer kurzen und oft überraschenden Besuche wieder zum Hamburger Flughafen zurückeilte, um als Stewardeß eines der Flugzeuge zu besteigen, zu deren jeweiliger Crew sie gehörte.
»Gehen wir frühstücken«, sagte sie etwas ratlos resigniert und wandte sich ins Haus zurück, ihre Hand hielt die Hand ihres kleinen Enkels.
»Und was machen wir danach?« fragte Daniel und machte mit dieser Frage den langen Tag deutlich, der vor ihnen lag.
Else Honert seufzte. Sie war über sechzig Jahre alt und spürte diese Jahre oft auch als anstrengende Tatsache gerade durch die Lebendigkeit ihres Großsohnes. Er hielt sie in Atem, und diese Atemlosigkeit, die er ihr tagaus, tagein verschaffte, hatte sie die Grenzen schon oft ahnen lassen, an der ihre Kraft für die Anstrengung nicht mehr ausreichen würde.
»Ich möchte ein Honigbrötchen!« unterbrach Daniel ihre Gedanken und lief ihr in die Küche voraus.
»Wir werden dich erst einmal waschen und anziehen«, sagte sie und versuchte ihrer Stimme einen bestimmten Ton zu geben.
»Och, Omi, warum denn?« Daniel zog ein langes Gesicht. »Bei Mami muß ich mich auch nicht erst anziehen.«
»Das sind Ausnahmen, die wir aber nicht für jeden Tag einreißen lassen«, mahnte sie. »Als ich ein kleines Kind war, mußte ich mich auch immer zum Frühstück anziehen.«
»Als du ein kleines Kind warst?« Daniel erkletterte den Stuhl und stützte die Ärmchen auf den Küchentisch auf, und indem er den Kopf in die Hände nahm, sah er sie aus großen Augen an. Die Vorstellung, daß seine Omi einmal ein kleines Kind gewesen sein sollte, war etwas ganz Unvorstellbares, und man sah es ihm an.
»Ist das lange her?« forschte er daher erst einmal und sah sie aufmerksam von der Seite an.
Else Honert nickte. »Ja, sehr lange.«
»Was ist sehr lange?«
»Sehr lange ist, wenn man graues Haar bekommt, nicht mehr so schnell laufen kann – und es hier und da mal etwas weh tut.«
»Mit tut hier und da auch mal etwas weh«, wiederholte er teilnehmend ihre Worte und griff dann nach einem Brötchen.
Else Honert mußte lachen. »Das ist bei dir ganz etwas anderes.«
Daniel verstand das nun wieder überhaupt nicht und biß erst einmal in das Brötchen.
Else Honert seufzte und ließ für heute den Schlendrian noch mal durchgehen. Sie setzte sich zu dem Kleinen an den Küchentisch, nahm ihm das trockene Brötchen aus der Hand und bestrich es mit Butter und Honig.
Der kleine Enkel war ihre Freude, aber diese Freude konnte sie nicht ohne Zukunftsangst genießen. Und immer wenn ihre Tochter in die Weit hinausflog, kamen die Gedanken und setzten ihr zu.
Ob Barbara bedacht hatte, was es hieß, ein Kind allein großziehen zu wollen, ohne Vater und nur mit Hilfe ihrer Mutter, die nicht mehr die Jüngste war?
Daniel hatte einen Vater – und hatte doch keinen Vater! Er hatte ihn nie gesehen – und würde ihn wohl auch nie sehen! Ein verheirateter Mann, den ihre Tochter sich lediglich als Traummann für die Zeugung ihres Wunschkindes ausgeguckt hatte!
Schlimm genug, das Ganze, fand Else Honert, zumal es so bewußt geschehen war. Was waren das für Zeiten? Die alte Dame verstand die Welt nicht mehr. Ihre Tochter hatte ein Kind gewollt, aber keinen Ehemann! Freiheit nannte sie das, und Else Honert fragte sich, auf wessen Kosten so ein Denken ging.
Manchmal sah sie die Kinder im Dorf an, die an der Hand ihrer Väter gingen, und ein Gefühl von traurigen Verzicht beschlich sie, wenn sie an den kleinen Enkel dachte. Ihm würde einmal diese Erfahrung fehlen, die männliche Bezugsperson, die seiner normalen Entwicklung gutgetan hätte.
»Omi, ich möchte eine Milch!« rief Daniel und schreckte sie aus ihren Gedanken auf.
Und während sie ihm die Milch holte, fragte er erneut: »Und was machen wir nachher?«
»Wir gehen für das Mittagessen einkaufen.«
»Und dann?«
»Dann wirst du etwas spielen, während ich die Mahlzeit zubereite.« Die Tatsache, daß sie ihn hier auf dem Lande auch einmal eine Weile unbeaufsichtigt lassen konnte, war eine große Erleichterung. Aus dem Grunde war sie auch vor einem Jahr in die Heide hinausgezogen, da ihr die weite stille Landschaft für die gesunde Entwicklung des Kindes geeigneter schien als die laute verschmutzte Großstadt.
Für ihre Tochter war diese Entfernung von Hamburg zwar eine zusätzliche Anstrengung, wenn sie während ihrer meist kurzen Aufenthalte zwischen den Flügen erst so weit hinausfahren mußte, aber in diesem Fall hatte Else Honert sich im Interesse des Kindes durchgesetzt.
Das kleine Häuschen in der Heide gehörte ihr ohnehin und stellte somit keine zusätzliche finanzielle Belastung dar.
»Und wenn wir zu Mittag gegessen haben?« fragte Daniel und wollte die Planung des Tages so sicher vor sich sehen wie das Brötchen, das er gerade aß.
»Wir unternehmen einen Spaziergang in die Heide hinaus – einverstanden?«
Er nickte und schlürfte hingebungsvoll seine Milch, während der kurze Besuch seiner jungen hübschen Mami schon wieder so weit aus seinen Gedanken verschwunden war, als hätte er nie stattgefunden.
*
Die Wärme des Nachmittags brütete über der friedlichen Heide, trug in der flirrenden Luft das tausendfache Summen der Bienen an die beiden Spaziergänger heran.
»Sieh, wie fleißig die Bienen sind!« sagte Else Honert und blieb einen Moment stehen, um ein wenig zu verschnaufen und auf den weiten blühenden Heideteppich zu zeigen. Sie lüftete ein wenig das Strohhütchen, welches die Sonne abhielt und das Licht von den Augen nahm.
»Ja«, sagte Daniel interessiert und ging vor einem der Heidekrautbüsche in die Hocke, um sich die Arbeit der Bienen genauer anzusehen. Seine Omi hatte ihm erzählt, wie die Bienen den Nektar sammelten und ihn dann in den Bienenstock trugen, der bei Imker Lüns im Garten stand. Dort arbeiteten sie an dem Honig, den er morgens auf seinem Brötchen aß.
Else Honerts Blicke schweiften über die stille Weite der Heidelandschaft, ihr teils flaches und auch wieder welliges Auf und Ab, das scheinbar kein Ende nahm. Sie war ein wenig erschöpft und schaute sich nach einem schattigen Plätzchen unter den vereinzelt stehenden Birken und Kiefern um.
»Was meinst du, wollen wir jetzt unser Picknick einlegen?« fragte sie und schaute auf den blonden Lockenkopf ihres Enkels hinab.
Daniel ließ augenblicklich von der Beobachtung der Bienen ab und nickte begeistert, während er sein lebhaftes Jungengesicht zu ihr emporhob.
»Schau, setzen wir uns dort drüben in den Schatten«, sagte sie und zeigte auf eine Birke, deren Zweige so ausladend waren, daß ein Verweilen unter ihr ein wenig Kühle verhieß.
Daniel, ein neues Ziel vor Augen, rannte los, während Else Honert einen Moment die Hand aufs Herz legte. Und bevor sie ihm nun langsam folgte, rief er bereits: »Komm, Omi, schnell! Hier sind auch Kaninchenlöcher!« Er lag bereits auf seinen braunen Knien, um einen Blick in die Tiefe der kleinen dunklen Höhlen zu erhaschen.
»Keine da!« stellte er kurz darauf enttäuscht fest, als auch sie herangekommen war. Das Herz machte ihr bei der Witterung zu schaffen, und als die leichte Decke unter der Birke einladend ausgebreitet lag, ließ sie sich erleichtert darauf nieder und streckte die Beine aus.
»Ich habe Durst, Omi«, sagte Daniel und setzte sich neben sie. Seine Aufmerksamkeit galt jetzt dem Leinenbeutel, der die Safttüten und Kuchenstückchen enthielt.
»Ja, ich auch«, lächelte sie, »jetzt werden wir uns erst einmal stärken.« Sie streichelte seine erhitzten Bäckchen und entnahm dann dem Beutel die Köstlichkeiten.
Daniel schien ganz dem Glück der Stunde hingegeben, während er genüßlich den Saft mit dem Strohhalm aus der Papptüte sog.
»Nicht so hastig«, mahnte sie, vernahm aber bereits die Geräusche, die besagten, daß die Tüte leer getrunken war.
»Wo sind die Kaninchen?« fragte er dann und behielt die kleinen Bodenlöcher im Auge.
»Sie werden so wie wir unterwegs sein und da draußen irgendwo ein Picknick halten.«
»Soll ich mal nach ihnen suchen?« Else Honert schüttelte den Kopf. »Jetzt iß erst einmal deinen Kuchen.«
»Was essen die Kaninchen?«
»Ich denke, Gras und Klee.« Else Honert nahm nach der Stärkung das Hütchen vom Kopf und legte sich ein wenig auf die Decke zurück.
Daniel tat es ihr erst nach, und sie lächelten einander zu. Dann sah er in den hohen blaßblauen Himmel, aber bis auf einige vorüberfliegende Vögel war da nicht viel zu sehen, und er richtete sich wieder auf.
Die Löcher im Boden waren da weitaus aufregender, und er fieberte dem Auftauchen eines Kaninchens entgegen. Ob er sich doch einmal nach ihnen umsah? Er schaute zu seiner Omi hin, und als er bemerkte, daß sie die Augen geschlossen hatte, hielt es ihn nicht länger auf der Decke, und er stand auf und ging leise davon.
Ratlos sah er eine ganze Weile auf die Kaninchenbauten, bevor seine Augen die Tiere in der Weite der Heide zu entdecken versuchten.
Das flirrende Licht spiegelte ihm allerlei scheinbare Bewegungen vor, und er folgte schließlich diesen Verlockungen, wie ihnen nur ein kleiner Junge folgen kann, dessen abenteuerliche Entdeckerfreude keine Grenzen kannte.
So lief er von Punkt zu Punkt, und als nach einer Weile tatsächlich eines der Hoppeltiere aufsprang und in munteren Sätzen davonlief, kannte seine Aufregung keine Grenzen mehr, und er drang weiter und weiter in die Heide vor.
Zeit und Entfernung waren in seinem Alter unbekannte und schwer abschätzbare Dinge, und wenn er sich dann und wann umwandte, schien ihm immer die nächststehende Birke die zu sein, unter der seine Omi gerade schlief.
Das leuchtende Warnschild am steil abfallenden Abbruchrand einer Sandgrube erregte zwar seine Aufmerksamkeit, erfuhr aber nicht seine Deutung, da er noch nicht lesen konnte Das »Betreten verboten – Abräumgebiet!« erreichte ihn daher nicht als Warnung, sondern lediglich als eine hochstehende Tafel, weithin sichtbar und ganz und gar ungefährlich.
So lief er über diese Warnung hinaus und stand kurz darauf am brüchigen Rand der Grube, um aus der Höhe in eine unverhoffte Tiefe zu sehen, die sich in einem weiten auslaufenden Becken bis an den gegenüberliegenden Horizont zu erstrecken schien.
Das Ganze wäre nun gar nicht so interessant für Daniel gewesen, wenn nicht in der Tiefe des Abbaugebiets diese aufregend mächtigen Fördermaschinen gestanden hätten.
Aus schwindelnder Höhe erblickte er direkt unter sich einen Schaufelbagger, der so viel faszinierender als sein eigener kleiner Spielzeugbagger war, der bei Omi im Vorgarten lag, und mit dem er ihre Blumenbeete ruinierte.
Aber das mächtige Ungetüm dort unten stand still, und die anderen Fördergeräte ebenfalls, wie er aufmerksam registrierte – bis hin zu dem Lastwagen, der in der Entfernung schon klein wirkte.
Daniel sah eine ganze Weile ratlos erstaunt auf das stille weite Tal, auf die ruhenden Maschinen, denn mit dem Begriff »Wochenende« konnte er nichts anfangen.
Dann kehrten seine Blicke voller Faszination zu dem Bagger zurück.
Ob er sich das Ding einmal aus der Nähe ansah? Der Wunsch ließ seine Bäckchen rot werden vor Aufregung, als er das dachte und sich dem Abbruchrand bis zur äußersten Kante näherte. Und so wenig er in seinem Alter Entfernungen abzuschätzen vermochte, so wenig erkannte er die gefährliche Höhe, als er sich entschloß, hinunterzuklettern.
Ratlos versuchte er eine Weile unter den überhängenden Gras- und Heidekrautbüscheln die ideale Stelle zu finden, ließ dabei aber als Fixpunkt den mächtigen Bagger nicht aus den Augen.
Die Grasnarbe, auf die er schließlich seine kleinen Füße setzte, war gezackt abgerissen über bloßliegenden Erdreichschattierungen und brach in dem Moment weg, als sein ganzes Gewicht darauf stand.
Er fiel nicht nach hinten, was ihn vielleicht rutschend nach unten gebracht hätte, sondern stürzte kopfüber in die Tiefe.
Der mächte Schaufelbagger, zu dem er gewollt hatte, fing ihn schließlich auf und ließ ihn bis unter seinen mächtigen stählernen Panzer rollen, wo der kleine zerschundene Körper endlich zur Ruhe kam.
Den blonden Lockenkopf gegen das Eisen gelehnt, blieb das Gesicht Daniels still, weich und wie schlafend – dem erträumten Ungetüm jetzt so nah und doch so fern…
*
Die Sonne stand tief, als Else Honert erwachte und eine Weile in den Himmel sah, bevor sie wußte, wo sie war.
Nun wandte sie den Kopf ein wenig zur Seite, aber der Platz neben ihr war leer. Etwas steif vom langen Liegen auf dem harten Boden richtete sie sich auf, griff automatisch nach dem Strohhut und setzte ihn gedankenlos auf die weißen Löckchen.
»Daniel!«
Der Ruf war nicht sehr laut, und Else Honert schaute suchend in alle Richtungen. Sie erkannte, das Licht hatte sich verändert, war jetzt nicht mehr flirrend, sondern ruhig und klar. Erst jetzt sah sie auf ihre Armbanduhr und erschrak.
»Oh, Daniel!« rief sie nun erschrocken und lief auf ein wenig zittrigen Beinen ratlos eine Weile im Kreis. Dabei strich sie den Rock glatt, wie Frauen es automatisch tun, und blickte suchend über die friedliche Landschaft. Wie konnte sie nur so lange schlafen!
Aber von ihrem Enkelsohn war weit und breit nichts zu sehen. Das Gelände war übersichtlich, und wenn er in der Nähe gewesen wäre, so hätte sie ihn sehen müssen.
Mit großer Anstrengung rief sie wiederholt seinen Namen, ohne daß ein Gegenruf sich einstellte – oder das leuchtend blonde Kind zwischen den Büschen aufgetaucht wäre.
Ratlos stand sie da in den letzten Sonnenstrahlen, die ein goldenes Licht über die friedliche Heide schickten. Dann bückte sie sich gedankenlos nach der Decke, nahm sie zusammen und griff nach dem Leinenbeutel.
Der Kirchturm und die ihn im kleinen Kreis umstehenden Häuser mit den roten Dächern kamen nur langsam näher, und als sie schließlich doch an der weißen Gartenpforte ihres Hauses lehnte, hielt sie sich erst einmal aufatmend fest, während ihre Augen das Kind bereits im Garten suchten.
Aber alles war beängstigend still, und voller Beklemmung trat sie den Rundgang an, der sie schließlich ratlos an die Pforte zurückkehren ließ.
Der winkende Gruß ihrer Nachbarin traf sie wie ein Rettungsanker, und sie lief auf die junge Frau zu.
»Guten Tag, Frau Honert!« rief Gerda Brennecke und kam an den Zaun. »Sie waren spazieren?«
Else Honert nickte, und ihre Stimme klang aufgeregt, als sie sofort fragte: »Haben Sie Daniel gesehen? Wir waren zusammen in der Heide, und ich bin auf der Decke eingeschlafen. Als ich erwachte, war er spurlos verschwunden…«
»Zurückgekommen ist er nicht, ich war im Garten und hätte ihn sehen müssen, Frau Honert.« Gerda Brennecke legte die Harke aus der Hand und kam nun auf den Weg hinaus. »Vielleicht hat er sich verlaufen!«
»O Gott!« stammelte Else Honert und tastete nach dem Zaun.
»Können Sie mir den Platz beschreiben, wo Sie Ihr Picknick abgehalten haben? Ich laufe rasch noch mal hinaus…«, bot Gerda Brennecke an.
»Nein, nein, ich komme mit!«
»Werden Sie es schaffen?« Die junge Frau hatte so ihre Bedenken, wenn sie die alte Dame anschaute.
»Ja, sicher, wenn ich mich nur ein wenig einhängen darf?« Sie sah Gerda Brennecke an. »Es wird ihm doch nichts passiert sein?«
»Aber, Frau Honert, was soll ihm in unserer gutmütigen Heide schon geschehen?« lachte die junge Frau, während sie bereits wieder den Weg entlangschritten, den die alte Dame gerade hinter sich gebracht hatte.
Else Honert beruhigte sich ein wenig und ging am Arm Gerda Brenneckes mit neuem Halt und neuer Zuversicht, um den Enkel zu finden. Die junge Frau in ihrer gesunden bodenständigen Art bewirkte das.
Die Sonne war hinter dem Horizont verschwunden, als sie schließlich die Birke erreichten, deren Zweige ihnen in der etwas bewegten Luft einen täuschend beschwingten Gruß entgegenschickten.
Aber der Platz unter der Birke war leer, so leer wie die weite stille Landschaft, bevor Gerda Brennecke mit ihrer kräftigen Stimme diese Stille durchbrach, indem sie laut den Namen des Jungen rief, wieder und wieder – aber ohne jeden Erfolg.
Die junge Frau bemühte sich, auch weiterhin ein sorgloses Gesicht aufzusetzen, spürte aber die Unruhe nun auch in sich wachsen, als würde das schwindende Tageslicht die Schatten des Zweifels verstärken.
»Kommen Sie, Frau Honert, gehen wir zurück. Mein Mann ist bei der Ortsfeuerwehr. Er soll die Männer zusammenrufen, damit sie noch vor Beginn der Dunkelheit eine Suchaktion starten!«
Else Honert war am Ende ihrer Kraft. Sie legte die Hand auf ihr Herz und flüsterte: »Und Sie meinen, die Männer würden das für mich tun?«
»Natürlich – sie müssen es sogar!« Gerda Brennecke legte ihren Arm um die schmalen Schultern der verzweifelten alten Dame. »Sie werden sehen, wie schnell die Leute Ihren Kleinen finden werden…«
Else Honert wollte das glauben und hatte doch Mühe, ihre Angst, die ihr wie ein Stein auf der Brust lag, zu bezwingen. Und während nun Gerda Brennecke ihr vorauseilte, um die Hilfe zu mobilisieren, blickte sie ratlos über diese Landschaft, die immer noch so friedlich aussah, obwohl nun die Angst den Zweifel nährte.
Wenig später sah sie die Suchmannschaft der Feuerwehr ausrücken. Der rote Wagen leuchtete weit – und all das sah beunruhigend und gefährlich aus.
»Daniel«, murmelte sie, während Gerda Brennecke ihr entgegenkam und sie nach Hause brachte.
Das letzte Tageslicht wich, und die Dämmerung reichte der Dunkelheit die Hand, während Else Honert Stunde um Stunde am Fenster ausharrte.
Gerda Brennecke ging immer mal fort, und wenn sie zurückkam, so hatte ihr Gesicht von Mal zu Mal mehr Mühe, ihre Zuversicht aufrecht zu erhalten. Die frohe Unbekümmertheit war einer gewissen Ratlosigkeit gewichen.
»Sie sitzen ja im Dunkeln, das ist nicht gut!« sagte sie und nahm dann die Hände der alten Dame, während sie daran dachte, daß die Suchmannschaften die nähere Heide kreuz und quer durchkämmt hatten, ohne den geringsten Hinweis über den Verbleib des Kindes gefunden zu haben. Der Kleine war so verschwunden, als hätte die Erde sich aufgetan und ihn verschluckt.
Natürlich hatte man auch das großräumige Abbaugebiet der Sandgrube abgesucht, von oben so offen wie ein übersichtliches Tal, aber kein suchender Blick wanderte unter den Bagger, in dessen dunklem Schatten das hilflose Kind lag.
»Sie haben Suchhunde angefordert«, sagte Gerda Brennecke später in die tiefe Stille des Hauses hinein und erhob sich dann, um an das Fenster zu treten. Sie sah in der Ferne die Lampen gleich tanzenden Lichtern über die Heide geistern.
»Ich habe versagt«, murmelte Else Honert, und die Verzweiflung erstickte jedes weitere Wort.
Gerda Brennecke wandte sich ihr zu.
»Nein, Frau Honert, ich habe auch Kinder und weiß, daß man sie nicht jede Sekunde im Auge behalten kann.« Sie kam zurück und beugte sich mitfühlend über die nette alte Dame.
»Sie sollten sich wirklich ein wenig hinlegen. Ich könnte Ihnen ein Beruhigungsmittel holen.«
Else Honert schüttelte den Kopf und legte dann das starre Gesicht in die Hände, während die Zeit verrann, die Minuten, kaum noch Hoffnung, nur noch Angst.
Die Lichter geisterten die ganze Nacht über die Heide, und ihr Licht vermischte sich schließlich mit dem ersten grauen Morgenstreifen, der den neuen Tag ankündigte. Und während das Licht stetig stieg, rosig einen Sonntag ankündigte, der warm und schön sich darbieten würde, verließen die Suchmannschaften deprimiert und ratlos die Heide, um sich ein wenig zu erholen von einer langen Nacht, die kein Lebenszeichen des Jungen gebracht hatte.
Else Honert sah die Leute zurückkommen und preßte die Hand aufs Herz. Sie hatten Daniel nicht gefunden, man sah es schon von weitem ihrer Haltung an.
»Die Polizei wird das Gebiet heute großräumig absuchen, Frau Honert«, sagte Heinz Brennecke, der den Einsatz der Feuerwehr geleitet hatte, »keiner verschwindet in der Heide spurlos.«
»Ich habe Angst«, flüsterte Else Honert, »ich habe solche Angst.«
Dann kam nach einer langen bangen Nacht die wohltuende Ohnmacht und hob für kurze Zeit den Schrecken auf.
*
Richard Bremer war Frühaufsteher – auch am Sonntag. An sechs Tagen der Woche mußte er es beruflich, am siebten tat er es schließlich aus Gewohnheit – und auch, weil keine Familie ihn daran hinderte.
Frau Korten, seine Haushälterin, hatte am Sonntag immer frei, und so kochte er sich den Kaffee heute selbst – wie an jedem anderen Sonntag auch.
Und während der Kaffee durch den Filter tropfte, trat er ans Küchenfenster, das zum Bauhof hinausging. Dort stand er regungslos dem aufziehenden Morgen zugewandt, und wäre er nicht so dominierend in seinem ganzen Erscheinungsbild gewesen, so hätte man ihn in seiner Einsamkeit gesehen.
Die Tasse, die er wenig später aus dem Regal nahm und mit dem starken aromatisch duftenden Kaffee füllte, behielt er gleich in der Hand und nahm sie mit zurück ans Fenster.
Das Fenster lag ein wenig erhöht, und er hatte selbst noch über die Mauer, die Privat- und Geschäftsbereich trennte, einen Blick über das weite Gelände.
Im grauen Licht des Morgens ließ er seine Blicke prüfend über das gelagerte Baumaterial und den Maschinenpark gleiten. Der Hof platzte aus allen Nähten, so daß sie am Wochenende schon Transportmaschinen draußen im Gelände der Sandgrube abstellen mußten.
Richard Bremer war Baustoffhändler und Betreiber einer Sandgrube in der Heide, und die lärmende Geschäftigkeit des Betriebes unter der Woche machte die ungewohnte Stille, die am Sonntag über dem Platz lag, doppelt deutlich und auch unnormal.
Die Transportfahrzeuge, die das Gelände an den Wochentagen unablässig anfuhren, standen heute wie stille graue Riesenelefanten hinter der mannshohen Mauer.
Sonntag hieß für ihn, einen Kontrollgang über das Gelände mit anschließenden Büroarbeiten, zu denen er aus Zeitmangel unter der Woche nicht kam. Hilde Kern, seine Bürokraft, arbeitete ihm zwar gut zu, aber es galt Entscheidungen zu treffen, die er nun mal als Chef der Firma alleinverantwortlich zu vertreten hatte.
Die Firma war seit Jahren sein Leben, und ihr galt sein Denken – das Leben der Leute, die für ihn arbeiteten, eingeschlossen. Er trug gern Verantwortung und stellte sich auch allen damit zusammenhängenden Problemen.
Das Licht stieg stetig, und Richard Bremer stellte die leergetrunkene Tasse in das Abwaschbecken, bevor er durch den Küchenausgang in den Garten hinaustrat. Und während er seine Schritte über den gepflegten Rasen auf das Tor in der Mauer zubewegte, blieb das weiße Wohnhaus wie eine stille Oase hinter ihm zurück, zu still für den familiären Charakter, den es ausstrahlte.
Das kleine Bürogebäude lag gleich hinter der Mauer, und er schloß die Tür auf, um als erstes zu sehen, ob gestern nachmittag während seiner Abwesenheit noch etwas angefallen war, was er wissen mußte.
Auf seinem Schreibtisch lag dann auch neben den von Hilde Kern fein säuberlich zurechtgelegten Arbeiten, die er heute zu erledigen hatte, ein Zettel Hänschen Krümels, auf dem zu lesen stand: Chef, Ottos Laster liegt mit Motorschaden in der Grube, wir müssen für die Fuhren nach Celle am Montag umdisponieren…
Richard Bremer starrte ärgerlich auf den Zettel. Damit fielen morgen zwei Lkw aus, und sie würden für die Belieferung der Großbaustelle in Schwierigkeiten kommen. Am besten, er sah sich den liegengebliebenen Kipper draußen im Gelände erst einmal selbst an, bevor er in die Werkstatt abgeschleppt wurde.
Als Richard Bremer schließlich von der Landstraße in das offene Heidegelände abbog, begann der private Transportweg, den er hatte anlegen lassen, damit die mit Sand schwerbeladenen Wagen, die aus der Grube heraufkamen, unbeschadet ihren Weg nehmen konnten.
Auf dieser schmalen befestigten Zufahrt fuhr er bis dicht an die Schräge heran, die in einem sanften Bogen in die Grube hinabführte. Dann hielt er an.
Ein prüfender Blick glitt aus der Höhe über das weite Abbaugebiet, bevor er sich auf den Weg machte, um sich den Laster unterhalb der Auffahrt anzusehen. Er hatte sein Leben lang mit Maschinen zu tun gehabt und kannte sich aus. Aufmerksam betrachtete er gleich darauf das Innenleben des grauen Riesen, überprüfte alle Leitungen und Anschlüsse – fand aber nicht den Fehler. Ärgerlich verschloß er schließlich wieder das Fahrzeug und begab sich auf seinen Inspektionsgang zu den Fördermaschinen.
Der Abbau des Sandvorkommens erfolgte zur Zeit am entgegengesetzten Ende der Grube, dort wo der mächtige Bagger unterhalb der steil abgebrochenen Wand stand. Und da er einmal hier war, führte ihn sein Weg zu einem Kontrollgang durch die ganze Weite des Gebiets.
Als er den mächtigen stählernen Koloß endlich erreichte, ging er um ihn herum, die Augen prüfend auf Zustand und Technik gerichtet. Und da ein Blick von unten oft mehr zeigte, als die stählerne Verkleidung von oben erkennen ließ, stützte er ein Knie auf den Boden, um einen Blick unter das Fahrzeug zu werfen.
All das geschah automatisch, und während er den Kopf bis nahe zum Boden hinabbeugte, eine Hand am Fahrzeug, die andere auf der Erde, erstarrte er augenblicklich in dieser Haltung, als hielte ihn ein unglaubliches Entsetzen für alle Zeiten in dieser Stellung fest.
Richard Bremer schloß sekundenlang die Augen, von schmerzvollen Bildern heimgesucht, und diese ließen ihn einen Moment auch an eine Täuschung der Sinne glauben, so sehr glichen sich die Bilder.
Das Kindergesicht aber, blutüberströmt und still gegen die Kettenkufen des Fahrzeugs gelehnt, war real, wie auch Erinnerungen real sein können, wenn sie einen nie mehr verließen. Bis er klar denken konnte, vergingen Augenblicke, die gleich einem furchtbaren Alptraum sein Innerstes auseinanderzureißen schienen.
Wie ein rasch ablaufender Film tauchte wieder jener Morgen vor seinem geistigen Auge auf, als er seinen kleinen Sohn so gesehen hatte – blutend, die blonden Haare verklebt, leblos.
Der Mann Richard Bremer schien im Moment zweigeteilt. Und während der eine Teil in ihm unter diesem furchtbaren Schock stand, funktionierte der andere wie eine seiner Maschinen.
So streckte er sich automatisch lang auf dem Boden aus und schob sich unter den Bagger, mühsam vorwärtsrutschend in dem flachen Spielraum zwischen Erdboden und Fahrzeug.
Als seine Hände nach dem Kleinen griffen, registrierte er lediglich, daß er zwischen den Ketten frei lag, denn noch beherrschte ihn die schreckliche Annahme, daß das Kind unter das laufende Fahrzeug geraten sein könne und sich seine Verletzungen von daher zugezogen hatte.
Und während er eine Hand vorsichtig unter den Kopf des Jungen schob und mit der anderen den kleinen Körper umfaßte, bewegte er sich langsam zurück.
Das Wasser rann ihm von der Stirn, als er ihn im grauen Licht des Morgens endlich frei hatte und nun schwer atmend in das stille Kindergesicht blickte, das so blaß und fern und ohne jede Hoffnung sich seinen Augen darbot. Seine großen Hände zitterten, als er nach der Halsschlagader tastete, und nur mühsam fühlte er das flatternde Leben, das noch in dem Kleinen zu stecken schien.
Richard Bremer zog seine Jacke aus und breitete sie auf dem Boden aus. Dann hob er vorsichtig das Kind darauf und wickelte es darin ein, so daß nur noch das helle Gesichtchen mit den verkrusteten Blutspuren hervorschaute. Darin hob er das leichte Bündelchen hoch und trug es auf seinen Armen durch den weiten Grund der Sandgrube.
Jeder seiner weit ausholenden Schritte war bemüht, die vorwärtsdrängende Eile ohne Erschütterungen für den kleinen zerschundenen Körper zu vollziehen.
Alles schien sich zu wiederholen, was er vor Jahren erlebt und erlitten und nie verwunden hatte. Dieses verletzte Kind, ihm fremd und unverständlich an seinem Fundort, machte deutlich, daß es Dinge gab, die man nie bewältigte.
Genauso hatte er damals seinen Sohn getragen, befreit aus einem völlig zertrümmerten Wagen, den seine Frau gefahren hatte. Er merkte, wie ihn die alte Panik überkam, so sehr glichen sich die Bilder. Seine Schritte waren schneller geworden, und er nahm die Schräge atemlos, bis er den oberen Rand der Grube erreichte und das Kind schwer atmend auf den Rücksitz des Landrovers legte.
Das kleine Gesicht war still. Herrgott, zu still, und der mächtige hochgewachsene Mann, der nie hilflos wirkte, fuhr sich nun fassungslos über das Gesicht, so, als könnten die großen Hände etwas fortwischen, was nicht fortzuwischen war. Dann zwang er sich zur Ruhe und setzte sich ans Steuer seines Wagens.
Der Tag, leer begonnen, hatte sich auf schreckliche Weise gefüllt.
*
Die Kinderklinik Birkenhain lag in jenem stillen sonntäglichen Morgenlicht, das alles friedlich stimmte und mit dem Hauch der Verzauberung umgab, der alten Schlössern eigen ist. Aber dieses Heideschlößchen, umgeben von Birken und stiller Natur, beherbergte schon lange nicht mehr das adlige familiäre Glück, sondern bot sich nach einem Umbau als Kinderklinik dar mit gutem Ruf.
Das Örtchen Ögela in der Lüneburger Heide diente als Bezugspunkt, wollte man die Klinik im Schloß finden, um dort Hilfe und Hoffnung zu suchen.
Der Mann, dessen Wagen nun vor dem stillen Birkenschlößchen anhielt, verharrte einen Moment, als sei es für ihn unzumutbar, dieses Haus noch einmal zu betreten. Der Erinnerungsschmerz drückte ihn zu Boden, nachdem er jahrelang den Anblick dieser Kinderklinik gemieden hatte, obwohl man hier damals alles getan hatte, um das Leben seines Sohnes zu retten.
Der persönliche Schmerz dieser frühen Morgenstunde aber wurde zwingend durch dieses fremde Kind verdrängt, das dringend Hilfe brauchte. Und wie ein Hilfesuchender die Hoffnung in sich trägt, so trug Richard Bremer jetzt den kleinen Jungen in großer Eile in das noch stille Haus.
»Rufen Sie mir sofort Dr. Martens!« verlangte er mit rauher befehlender Stimme und nahm die diensthabende Klinikangestellte an der Aufnahme doch kaum wahr.
»Ein Unfall?« fragte sie automatisch und sah auf den hochgewachsenen blonden Mann, der ein Kind auf den Armen trug, dessen Gesichtchen keinerlei Regung zeigte.
»Stellen Sie keine überflüssigen Fragen – beeilen Sie sich!«
Schwester Laurie, deren Nachtdienst in der Aufnahme in wenigen Minuten zu Ende ging, zuckte zusammen, sagte aber nichts mehr, sondern drückte den Knopf mit dem Notruf.
Unmittelbar darauf setzte die rennende Bewegung ein, die so eingespielt war wie das tickende Räderwerk einer Uhr, welches die verrinnenden Sekunden in ihrer Entscheidung über Leben und Tod deutlich machten.
»Ich bin Dr. Mettner, diensthabender Arzt – sind Sie der Vater?« Der große schlanke Arzt stellte die Frage, die im Moment wichtiger war, als der Name, wenn es um die sofortige Zustimmung zu lebenserhaltenden Behandlungen ging. Gleichzeitig half er dem Pfleger, das Kind auf die eilig herangefahrene Liege zu betten.
Richard Bremer, den diese Frage vor Jahren schon einmal getroffen hatte, fühlte die Anspannung wachsen, während er auf das blonde Kind schaute, im hellen Licht der Aufnahme schrecklich anzusehen.
Er schüttelte mühsam den Kopf. »Ich habe ihn gefunden.«
»Gut – warten Sie hier!« Dr. Mettner folgte dem Pfleger, der sich anschickte, das Kind in das Untersuchungszimmer zu fahren.
»Ich werde hier nicht warten!« Richard Bremers Stimme war von der Autorität, die der ganze Mann ausstrahlte, und er folgte dem Kind, als sei er für alles, was mit ihm geschah, verantwortlich.
»Aber Herr…?« Der dienstbereite Arzt sah ihn erstaunt an.
»Bremer.«
»Herr Bremer, es ist nicht üblich, daß…«
»Das interessiert mich nicht, Doktor! Rufen Sie sofort den Chefarzt!«
»Liegt Ihnen nun das Kind am Herzen – oder wollen wir für die Erste Hilfe erst über kompetente Leute reden?« Dr. Mettner, nun ärgerlich, beugte sich über das Kind, um Herz- und Kreislauftätigkeit zu überprüfen.
»Sie können mir glauben, ich fordere schon die Fachkollegen auf, hier zu erscheinen, wenn es nötig sein sollte!«
Richard Bremer maß den Arzt mit Blicken, die dieser nur schwer verstehen konnte. »Ich fordere Sie zum letztenmal auf, Dr. Martens herbeizubeordern!«
Das Stethoskop lag auf der freien Brust des Kindes, wanderte von Punkt zu Punkt, bevor der Arzt mit mühsamer Höflichkeit sagte: »Ich hoffe, Sie gestatten mir wenigstens, dem Kleinen zuvor noch eine kreislaufstärkende Injektion zu geben?«
Richard Bremer wischte sich mit der großen Hand über die Augen. Es war ihm egal, welchen Eindruck er auf diesen Arzt machte, er wollte das Schicksal wenigstens diesmal bezwungen sehen, indem dieses fremde Kind sein Leben weiterleben durfte.
Als Dr. Martens, leitender Arzt und Chirurg dieses Hauses, wenig später erschien, erkannte er Richard Bremer sofort und verstand ohne viel Worte, worum es diesem Mann ging.
»Ausgerechnet Sie finden wieder so ein Kind – wie sich die Bilder gleichen«, sagte er und reichte dem Baustoffhändler die Hand.
Dann wandte er sich dem Jungen zu, der nun ausgezogen dalag. »Der Kopf sieht schlimm aus«, murmelte es, als seine Hände ihn abtasteten. Er sah Dr. Mettner an. »Wir müssen zuerst röntgen, veranlassen Sie das bitte. Eine Schädelfraktur ist nicht auszuschließen.«
Und während das Kind hinausgerollt wurde, nahm der Arzt Richard Bremer beim Arm. »Kommen Sie«, sagte er, als dieser zögerte, »Sie wissen, daß hier alles getan wird.«
Mit knappen Worten schilderte Richard Bremer, wo und wie er das Kind gefunden hatte, und Dr. Martens hörte ihm aufmerksam zu.
»Die Verletzungen sehen nicht so aus, als seien sie durch das Kettenfahrzeug erfolgt«, meinte der Arzt. »Wenn er unter das laufende Fördergerät geraten wäre – nun ja, Sie wissen selbst, was von ihm dann noch übriggeblieben wäre…«
Richard Bremer biß die Zähne aufeinander, und die Haut spannte über den Wangenknochen. »Es ist wie ein Alptraum«, murmelte er, »es ist wie ein schrecklicher Alptraum.«
»Sie haben keine Ahnung, wer das Kind ist?« holte Dr. Martens ihn wieder in die Wirklichkeit zurück.
Richard Bremer schüttelte den Kopf.
»Das Kind muß Stunden dort gelegen haben – irgend jemand muß es doch vermißt haben!« Der Arzt erhob sich. »Ich werde gleich mal die Polizei anrufen.«
Wenig später erfuhr der leitende Arzt der Kinderklinik Birkenhain, daß es sich bei dem Jungen um den kleinen Daniel Honert handeln könnte, der seit gestern nachmittag vermißt wurde. Angeblich hatte die Polizei bereits in den späten Abendstunden im Krankenhaus nach einer eventuellen Einlieferung des Kindes nachgefragt.
Und wie Dr. Martens kurz darauf in der Telefonie erfuhr, lag die Meldung tatsächlich vor.
»Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten, Herr Bremer?« fragte nun der Arzt und ahnte, wie diesem Mann zumute war.
Richard Bremer schüttelte den Kopf. »Machen Sie sich keine Sorgen um mich, Doktor, tun Sie aber bitte alles für den Jungen – egal, was es kostet.« Er wandte sich zur Tür. »Wo muß ich meine Aussage machen?«
»Ich denke, die Polizei wird bald hier sein.« Der Arzt reichte dem Mann die Hand. »Mich entschuldigen Sie jetzt bitte, ich werde mir die Röntgenergebnisse einmal ansehen.«
Richard Bremer nickte und verließ zusammen mit dem Chefarzt den Raum. »Ich werde draußen warten«, sagte er und ging dann mit schweren Schritten über den Flur zurück ins Freie.
Draußen lehnte er an seinem Geländewagen und rauchte eine Zigarette. Wie schnell sich ein Tag verändern konnte! Gleich würde die Polizei hier sein und sicherlich auch die vor Sorge aufgelösten Eltern des Kindes…
Und die Beamten kamen, erleichtert nun, daß das vermißte Kind gefunden war und sie die Suche abbrechen konnten. Durch sie erfuhr Richard Bremer dann auch, daß es da keine erreichbaren Eltern gab, sondern lediglich eine herzkranke Großmutter, welche in den Morgenstunden infolge der Aufregung einen Herzanfall erlitten hatte.
Zusammen mit den Polizeibeamten fuhr er dann in die Sandgrube zurück, um zu erkunden, wie das Kind unter den Bagger geraten sein könne. Der Bericht über die Untersuchung des Falls mußte geschrieben werden, und der Sachverhalt war sehr schnell ermittelt, denn bereits auf den Findlingen fanden sich Blutspuren und weiter oben die Abbruchstelle am Hang.
»Schrecklich, sich auszumalen, was geschehen wäre, wenn der Fahrer des Baggers sich morgen früh nichtsahnend auf die Maschine gesetzt hätte, um seiner Arbeit nachzugehen…«, sagte einer der Beamten und sah dem Betreiber der Sandgrube in das starre Gesicht. »Der Himmel muß Sie geschickt haben, Herr Bremer!«
»Ich hoffe, der Himmel hat auch ein Einsehen und läßt nicht alles umsonst gewesen sein…« Richard Bremer wandte sich ab.
Wenig später saß er in seinem Büro, wie an jedem Sonntag, aber seine Hände griffen ziellos nach den Geschäftspapieren. Wie unwichtig das alles war, wie unwichtig! Ein Kind rang mit dem Tod, eine herzkranke Großmutter war in den Nachtstunden durch die Hölle gegangen – und eine ledige Mutter war in New York ohne die geringste Ahnung von dem, was geschehen war! All das wußte er von den Polizeibeamten.
Eine Stunde später war er wieder in der Klinik. Trauma, Pflicht und eine Art übernommener Verantwortung trieben ihn wieder her und ließen ihn stundenlang ausharren, bis Dr. Martens die Operation beendet hatte.
Frau Dr. Hanna Martens, die Schwester des Chirurgen und zweite verantwortliche Leiterin der Kinderklinik, setzte sich eine Weile zu dem einsam ausharrenden Mann. Auch sie kannte seine Geschichte, die ihn vor Jahren zum unglücklichsten Mann weit und breit gemacht hatte.
»Wird er durchkommen, Frau Doktor?« fragte er mühsam und blickte der blonden Ärztin für Kinderheilkunde in das freundliche Gesicht, das beruhigend auf ihn wirken sollte.
»Das Röntgenbild zeigt eine Schädeldachfraktur, Herr Bremer, und wenn keine Komplikationen besonderer Art auftreten, so bekommt mein Bruder das wieder hin…«
»Ein Schädelbruch also?« Der Mann fuhr sich mit den Händen über das Gesicht.
Sie nickte.
»Der Kleine hat viele Stunden dort gelegen, wie sehr vermindert das seine Chancen?« Er atmete schwer.
»Ja, das ist ein Problem, aber wenn keine inneren Blutungen aufgetreten sind, so besteht durchaus Hoffnung, daß er es schafft.«
Richard Bremer sprang auf. Auch diese Worte hatte er vor Jahren schon einmal gehört. Erregt lief er auf und ab.
Die Blicke Hanna Martens folgten ihm eine Weile. Ein Mann wie ein Baum, dachte sie, groß und athletisch mit einer unbesiegbaren Kraftausstrahlung – und doch so empfindsam, wie sie es selten erlebt hatte.
»Ich werde künftig nur noch in Terrassenform abtragen lassen«, sagte er mehr zu sich, »der steile Abbruch ist dem Kind zum Verhängnis geworden.«
»Aber, Herr Bremer, das Gelände ist durch Warnschilder kenntlich gemacht, und deshalb müssen Sie sich keine Vorwürfe machen.«
Er blieb mit einem Ruck stehen und sah der Ärztin in das hübsche Gesicht. »Man ist immer verantwortlich, Frau Doktor, daraus entläßt einen weder ein Warnschild noch das dadurch beruhigte Gewissen.«
Als in diesem Moment ihr Bruder den Raum betrat, atmete sie auf, denn das Gesicht des Chirurgen wirkte nicht unzufrieden.
»Herr Bremer, ich denke, er könnte es schaffen…«, sagte Dr. Kay Martens und sah dem Mann in das verzweifelt angespannte Gesicht, bevor er auch seiner Schwester einen Blick zuwarf.
»Kann ich ihn sehen?« fragte Richard Bremer und atmete tief.
Der Arzt schüttelte den Kopf. »Der Kleine ist noch in der Obhut unserer Anästhesistin Frau Dr. Dirksen. Ich denke, daß Sie morgen einen Blick auf ihn werfen können.«
Richard Bremer nickte. »Wenn etwas sein sollte, Sie erreichen mich zu Hause«, sagte er und reichte dann dem Arzt die Hand. »Danke, Doktor«, sagte er tief bewegt und verließ dann die Klinik.
Die zurückgebliebenen Geschwister sahen sich an.
»Ich finde, das durfte das Schicksal nicht zulassen, daß ausgerechnet er das Kind fand und nicht ein anderer«, bemerkte Hanna Martens.
»Wer weiß!« gab ihr Bruder zu bedenken. »Vielleicht hilft ihm dieses Kind, mit dem eigenen Schicksalsschlag fertig zu werden, denn sicherlich sind heute zeitweise bei ihm beide Fälle zu einem verschmolzen…«