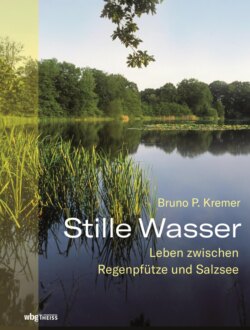Читать книгу Stille Wasser - Бруно П. Кремер - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 Ein ganz erstaunlicher Naturstoff
ОглавлениеWasser ist der Urgrund aller Dinge.
Thales von Milet (625 bis 547 v. Chr.)
Bis weit in das 19. Jahrhundert waren Gewässer und damit auch Seen überhaupt kein besonderer Gegenstand irgendeines wissenschaftlichen Interesses. Die reinen Naturwissenschaften hatten sich eben noch nicht genügend aus der engen – und in der Nachbetrachtung erdrückenden – Umklammerung durch die Geisteswissenschaften und insbesondere der Theologie gelöst. Man nutzte die Binnengewässer ebenso wie die Meere natürlich schon lange als Verkehrswege und für den Fischfang, aber an eine weitere Beschäftigung mit diesen wichtigen Komponenten unserer Welt dachte noch niemand. Doch immerhin: Schon etwa gegen Ende des 17. Jahrhunderts befasste man sich zumindest mit dem faszinierenden Naturstoff Wasser. Mit der jetzt beginnenden „skeptischen Chemie“ des irischen Physikers Robert Boyle (1627–1691) setzte sich allmählich die Erkenntnis durch, dass die aus der Antike sicherlich ziemlich gutgläubig übernommenen und nicht weiter hinterfragten Elementlehren bestenfalls die beobachtbaren Eigenschaften der betrachteten Stoffe, aber nicht deren Natur selbst zutreffend beschreiben. Seither geriet auch die vordem überwiegend mythische Sicht des Leben spendenden und erhaltenden Stoffs immer mehr in den Hintergrund: Jetzt wurde das Wasser zunehmend zu einer eher technisch-wissenschaftlichen Kategorie. Das klingt zwar ein wenig nach Entzauberung, aber dennoch hat es auch in dieser neuen und spezifischen Sichtweise bis heute nichts von seiner besonderen Faszination verloren. Zweifellos gilt auch hier uneingeschränkt die schon in der Antike formulierte Einsicht: „In allem, was die Natur hervorbringt, liegt etwas Bewundernswertes“ (Aristoteles, 384 – 322 v. Chr.).
2.1 Wasser begegnet uns auf der Erde als einziger Naturstoff in seinen gänzlich verschiedenen Erscheinungsformen zwischen gasförmig und als Festsubstanz Eis
Alle nachfolgend dargestellten und vielleicht eher als thematische Eskapade angesehenen physiko-chemischen Sachverhalte haben für die ökologischen Eigenarten von (Binnen-) Gewässern und für die Lebewesen darin unmittelbare Konsequenzen, von denen sie total abhängig sind. Allerdings hat die Evolution sie in absolut bewundernswerter Weise an diese Vorbedingungen ihrer Lebensräume geradezu optimal angepasst. Nichts, aber auch wirklich gar nichts erscheint in diesem Kontext zufällig. Die immer wieder beeindruckende Übereinstimmung von äußeren (physiko-chemischen) Vorgaben und daran angepassten Organismen darf man durchaus als ein geradezu unglaubliches und keineswegs selbstverständliches Wunder unseres blauen (weil eben überwiegend) wässrigen Planeten begreifen. Die Natur lässt uns, wenn man nur genau genug mit „wissendem Auge“ hinschaut, eben in vieler Hinsicht staunen – und diesen Primäreindruck muss man sich tatsächlich immer wieder einmal gönnen. Dagegen verblasst aber wirklich jede noch so reißerisch aufgemachte TV-Produktion zum Megaflop – die grandiose Originalerfahrung, draußen aktiv dabei zu sein, zu sehen, zu erleben und zu verstehen, ist einfach durch nichts zu toppen.
2.2 Stillgewässer bieten enorm unterschiedlichen und erstaunlich angepassten Organismengruppen einen zusagenden Lebensraum. Dazu gehören die seltsamen Wasserfarne der Gattung Salvinia ebenso …
Wasser war immer dabei
In fast allen Hochkulturen bestehen besondere Mythen zur Entstehung unserer erlebbaren und in großen Teilen eben auch wässrigen Umwelt. Bezeichnenderweise unterscheiden die weitaus meisten den Ursprung der Erde nicht vom Anfang des Universums, denn dieses gigantische Umfeld war einfach noch nicht erkannt bzw. vorstellbar. Auch der biblische Schöpfungsbericht (Genesis 1,1; Altes Testament) beginnt ausdrücklich erst bei der Erschaffung bzw. Einrichtung der (bewohnbaren) Erde. Das Wasser spielt darin eine besondere Rolle. Möchte man aber vor den Anbeginn unseres heute für viele Menschen recht komfortabel für die Alltagsbedürfnisse hergerichteten Heimatplaneten zurückblicken, ist die scheinbare Ewigkeit seiner bisherigen Geschichte noch um ein Beträchtliches zu erweitern: Der eigentliche stoffliche Beginn setzt eben nicht erst mit der Formung des Himmelskörpers Erde aus flüchtiger solarer Materie vor rund 4,7 Mrd. Jahren ein, sondern mindestens vor dem Drei- bis Vierfachen dieses Zeitraums. Der Anfang der Erde und die Begründung unserer eigenen Existenz ist somit zwar aus menschlicher Sicht ein zentrales Ereignis, aber aus kosmischer Perspektive ein beinahe vernachlässigbares Randgeschehen.
Für den Absolutbeginn bietet die seit mehreren Jahrzehnten mit zunehmender Intensität diskutierte Theorie vom heißen Anfang des Universums im sogenannten Urknall („Big Bang“) das wissenschaftlich am weitesten ausgereifte, zudem in sich am ehesten widerspruchsfreie und heute weithin akzeptierte Konzept. Es erklärt außerdem plausibel, warum das Weltall sich bis heute real beobachtbar nach allen Richtungen immer noch ausdehnt und warum es überhaupt beträchtliche Mengen Wasser enthält. „Das Universum ist nass“, formulierte unlängst der britische Wissenschaftsjournalist Philip Ball.
2.3 … wie die wegen ihrer Entwicklungseigenheiten auf aquatische Biotope zwingend angewiesenen Libellen
Am Anfang stand der Wasserstoff
Die Theorie vom ultraheißen Start des Universums mit der Singularität, wie man das kaum vorstellbare Einheitsgemisch von Materie, Strahlung (Energie) und Zeit in der modernen Kosmologie nennt, erklärt unter anderem ebenso eindrucksvoll wie widerspruchsfrei, warum der Wasserstoff – ohne Berücksichtigung der kalten dunklen Materie (cold dark matter, CDM) – mit rund 75 % Gewichtsanteil das mit großem Abstand häufigste Element im Weltall ist. Zweithäufigstes Element ist mit knapp 25 % das aus besonderen Gründen bemerkenswert reaktionsträge Edelgas Helium. Aus Wasserstoff-Helium-Gemischen mit ungefähr dieser Zusammensetzung bestehen (immer noch) die weitaus meisten leuchtenden Sterne und auch die interstellaren Gaswolken. Berücksichtigt man innerhalb der bekannten Materie die Gesamtzahl der vorhandenen Atome, dann beträgt der Anteil des Wasserstoffs erstaunlicherweise sogar 93 %. Dritthäufigstes Element mit einem Gewichtsanteil von etwa 0,01 % ist Wasserstoff in Form seines schweren Isotops Deuterium 2H (S. 28). Dann erst folgen die übrigen (stabilen) Elemente des Periodensystems in durchaus weitem Abstand.
2.4 Überall ist hier Wasserstoff als unentbehrliche Komponente beteiligt. Man sieht ihn zwar nicht, aber seine Präsenz ist völlig unentbehrlich
2.5 Die talwärts gleitenden Eismassen von Gletschern verdanken ihre Formen nur den besonderen Eigenschaften des Naturstoffes Wasser
Die explosive Ausdehnung des anfänglichen Plasmas aus Strahlung und Teilchen unmittelbar nach der Singularität (Urknall) erfolgte so überaus rasch, dass die Zeit zum Direktaufbau schwerer Atomkerne einfach nicht ausreichte. Außer den Atomkernen von Wasserstoff und Helium entstanden daher relativ bald nach der Singularität – allerdings lediglich in Spuren – überwiegend nur die Kerne der relativ leichten Elemente Lithium, Beryllium und Bor. Lithium ist somit das vierthäufigste Element, aber tatsächlich nur mit knapp 0,000.000 1 % an der kosmischen Materie beteiligt. Im Gesamtmaßstab des Universums sind alle übrigen Elemente um viele Größenordnungen geringer vertreten und somit eigentlich Spurenstoffe oder – in der Diktion der Chemiker – eigentlich Verunreinigungen. Sie formten sich zudem erst wesentlich später in den Reaktionskaskaden thermonuklearer Verschmelzungs- und Umwandlungsprozesse im Inneren der Sterne, nachdem diese sich aus abgekühlten Gaswolken zusammengeballt hatten. Äußerst bedeutsame Elementschmieden sind auch die gigantischen Explosionen, die bei den meisten Normalsternen vom Typ unserer Sonne zum üblichen Ablauf ihrer regulären Betriebsdauer gehören. Von der Erde aus sind derartige Ereignisse beobachtbar: Plötzlich flammt in einem ansonsten gut untersuchten Gebiet unserer Milchstraße ein neues und meist recht helles Sternenlicht auf. Je nach Ausmaß nennt man eine solche Neuerscheinung Nova oder Supernova. Der Stern von Bethlehem, wenngleich oft als Komet mit Schweif dargestellt oder als besondere Planetenkonstellation gedeutet, könnte eventuell eine solche auffällige Nova am damaligen Sternenhimmel gewesen sein.
Die große Mehrheit der Elemente, die sich heute als die 90 Bausteine des ebenso berühmten wie beeindruckenden Periodensystems (PSE) von Platz 1 (= Ordnungszahl; Wasserstoff H) bis Platz 92 (= Ordnungszahl; Uran U) präsentieren, ist im Grunde genommen lediglich eine Art stellare Verunreinigung, auch wenn wir gerade diesen Stäuben und Stäubchen letztlich unsere landschaftlich so vielfältige Erde und sogar uns selbst zu verdanken haben. Trotz des gewaltig erscheinenden Festkörpers Erde mit einer Masse von immerhin rund 6 × 1021 t bei einer Dichte von 5,52 t/m muss man sich jedoch unbedingt vor Augen halten, dass es im kosmischen Maßstab fast keine schweren Elemente gibt: Über 99 % der bekannten Materie sind tatsächlich nur Wasserstoff H und Helium He.
2.6 Wasser ist nicht nur in seinen verschiedenen Zustandsformen ein spannender Naturstoff, sondern auch in seinen molekularen und atomaren Details. Die Entdeckung der Komponenten war schwierig
Wasserbaustein Wasserstoff
Wasserstoff war schon den Alchimisten des Mittelalters als „brennbare Luft“ bekannt, die bei der Einwirkung von verdünnter Mineralsäure (z.B. Schwefelsäure, H2SO4) auf unedle Metalle nach der damals jedoch so noch nicht bekannten einfachen Reaktionsgleichung:
Fe + H2SO44 → H2 + Fe2+ + SO42– entsteht. Mit Eisen (Fe) oder Zink (Zn) stellte auch der berühmte Robert Boyle (1627–1691) den für seine Experimente benötigten Wasserstoff her, den er jedoch noch nicht als chemisches Element im modernen Sinne verstand. Paracelsus (S. 18) beschrieb sogar schon die Explosion von Wasserstoff-Luft-Gemischen – dieser Effekt ist unter Chemikern bis heute als Knallgas-Reaktion wegen ihrer außerordentlichen Heftigkeit zu Recht gefürchtet. Erst der bemerkenswert begüterte englische Naturforscher Henry Cavendish (1731–1810) erkannte bereits im Jahr 1766 in seinem Privatlabor in London als Erster den Wasserstoff als chemisches Element. Das bis heute dafür verwendete chemische Symbol H schlug indessen der schwedische Chemiker Jöns Jakob Berzelius (1779–1848) erst im Jahr 1814 vor. Er wählte damit übrigens als gänzlich neues und unmissverständliches Symbol einfach den großgeschriebenen Anfangsbuchstaben vom lateinischen bzw. griechischen Namen des betreffenden Elements, also H von hydrogenium für Wasserstoff.
Unter irdischen Normalbedingungen kommt Wasserstoff immer nur gasförmig vor und zwar nicht einatomig als H-Atom, sondern zweiatomig-molekular als H2-Verbindung. Im Inneren der großen sonnenfernen Gasplaneten liegt er dagegen als festes, schwärzliches Halbmetall vor, im Mantel des überaus massereichen und riesigen Jupiters jedoch erst ab einer Tiefe von etwa 14.000 km. Auf der Erde gewonnene experimentelle Daten lassen vermuten, dass dazu ein Druck von etwa 2,5 Mio. at (250 GPa) nötig ist. Die zwar theoretisch vorausgesagte vollmetallische Hochdruckform von einatomigem Wasserstoff (H) ist experimentell bislang noch nicht bestätigt worden.
Der farblose und völlig geruchsfreie Wasserstoff ist außerordentlich reaktionsfreudig und verbindet sich bereitwillig mit allen anderen Elementen (außer den Edelgasen) des Periodensystems der Elemente. Alle organischen Verbindungen, wie man die Stoffe mit einem Gerüst aus Kohlenstoffatomen nicht so ganz korrekt nennt, enthalten immer auch Wasserstoff. Daher nennt man die Stammverbindungen aller biologisch wichtigen Moleküle bezeichnenderweise Kohlenwasserstoffe oder Hydrocarbone (Alkane), wie beispielsweise Methan CH4, Ethan H3C – CH3 oder Propan H3C–CH2–CH3. Die Beteiligung von Wasserstoff an solchen Stoffen ist sogar so selbstverständlich, dass man ihn in komplexeren Strukturformeln üblicherweise gar nicht mehr eigens einzeichnet.
2.7 Alle in Lebewesen vorkommenden und für deren Stoffwechselbetrieb wichtigen Moleküle kann man als Kohlenwasserstoffverbindungen auffassen. Beispielhaft zeigt dies auch die vergleichsweise komplexe Formel des unglaublich bedeutsamen Blattgrünstoffs Chlorophyll
Einfacher geht es nicht: Das H-Atom
Wie jedes Atom besteht auch das Wasserstoffatom aus einem Atomkern und einer Atomhülle. Beide sind im Fall des Wasserstoffs denkbar einfach aufgebaut: Der Kern des Wasserstoffs enthält als Kernteilchen (Nukleon) nur ein einziges positiv geladenes Proton (p+), während auf seiner Elektronenhülle nur ein negativ geladenes Elektron (e–) kreist. Ein HAtom ist nach außen elektrisch neutral, weil sich die beiden entgegengesetzten Ladungen von Kern und Hülle jeweils genau ausgleichen. Nimmt man dem Wasserstoffatom dagegen sein einziges Hüllenelektron, bleibt nur noch der positiv geladene Wasserstoffkern als Ion übrig. Diesen Atomrest nennt man Proton und verwendet dafür neben dem vor allem in der Physik gebräuchlichen Kürzel p+ im chemischen Kontext eher die Schreibweise H+.
2.8 Robert Boyle
2.9 Henry Cavendish
2.10 Jöns Jakob Berzelius
2.11 Wasserstoff ist zwar einfach, aber nicht ganz einfach: Es gibt verschiedene atomare Bautypen, die man Isotope nennt. Sie unterscheiden sich in der Kombination verschiedener Elementarteilchen
Wegen ihrer ausgeprägten Reaktionsbereitschaft verbinden sich normalerweise zwei Wasserstoffatome (2 H) sofort zum Wasserstoffmolekül H2, weswegen man atomaren (H) und molekularen (H2) Wasserstoff begrifflich strikt unterscheiden muss. Im H2 haben sich die beiden Einzelelektronen eines jeden beteiligten Bindungspartners zu einem die Atome verknüpfenden Elektronenpaar zusammengefunden. Eine solche interatomare Bindung nennt man daher auch Elektronenpaarbindung oder homöopolare Bindung. Sie liegt den meisten biologisch wichtigen Verbindungen zugrunde. In Formelbildern drückt man diesen Sachverhalt durch einen einfachen Bindungsstrich zwischen den verknüpften Atomen aus, wie das Formelbeispiel für eine Kohlenwasserstoffverbindung (Abb. 2.10) zeigt.
Unter den in der Natur vorkommenden Wasserstoffatomen ist ein zwar geringer, aber nicht zu übersehender Anteil von etwa 0,0145 % deutlich schwerer als ein nur aus Proton und Elektron zusammengesetztes H-Atom in der Standardversion. Die genauere Analyse führte bereits im Jahre 1939 zu der damals äußerst überraschenden Erkenntnis, dass es vom Wasserstoff eine seltene natürliche Variante gibt: In deren Atomkern steckt außer dem Proton auch noch ein zweites Kernteilchen, nämlich das 1932 gerade neu entdeckte, um etwa 0,14 % massereichere und vor allem ungeladene Neutron (n). Diese folglich etwas schwereren Wasserstoffatome besetzen im Periodensystem der Elemente (PSE) dennoch den gleichen Platz wie die Atome der Normalversion. Man nennt sie deshalb Isotope (= Gleichgestellte). Als Isotope definiert man also Atome mit gleicher Protonen-, aber unterschiedlicher Neutronenanzahl. Fast alle in der Natur vorkommenden Elemente sind tatsächlich Gemische aus mehreren Isotopen.
Das schwerere Wasserstoffisotop mit zwei Kernteilchen erhielt die Bezeichnung Deuterium und sogar ein eigenes Elementsymbol D, weil es anstelle des gewöhnlichen H auch sogenanntes Schweres Wasser bzw. Schwerwasser D2O bilden kann. Obwohl Deuterium nur einen Bruchteil des normalen irdischen Wasserstoffvorrats ausmacht, ist es im kosmischen Maßstab sogar das zweithäufigste Atom. In einem Gewässer von rund 5000 L Volumen ist etwa 1 L D2O enthalten. In dieser vergleichsweise geringen Konzentration ist es völlig harmlos. Aber ein höherer Anteil wirkt stark wachstumshemmend, und reines D2O lässt aquatische Wirbeltiere (Amphibien, Fische) nach experimentellen Befunden sogar ziemlich rasch absterben. Mikroskopisch kleine Wasserlebewesen ertragen Deuterium dagegen erstaunlicherweise recht gut. Experimentell hat man sogar Mikroorganismen gezüchtet, deren gesamte Körpersubstanz tatsächlich durchweg deuteriert war.
Zur besseren Unterscheidung der beiden Wasserstoffisotope ist manchmal eine erweiterte Schreibweise üblich. Dabei setzt man die Gesamtzahl der vorhandenen Kernteilchen dem Elementsymbol hochgestellt voran. Für den normalen Wasserstoff ergibt sich somit die Schreibung 1H für das schwerere Wasserstoffisotop Deuterium schreibt man entsprechend 2H. Weitere Details zeigt die Tabelle 1.
Der geniale neuseeländische, jedoch überwiegend in Großbritannien forschende Physiker Ernest Rutherford (1871 – 1937; er ist sogar auf neuseeländischen Banknoten abgebildet) entdeckte im Jahre 1934 als weiteres Wasserstoffisotop das Tritium, das in seinem Atomkern ein zweites Neutron führt und demnach den Kernaufbau p+ + n + n aufweist. Entsprechend lautet das entsprechende Komplettsymbol H. Tritium ist allerdings nicht stabil, sondern radioaktiv und wandelt sich beim Zerfall unter Aussendung eines Elektrons zum stabilen Heliumisotop He um. Diese Reaktion ist ein bemerkenswert glücklicher Umstand, denn mit ihrer Hilfe kann man bezeichnenderweise das geologische Alter von Wasser sehr exakt bestimmen. Tritium entsteht nämlich nur in den obersten Schichten der Atmosphäre durch Beschuss von Stickstoffatomen N mit schnell fliegenden Neutronen n aus dem Weltraum nach der folgenden Reaktionsgleichung:
14N + n → 12C + 3H
Es gelangt mit den Niederschlägen zur Erde und wird dann durch Versickerung zum Bestandteil des Grundwassers. Der weltweite Vorrat an natürlichem Tritium, das man gelegentlich auch mit dem eigenen Elementsymbol T wiedergibt, macht etwa 8 kg aus. Seine Halbwertszeit beträgt 12,26 Jahre – nach dieser Zeit ist ziemlich genau die Hälfte der Tritiumatome durch radioaktiven Zerfall wieder verschwunden. Beim Zerstrahlen entsteht ein Heliumkern, weil sich eines der beiden Kernteilchen zum Proton wandelt. Nach rund 25 Jahren ist nur noch ein Viertel der Ausgangsmenge vorhanden, nach 50 Jahren nur noch ein Achtel. Durch Messung des Restgehalts an Tritium etwa einer Quellwasserprobe lässt sich somit ziemlich genau feststellen, ob das Wasser erst kürzlich oder schon vor längerer Zeit in den Untergrund absickerte. Radioaktiv mit dem schweren Isotop Tritium markierte Biomoleküle spiel(t)en bei der Aufklärung von grundlegenden organismischen Stoffwechselreaktionswegen durch Tracer-Techniken eine überragende Rolle.
Sauerstoff und seine Isotope
Bereits den Naturphilosophen der Antike war bekannt, dass zur Verbrennung immer Luft erforderlich ist. Dennoch verstand man das Wesen des Verbrennungsvorgangs bis weit in das 18. Jahrhundert überhaupt nicht. Der bedeutende irische Gelehrte Robert Boyle (1627–1691) entwickelte zwar die im Prinzip korrekte Vorstellung, dass sich brennende Substanzen mit einem Bestandteil der Luft verbinden, doch wurde diese grundsätzlich korrekte Deutung nicht allgemein angenommen, weil die einfache Erfahrung zeigte, dass eine Verbrennung eben immer auf die Zersetzung eines Materials und nicht auf eine neue Verbindung hinauslief. Auf diesen Sachverhalt stützte sich die aus heutiger Sicht reichlich skurril anmutende Phlogistontheorie des deutschen Chemikers Johannes Joachim Becher (1635–1682) und deren Fortentwicklung durch Georg Ernst Stahl (1660–1734), die mit ihren Vorstellungen lange Zeit eine nicht unerhebliche Verwirrung stifteten. Nach dieser seltsamen Theorie enthalten alle brennbaren Stoffe ein nicht weiter fassbares „Phlogiston“, das beim Verbrennen angeblich entweicht. Erst der geniale französische Privatgelehrte Antoine Laurent de Lavoisier (1743–1794) stellte im Jahr 1775 klar, dass jede Verbrennung eine Oxidation mit Sauerstoff ist und ein entweichendes Phlogiston locker verzichtbar ist.
Der Wasserbaustein Sauerstoff wurde zuerst 1771 vom deutsch-schwedischen Chemiker Carl Wilhelm Scheele (1742–1786) in Uppsala entdeckt, als er Braunstein (MnO2) mit konzentrierter Schwefelsäure erhitzte und damit eine Umsetzung wie folgt durchführte:
MnO2 + H2SO4 → Mn + 2 H+ + SO42− + O2
2.12 Für das gemeinsame Reaktionsprodukt von Wasserstoff und Sauerstoff verwendet man verschiedene Darstellungen
Wenig später wurde dieses Element unabhängig davon allerdings noch einmal entdeckt: Im Jahre 1744 erläuterte der britische Hobbychemiker und Theologe Joseph Priestley (1733–1804) aus Leeds vor der Königlichen Akademie in London seine erstmalige Darstellung von Sauerstoff: Bei der thermischen Zersetzung von Quecksilberoxid HgO nach der folgenden Gleichung konnte er ein Gas auffangen, in dem eine Kerze anschließend viel heller brannte als in gewöhnlicher Luft:
2 HgO → 2 Hg + O2
Irrigerweise nahm man in den Folgejahren an, dieses neu entdeckte Element mache auch das Wesen von Säuren aus, und von daher stammt die eigenartige Bezeichnung Sauerstoff. Den Elementcharakter erkannte erstmals Antoine Laurent de Lavoisier, von dem auch die Bezeichnung oxygène (von oxygenium = Säurebildner, Sauerstoff) stammt. Jöns Jakob Berzelius (1779–1848) führte 1814 das davon abgeleitete Elementsymbol O ein.
Sauerstoff ist unterhalb von – 218,8 °C ein Feststoff aus hellblauen Kristallen. Auch flüssiger Sauerstoff ist leicht bläulich. Sein Siedepunkt liegt bei − 183 °C. Unter Normaldruck wiegt 1 L Sauerstoff 1,4 g. Abgesehen von den Edelgasen verbinden sich alle Elemente des Periodensystems recht bereitwillig mit diesem reaktionsfreudigen Element. Sofern dieser Verbindungsvorgang ziemlich rasch und mit Wärme- sowie Lichterscheinungen abläuft, spricht man von Verbrennung. Während Luft fast kein Wasserstoffgas enthält (es entsteht nur in den höheren Schichten der Atmosphäre aus der Wasserdampfzersetzung durch UV-Strahlung), ist molekularer Sauerstoff (O2) in der Lufthülle mit 20,93 % Volumenbzw. 23,1 % Gewichtsanteil vertreten. Der heute in der unteren Erdatmosphäre enthaltene Sauerstoff ist das ausschließliche Ergebnis der Photosynthese phototropher Bakterien, Algen und Landpflanzen – diese Lebewesen haben die anfänglich reduzierende Atmosphäre in eine oxidierende umgebaut. Sauerstoff ist zwar nur das fünfthäufigste Element des Weltalls, aber mit einem Anteil von 49,4 % das häufigste der Erdkruste. Hier liegt er überwiegend gebunden in Gestalt der Carbonat- und Silicatgesteine vor. Dem Oxid des Wasserstoffs, eben der Verbindung H2O, verdankt die Erde ihre einzigartige Hydrosphäre und damit den Leben spendenden Wasserkreislauf in der Biosphäre.
Auch vom Sauerstoff sind mehrere natürliche Isotope bekannt. Häufigstes ist mit 99,76 % das Isotop 16O (Atomkern: 8 n + 8 p+). Die Isotope 17O (0,04 %, Atomkern: 9 n + 8 p+) sowie 18O (0,2 %, Atomkern: 10 n + 8 p+) sind stabil, die Isotope 13O, 14O, 15O, 19O und 20O dagegen kurzlebige Strahler, deren Halbwertszeit im Bereich nur von Sekunden liegt. Unter anderem wurde am Sauerstoffatom entdeckt, dass die Atommassen der höheren Ränge im Periodensystem keine ganzzahligen Vielfachen der anfangs mit dem Zahlenwert 1 festgesetzten Atommasse von Wasserstoff sind, sondern immer ein wenig leichter ausfallen, als sie eigentlich sein sollten. Das liegt einerseits an der Isotopie (Mischung von Atomen mit unterschiedlicher Kernteilchenzahl und daher verschiedenen Ausgangsmassen), andererseits auch daran, dass bei der Zusammenballung der Elementarteilchen zum Atomkern ein ungeheurer Energiebetrag benötigt wird. Diese Energie (E) entspricht der fehlenden Masse (m). Das Massendefizit berechnet sich nach der berühmten Einsteinschen Formel E = mc2. Diese Energie lässt sich bei Zerlegung eines Atomkerns (Kernspaltung) auch wieder freisetzen. Heute verwendet man als Bezugsbasis für die relativen Atommassen der Elemente übrigens nicht mehr den Wasserstoff. Seit 1885 diente dazu zeitweilig das Sauerstoffatom. Mit der Entdeckung der Isotopie entwickelten sich zwei verschiedene Atommassenskalen: Die Chemiker verwendeten die mittlere Isotopenmassen des Sauerstoffs in seiner natürlichen Häufigkeit (16O : 17O : 18O = 506 : 0,204 : 1), die Physiker dagegen das Isotop 16O. Erst 1960 einigte man sich auf das Kohlenstoffisotop 12C als gemeinsame Bezugsbasis der atomaren Masseneinheit.
Tab. 1 Relative Häufigkeit der wichtigsten Wassermolekülarten
| H216O | 100.000 |
| H218O | 204 |
| H217O | 37 |
| D216O | 15 |
Unter Berücksichtigung der verschiedenen Isotope von Wasserstoff und Sauerstoff kommen in der Natur vom Wasser mehr verschiedene Molekülarten des Wassers vor, als es die populäre Formel H2O zunächst erwarten lässt. Die stabilen O-Isotopen und die drei bekannten H-Isotopen lassen mehrere Kombinationsmöglichkeiten zu, sodass es in der Natur tatsächlich nicht nur das einfache Wasser H2O gibt, sondern eine umfangreiche Palette mit verschiedenen Isotopenbeteiligungen (Tab. 2).
Tab. 2 In der Natur vorkommende Molekülarten des Wassers unter Berücksichtigung der Isotopie von Wasserstoff und Sauerstoff (H = gewöhnlicher Wasserstoff, D = Deuterium, T = Tritium)
Der schwedische Naturforscher Jöns Jakob Berzelius (1779–1848), der auch die heute übliche Formelsprache in die Chemie einführte, verwendete für die Schreibweise eines Wassermoleküls ursprünglich die Symboldarstellung H2O. Die in seinen Formelbildern anfangs noch hochgestellte Ziffer zur Bezeichnung der Atomanzahl des vorangehenden Elements (keine nähere Bezeichnung wie beim Sauerstoff bedeutet immer die Einzahl) wandelten erst im späten 19. Jahrhundert die Chemiker Justus von Liebig (1803–1873) und Johann Christian Poggendorff (1796–1877) zur tiefgestellten Basiszahl. Seither gilt die heute konsistent im gesamten Wissenschaftsbereich mit H2O abgekürzte Kennzeichnung des molekularen Aufbaus von Wasser als die populärste chemische Formel überhaupt. Der bemerkenswert innovativ wirkende Berzelius ersetzte mit seinem angenehm vereinfachten und logischen Formelrepertoire übrigens auch den zu seiner Zeit noch vorherrschenden Wirrwarr alchemistischer Symbole, die begrifflich noch nicht zwischen Element und Verbindung unterschieden. Insgesamt war die lange Zeit intensiv betriebene Alchemie eine Art Geheimwissenschaft und damit wissenschaftshistorisch betrachtet eine durchaus wirksame Systembremse bzw. Episode. Zum Fortschritt der Naturwissenschaften hat sie sozusagen rein garnichts beigetragen – es sei denn, man gesteht ihr großzügig zu, dass sie kritische Köpfe zu energischem Widerspruch herausforderte.
2.13 Teile der hoch in die Atmosphäre aufragenden Haufenwolken bestehen (auch) aus unterkühltem Wasser
Ganz cool bleiben
Zu den vielen Besonderheiten des vermeintlich so einfachen Naturstoffs Wasser gehört auch, dass sich die Phasenübergänge zwischen den drei Zustandsformen fallweise und in Abhängigkeit von den Außenbedingungen auch recht unregelmäßig gestalten. Zum kompetenten Umgang der Lebewesen mit dem Medium Wasser gehört nämlich auch das eigenartige Phänomen Unterkühlung. Der amerikanische Physiker Percy Bridgman (1882–1961) hat bereits in den 1940er-Jahren besondere Hochdruckformen von Eis bei mehr als 20.000 bar Druck untersucht und dabei herausgefunden, dass man dieses dann glasartige Gebilde eventuell auch auf über 80 °C erhitzen kann, ohne dass es schmilzt. Für diese Arbeiten, die vor allem für das bessere Verständnis der Kristallgitterstrukturen im Eis von großem Belang waren, erhielt er 1946 den Nobelpreis für Physik. Andererseits kann man hochreines Wasser auch deutlich unter 0 °C abkühlen, ohne dass es zu Eis erstarrt – es geht dann in einen metastabilen Zustand über, der sich allerdings schlagartig ändern kann. Wasser in diesem Zustand nennt man ganz schlicht unterkühlt. In dieser Form kommt es beispielsweise in den Leitgeweben von Pflanzen vor, ohne dass sich die zerstörerischen und für die Feinstrukturen einer Zelle fatalen Eiskristalle bilden. Man kann solches unterkühltes Wasser auch in großen Mengen beobachten: In der Atmosphäre liegt die 0-°C-Grenze häufig genug bei etwa 2000 m Höhe. Dennoch sieht man hoch reichende Wolken aus unterkühlten Wassertröpfchen auch oberhalb von 10.000 m, wo die Außentemperatur bei unter – 30 °C liegt. Viele Cirrus- und Haufenwolken führen neben Eiskristallen unterkühltes Wasser. Dieser Sachverhalt führt uns zu einem weiteren wichtigen Aspekt:
Tab. 3 Stoffliche Eigenschaften von H-Verbindungen (Nichtmetallhydride) der Elemente der Sauerstoffgruppe im Periodensystem der Elemente (PSE)
Es ist absolut nicht normal
Der überaus häufige Naturstoff Wasser weist einige recht ungewöhnliche Eigenschaften auf, die so bei anderen Stoffen in der Natur nicht auftreten und die man deswegen als Anomalien bezeichnet. Dazu gehört unter anderem auch die wie selbstverständlich hingenommene Lage der Fixpunkte (Schmelz- und Siedepunkt), die nur deswegen nicht als fragwürdig erscheinen, weil sie aus dem Alltag vertraut und die Orientierungsmarken der üblichen Thermometer sind. Die Tabelle 3 vergleicht unter anderem die Fixpunkte der Wasserstoffverbindungen von Sauerstoff O (Wasser), Schwefel S (Schwefelwasserstoff), Selen Se (Selenwasserstoff) und Tellur Te (Tellurwasserstoff) aus der Hauptgruppe 16 (früher Gruppe VIA) des Periodensystems der Elemente. Mit steigender molekularer Masse steigen bei den Wasserstoffverbindungen von S, Se und Te gleichsinnig Schmelzpunkt, Siedepunkt und Verdampfungswärme. Bei Zimmertemperatur (20 °C) und Normaldruck (1 bar) sind alle diese Verbindungen demnach gasförmig.
Wasser verhält sich demnach völlig anders, denn es ist unter den benannten „Normal“-Bedingungen bekanntermaßen flüssig. Es zeigt – als leichteste der aufgeführten Verbindungen ganz anders als die aus der einfachen Formel H2O abgeleitete Molekularmasse von 18 – nicht nur bei den Fixpunkten, sondern auch hinsichtlich der Verdampfungswärme erheblich abweichende, nämlich viel höhere Werte. Der Schmelz- und ebenso sein Siedepunkt liegen im Vergleich zu den analogen Verbindungen geradezu extrem hoch. Daraus ergibt sich eine wichtige Folgerung: Die rechnerisch korrekte und aus mancherlei Versuchen abgeleitete Molekularmasse 18 (= 16 für O + 2 × 1 für 2 H) kann in Wirklichkeit demnach so offenbar nicht zutreffen. Wenn es diesen bemerkenswerten Sachverhalt nicht gäbe, hätten wir auch keine Still- oder Fließgewässer. Die wässrige Welt unseres Heimatplaneten wäre fast nicht vorstellbar.
2.14 So selbstverständlich, wie man sie normalerweise zur Kenntnis nimmt, ist die Dampfkurve von Wasser tatsächlich nicht: Die Aggregatzustände ändern sich sprunghaft
Eine folgenreiche Habgier
Der Bindungspartner Sauerstoff im Wassermolekül zeichnet sich, wie oben dargestellt, durch eine besondere Elektronengier (Elektronegativität genannt) aus. Er ist, weniger plakativ, aber mit dem zugehörigen Fachbegriff ausgedrückt, um ein Vielfaches elektronegativer als der Wasserstoff. In der zwischen diesen beiden Elementen bestehenden Elektronenpaarbindung (H–O) sind die bindenden Elektronen folglich nicht ganz symmetrisch zwischen den Bindungspartnern angeordnet: Der deutlich elektronegativere Partner O zieht das gemeinsame Elektronenpaar bei jeder Bindung mit einem H deutlich auf seine Seite. Dadurch wird jedoch die Ladungsverteilung im Wassermolekül asymmetrisch. Die Wasserstoffseite wird durch die Auslagerung ihres Elektrons leicht positiv, das andere Ende durch den Teilchenzuwachs leicht negativ. Diese zwar nur geringe Ladungsumverteilung ist aber außerordentlich folgenreich, denn sie bewirkt, dass das Wassermolekül sich wie ein Dipol verhält. In einem gleichförmigen elektrischen Feld richtet es sich genau nach den Feldlinien aus. Weil die beiden O–H-Bindungen einen Winkel von knapp 105° (genau: 104° 40’) einschließen und das Wassermolekül daher etwas bananenförmig aussieht, liegt der positive Ladungsschwerpunkt in der Mitte der Wasserstoffseite, der negative Ladungsschwerpunkt aber im Sauerstoffatom. Man spricht daher in Fachkreisen auch von einer polarisierten Elektronenpaarbindung.
2.15 Die Elektronengier des Sauerstoffs führt im Wassermolekül zu einer folgenreichen Ladungsverschiebung: Wassermoleküle sind daher immer Dipole
2.16 Im Eis ist jedes Wassermolekül räumlich fixiert und bildet die größtmögliche Anzahl von vier Wasserstoff-Brücken aus. Damit entsteht ein regelmäßiges sechseckiges Kristallgitter (Cluster), das sich letztlich auch im Grundmuster einer Schneeflocke findet
Der Dipolcharakter des Wassermoleküls hat tatsächlich bemerkenswerte und auch ökologisch relevante Konsequenzen für alle Gewässer. In der Flüssigkeit Wasser zieht nämlich die positive Seite eines Wassermoleküls auf elektrostatischem Weg jeweils die negative Seite eines anderen an, so wie sich auch die entgegengesetzten Pole zweier Magnetstäbe gegenseitig äußerst attraktiv finden. Als Dipole bilden die einzelnen Wassermoleküle folglich größere Zusammenlagerungen oder Assoziationen. Ihre molekulare Masse beträgt daher eben nicht 18, weil H2O nicht als Einzelmolekül vorliegt, sondern als größerer Molekülverband (H2O)n mit der daraus folgenden Molekülmasse n × 18. Als größeres Molekülgebilde muss Wasser daher einen entsprechend hohen Schmelzpunkt aufweisen, der zulässt, dass es auch bei Zimmertemperatur noch als Flüssigkeit vorliegt. Dieser bemerkenswerte Befund erscheint vielleicht als eine vernachlässigbare Nebensächlichkeit, doch ohne diesen folgenreichen Sachverhalt hätte sich auf der Erde tatsächlich niemals das Leben entwickeln können – weder in den Gewässern, noch auf dem Festland.
Ein kleines Experiment: Die zwei Seiten eines Moleküls
Den Dipolcharakter von Wassermolekülen kann man mit einem sehr einfachen Experiment indirekt, aber eindrucksvoll nachweisen. Es lässt sich nämlich zeigen, dass Wasser trotz seiner schlechten Leitung für den elektrischen Strom dennoch elektrische Eigenschaften aufweist: Durch Reiben eines Kunststoffstabes (Füllfederhalter, Kugelschreiber etc.) am wollenen Pulloverärmel lädt sich dieser elektrostatisch auf. Diese Ladung wirkt nun auf die Wasserteilchen überaus anziehend – klar erkennbar an der Ablenkung eines sehr sanften Wasserstrahls aus der häuslichen Wasserleitung, wenn man einen entsprechend vorbehandelten Kunststoffgegenstand in seine Nähe bringt. Dieser überraschende Effekt ist jedoch nur unter der Annahme zu erklären, dass die Wassermoleküle Dipole darstellen. Die Ladungen sind im Wassermolekül eben nicht gleichmäßig verteilt. Beim Annähern eines geladenen Körpers richten sich die Dipole so aus, dass sie mit ihrer Seite zum elektrostatisch aufgeladenen Objekt weisen.
2.17 Wer hätte das gedacht: Der relativ zähe Zusammenhalt der Moleküle im flüssigen Wasser eines Stillgewässers beruht nur auf ein paar elektronischen Schiebereien im molekularen Bereich der Wassermoleküle
Atomare Brückenköpfe
Die Assoziation zwischen den einzelnen polarisierten Wassermolekülen kann man auch so deuten, dass jedem Wasserstoffatom außer dem daran gebundenen Sauerstoffatom noch ein weiteres O-Atom anlagert, nämlich dasjenige eines benachbarten Wassermoleküls. Das Wasserstoffatom bildet also gleichsam eine Brücke zwischen den Sauerstoffatomen verschiedener Moleküle, wobei das eine Brückenende eine polarisierte Elektronenpaarbindung darstellt, das andere auf elektrostatischer Anziehung der Dipole beruht.
Diese zwar einfache, aber irgendwie geniale Vorstellung entwickelte um 1923 der amerikanische Physikochemiker Gilbert Newton Lewis (1875 – 1946), der auch eine ebenso elegante Säuretheorie formulierte. Jedes Wassermolekül kann maximal vier solcher Wasserstoffbrücken ausbilden – je zwei intramolekular über die gebundenen Wasserstoffatome und zwei weitere zu benachbarten Wassermolekülen, genauer zu den freien Elektronenpaaren von deren Sauerstoff. Es bildet damit einen Tetraeder – eine dreiseitige Pyramide, an deren Ecken entweder ein Wasserstoffatom oder ein Elektronenpaar sitzt, während das Sauerstoffatom jeweils die Mitte einnimmt.
Thermische Anomalie
Außer seiner unerwarteten Molekülgröße, die tatsächlich eher an eine verzweigte Kette erinnert als an individuelle, unverbundene Kettenglieder, zeigt Wasser einige weitere bemerkenswerte Anomalien. Früher hat sich niemand wirklich darüber gewundert, warum sich Seen und Flüsse bei den damals noch häufigeren winterlichen Tieftemperaturen mit einer festen Eishaut bzw. -decke überziehen. Gerade dies ist jedoch für eine Flüssigkeit ein höchst merkwürdiges Verhalten. Die meisten Stoffe sind im festen Aggregatzustand deutlich dichter, damit schwerer als im flüssigen und sinken somit auf den Grund eines Gefäßes ab. Üblicherweise schrumpft eben nach der Theorie das Volumen einer Flüssigkeit, wenn sie beim Gefrieren zum Festkörper erstarrt.
Nicht so beim Wasser. Wasser dehnt sich nämlich beim Gefrieren immer aus und wird damit weniger dicht. Ohne diesen Effekt gäbe es keine geborstenen Wasserleitungen, denn der Rohrbruch kommt nur durch das sich ausdehnende Eis in seinem Inneren zustande. Aus dem gleichen Grund schwimmen Eisberge auf dem Meerwasser und konnten so der Titanic am 15. April 1912 etwa 300 sm vor Neufundland ausgerechnet bei ihrer Jungfernfahrt zum Verhängnis werden. Und nur aus diesem Grund frieren die Binnengewässer nicht am Boden beginnend nach oben zu, sondern umgekehrt von der Oberfläche her – ein Effekt von ungeheurer ökologischer Tragweite, denn er hält das Tiefenwasser von Weihern und Seen im Winter trotz oberflächlicher Eisdecke flüssig. Flüssiges Wasser ist nicht dann am dichtesten, wenn es am kältesten ist (0 °C), sondern ungefähr vier Grad darüber: Ganz genau liegt das Dichtemaximum von Wasser bei + 3,98 °C.
2.18 Im flüssigen Zustand sind die von den H-Atomen vermittelten Brückenköpfe nicht lagefixiert. Sie bedingen dennoch die ungewöhnlichen Eigenschaften des Naturstoffes Wasser
Mit dieser Merkwürdigkeit wurde reinstes Wasser mit einer Temperatur von + 3,98 °C als Basis zur Festlegung der Masse- bzw. Volumeneinheit gewählt: Ein Liter (1 L, entstanden aus dem vorrevolutionären französischen Maß litron) ist im heute verbindlichen metrischen Einheitensystem definiert als dasjenige Volumen, welches 1 kg Wasser bei der Temperatur seiner größten Dichte einnimmt. Ein Liter beträgt demnach 1,000028 Kubikdezimeter (dm3). Die geringe Zahlendiskrepanz zwischen Liter und Kubikdezimeter erkannte man erst im Jahr 1875. Seit 1964 ist aber international vereinbart, die Ungenauigkeit von 1 : 36.000 zu vernachlässigen und die Festsetzung 1 L = 1 kg Wasser für die alltägliche Praxis zuzulassen.
Tab. 4 Dichte von Wasser bei verschiedenen Temperaturen
| Temperatur (°C) | bezogen auf Dichte bei 0 °C = 1,0 | bezogen auf Dichtemaximum bei 4 °C = 1,0 |
| 0 | 1,00000 | 0,99987 |
| 10 | 0,99986 | 0,99973 |
| 20 | 0,99836 | 0,99823 |
| 30 | 0,99580 | 0,99568 |
Wenn die Wassertemperatur ausgehend vom Gefrierpunkt ansteigt, wird die Dichte des Wassers (bezogen auf 0 °C als relativen Vergleichswert = 1,0) zunächst einmal größer (Anstieg auf 1,000 13) und sinkt erst oberhalb von 4 °C wieder proportional zur Temperatur. Bei Bezug auf das Dichtemaximum (Dichte bei rund 4 °C = 1,0) beträgt der Wert für 0 °C 0,999 87.
Für Schweres Wasser (D2O) sind die relevanten Werte übrigens völlig verschieden: Es gefriert schon bei + 3,82 °C, siedet bei 101,42 °C und erreicht seine größte Dichte erst bei + 11,185 °C. Es ist bisher nur teilweise gelungen, das recht ungewöhnliche Dichtemaximum von normalem und schwerem Wasser deutlich oberhalb des Gefrierpunkts theoretisch aus der molekularen Struktur des Wassers schlüssig abzuleiten.
2.19 Taumelkäfer leben an der Wasseroberfläche. Die ungewöhnlich hohe, auf Kohäsion zurückgehende Oberflächenspannung der Grenzschicht trägt sie zuverlässig
Ziemlich gespannte Verhältnisse
Eine weitere recht ungewöhnliche und ökologisch gesehen folgenreiche Eigenschaft von Wasser ist seine große Oberflächenspannung – sie beträgt bei 20 °C knapp 73 dyn/cm. Wasser wird darin nur vom Element Quecksilber übertroffen. Diese stoffliche Eigenschaft, die aus seiner durch den Dipolcharakter der Wassermoleküle begründeten Kohäsionskraft abzuleiten ist, äußert sich darin, dass ein vorgegebenes Wasservolumen bevorzugt eine Raumgestalt einnimmt, die den größten Inhalt bei kleinstmöglicher Oberfläche aufweist – eben die ideale Kugelgestalt. Die Wassertröpfchen der Regenwolke sind tatsächlich kugelrund. Erst der freie Fall verformt sie zum eher mützenförmigen Tropfen, aber nach dem Aufprall auf einer festen Oberfläche streben sie sofort wieder die ideale Kugelgestalt an. Ohne seine betont kohäsive Oberflächenspannung hätten wir kein „perlendes“, sondern nur unbegrenzt zerfließendes Wasser, das kaum in den Boden eindringen könnte, weil es viel zu rasch verdampft. Außerdem könnten dann auch keine Kleintiere wie die Wasserläufer so elegant über die Wasseroberfläche flitzen.
Eine Folge der Adhäsionskraft des Wassers ist auch seine Kapillarität, die es in engen Gefäßen aufsteigen lässt. Der seitliche Blick auf eine mit Wasser gefüllte Pipette (oder gegebenenfalls auf ein engröhriges Kölsch-Glas) zeigt, dass der Spiegel der Wasserfüllung randlich ein wenig nach oben gebogen ist – er bildet einen liegenden, nach oben offenen Halbmond und heißt deswegen auch Meniskus (altgriechisch meniskos = kleiner Mond).
Adhäsion und Kohäsion des Wassers haben viele weitreichende Konsequenzen für die Lebewesen. Die Kapillarität ist unter anderem beim Aufsteigen des Wasserstroms von den Wurzeln bis zu den obersten Blattspitzen von Bedeutung. Pflanzen können danach nur so hoch werden, wie ein Wasserfaden in einer engen Leitbündelröhre nicht unter seinem Eigengewicht abreißt. Diese Grenze liegt bei etwa 130 m – und viel höher werden konsequenterweise auch die rekordverdächtigen höchsten Eukalyptusbäume in Australien nicht.
Eine weitere bemerkenswerte Kenngröße des Wassers ist seine schlechte Wärmeleitung. Für die Flüssigkeit Wasser beträgt der Wert 0,0057 J/cm × s × C, für Eis jedoch 0,024 J/cm × s × °C. Dieser Sachverhalt spielt für den Wärmehaushalt der Gewässer eine besondere Rolle: Hat sich ein Teich, Weiher oder See erst einmal mit einer Eisdecke von der freien Atmosphäre abgetrennt, findet fast kein weiterer Wärmeverlust durch Strahlung oder Konvektion statt.
Unentbehrliches Lösemittel
Lösungen sind homogene Mischungen reiner Stoffe, aber nicht alle homogenen Mischungen sind umgekehrt auch echte Lösungen. Echte Lösungen weisen nur zum Teil die Kennzeichen ihrer Bestandteile auf, zeichnen sich zum anderen aber auch durch völlig neue (emergente) Eigenschaften aus. Das Wasser als Lösemittel erhält ebenfalls neue Eigenschaften: Dichte, Wasserhärte, Leitfähigkeit, Siede- und Gefrierpunkt sowie osmotischer Wert sind nun verändert.
Die physiko-chemischen Eigenschaften einer Lösung bezeichnet man als kolligativ (von lat. colligare = verbinden). Dazu gehören Dampfdruck, osmotischer Druck, Gefrierpunkterniedrigung und Siedepunkterhöhung. Diese Eigenschaften sind nur von der Teilchenzahl, nicht aber von der Art der Teilchen abhängig. Für die kolligativen Eigenschaften ist nicht entscheidend, ob die gelösten Stoffe eine oder mehrere Ladungen tragen oder als organische Stoffe insgesamt überhaupt ungeladen sind. Wichtig ist im Fall des idealen Verhaltens einer Substanz in einer Lösung der van’t-Hoff-Faktor und dass die gelösten Substanzen das chemische Potenzial des Lösungsmittels verringern. In der Physikalischen Chemie bezeichnet der van’t-Hoff-Faktor das Verhältnis der Stoffmenge eines gelösten Stoffs (= Solut) in einer wässrigen Lösung zur Stoffmenge des ursprünglich zugegebenen festen Ausgangsstoffs. Der Faktor ist damit ein Maß für die Löslichkeit und somit dafür, wie gut oder vollständig sich ein Stoff in Wasser löst, und insbesondere dafür, wie viele Teilchen sich danach in der Lösung befinden.
Verbindungen, die elektrisch geladene Partikeln oder selbst Dipole darstellen – also polar sind – und sich folglich in Wasser gut lösen, nennt man hydrophil. Reine Kohlenwasserstoffe, die nur aus Ketten mit – CH2 – oder vergleichbaren Wiederholungsstrukturen bestehen, stellen keine Dipole dar, sind daher apolar (unpolar) und bilden konsequenterweise auch keine Ionen. Sie sind folglich nicht wasserlöslich und gelten als hydrophob bzw. wasserscheu: Benzin kann man erfahrungsgemäß auch in Zeiten höchster Knappheit nicht mit Wasser verdünnen. Wegen seiner geringeren Dichte schwimmt Benzin immer auf dem Wasser – es bilden sich eben zwei Phasen. Diese Eigenschaft teilt es mit den Fetten und den fettähnlichen Substanzen (= Lipiden), denn auch die hydrophoben Fettaugen schwimmen auf der ansonsten wässrigen lipophoben Suppe.
2. 20 Eine angehauchte kalte Glasscheibe zeigt im mikroskopischen Bild eine Vielzahl kleinster Wassertröpfchen. Die ballt die Kohäsionskraft des Wassers zusammen
Die hydrophoben Lipide sind allerdings in allen Lösemitteln löslich, die sich nicht oder kaum mit Wasser mischen lassen, beispielsweise in Chloroform oder in Tetrachlorkohlenstoff. Darin lösen sich allerdings die fettigen Saucenflecken auf der Krawatte (Flecken-„Wasser“), die mit Wasser nicht zu beheben sind. Die Eigenschaft hydrophob ist also immer mit dem Merkmal lipophil gepaart, und lipophobe Verbindungen sind generell hydrophil. Obwohl in der belebten Natur zahlreiche lipophile Verbindungen vorkommen und dort eine enorm wichtige Rolle spielen (beispielsweise als Membranbaustoffe in der lebenden Zelle), laufen die lebenswichtigen stofflichen Vorgänge allesamt in wässrigem Milieu ab: Corpora non agunt nisi soluta (stoffliche Interaktionen spielen sich [fast] nur in Lösung ab). Die Stoffwechselbiologie ist somit in wesentlichen Anteilen eine Angelegenheit der wässrigen Lösungen, weil Wasser in der Natur das universelle Lösemittel darstellt.
Tab. 5 Löslichkeit von Gasen in Wasser. Angegeben ist das Volumenverhältnis Gas/Wasser unter Normaldruck bei verschiedenen Temperaturen
2.21 Obwohl man über das Wasser schon sehr viel weiß, bleiben dennoch ein paar Rätsel: Warum spiegelt eine Seeoberfläche so eindrucksvoll ihr Umfeld?
Wärme beschleunigt
Die Löslichkeit von Stoffen in Wasser ist temperaturabhängig. Feststoffe lösen sich besser mit steigender Temperatur, Gase dagegen besser bei niedrigen Temperaturen (Henrysches Gesetz). Außerdem erhöht sich bei Gasen die Löslichkeit mit steigendem Druck, wie das aus dem Champagner (oder Sprudelwasser) heftig ausperlende Kohlenstoffdioxid zeigt. Einen Überblick über die Gaslöslichkeit gibt die Tabelle 5. Angegeben sind die Volumenverhältnisse Gas/Wasser. Deren 1000-facher Wert ist der Bunsensche Absorptionskoeffizient. Für das Leben in den Gewässern sind diese Zahlenwerte von nachhaltiger Bedeutung. Besonders relevant für tierische Organismen ist vor allem die O2-Löslichkeit, weil diese unmittelbar ihre Atmungsaktivität betrifft.
2.22 Und warum zeichnet sich die Wasser-linie eines Gewässers am Horizont selbst bei diffuser Beleuchtung immer dunkel ab?
Dieser kleine physiko-chemische Ausflug in die überaus erstaunlichen Materialeigenschaften des vermeintlich so simplen Naturstoffs Wasser und ihre Konsequenzen verdeutlicht, warum ein geregelter Stoffwechselbetrieb in jeder einzelnen Zelle eines Lebewesens ebenso wie im Gesamtorganismus sowie auf der ökosystemaren Ebene tatsächlich nur in der einzigartigen Kombination aller Merkmale dieses bekannten, aber gar nicht so einfachen Naturstoffs H2O möglich ist. Würde eines der oben skizzierten Kennzeichen so nicht vorliegen oder sich geringfügig anders darstellen, hätte das Leben in den uns heute bekannten Erscheinungsformen mit Sicherheit nicht entstehen können. Alle benannten Eigenschaften von Wasser sind natürlich auch für das physiko-chemische Profil sämtlicher aquatischer Lebensräume und ihrer Besiedelbarkeit durch Organismen unendlich folgenreich. Und damit kehren wir aus den molekularen Dimensionen wieder in die Anschaulichkeit und Betrachtungswürdigkeit eines stehenden Gewässers zurück.