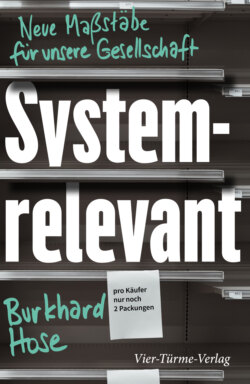Читать книгу Systemrelevant - Burkhard Hose - Страница 8
ОглавлениеPures Leben, oder: Was wirklich zählt
Ich sitze an meinem Schreibtisch und schaue aus dem Fenster in den blauen Himmel. Irgendetwas ist anders als sonst. Etwas stimmt da nicht. Es dauert einige Momente, bis ich merke, was meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Es ist nicht etwas, was da ist, sondern etwas, das fehlt. Ich blicke in einen Himmel ohne Kondensstreifen. Der blanke blaue Himmel irritiert mich. Für einen Moment erschrecke ich fast ein wenig über meine Reaktion. Der Anblick des puren blauen Himmels verunsichert mich mehr als ein Himmel, der von künstlichen Wolkenstreifen aus Abgas- und Wasserdampf durchzogen ist? Dabei ist die Erklärung für das Phänomen relativ einfach: Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 bricht erstmalig der gesamte Flugverkehr zusammen. Weniger Flugzeuge bedeuten weniger Kondensstreifen am Himmel. Etwas irritiert über die folgenden Gedankenketten geht mir durch den Kopf: Wie mag es gerade denen ergehen, die seit beinahe dreißig Jahren die Verschwörungstheorie von den sogenannten Chemtrails verbreiten? Sie sind davon überzeugt, eine bestimmte Art von Kondensstreifen würde absichtlich am Himmel platziert, um unser Leben zu beeinflussen. Hartnäckig halten sich solche Geschichten von Chemikalien, die von Regierungen in geheimen Aktionen über Abgase von Flugzeugen über die Bevölkerung versprüht würden, um den Klimawandel zu beeinflussen oder sogar das Bevölkerungswachstum zu steuern. Vielleicht rührt die Beständigkeit dieser Theorien auch daher, dass alle Vorgänge, die am Himmel zu beobachten sind, auf Menschen schon immer eine besondere Faszination ausgeübt haben. Ob es sich um bestimmte Sternenkonstellationen handelt, um Sonnen- oder Mondfinsternisse, auffällige Wolkenbildungen oder Lichtspiegelungen: Sobald sich etwas am Himmel abspielt, neigen Menschen dazu, diesen Beobachtungen tiefere Bedeutung beizumessen. Nun gehe ich nicht davon aus, dass die Veränderungen am Himmel auf geheimnisvolle Weise mein Leben beeinflussen. Für mich wird der Himmel in diesen Zeiten eher zur Metapher, zum Bild und zum Spiegel der Veränderungen, die sich gerade auf der Welt und damit auch in meinem Leben ereignen. Warum sich der Himmel verändert hat, kann ich mir erklären, was sich aber gerade auf der Erde und in meinem Leben an Veränderungen abzeichnet, ist weniger eindeutig und überfordert mich sogar. Ich versuche zu verstehen. Und ich frage nach der tieferen Bedeutung dessen, was ich beobachte.
Der klare Himmel, frei von Flugzeugen und deren Spuren, ist für mich zu einem Symbolbild für eine wichtige Erfahrung dieser Monate geworden. Es ist die Erfahrung, dass vieles fehlt, was vertraut oder gewohnt war. Und die Erkenntnis, dass damit das Leben unverstellt und pur sichtbar wird, wie der blaue Himmel eben.
Dabei verbindet sich die Klarheit des Himmels nicht unbedingt nur mit positiven Erfahrungen. Eindrücklich und gleichzeitig schmerzlich ist für mich in diesen Monaten der unverstellte Blick auf die Zerbrechlichkeit des Lebens. In einem hochentwickelten Land, in dem die Menschen immer älter werden, stehen wir beinahe ohnmächtig da und erleben, dass viele in Alten- und Pflegeheimen nach wenigen Krankheitstagen sterben. Freundinnen und Freunde, die in Kliniken arbeiten, berichten davon, wie rasant sich der Zustand mancher Patient*innen mit COVID-19 verschlechtert und wie vor ihren Augen das Leben entschwindet.
So oft habe ich bei Beerdigungen schon den Psalm gebetet, in dem es von Gott heißt: »Denn er weiß, was wir für Gebilde sind, er bedenkt, dass wir Staub sind. Wie Gras sind die Tage des Menschen, er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin; der Ort, wo sie stand, weiß nichts mehr von ihr« (Psalm 103,14–16). Immer wieder denke ich an dieses Bild von der Flüchtigkeit des Lebens, wenn ich davon höre oder lese, welche Menschen aus meiner Nähe auf einmal nicht mehr da sind. Der Blick in den klaren Himmel ist auch ein Blick auf das pure Leben, das so verletzlich, so kostbar und unabänderlich begrenzt ist, und es ist der Blick auf den Tod. Es ist ja nicht so, dass mir die Endlichkeit des menschlichen Lebens nicht auch sonst bewusst wäre. Aber es erscheint mir so, als sei Sterben in unserer Gesellschaft auf einmal viel näher gekommen, bedrohlicher und dabei alltäglicher. Ich muss eben nicht mehr erst in der Zeitung nach der Seite mit Todesanzeigen suchen, sondern bereits auf der ersten Seite der Tageszeitung und in der ersten Meldung der Nachrichten erreichen mich aktuelle Todeszahlen. Diese Zahlen stehen da wie der Wetterbericht oder die Börsenkurse auf der gleichen Seite.
Der unverschleierte Blick auf diese Realität, auf die Verletzlichkeit des Lebens, überfordert viele in dieser Zeit – mich auch. Ich kann noch so viele Versicherungen abschließen, um mich gegen alle möglichen Gefahren zu wappnen, aber letztlich gibt es kein Sicherungsnetz für das pure Leben. Das Leben an sich ist so etwas wie der freie Fall in Richtung des sicheren Todes. Das Ausschließen von Risiken funktioniert nicht mehr. Es funktioniert auch nicht mehr, das Sterben und den Tod unsichtbar zu machen und in Kliniken oder Altenheime abzuschieben. Eine Erfahrung, die ich eigentlich sonst nur mache, wenn mich die Nachricht vom plötzlichen Tod eines nahen Menschen erreicht: Du bist für einen Augenblick ganz bei dir selbst. Alles andere, was sonst das Leben bestimmt und die Realität des Todes überdeckt, wird beinahe unwichtig und unsichtbar. Das Sterben anderer Menschen ist immer auch eine unverstellte Begegnung mit der eigenen Endlichkeit. Die Erfahrung einer Pandemie ist so etwas wie das kollektive Erleben eines Schicksalsschlages. Noch dazu zieht sich dieses Erleben über viele Monate hin. Wer hält das schon aus, über eine so lange Zeit immer wieder auf sich selbst und die eigene Sterblichkeit zurückgeworfen zu werden? Es ist nur auszuhalten, wenn ich mich dem Blick in den klaren Himmel bewusst aussetze, mich selbst wahrnehme. Verdrängen oder Nicht-Wahrhaben-Wollen helfen nicht. Und irgendwann werden auch die Verschwörungstheorien, die das Sterben verleugnen, wie die sogenannten Chemtrails vom Himmel verschwinden. Was bleibt, ist der unverstellte Blick auf das pure Leben.
Während manche noch mit Flucht oder Trotz versuchen, sich dieser Erfahrung zu entziehen, bemerke ich bei vielen Menschen in meiner Umgebung etwas anderes. In manchen Gesprächen nehme ich so etwas wie eine neue Bescheidenheit wahr. Der Wert von Gesundheit und die Kostbarkeit des Lebens werden mir wieder bewusster. Viele wünschen sich zum Abschied oder am Ende einer E-Mail »Bleib gesund« oder »Komm wohlbehalten durch die nächsten Wochen!«. Und immer schwingt so etwas mit wie: »Das Leben ist kostbar.«
Durch die Reduzierung der Kontakte nehme ich auch meine Beziehungen wieder unverstellter wahr. Es gibt nicht mehr die unzähligen flüchtigen Begegnungen, die wie ein Netz aus Kondensstreifen am Himmel mein Leben durchziehen. Es sind wenige, aber dafür intensive Beziehungen, die mich verlässlich tragen und auf einmal wieder klarer zum Vorschein kommen. Mit einem Freund gehe ich in den Monaten des Lockdowns jeden Sonntag spazieren. Er ist sonst viel auf Reisen und genauso wie ich mit Terminen zugedeckt. Wir entdecken unsere alte Freundschaft noch einmal neu, und ich bin dankbar dafür. Die Sonntagsspaziergänge öffnen neue Räume für unsere gemeinsamen Erinnerungen, aber auch für Themen, für die sonst immer die Zeit fehlte. Ähnlich geht es mir mit den Beziehungen in meiner Familie. Es ist, als rückten wir wieder näher zusammen. Natürlich auch aus Sorge um die inzwischen betagten Eltern. Dazu trägt zudem bei, dass manche behördlichen Regelungen Kontakte tatsächlich auf die Familie begrenzen. Viele sind dadurch überfordert. Konflikte, die sonst verschleiert oder überdeckt werden, treten offen zutage. Berichte über zunehmende häusliche Gewalt verstören. Aber ebenso wird sichtbar, dass viele Menschen, die alleine leben, auf einmal unverstellt mit der Tatsache des Alleinseins konfrontiert werden. Hinter dem Vorhang der Singlegesellschaft wird der Blick frei auf eine Einsamkeitsgesellschaft. Wenn berufliche und Freizeitaktivitäten massiv eingeschränkt werden und die vielen flüchtigen Alltagskontakte wegbrechen, falle ich auf mich zurück. Für manche Menschen ist das eine Überforderung. Sie erleben, dass sie mit sich allein nicht zurechtkommen oder sich selbst nicht genügen. Aber vielleicht ist dieser Blick in den blauen Himmel, der auch ein Blick auf mein unverschleiertes Ich ist, eine Entdeckungsreise wert. Manche schaffen es, dieses neue Alleinsein auch als eine neue Möglichkeit zu sehen. Es ist die Möglichkeit, sich selbst zu begegnen.
»Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen.« Dieser Satz stammt von dem französischen Mathematiker und Philosophen Blaise Pascal, der im 17. Jahrhundert lebte. Das Zitat ist mir zum ersten Mal begegnet, als ich an Schweigetagen in einem Kloster teilnahm. Damals habe ich mich gegen den Gedanken gewehrt und fand die Erklärung für Unglück auch ziemlich vereinfacht. In Zeiten immer wiederkehrender Lockdowns und Ausgangsbeschränkungen bekommt das Wort einen sehr konkreten und aktuellen Klang. Schließlich gehört zu dieser konkreten Seite auch dazu, dass sich eine Pandemie mit der Mobilität der Menschen in ungeheurer Geschwindigkeit über den Erdball verbreitet hat. Würden wir Menschen nicht so viel reisen, hätte es auch ein Virus schwerer, auf Weltreise zu gehen. Aber das Zitat von Blaise Pascal bezeichnet eben viel mehr und Tieferes für mich. Es geht um das Unvermögen, bei sich selbst zu bleiben, sich selbst genug zu sein, es mit sich selbst auszuhalten.
In der Bibel gibt es unzählige Geschichten von Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen wie Getriebene unterwegs sind. Dabei geht es immer wieder darum, dass sie auf sich zurückgeworfen werden. Die Urgeschichte von der Vertreibung Adams und Evas erzählt davon, dass der Mensch sein ursprüngliches Zuhause, sein »Paradies«, verliert (Genesis 3). In dem Moment, als Adam und Eva mehr wollen, als nur zu sein, und vom Baum der Erkenntnis essen, stehen sie nackt da. Sie verlieren ihr Zuhause. Der Mythos ist der Versuch, die Welt zu erklären, in der sich die Menschen so oft als verloren und heimatlos erfahren. Das Buch Exodus erzählt die fantastische Geschichte eines ganzen Volkes, das vierzig Jahre lang umherirrt und dabei sich selbst findet (Exodus 1–15). Der Einzug in das »Gelobte Land« ist sozusagen die Rückkehr in das verlorengegangene Paradies. Es ist eine Geschichte vom Heimkommen. Dieses Ankommen bei sich selbst war aber nur nach einer langen Zeit des Lebens in der Fremde möglich. Die Versklavung in Ägypten und der lange Weg durch die Wüste lassen sich auch wie Bildergeschichten für die innere Befreiung und die lange Reise zu sich selbst lesen. Ein Großteil der Texte in der hebräischen Bibel, dem Alten Testament, beschreibt diese Urerfahrung des Menschen, der nicht bei sich zu Hause ist und gerade dadurch auf sich selbst zurückgeworfen wird. Die literarisch produktivste Phase der Bibel war die Zeit im und nach dem Babylonischen Exil. Historisch beginnt die Exilszeit 597 v. Chr. mit der ersten Eroberung Jerusalems und des Königreiches Juda durch den babylonischen König Nebukadnezar II. und dauert bis zur Eroberung Babylons 539 v. Chr. durch den Perserkönig Kyros II. Die Jerusalemer Oberschicht war nach Babylon verschleppt worden. Eine traumatische Erfahrung, die literarisch verarbeitet und theologisch gedeutet wird.
Theologisch bezeichnet das Exil den Verlust des von Gott verheißenen Landes. Und gerade in dieser Phase entdeckt das Volk Israel sich selbst und seinen Gott neu und kehrt nach Hause zurück.
Schließlich denke ich noch an eine neutestamentliche Erzählung, eine Beispielgeschichte von einem, dessen Unglück damit begann, dass er nicht zu Hause geblieben ist. Es ist die Parabel vom sogenannten verlorenen Sohn, die eigentlich eine Geschichte der Heimkehr und der Entdeckung des eigentlichen Zuhauses ist (Lukas 15,11–32). Warum kreisen so viele Geschichten um das Aufbrechen und Weglaufen, um das Vertriebenwerden und Heimkehren? Immer geht es um die Entdeckung des Wesentlichen im Leben, die in diesen Erzählungen beschrieben wird.
Ich sitze im Lockdown in meinem Zimmer, bin äußerlich zu Hause, fühle mich aber gleichzeitig wie jemand, der sein altes Leben und damit sein eigentliches Zuhause auch ein Stück weit verloren hat oder daraus vertrieben wurde. Es kommt mir an manchen Tagen vor wie ein Exil in den eigenen vier Wänden, wie eine Wüstenzeit, ohne dass ich schon wie die biblischen Autoren deutend und verstehend auf diese Zeit zurückschauen könnte. Ich stecke gerade mittendrin in der Wüste, im Exil. Ich ahne nur, dass diese Zeit »zwischen« meinem bisherigen und dem zukünftigen Leben Bedeutung hat Die biblischen Erzählungen vom Zug des Volkes Israel durch die Wüste und vom Ankommen im »Gelobten Land«, von der Heimkehr aus dem Exil machen mir Mut, dass auch meine Geschichte gut ausgehen kann. Sie können meine Widerstandskraft, meine persönliche Resilienz stärken, weil ich an ihnen ablesen kann, wie das ist, im Ausnahmezustand zu leben. Ich versuche aus diesen Geschichten zu lernen, die gegenwärtige Situation nicht nur auszuhalten oder zu überstehen, sondern im besten Fall bewusst wahrzunehmen und zu gestalten, ohne letztlich zu wissen, was mich danach erwartet. Immer wieder also kommen mir biblische Erzählungen und Bilder in den Sinn. Viele Menschen in meinem Umfeld erleben diese Zeit wie ich auch als eine Art Exil oder Wüstenzeit. Für andere erscheint der Verlust des gewohnten Lebens wie die Vertreibung aus dem Paradies. Wieder andere erleben das ohnehin harte Leben noch härter und unverstellt ungerecht.
Ich schaue in den blanken Himmel ohne Kondensstreifen und kreise um die Frage: Was ist wesentlich?