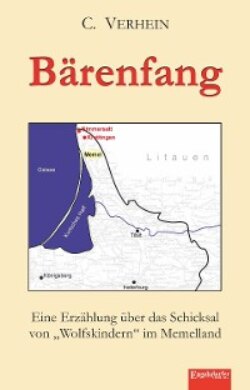Читать книгу Bärenfang - C. Verhein - Страница 6
1. Unser Leben im Memelland
ОглавлениеDen Sommer 1944 erlebte ich als Zwölfjähriger mit meinem achtjährigen Bruder Frank in Krettingen, früher Crottingen, im nördlichen Memelland, ohne wesentliche Kriegseinwirkungen, obwohl die Front keine zweihundert Kilometer entfernt war.
Diese Kleinstadt lag unmittelbar an der deutsch-russischen oder litauischen Grenze. Jenseits der Grenze gab es das russische Crottingen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aus Krettingen das litauische Kretinga.
Während der Eroberung Polens und solange es beim Überfall auf die Sowjetunion vorwärts ging lagen wir abseits der großen militärischen Vorgänge. Abgesehen von wenigen Einschränkungen verlief unser Leben wie in tiefsten Friedenszeiten.
Das sollte sich aber bald ändern!
Vater unterhielt als Landarzt, Dr. Wilhelm Mauruschat, eine Praxis im Stadtzentrum, unweit des Marktes dieser Kleinstadt. In dem großen zweigeschossigen Haus mit einem weithin leuchtenden Ziegeldach befand sich über der Praxis im Erdgeschoss unsere geräumige Wohnung. Seitlich des Hauses führte eine mit Kopfsteinen gepflasterte Einfahrt auf den Hof des Grundstückes, wo sich der Pferdestall und daneben die Garage befand, in der zu Friedenszeiten Vaters Auto stand, mit dem er seine Krankenbesuche über Land machte.
Nachdem der Wagen im Krieg eingezogen wurde, diente die ehemalige Garage als Remise für den einachsigen Dogcart1. Mit solch einem Gespann machte Vater jetzt seine Krankenbesuche über Land.
Über dem Pferdestall wurden Stroh und Heu gelagert. Von Zeit zu Zeit wurde in einer Kammer neben dem Pferdestall mit einer Maschine Stroh zu Häckel geschnitten. Für uns Kinder war das ein beeindruckender Vorgang, wenn das große Schneidrad durch eine Kurbel in Bewegung gesetzt wurde und das lang faserige Stroh wie Späne zu Boden fiel. Selbstverständlich durften wir Kinder diese gefährliche Maschine nur von weitem betrachten. Ansonsten wurden wir mit allem rund um das Pferd vertraut.
Genau so interessant waren für uns die Praxisräume, die wir aber außer den Sprechzeiten und erst recht nicht während der Sprechstunde betreten durften. Vater wurde ganz streng, wenn er erfuhr, dass wir in seiner Abwesenheit in den Praxisräumen gewesen waren. Eine Ausnahme machte er jedoch, wenn wir an Wochenenden unsere Eisenbahn im Wartezimmer aufbauen wollten. Wenn er dann nach Hause kam und uns mit anderen Kindern auf dem Fußboden liegend im Wartezimmer, inmitten der Eisenbahn, fand, siegte in ihm seine Begeisterung für das „Dampfross auf Rädern“.
Eine strikte Teilung in Dienst- und Freizeit gab es für den Landarzt nicht. So gesehen war er immer im Dienst, denn eine Geburt, ein schwerer Unfall oder andere, plötzlich auftretende starke Schmerzen fragen nicht nach Dienst- oder Freizeit, nach Tag oder Nacht oder Feiertag. Für seine Patienten war Vater immer da, und das wussten und schätzten seine Patienten an ihm.
Neben einer Krankenschwester half Mutter in der Praxis.
Während des Krieges kamen auch Kriegsgefangene als Patienten, unter anderem Franzosen, Italiener, Holländer, Belgier, Polen und Russen, Menschen aus vielen Ländern Europas, die von deutschen Truppen besetzt waren. Die Gefangenen arbeiteten in der Landwirtschaft, beim Be- und Entladen auf dem Bahnhof oder überall dort, wo deutsche Arbeitskräfte fehlten, die für den Krieg eingezogen wurden.
Holländer und Franzosen waren unsere besonderen Freunde. Uns Kindern schenkten sie manchmal Schokolade, welche sie aus den tiefen Taschen ihrer braunen Militärmäntel zogen. Anfangs waren wir misstrauisch, denn in der Kriegszeit wussten wir zunächst überhaupt nicht, was Schokolade war.
Vater sah es nicht gerne, wenn wir von den Gefangenen Süßigkeiten bekamen, denn fanatische Nazis machten daraus eine Anzeige. In deren Augen war es für einen „guten“ Deutschen unter aller Würde, von einem Gefangenen etwas anzunehmen, aber erst recht nicht, zu geben.
Erst später erfuhr ich, dass gefangene Holländer und Franzosen Hilfspakete vom Roten Kreuz erhielten und den Inhalt meistens auch behalten durften.
Unsere Eltern hatten uns besorgt den Ernst der Lage erklärt, dass die Front, an der erbittert gekämpft wurde, allmählich keine einhundert Kilometer mehr entfernt sei.
Den näher kommenden Krieg spürten wir unter anderem daran, dass Verwundetentransporte durch die Stadt zunahmen und selbst in unserer unmittelbaren Umgebung ein Lazarett eingerichtet wurde.
Während früher in den Ferien die Klassenzimmer für Schulkinder aus den Großstädten des Reiches vorübergehend geräumt wurden, kam jetzt eine Schule nach der anderen für militärische Zwecke in Betracht und der Unterricht fiel aus.
Gern erinnere ich mich an das bunte Markttreiben in unserer Kleinstadt, das jeden Sonnabend im Zentrum von Krettingen organisiert wurde. Bedingt durch das Nationalitätengewirr der nahen Grenze, waren die Angebote auf dem Markt unheimlich interessant und vielseitig. Da kamen neben den Einheimischen auch Polen, Litauer, Russen, Letten und boten an, was sie auch nur bis hierher transportieren konnten.
Neben Obst und Gemüse, Fleisch, Fisch, Pilzen, Honig, Kleinvieh, Hunden und Pferden wurden wertvolle Holzarbeiten und sogar Möbel angeboten, nicht zu vergessen, der Bernstein.
Straßenmusiker schoben sich mit „Fiedel und Quetschkommode“ durch die engen Gassen der aufgebauten Stände und sorgten für die auf dem Markt so typische Atmosphäre. Oft waren die Passagen so eng, dass sich die Vordächer der Stände fast berührten, so dass kaum noch Licht auf die Auslagen fiel, was vielleicht sogar beabsichtigt war. Dazwischen duftete Essen und Trinken verführerisch.
Dieses Markttreiben zog natürlich auch Leute an, die fahrend durchs Land zogen und allzu viel Licht scheuten, vor denen man sich besser in Acht nahm. Großmutter gab immer den Rat: “Saite auf der Hut, jestohlen wird heite überall und haltet eier Jeld zusammen.“ Trotz alledem, oder gerade deshalb, die Besuche des Marktes blieben mir unvergessen.
Mein Bruder und ich verbrachten eine sorglose Kindheit und hatten neben der Schule viel Freizeit.
Unvergessen und in lebendiger Erinnerung bleiben mir auch die Feste in der Familie, wie Geburtstage, Weihnachten und Ostern. Wenn bei solchen Anlässen nicht die Großeltern und Tanten zu Besuch waren, fehlte etwas.
Unterstützt von der Großmutter gab sich Mutter die größte Mühe, die Feste für alle Beteiligten zu einem besonderen Erlebnis zu machen, in dem sie für das leibliche Wohl sorgte, was wir Kinder damals noch gar nicht richtig wahrnahmen und würdigen konnten. Wenn am Abend die Gäste gegangen waren, hörte ich, wenn Vater die Mutter in die Arme nahm und sich bei ihr für den schönen Tag bedankte. An solchen Festtagen hatte sie die Hauptlast zu tragen, während die Familie und der Besuch diesen Tag voll genießen konnten.
Erst als ich älter wurde, merkte ich, dass der Weihnachtsmann der verkleidete Großvater war, denn es fiel mir allmählich auf, dass dieser bei der Bescherung niemals zugegen war.
Auch Ostern gab es Merkwürdigkeiten, die mir früher nicht aufgefallen sind. Bei diesem Fest wurden die Ostereier im nahe gelegenen Auwald versteckt, durch den ein kleiner Bach in kurzen Windungen seinen Weg suchte. An diesem Ostereiersuchen nahmen die ganze Familie und auch die Gäste teil. Je mehr Menschen anwesend waren, umso undurchsichtiger wurde Vaters Trick.
Er trug immer den Korb, in den wir Kinder die gefundenen und von ihm vorher versteckten Ostereier und Süßigkeiten legten. Ich hatte bald bemerkt, dass Vater die Ostereier versteckte und nicht der Osterhase. Um die Osterbescherung nicht zu gefährden, ließ ich ihm aber die Freude zu glauben, wir Kinder hätten das nicht gewusst.
Was wir bei der Prozedur nicht bemerkten war, dass er in einem Augenblick, in dem er sich unbeobachtet fühlte, die von uns bereits gefundenen Ostereier aus dem Korb erneut versteckte. In der Aufregung merkten wir Kinder nicht, dass der Inhalt des Korbes nicht zunahm.
Wenn schlechtes Wetter den Osterspaziergang verhinderte, musste alles im Haus stattfinden. Höhepunkt war ein lebendiges Kaninchen, welches vom Nachbarn ausgeliehen, durch das Wohnzimmer hoppelte und einen riesigen Spaß bereitete. Uns Kindern wurde dann erzählt, dass dieser Osterhase für das Verstecken der Ostereier zuständig sei. Nur Mutter bangte um ihren Teppich, denn der falsche Osterhase könnte ja auch etwas verlieren, was nicht gerade mit Ostern im Zusammenhang stand.
Ähnlich wie zu Weihnachten musste ich als der Ältere vor dem Ostereiersuchen, Goethes Osterspaziergang aufsagen und ich kann ihn heute noch auswendig vortragen, weil er auf diese Weise alle Jahre wieder geprobt wurde. Bei den Tanten erntete ich dafür viel Lob und Beifall für meinen Vortrag.
„Nichts gibt es umsonst“, waren meine stillen Gedanken.
So oft es ging, begleiteten wir den Vater bei seinen ausgedehnten Krankenbesuchen im Landkreis und darüber hinaus. Sein Tätigkeitsfeld erstreckte sich bis über die damalige Reichsgrenze hinaus. Im kleinen Grenzverkehr machte er keinen Unterschied zwischen Deutschen, Litauern und Russen.
Für seine Hausbesuche hatte Vater den einspännigen Dogcart, der von der umgänglichen und sanften Stute Lajana gezogen wurde, denn das Auto, welches sonst für diesen Zweck bereitstand, konnte in Folge des Krieges schon lange nicht mehr benutzt werden. Lajana brachte Vater bei Wind und Wetter, Sommer wie Winter sicher ans Ziel und wieder nach Hause.
Gerade im Winter und davon gab es im äußersten Norden Deutschlands, hier im Memelland, harte Kostproben. Wo das Auto schon längst streikte, war keine Schneeschanze für sein Gespann zu hoch. Diese Überlandfahrten machte Vater an zwei Tagen in der Woche.
Wenn wir Jungs ihn begleiteten, übernahm ich das Kutschieren. Meinen kleineren Bruder Frank nahmen wir in die Mitte. Hinter der Sitzbank befand sich ein Kasten mit einer verschließbaren Klappe, in dem die Tasche mit den Instrumenten und Medikamenten stand.
Auf der Rückfahrt hatte dieser Kasten meistens noch eine andere sehr wichtige Funktion. Dort hinein wanderten allerlei Lebensmittel, wie Eier, eine Milchkanne, ganze Hähnchen und Enten sowie Gemüse aller Art. In der Landpraxis war es üblich, wenn möglich, mit Naturalien zu bezahlen und in der Kriegszeit, als die Lebensmittel immer knapper wurden, war das sehr willkommen.
Um von der Landbevölkerung anerkannt zu werden, musste ein Arzt deren Sprache sprechen. Vater beherrschte nicht nur den ostpreußischen Dialekt, sondern er konnte auch Litauisch und Russisch, selbst die alte Sprache der Kuhren verstand er.
Oft bat man ihn nach der Behandlung eines Patienten auch nach kranken Schweinen und Kühen zu sehen. Nicht selten konnte er in solchen Fällen auch helfen. Nur gut, dass die Anforderung nicht umgekehrt war und Vater wäre Tierarzt gewesen. Als solcher wäre es weit schwieriger gewesen, kranken Menschen zu helfen.
Der Landarzt war dort nicht nur für physische Krankheiten zuständig. Die Leute vertrauten ihm so, dass er auch in vielen anderen Dingen zu Rate gezogen wurde. Er war für die Menschen auf dem Lande nicht nur eine Vertrauensperson als Arzt, sondern auch Pastor, Berater für Finanz-, Versicherungs-, Steuerfragen und andere Dinge. Selbst bei Ehekonflikten wurde er zu Rate gezogen. Dementsprechend lange dauerte auch immer der einzelne Patientenbesuch und wir Jungs mussten vor der Tür auf ihn warten.
Das war selten langweilig, denn meistens waren wir bei Bauern auf dem Hof und da gab es viel Interessantes zu beobachten. Beim Füttern und Melken konnten wir zusehen. Außerdem konnten wir miterleben, wie eine Kuh kalbte, wie Pferde beschlagen und wie ein Schwein geschlachtet wurde. Bei Letzterem verschwand Frank lieber und ließ sich erst wieder blicken, wenn das Schwein an der Leiter hing.
Wenn Vater zu Hause Sprechstunde machte, graste Lajana auf der Weide neben dem Haus. An solchen Tagen übten wir Jungs reiten und Lajana ließ alles über sich ergehen.
Uns fehlte zwar die richtige Reitausrüstung, aber eine zusammengeschlagene, mit einem Gurt auf dem Pferderücken verzurrte Decke tat es auch. Am schwierigsten war das Trab-Reiten, denn auf dem Pferderücken ohne Sattel und Steigbügel hoppelte man von einer Seite zur anderen. Kam das Pferd erst in den Galopp, saß man wie in einem Sessel.
Im Laufe der Zeit lernten ich und auch mein kleinerer Bruder perfekt Reiten. Wir lernten mit Pferden umzugehen, das Füttern, Striegeln und selbstverständlich auch das Ausmisten. Alle diese Kenntnisse sollten uns später noch von großem Nutzen sein.
So oft es möglich war, aber vor allem in den Ferien, besuchten wir die Großeltern in Nimmersatt oder Nimereseta, wie die Litauer es nannten. „Nimmersatt – wo das Reich ein Ende hat“, so spottete man gern über diesen Namen der nördlichsten Ortschaft im damaligen Deutschen Reich.
Gleich am Ortsrand war die russische oder die litauische Grenze. Zwei große nicht zu übersehende Grenzsteine kennzeichneten früher den Grenzverlauf. Sie ragten wie zwei Obelisken aus der Landschaft.
Diese Grenze war die stabilste und langzeitigste Grenze in Europa. Über siebenhundert Jahre gab es hier keine Grenzveränderungen. Das Memelland war wie ganz Ostpreußen ein Einwanderungsland für politisch – und des Glaubens wegen verfolgter Menschen aus vielen Ländern wie Holland, Litauen, Österreich und Russland Es gab dort evangelische und katholische Kirchen sowie jüdische Synagogen und andere Gotteshäuser. In Preußen herrschte, entsprechend der Politik Friedrich des Großen, Glaubensfreiheit. „Jeder möge nach seiner Fasson glücklich werden“, hatte Friedrich erklärt und zum obersten Gebot erhoben. Nimmersatt an der Ostseeküste des Memellandes war erst am Anfang seiner Entwicklung als bescheidener Badeort und erhielt dadurch einen gewissen Auftrieb. Die Landwirtschaft konnte die Bevölkerung auf diesem kargen Boden kaum ernähren. So ist wahrscheinlich auch einmal dieser Ortsname entstanden. Außer dem Kur- und Zollhaus gab es nur wenige, bescheidene Holzhäuser. Hinter den Dünen verlief die Straße, die von Deutschland nach Russland oder Litauen über den dortigen Grenzübergang führte. Zu Friedenszeiten passierten Fußgänger und Fahrzeuge im kleinen Grenzverkehr unbeschwert die Grenze. Festgelegt im Versager2 Vertrag, wurde das Memelland 1918 von den Franzosen besetzt. 1923 überließen die Franzosen den Litauern bei Nacht und Nebel dieses Gebiet. Selbst im Potsdamer Abkommen soll nichts über den Verbleib des Memellandes nach 1945 festgelegt worden sein. Theoretisch untersteht dieses Gebiet immer noch dem Völkerbund, also der UNO. Nach der Besetzung wurde zwar Litauen auferlegt, diesem Gebiet eine Autonomie zuzuerkennen, was aber auch nicht verwirklicht wurde.
Nimmersatt lag nur wenige Kilometer von Krettingen entfernt und war für uns Jungs schnell mit dem Fahrrad zu erreichen. Insbesondere bei gutem Wetter nutzten wir jede Gelegenheit, um bei den Großeltern und am Strand zu sein.
Die Oma und der Opa waren hier geboren und die Großmutter sprach einen ausgeprägten ostpreußischen Dialekt. Ihr bescheidenes, in den zwanziger Jahren selbst erbautes, Holzhaus war nicht das Schloss am Meer, aber gerade weil sie es sich unter großen Anstrengungen und Entbehrungen erbaut hatten und viele glückliche Jahre dort verlebt hatten, hingen sie ganz besonders an diesem Domizil.
Entsprechend der dortigen Tradition hatten sie ein Holzhaus gebaut und an der Ostsee, selbstverständlich mit einem Rohrdach3. Großvater bestand immer auf diese Bezeichnung, denn das Dach war nicht aus Reetgras, wie in der Lüneburger Heide üblich, oder aus Roggenstroh, das als ärmste Dacheindeckung galt. Seeseitig schmückte eine große Dachgaube4, auch „Ochsenauge“ genannt, das Haus.
Wenn wir Jungs an den Wochenenden oder in den Ferien bei den Großeltern waren, hatten wir das dahinter liegende Zimmer, mit Blick auf die Ostsee, ganz für uns. Besonders abends, wenn es dunkel geworden war, konnten wir an Hand der Lichter den Schiffsverkehr auf der Ostsee verfolgen. Wir stellten uns vor, an Bord eines alten Postdampfers auf der Fahrt von Petersburg nach Hamburg zu sein. Natürlich war ich als der Ältere der Kapitän und Frank der Bootsjunge, der wegen guter Führung im Dienst allabendlich befördert wurde, so dass er schon beim Zubettgehen fragte: „Werde ich heute wieder befördert?“ Langsam musste ich aufpassen, dass er nicht höher aufstieg als der Kapitän.
Selbstverständlich wurden die Kommandos laut und deutlich gegeben, so dass sich Großmutter bald von unten meldete und fragte: „Habt ihr noch immer kaine Ruhe nich jefunden? Jetzt wird schleinichst jeschlafen.“
Großvater war in Vorpommern geboren und aufgewachsen, daher sprach er weitgehend neutral ohne ausgeprägten Dialekt. Wenn jemand die napoleonische Besetzung von 1812 erwähnte, konnte Großvater interessante Geschichten erzählen, die er wiederum von seinen Eltern gehört hatte. Jedes Mal unterbrach dann Großmutter: „Aber wir im Memelland waren die asten in Preißen, die sich jegen Napoleon erhoben haben. Denk an General York.“
„War ja auch nicht schwer, Napoleon hatte das Memelland gar nicht besetzt“, entgegnete dann Großvater und fuhr fort: „Wenn die Franzosen in der Gastwirtschaft ‚Omelett o Konfitüre‘ bestellten, mussten das bei uns Eierkuchen mit Blaubeeren sein.
Unter den Kiefern an der Küste von Vorpommern bis ins Memelland konnte man die Blaubeeren damals eimerweise pflücken. Die Marjelchen, die in der Wirtschaft bedienten, verstanden aber kein Französisch und deuteten das Wort ‚Omelett‘ als Mädchennamen. Den Rest übersetzten sie frei nach Gehör, ähnlich klingend: ‚Komm mit vor die Tür!‘“
Bei Großvaters Geschichten wusste man nie so recht, wie viel er ohne „Spinnrad“ gesponnen hat. Richtig spannend wurde es, wenn er von der Kontinentalsperre erzählte. Napoleon hatte nahezu ganz Europa besetzt, um den Handel mit England zu unterbinden. Die Engländer wiederum waren auf diesen Handel angewiesen. Deshalb versuchten sie unbemerkt, meistens nachts, mit ihren Schiffen an die Küsten der von Napoleon besetzten Länder zu kommen, um Getreide und andere landwirtschaftliche Produkte gegen Waren wie englische Tuche, Rum oder andere begehrte Erzeugnisse aus ihren Kolonien einzutauschen.
Meistens haben Fischer mit ihren kleinen Booten die Fracht zu den auf Reede liegenden englischen Blockadebrechern gebracht.
„Auch euer Ururgroßvater hat an solchen Schmuggelfahrten teilgenommen. Die an Land stationierten französischen Soldaten haben scharf geschossen, wenn die Boote bei Zuruf nicht umkehrten.
Einmal ist euer Ururgroßvater, dort hängt sein Bild, in eine wilde Schießerei geraten. Nur die mit Getreide prall gefüllten Säcke boten Schutz vor den französischen Kugeln. In solchen Fällen gaben die Engländer Feuerschutz, wenn es sein musste, auch mit Zehnpfündern aus ihren Kanonen.
Ohne Schaden zu nehmen haben die Fischer noch einmal das englische Kriegsschiff erreicht, aber wie sollten sie wieder zurückkommen? Die Franzosen waren jetzt alarmiert und warteten auf die Rückkehrer. Es blieb nichts anderes übrig, als bei den Engländern an Bord zu bleiben, bis die Franzosen die Verfolgung aufgaben.
Über lange Weile halfen nur große Mengen Rum, davon hatten die Engländer genug. Erst nach zwei Tagen kehrte der Ururgroßvater mit den anderen an einer anderen Stelle des Strandes bei Nacht und Nebel mit seinen eingetauschten Waren zurück. Dort haben sie alles erst einmal in den Dünen versteckt, um es später, wenn die Luft rein war, abzuholen.“
Dafür konnte sich der Großvater noch nach zirka einhundert dreißig Jahren begeistern.
Nimmersatt war für uns die große Freiheit. Hier konnten wir von früh morgens bis zum späten Abend fast alles machen, was wir wollten. Nur wenn wir baden gingen, mussten wir den Großeltern Bescheid sagen und wenn die Wellen zu hoch waren, kam ein strenges Verbot.
In der Blaubeerzeit zogen wir mit Wassereimern bewaffnet in die Wälder, immer nach dem Motto, eins ins Töpfchen, eins ins Kröpfchen. Wassereimer benötigten wir schon, denn es gab mehr als genug von den Blaubeeren. Ähnlich war es zur Pilzzeit, denn es gab auch Pfifferlinge in Überfluss. Um alles nach Hause zu bekommen, wurde ein Fahrrad mitgenommen, an das wir die Eimer hängen konnten.
Abends gab es Eierkuchen mit Blaubeeren oder Pfifferlinge mit Rührei, bevor wir vor Müdigkeit ins Bett fielen.
Im Wald waren wir nicht die Einzigen, die Russen nannten die Pilze Grippe, die Polen suchten Gschippi und die Litauer … Ich weiß es nicht mehr.
Zu den gewissen Zeiten fanden richtige Kampagnen statt, denn die Leute waren auf diesen Zuverdienst angewiesen. Wenn auch nicht auf den Feldern mit den sandigen Böden, aber in den Wäldern wuchs der „Reichtum“.
Die Sommerferien gingen dem Ende zu und am 1. September 1944 sollte die Schule wieder beginnen. An diesem Wochenende wollten die Eltern kommen und uns wieder nach Hause mitnehmen.
Dann saß Frank vorne zwischen Mutter und Vater und ich hinten auf dem „Milchkasten“ unseres Dogcarts. Aber soweit sollte es nicht kommen. Als die Eltern um die Kaffeezeit eintrafen, stürmten wir ihnen schon von weitem entgegen.
Endlich stand das Gespann still und Vater eröffnete seine „Neusten Nachrichten“: „Ich habe zwei Botschaften, für euch, die Gute zu erst. Ihr könnt noch bei den Großeltern bleiben. Die Schule bleibt geschlossen und wird Lazarett.“
Unser Jubel war nicht zu überhören und die Großeltern eilten herbei, um von der freudige Nachricht zu hören.
„Aber nun die schlechte Nachricht“, drängte die Mutter.
„Ja“, sagte Vater. „Ich muss mich schon morgen auf dem Wehrmeldeamt in Memel melden. Ich werde im Kessel von Libau gebraucht.“
„Das kann ich nicht verstehen“, meldete ich mich zu Wort. „Ich denke die Marine holt alle Soldaten aus dem Kessel.“
„Ja, aber bis das geschafft ist, kommen immer wieder neue Verwundete hinzu und es gibt nicht genug Ärzte für die Versorgung“, entgegnete Vater.
Jetzt blieben alle still und Großmutter standen die Tränen in den Augen. Vater war immer Optimist und auch jetzt versuchte er uns zu beruhigen: „Der Krieg wird nicht mehr lange dauern.“
Großvater fügte hinzu: „Auch das Kurhaus hier wurde Lazarett, ein Zeichen dafür, dass die Front immer näher kommt.“
Die Eltern nutzten den Nachmittag für einen ausgiebigen Strandspaziergang mit der ganzen Familie. Nach dem Abendbrot wurde es Zeit für die Heimfahrt, obwohl es zu dieser Jahreszeit noch lange hell war. Wir Jungs konnten zu unserer Freude bei den Großeltern bleiben und nach einem herzlichen Abschied, setzte sich der Dogcart in Bewegung. Niemand ahnte, dass dies ein Abschied für viele schmerzliche Jahre und für die Großeltern ein Abschied für immer werden sollte.
Schon am Nachmittag hörte man in der Ferne Geschützdonner, als wenn ein Gewitter aufzieht, auch aus diesem Grunde drängten die Eltern zum zeitigen Aufbruch.
„An der Front tut sich was“, meinte Großvater besorgt. Hoffentlich nicht zu unseren Ungunsten.
Mir fiel schon heute am Tage auf, dass verstärkt Sankas zum hiesigen Lazarett fuhren.
Die Eltern waren keine zwanzig Minuten unterwegs, als plötzlich verstärkt Artilleriefeuer einsetzte. Neben ihnen auf dem Feld schlug eine Granate ein. Das Pferd scheute und bäumte sich auf. Um sie herum war flaches Ackerland, deshalb verließ der Arzt kurz entschlossen den Weg und lenkte das Pferd zum nahen Wald, um Schutz unter den Bäumen zu finden.
„Wollen wir eine Pause machen?“, fragte er seine verängstigte Frau.
Ohne ihre Antwort abzuwarten, trieb er das Pferd zur Eile an. Sie machten einen großen Umweg, um den Wald nicht mehr verlassen zu müssen und kamen wohlbehalten spät abends zu Hause in Krettingen an.
Etwaige Splitter hatten auch ihre treue Lajana nicht verletzt.
Am darauffolgenden Morgen verabschiedete sich der Vater unter Tränen von seiner Frau. So sehr er sich bemühte Optimismus zu verbreiten, dieses mal konnte Mutter sich nicht wieder beruhigen. Eine tiefe Vorahnung hatte sie befallen.
Es war ein Abschied, bei dem beide nicht im Geringsten ahnten, was ihnen bevorstand.
Auf dem Wehrmeldeamt bekam der Vater seinen sogenannten Marschbefehl und der lautete: Er hätte sich noch heute Abend bis neunzehn Uhr im Memeler Kriegshafen an Bord des Torpedobootes T 26 zu begeben. Noch in derselben Nacht verließ das Schiff den Hafen von Memel mit dem Ziel Libau.
Tagesfahrten, besonders bei guter Sicht, waren wegen dauernder Luftangriffe der Sowjets zu gefährlich. Wie auf einer Gespensterfahrt glitt das abgedunkelte Boot durch das an dieser Stelle enge Fahrwasser des Kurischen Haffs vor Memel, vorbei an Sandkrug mit der alten preußischen Festung. Oft fuhr das Boot nur handbreit an Dalben5, die das Fahrwasser rechts und links einengten, vorbei an halb gesunkenen Schiffskörpern, der Mole entgegen.
Selbst das Feuer der Nordmole an der Ausfahrt in die Ostsee, welches sonst der Orientierung diente, war aus militärischen Gründen außer Betrieb und wurde nur auf Anforderung eingeschaltet. Das Auslaufen aus dem Memeler Hafen glich unter diesen Umständen einer nautischen Meisterleistung. Noch schwerer war es allerdings umgekehrt, bei hoher See, selbst bei Tageslicht, die Einfahrt in den Hafen zu finden.
In derselben Nacht erreichte das Schiff unbeschadet den Hafen von Libau6.