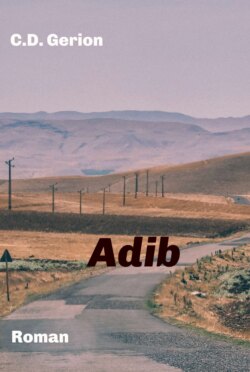Читать книгу Adib - C.D. Gerion - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеErstes Buch – Flucht
Jetzt, wo die Geschichte doch noch ein so tragisches Ende gefunden hat, kommen wir nicht darum herum, alles noch einmal hervorzuholen. All das, was wir schon einmal zusammengestellt hatten, vor einen Dreivierteljahr, als wir sicher waren, es wäre geschafft. Jetzt nämlich müssen wir ein weiteres Kapitel hinzufügen zu den Aufzeichnungen, Protokollen und Tagebucheinträgen aus unseren ersten anderthalb Jahren mit Adib. Es gilt vorbereitet zu sein für den Fall, dass man uns doch noch einmal kritische Fragen stellt. Wir wollen aber auch Klarheit für uns selbst, damit diese Geschichte uns nicht auf Dauer in unseren Alpträumen heimsucht, so wie seine Geschichte unseren Adib. Und möglicherweise werden auch unsere Kinder eines Tages genau wissen wollen, wie es dazu kommen konnte, dass dieses Abenteuer ihrer Eltern so endete.
An den Anfang gehören die Aufzeichnungen, die uns der Junge an einem Tag überreicht hat, an dem wir alle noch voller Optimismus gewesen sind – am Morgen seines achtzehnten Geburtstags:
MEINE FLUCHTGESCHICHTE
– Für Mama Martina und Papa Mitch –
So steht es vorne auf dem weißen Aufkleber, eigenhändig geschrieben von ‚unserem Jungen‘, in sorgfältig ausgemalten Buchstaben. Die mehr als hundert Seiten in dem schwarzen Hefter sind eng bedruckt in Kursivschrift – so, als müssten sich die Buchstaben anlehnen und die Sätze Halt suchen aneinander. Ich weiß noch, wie Martina gestaunt hat. „Das ist ja ein richtiges Buch.“
Heute wissen wir, dass es vor allem sein schlechtes Gewissen war, das den Jungen dazu gebracht hat, die Geschichte seiner Flucht aufzuschreiben – extra für uns. Schlechtes Gewissen, weil er es nicht vermocht hat, uns die eigentliche Geschichte anzuvertrauen. Wir haben diese Seiten damals also zur Kenntnis genommen, ohne den Schlüssel zu ihrem vollen Verständnis zu haben. Sobald der Junge zur Haustür raus war, haben wir es uns in unserer Sitzecke bequem gemacht, um uns sein ‚Buch‘ abwechselnd vorzulesen.
„Du zuerst.“ Ich habe Martina den schwarzen Hefter über den Tisch geschoben. Adib war ja zuallererst ihr Junge.
Martina hat auf das schwarze Cover hinuntergesehen, als würde sie sich fürchten vor dem, was auf den Seiten dahinter zu lesen sein würde. „Nein, du zuerst. Schließlich ist er auch dein Junge.“
„Nein, du zuerst – er hat dich ja im Untertitel an erster Stelle genannt.“
„Okay“, Martina hat einmal tief durchgeatmet. „Aber dann unterbrich mich nicht dauernd.“
. . .
Kabul, Afghanistan
Mir blutet das Herz. Immer wieder, wenn ich nur daran denke. „Du darfst unter keinen Umständen wiederkommen“, hat Tante Khosala gesagt. „Niemals. Und nimm auch nie wieder Kontakt zu uns auf.“ Tante Khosala, Trost meiner Kindheit, letzte Zuflucht in tiefster Not, Tante Khosala hat mich über die Schwelle geschoben und fortgescheucht wie einen bösen Traum. Alle meine Sachen hat sie verbrannt. Meine struppigen Haare hat sie geschoren. Am Ende hat sie mir auch noch eine Baseball-Kappe tief ins Gesicht gedrückt, damit mich auch ja keiner erkennt. Damals habe ich nicht verstanden, wie sie so grausam sein konnte.
Es wurde schon dunkel. Ich musste so schnell wie möglich einen Winkel finden, in dem ich mich für die Nacht verkriechen konnte. Erst am Morgen, um sieben Uhr spätestens, musste ich an der Asmayi Road stehen, am großen Kreisverkehr, an dem auch die Darul Aman in Richtung Nationalmuseum abgeht. Ich aber musste an der Ausfahrt Richtung Westen warten. Ein Lastwagen mit Nummernschild aus Herat würde mich aufnehmen, hatten sie gesagt.
Es begann zu nieseln. Die neuen Schuhe drückten, die steifen Jeans scheuerten auf der Haut, die Gurte des schweren Rucksacks schnitten mir in die Schultern. Mir fiel nur ein einziger Ort in der Nähe ein, an dem ich – mit etwas Glück – niemandem auffallen würde. Zitternd drückte ich mich in die Lücke zwischen der Mauer um den Innenhof der Moschee und dem rissigen Stamm des alten Maulbeerbaums. Damals, im letzten Sommer meiner Kindheit, hatte das dichte Laub dieses Baums meinem Vetter Xatar perfekten Sichtschutz geboten. Jetzt aber – im März – war das frische Grün noch nicht dicht genug. So blieb mir nur der enge, feuchte Winkel auf dem Boden hinter dem Stamm, damit mich niemand bemerkte.
In nicht einmal zwanzig Minuten hätte ich von diesem Versteck aus an den Stätten meiner Kindheit sein können. Hätte hinauflaufen können in den fünften Stock und mit klopfendem Herzen vor unserer Wohnungstür gestanden. Hätte laut „Hallo, ich bin wieder da …“ rufen können. Aber Großvater wäre nicht da gewesen, um mir die Tür zu öffnen. Auch zum Block VI hätte ich hinüberlaufen können, um noch einmal hinaufzusehen zu den Fenstern im dritten Stock. Das aber hätte mir das Herz zerrissen. Auch an meiner alten Schule wäre ich schnell gewesen, aber man hätte mich dort nicht mehr eingelassen. Außerdem gab es ja auch noch den Militärposten direkt gegenüber dem Schultor. Ohnehin hätte mich in dieser Schule niemand mehr als den ‚Kleinen von unserer Zohra‘ begrüßt. Selbst an den Namen meiner Mutter hätten sich die wenigen dort, die sie noch kannten, inzwischen sicher kaum noch erinnert. Nein, meine Kindheit war endgültig tot und begraben. Es war sinnlos, sich an eine Welt zu klammern, die es gar nicht mehr gab. Alles was es gab, war ein Ziel, das ich nicht kannte. Aber ein Ziel immerhin. Wer ein Ziel hat, hat auch wieder Grund, etwas zu hoffen, selbst wenn es nur die Hoffnung auf eine Ankunft irgendwo ist.
Ja, ich musste alles hinter mir lassen und nur noch nach vorne schauen. Das war ich schließlich auch meiner Tante Khosala schuldig. Trotz allem hatte ich es nur ihr zu verdanken, dass es noch einmal so etwas wie eine Hoffnung gab. Najib, mein Onkel, hatte mich schon an der Haustür davonjagen wollen.
„Aber sieh dir den Jungen doch einmal an“, hatte Tante Khosala gerufen. „Und jetzt, im Dunkeln, hat ihn bestimmt auch keiner gesehen.“ Damit hatte sie Onkel Najib beiseitegeschoben, mich ins Haus gezogen und schnell die Tür zugeworfen. Da war ich zusammengebrochen.
Als ich wieder zu mir gekommen bin, habe ich auf dem Bauch gelegen, auf etwas so kühl und so glatt, wie ich es noch nie zuvor gefühlt hatte. Etwas hat an meinen Haaren gezupft, da war ein metallisches Klicken zu hören und irgendjemand atmete schwer. Endlich habe ich die Kraft aufgebracht, meine Augen zu öffnen. Erst habe ich nur schwarze Haarbüschel auf weißglänzenden Fliesen liegen gesehen, dann einen schwarz-rot gemusterten Stoff, über ein paar Knie gespannt. Dann erst habe ich erkannt, dass das Tante Khosala war, die vor meinem Gesicht gekniet hat. Sie war dabei, mir die struppigen Haare zu scheren wie einem Schaf. Ich war nackt! Sie hatten mir die schmutzigen Kleider vom Leib gezogen, bevor sie mich auf ihren sauberen, weißen Fliesen abgelegt hatten. Haben sie etwa gedacht, sie könnten mir so meine Vergangenheit abstreifen?
Tante Khosala hat wohl gemerkt, wie ich mich verkrampft habe. „Keine Angst, Adib. Jetzt bist du erst einmal sicher“, hat sie leise gesagt. Das Mitleid in ihrer Stimme brachte etwas tief in mir zum Schmelzen. „Lass die Tränen nur fließen. Die duschen wir dann auch gleich mit ab.“
Ich hatte das Haus von Onkel Najib und Tante Khosala im Stadtteil Karta-i-Seh erst gar nicht wiedererkannt. Damals, als sie geheiratet hatten, war es ein etwas heruntergekommenes Haus auf einem großen Grundstück gewesen. Inzwischen war daraus eine prächtige Villa geworden. Ich erinnerte mich, dass Onkel Najib noch in meiner Zeit in Kabul den Auftrag erhalten hatte, in seiner Druckerei die Schulbücher für das ganze Land zu drucken. Welch ein Wunder, dass man durch Bücher reich werden konnte!
Die glatten Fliesen, diese herrliche Dusche, aus der heißes Wasser kam, alles glänzend und neu. Und dann erst das Bett. Als ich das erste Mal in diesem Hause gewesen war, am Abend von Tante Khosalas Hochzeit, sieben Jahre zuvor, hatten wir als die engsten Verwandten des Brautpaars uns um das riesige Bett im Hochzeitszimmer gedrängt und gestaunt. Ich, damals gerade neun Jahre alt, hatte an einer Ecke des Fußendes heimlich über die seidig glänzende Überdecke gestrichen und mir vorgestellt, wie es sich wohl anfühlen würde, in so einem Bett zu liegen.
Inzwischen gab es anscheinend mehrere Schlafzimmer im Haus, in denen richtige Betten standen wie in einem amerikanischen Film. In eines dieser Zimmer im ersten Obergeschoß hat mich Tante Khosala geführt, nachdem sie mit mir fertig gewesen ist. Hemd und Hose von Onkel Najib sind mir lose um den Körper geschlottert. Ich habe mich in das Bett fallen lassen. Als die weiche Decke über mir zufiel, war es, als versänke ich in einem tiefen, warmen See. Ich müsse die ganze Zeit leise sein, hat Tante Khosala gesagt. Damit mich die Mädchen nicht hörten.
Die drei Tage und Nächte, die ich in diesem Zimmer weggesperrt war, habe ich die meiste Zeit nur geschlafen oder gedöst. Nicht einmal Alpträume hatte ich. Kann man zu erschöpft sein, um Alpträume zu haben? Als ich das erste Mal wieder aufgewacht bin, hat eine ganze Schüssel Kabuli Pilau mit Lammfleisch und vielen Rosinen auf dem Stuhl neben meinem Bett gestanden. Später, wenn ich zwischendurch wach lag, habe ich kaum gewagt, mich zu rühren. Ich hatte Angst, durch eine unbedachte Bewegung herauszufallen aus diesem watteweichen Traum, diesem Zustand zwischen Tod und Paradies.
Vom Kampf um mein Schicksal habe ich immer nur Bruchstücke mitbekommen: Wortfetzen einer etwas lauteren Diskussion unten, ein kurzes, heftiges Wort direkt vor meiner Tür, Austausch gemurmelter Argumente nebenan in der Nacht: „… muss sofort aus dem Land … kommt er nie durch … Flug von Peschawar nach Maschhad … Paschtunengebiete … wissen doch, wie er aussieht … geht nicht, in seinem Zustand … Landweg … Straßensperren … ohne Papiere …“ Ja, sie hatten Angst. Aber sie wollten mir helfen.
Einmal auch: „Nauroz …“ Ein Wort aus einer anderen Zeit, ein Wort, wie ein Versprechen, ein Wort, das sie einem aus dem Kopf schlagen und aus dem Körper peitschen wollen, weil es all das verheißt, was ihnen ein Gräuel ist: Musik – Tanz – die Feier des Lebens. Gleich als Tante Khosala mir das nächste Mal Essen ins Zimmer gebracht hat, habe ich nachgefragt. Ja, in zwei Tagen war der einundzwanzigste März. An dem Abend kämen Gäste ins Haus. Eine Party zur Feier des Frühlingsfests. Wichtige Gäste. Bis dahin müsse ich aus dem Haus sein. Ich habe noch die Tränen in ihren Augen gesehen, als sie sich abgewandt hat, um aus dem Zimmer zu gehen. Nach Großvater zu fragen und ob sie etwas von ihm gehört hätten, habe ich gar nicht gewagt. Und ihnen ist es in der restlichen Zeit ja ohnehin nur noch darum gegangen, mir einzuschärfen, was ich für die Flucht wissen musste …
Plötzlich schreckte ich hoch. Etwas Heißes breitete sich aus, unten am Bein. Ein großer, magerer Köter stand da – mit dem Hintern zu mir und einem Bein in der Luft. Der heiße Urin sickerte mir durch die Hose und bis in den Schuh. Einen Aufschrei konnte ich gerade noch unterdrücken. Später begann ein kalter Nieselregen aus der Finsternis über mir auf mich herniederzugehen. So tief es ging, verkroch ich mich in meine neue, gefütterte Jacke. Gegen Morgen fingen meine Zähne vor Kälte so laut zu klappern an, dass ich Angst bekam, jemand könnte mich hören. Da kroch ich aus meinem Versteck und machte mich auf den Weg.
Ich hatte schon über eine Stunde an dem Kreisel gestanden, da endlich näherte sich ein Lastwagen mit Kennzeichen aus Herat. Auch die fünfstellige Zahl hinter dem HRT stimmte. Ich begann, wild zu winken. Ich hatte Angst, der Fahrer könnte mich übersehen. Er bremste erst in letzter Minute. Ich rannte, als ginge es um mein Leben. Die Tür des Fahrerhäuschens flog auf, ich wurde nach oben gerissen und im nächsten Moment schon presste mich die zuschlagende Tür an den kräftigen Jungen, der mich zu sich hinaufgezogen hatte.
Der Fahrer fluchte und trat aufs Gas. Gleichzeitig langte er an seinem Beifahrer vorbei und riss mir die Baseball-Kappe vom Kopf. „Sowas hier vorne bei uns, und die winken uns an jedem Kontrollpunkt an die Seite. Und dann auch noch kahlgeschoren – wie ein entlaufener Soldat. Gib ihm deine Pakol.“ Sein junger Helfer grinste, zog seine schmutzig- braune Mütze ab – eine von der Art, wie sie bei uns Leute aus den Bergen tragen – und drückte sie mir auf den Kopf.
„Außerdem stinkt er nach Hundepisse. Bei der nächsten Gelegenheit muss er nach hinten.“ Der Mann schien mich nicht zu mögen. Er war ein vierschrötiger Typ mit rundem Gesicht, breiter Nase und schmalen Augenschlitzen, der mich an ein Bild von Dschingis Khan aus einem meiner alten Kinderbücher erinnerte. Offenbar ein Hazara. Das Einzige, was mich beruhigte, war das Wissen, dass er erst dann voll bezahlt werden würde, wenn er mich unversehrt über die iranische Grenze gebracht haben würde. Das hatte mir Onkel Najib gesagt. Ansonsten wusste ich nur, dass die Reise bis Endstation Italien ‚gebucht‘ und entsprechend Geld hinterlegt war. Danach würde ich mich allein durchschlagen müssen. Am besten bis nach Deutschland, hatte mir Onkel Najib geraten. Angeblich bekam man dort als Flüchtling gleich eine Wohnung und sogar Geld vom Staat. Das hatte er mir aber wohl nur erzählt, um mir die Angst vor der langen und gefährlichen Reise zu nehmen. Ich aber wollte sowieso lieber nach Frankreich …
Ein Stoß in meine Seite schreckte mich aus meinen Gedanken. „Hey, willst du nicht langsam mal deinen Rucksack abnehmen? Oder hast du da einen Goldschatz drin?“ Der Gehilfe Dschingis Khans zwinkerte mir zu. Er schien kaum älter zu sein, als ich, war aber viel kräftiger. Wie sein Boss hatte auch er die typischen Gesichtszüge der Hazara. Er half mir, meinen Rucksack herunterzunehmen und zwischen meinen Füßen zu verstauen.
Je weiter wir aus dem Stadtgebiet von Kabul herauskamen, desto mehr lichtete sich der Verkehr. Wir fuhren ein Stück weit an einem Flüsschen entlang. Das Wasser glitzerte in der aufgehenden Sonne. Beim Anblick der bereits rosa und weiß blühenden Obstbäume am Ufer und der dahinter in frischem Grün leuchtenden Felder entfuhr mir ein Seufzer. Der lange Winter war endlich zu Ende. Das Leben kehrte zurück.
Die Autobahn machte eine scharfe Rechtskurve und unmittelbar danach trat der Fahrer erneut voll auf die Bremse. Auf einer Brücke über ein ausgetrocknetes Flussbett kamen wir zum Stehen. „Yallah! Los, raus. Raus!“, bellte Dschingis Khan in meine Richtung. Sein Helfer stieß die Wagentür an meiner Seite auf und schubste mich aus dem Führerhaus. Ich wäre hingestürzt, hätte ich nicht sofort das Brückengeländer zu fassen bekommen. Da flog auch schon mein Rucksack auf mich zu. Der Junge sprang hinterher. Auch er brüllte jetzt „Yallah, Yallah“ und trieb mich durch den schmalen Zwischenraum zwischen Brückengeländer und LKW nach hinten, löste mit einigen geübten Griffen die Plane, ließ die Ladeklappe herunter und warf meinen Rucksack in den schmalen Zwischenraum zwischen zwei großen Holzkisten, die gleich vorn auf der Ladefläche standen. Dann half er mir hinauf.
Ich quetschte mich zwischen die Kisten, die fast so hoch waren wie ich. Die Ladeklappe schloss sich mit einem Knall, die Plane fiel zu und wurde festgezurrt. „Mach dich unsichtbar“, hörte ich noch, dann stand ich im Dunkeln. Ich hatte gerade noch sehen können, dass weiter hinten Kartons und Autoreifen gestapelt waren. Kaum hatte ich mich zwischen den Kisten hindurchgezwängt und mir einen Sitzplatz zwischen den Autoreifen ertastet, erzitterte der Laster und setzte sich ruckartig in Bewegung.
Eigentlich hätte ich wütend sein sollen auf den jungen Kerl, der mich wie ein Stück Vieh vor sich hergetrieben und in dieses finstere, nach Motorenöl stinkende Loch eingesperrt hatte. Aber der hatte ja nur die Anweisungen seines Bosses befolgen müssen. Der befürchtete wohl, dass es vor Maydanschahr – den Namen der Stadt hatte ich kurz zuvor noch auf einem Hinweisschild gelesen – schon eine erste Kontrolle geben könnte. Bei dem Gedanken an eine mögliche Kontrolle und daran, dass meine Flucht ein Ende finden könnte, bevor sie richtig begonnen hatte, spürte ich ein Würgen im Hals. Außerdem hatte ich Durst.
Ich tastete nach meinem Rucksack, der zwischen die Reifen gerutscht war. Innerhalb kürzester Zeit war meine Feldflasche leer. Onkel Najib hatte mir gesagt, dass die Schlepper auch dafür bezahlt wurden, mich unterwegs mit Essen und Trinken zu versorgen. Aber bei dem Motorenlärm und Gerüttel hatte ich keine Chance, mich bemerkbar zu machen. Trotzdem arbeitete ich mich langsam über die Stapel von Reifen, Holzkisten und Kartons Richtung Führerhaus vor. Schließlich musste ich rechtzeitig vor der ersten Kontrolle auch noch ein Plätzchen finden, um mich unsichtbar zu machen. Direkt vor dem Führerhaus stieß ich auf eine ganze Wand aus Kartons, die mir bis unters Kinn reichte. Beim Herumtasten stellte ich fest, dass es dahinter noch einen Hohlraum gab, wohl gerade groß genug, um im Fall einer Kontrolle darin verschwinden zu können.
Es kam aber keine Kontrolle. Stattdessen ging der Laster kurz darauf plötzlich in eine so enge Rechtskurve, dass ich gegen eine der Kisten geschleudert wurde. Zum Glück hatte ich die dicke Jacke an, die den heftigen Stoß gegen meine Schulter abpolsterte. Sobald der Schmerz etwas nachließ, klemmte ich mich in eine Lücke zwischen einem Stapel Reifen und einem großen Karton, in der ich mich vor weiteren solchen Unfällen geschützt glaubte.
Dann erst fiel mir auf, dass unser Fahrer jetzt häufiger hupte, bremste und schaltete und gelegentlich Hindernissen oder Schlaglöchern auszuweichen schien. Das konnte nur eins bedeuten: Wir waren von der Fernstraße abgebogen. Wir nahmen die Landstraße durch die Berge! Ich war davon ausgegangen, dass wir bis Herat auf der A 01 bleiben würden. Noch aus dem Erdkundeunterricht hatte ich den riesigen Bogen vor Augen, den diese Fernstraße durch den ganzen Süden Afghanistans macht, bevor sie wieder in Richtung Norden auf Herat zuführt und damit in die Nähe der iranischen Grenze kommt. Das war zweifellos die am besten ausgebaute und damit schnellste Strecke dorthin.
Herat 1.070 km. Auch das hatte ich auf einem Hinweisschild gelesen, als ich noch vorne gesessen hatte. Ich hatte mir ausgerechnet, dass wir so in gut zwei Tagen in der Nähe der iranischen Grenze sein könnten. Aber jetzt durch die Berge? Das konnte eine Woche dauern. Sogar länger. Mir wurde schwindelig. Der Fahrer wollte wohl die Gebiete im Süden vermeiden, die von den Taliban kontrolliert wurden. Ich aber wusste nicht einmal, wovor ich mehr Angst haben sollte: Vor einem Hinterhalt der Bärtigen oder vor einer Kontrolle durch die Armee.
Laute Stimmen weckten mich auf. Wir standen. Mir war kalt. Ich hatte Hunger. Schlimmer noch war der Durst. Außerdem musste ich pinkeln. Motoren wurden abgestellt oder angelassen. Es roch nach Benzin. Offenbar eine Tankstelle. Kaum war ich zu diesem Schluss gelangt, da spürte ich am Vibrieren des Bodens, dass auch unser Motor wieder angelassen wurde. Am liebsten hätte ich laut geschrien. Hatten die mich etwa vergessen?
Ich hatte zuvor festgestellt, dass die Bretterwand, die die Ladefläche nach vorne hin abschloss, bis ganz nach oben reichte. Es war also nicht möglich, direkt ans Führerhaus zu klopfen. Vielleicht würden die mich dort drin aber hören, wenn ich mit meiner Feldflasche gegen die Bretter schlug. Ich arbeitete mich ganz nach vorn durch und kletterte dort auf die großen Kartons. In dem Moment wurde der Laster so abrupt abgebremst, dass ich fast in den Zwischenraum gerutscht wäre, den ich vorher entdeckt hatte. Ich konnte mich gerade noch rechtzeitig festklammern.
Wir bogen ab auf einen offenbar unbefestigten Weg, es schaukelte heftig, wir fuhren bergauf. Mehrmals ging es um Kurven, abwechselnd nach links und nach rechts – Serpentinen.
Endlich kam der Laster zum Stehen. Jemand rief etwas. Dann ein Quietschen und Einrasten, als würde hinter uns ein Metalltor geschlossen. Ich tastete mich hastig wieder zurück Richtung Ausstieg. Dort hörte ich schon jemanden hantieren. Ich steckte noch in dem Zwischenraum zwischen den beiden Holzkisten, als bereits die Ladeklappe herunterfiel.
Auch draußen war es dunkel, aber ich erkannte die Umrisse des Jungen. „Komm raus“, rief er mir mit gedämpfter Stimme entgegen. Mit den Füßen voran rutschte ich auf dem Bauch von der Ladefläche. Ich musste mich abstützen, so wackelig war ich im ersten Moment auf den Beinen. Der Junge lachte. Dann zeigte er auf den schwachen Lichtschein, der aus der angelehnten Tür des schlichten Lehmhauses fiel, vor dem wir standen. „Essen“, sagte er und führte seine Fingerspitzen zum Mund, als hielte er bereits ein zur Kugel geformtes Reisbällchen dazwischen. Ich hätte ihn umarmen können. „Erst pinkeln“, sagte ich. Er wies auf eine Mauer gegenüber und verschwand dann im Haus.
Obwohl ich völlig erschöpft war, lag ich nach dem Essen noch länger wach. Der Besitzer dieser Herberge, der Fahrer, sein Helfer und ich lagen aufgereiht nebeneinander auf dem Boden in dem Raum, in dem wir gegessen hatten. Die beiden Frauen unseres Wirts, die uns bedient hatten, schliefen in dem kleinen Küchenanbau nebenan, in dem auch meine Sachen trockneten. Außer dem Schnarchen des Fahrers, dem gelegentlichen Grunzen unseres Wirts und hin und wieder Hundegebell in der Ferne war kein Laut zu hören. Es war, als hätte man mich in meine Zeit in den Bergen zurückversetzt. Seltsamerweise war der Gedanke daran in dieser Nacht mit so etwas wie einem Gefühl von Vertrautheit und Heimat verbunden.
Beim Essen hatte mich der Junge gefragt, wo ich eigentlich hinwollte. Nach Maschhad – da hätte schon ein Bruder von mir Arbeit in einer Ziegelei, hatte ich behauptet. Diese Antwort hatte mir Tante Khosala eingeschärft. Es solle bloß keiner auf die Idee kommen, dass ich eine längere Reise vorhätte und dafür vielleicht eine größere Summe Geld dabeihaben könnte.
Dschingis Khan hatte mich durchdringend angesehen. Dann hatte er mir mit seiner Pranke auf die Schulter geschlagen, mit der ich zuvor gegen eine Kiste geprallt war. Mit Mühe hatte ich einen Aufschrei unterdrückt. „Verdammt schwere Arbeit – da wünsche ich dir viel Glück“, hatte er gerufen. „Jedenfalls schwerer als das, was mein Neffe Karim bei mir zu tun hat.“ Damit hatte er seinem jungen Helfer auch einen kräftigen Klaps versetzt. „Dafür muss der dir aber gleich noch zeigen, wo du dich waschen kannst. Sonst haben wir noch die ganze Nacht diesen Geruch in der Nase“, hatte er mit einem vielsagenden Seitenblick auf mein eines Hosenbein hinzugefügt.
Offenbar war er gutmütiger, als ich gedacht hatte. Ab da war ich zuversichtlich, dass er alles tun würde, um mich sicher in den Iran zu bringen. Mit diesem Gedanken bin ich am Ende des ersten Tages meiner Flucht schließlich eingeschlafen.
Karim rüttelte mich wach. „Auf, Wasser holen“, sagte er und stellte einen großen Plastikkanister neben mir ab. Sein Onkel und unser Wirt tranken da bereits in aller Ruhe ihren Morgentee. Ich lief dem Jungen hinterher nach draußen, wo es im Osten gerade erst zu dämmern begann. Wir liefen den steilen Pfad hinter dem Haus hinauf zu der Quelle des Bergbachs, in dem ich mich am Abend noch schnell gewaschen hatte, und füllten dort unsere zwei Kanister mit dem eiskalten Wasser.
Bevor wir uns auf den Rückweg machten, zeigte Karim zu dem unterhalb unserer Herberge gelegenen Dorf hinunter und von da aus weiter das frühlingsgrüne Tal entlang Richtung Westen. In der Ferne ließen in diesem Moment die ersten Strahlen der aufgehenden Sonne eine Reihe schneebedeckter Berggipfel rosa erglühen. „Koh-i Baba“, sagte er, „da entlang geht es weiter.“
Als ich kurz darauf wieder in den düsteren Laderaum kletterte, reichte er mir noch einige zusammengerollte Brotfladen zu und stellte einen der beiden Wasserkanister zu mir auf die Ladefläche hinauf. Er schärfte mir ein, möglichst wenig zu trinken. Wahrscheinlich würden wir wieder den ganzen Tag und bis in die Nacht ohne Halt durchfahren. Und wenn sein Onkel eines hasste, wäre das ein vollgepinkelter Laderaum. Außerdem würde das bei einer Kontrolle auch sofort auffallen. Wie lange wir wohl brauchen würden bis Herat, fragte ich noch schnell. Sechs, sieben Tage – wenn wir Glück hätten, war die knappe Antwort. Dann fiel die Plane zu und es wurde dunkel im Laderaum.
Die folgenden Tage kamen mir endlos vor. Wir fuhren meist den ganzen Tag durch und hielten erst nach Einbruch der Dunkelheit, manchmal an einer ähnlichen Herberge, wie in der ersten Nacht, manchmal aber auch nur irgendwo abseits der Straße, wo ich kurz austreten durfte. Aber zum Schlafen musste ich immer wieder in den Laderaum. Die meiste Zeit über hatte ich Durst. Ich versuchte, den ganzen Tag mit dem einen Liter Wasser auszukommen, den ich mir morgens aus dem großen Plastikkanister in die Feldflasche abfüllte. Auch die Kälte war schlimm, vor allem nachts in meinem nur durch die dünne Plane geschützten Versteck. Je höher wir in die Berge hinaufkamen, desto eisiger wurde es. Oft zog ich mir die schmutzige, nach Motoröl stinkende Decke, die Karim mir vor der ersten Nacht draußen im Laster zugeworfen hatte, sogar bis über das Gesicht. Noch schlimmer war, dass die Straße immer schlechter wurde. Über weite Strecken war es nur eine aus lauter Schlaglöchern bestehende Piste. Über Stunden wurde ich durchgeschüttelt und musste mich, wenn der Laster um irgendwelche Hindernisse herumkurvte, immer wieder längere Zeit irgendwo festklammern. Bald tat mir jeder Knochen und jeder Muskel weh.
Während eines nächtlichen Halts, bei dem ich kurz austreten durfte, war es mir in einem unbeobachteten Moment gelungen, eine der Schnallen zu lockern, die an der Rückseite des Lasters ringsum die Plane verschlossen. Ab da konnte ich wenigstens hin und wieder einen Spalt öffnen und schräg nach hinten hinaussehen. So kam ich mir nicht mehr ganz so eingesperrt vor und der Tag verlor ein wenig von seiner Eintönigkeit.
Über weite Strecken folgte die Straße den Flusstälern. Manchmal konnte ich direkt in tosende Bergbäche hinuntersehen. Dann wieder glitten auf meiner Seite schroffe Felswände so nah vor meinen Augen vorbei, dass ich sie beinahe hätte berühren können. Wenn ich dann starr geradeaus auf den vorbeihuschenden Fels blickte, schien es kein Halten mehr zu geben. Das schroffe Gestein wurde zu einem flatternden Band, und es gefiel mir, an die Helden meiner Kindheit zu denken, wie sie in wildem Ritt durch die Steppe ihren Feinden davongaloppierten …
Ich musste geschlafen haben. Ich schreckte hoch, weil ich laute Stimmen hörte. Wir standen. Ein feiner Streifen Licht verriet mir, dass es draußen noch hell war. Anscheinend hatte ich meinen Sehschlitz nicht sorgfältig genug verschlossen. So viele Stimmen auf einmal hatte ich schon seit Tagen nicht mehr gehört. Jemand lachte laut. Ein Kontrollposten war das nicht. Autotüren wurden zugeschlagen. Dann auch die unseres Lasters, wie ich am kurzen Erzittern meines Gefängnisses merkte. Wir fuhren an, nur um nach wenigen Minuten rüttelnder Fahrt wieder stehen zu bleiben.
Jemand stieg aus und dann hörte ich, wie mein Name gerufen wurde. Laut, denn im Hintergrund rauschte es. Dann machte sich jemand an der Plane zu schaffen. Ich erschrak. Jetzt haben sie meinen Sehschlitz entdeckt, dachte ich. Mit angehaltenem Atem wartete ich im Schutz der großen Holzkiste vor der Ladeklappe. Dann fiel Licht in den Laderaum und ich erkannte Karims Stimme. „Hier für dich“, rief er. Ich wagte mich hinter meiner Kiste hervor, und dann sah ich, was er mir da unter der Plane entgegenstreckte: Ein ganzes Bündel Kebab-Spieße! Ich konnte es nicht glauben. „Nimm schon, wir müssen weiter“, hörte ich ihn rufen. Ich zwängte mich zwischen den Kisten hindurch. Hinter Karims grinsendem Gesicht strömte ein schäumender Fluss unterhalb einer Felswand vorbei.
„Eben, an der Brücke, gab es einen Verkaufsstand. Wohl die letzte solche Gelegenheit für längere Zeit“
„Wie weit ist es denn noch?“, fragte ich.
„Noch ein paar Tage. Wir sind ja erst in Tschaghtscharan. Der schwierigste Teil der Strecke liegt noch vor uns.“ Damit ließ er die Plane herunter. Ich stand wieder im Dunkeln, eingehüllt in den köstlichen Duft der Fleischspießchen.
Plötzlich saßen wir fest. Vor uns ein Laster, der wegen eines Steinschlags nicht weiterkam, wie ich kurz darauf von Karim erfuhr. Wir hatten das Flusstal schon vor längerer Zeit verlassen. Seitdem hatte sich die Piste in Serpentinen hinauf und hinunter durch schroffe, baumlose Berge gewunden, immer wieder an schwindelerregenden Abgründen entlang.
Hinter uns stauten sich bald weitere Fahrzeuge. Als die Fahrer endlich die Strecke freigeräumt hatten, fuhren wir in Kolonne. Für mich bedeutete das: Ich durfte auch bei den seltenen kurzen Zwischenstopps mein finsteres Versteck nicht mehr verlassen. Karim kam dann und tat so, als müsse er nach der Ladung sehen oder die Trinkflaschen für sich und seinen Boss auffüllen, um mir unauffällig in Zeitungspapier eingewickelte Brotfladen oder getrocknete Feigen zu hinterlassen. Nicht einmal meinen Sehschlitz konnte ich mehr nutzen. Jede ungewöhnliche Bewegung der Plane hätte den Männern im Laster hinter mir auffallen können.
Wir fuhren nun Tag und Nacht durch. Offensichtlich wechselten sich die Fahrer und ihre Beifahrer ab. Auch Karim übernahm zeitweise das Steuer, wie er mir mitteilte. Wahrscheinlich hatte ich ihn wegen seines weichen, runden Mogolengesichts jünger geschätzt als er war.
Ich verlor endgültig jegliches Zeitgefühl und schließlich auch jedes Gefühl für meinen durchgerüttelten Körper. Manchmal schien jede Muskelfaser und jeder Knochen zu schmerzen, dann wieder musste ich in dem harten Nest aus Reifen, das ich mir gebaut hatte, meine Position immer wieder in kurzen Abständen ändern, um überhaupt noch etwas zu spüren. Manchmal glaubte ich hellwach zu sein, nur um im nächsten Moment aus einem wirren Traum zu erwachen.
Es muss zwei oder drei Tage später gewesen sein, als wir einen besonders hohen Pass überquerten. Für mehrere Stunden wurde es eiskalt. Anschließend ging es eine längere Strecke steil bergab. Plötzlich begann unser Laster zu schlingern und blieb schließlich stehen. Es war wie eine Erlösung. Kein Gerüttel mehr, kein Motorenlärm, kein Warten auf den nächsten Stoß, bei dem man blitzschnell Halt suchen musste. Ich hörte die Männer draußen werkeln und fluchen. Offenbar eine Reifenpanne. Ich versuchte krampfhaft, nicht in den Schlaf zu fallen, aus Angst, dass ich schnarchen könnte und die mich draußen hören würden.
Ich wurde erst wach, als wir bereits wieder fuhren. Es ging weiter rüttelnd und schüttelnd bergab. Ich lag nur noch teilnahmslos zwischen den Reifen. Selbst dass es allmählich wärmer wurde, war mir gleichgültig. Es kam mir vor, als wäre ich schon seit Wochen unterwegs, und immer noch war ich in Afghanistan. Dass ich in wenigen Wochen in Italien sein würde, hatte Onkel Najib offenbar nur gesagt, um mich möglichst schnell und problemlos loszuwerden. Ob oder wann mich dieser Laster über die Grenze in den Iran bringen würde, machte letztlich auch keinen Unterschied mehr. Dort würden die Probleme ja wohl erst richtig beginnen. Auf einmal erschien die Lage mir aussichtslos. Nur mit Mühe konnte ich mich noch dazu bringen, weiter den kleinen Blechkanister zu benutzen, den Karim mir nach hinten gebracht hatte, statt einfach in die Ecke zu pinkeln. Es war ja doch alles egal.
„Aussteigen!“ Ich wusste erst gar nicht, wo ich war. Schwere Stiefel knallten auf Pflaster. „Los, los!“ Das kam von vorne. Eine Kontrolle!
Die Türen des Führerhauses wurden mit so einem Schwung zugeworfen, dass der ganze Laster erzitterte. Vielleicht wollte Dschingis sicherstellen, dass auch ich wach war. Hektisch tastete ich nach meinem Rucksack. Der musste hier irgendwo dazwischengerutscht sein. Endlich bekam ich einen Riemen zu fassen.
Die Stiefel kamen näher. Jemand schlug von außen an die Plane. „Aufmachen!“ Ich turnte über Reifen und Kisten Richtung Führerhaus.
„Beeilung! Wir haben nicht ewig Zeit.“
„Komm ja schon.“ Das war jetzt Dschingis Khans laute Stimme. Offenbar wollte er Zeit gewinnen. Trotzdem war ich gerade erst auf die vorderste Reihe von Kartons geklettert, als sich schon jemand an der Plane hinten zu schaffen machte. Vorsichtig ließ ich den Rucksack in den schmalen Zwischenraum vor der Wand zum Führerhaus hinunter und legte mich quer über die Kartons auf den Bauch, um dann mit den Füßen voran in mein Versteck hinterherzurutschen. Im gleichen Moment krachte die Ladeklappe nach unten. Helles Licht fiel in den Laderaum. Ich plumpste ins Dunkel. Ich musste in die Knie gehen, um ganz hinter den Kartons zu verschwinden. Es war viel enger, als ich gedacht hatte. Ich versuchte, mich möglichst geräuschlos zurechtzuruckeln. Ich merkte sofort, in dieser hockenden Position würde ich es nicht lange aushalten können.
„Ladung?“
„Ersatzteile, Reifen, Motoröl – für zwei Autowerkstätten in Herat“, hörte ich Dschingis Khan antworten.
„Und das hier?“
„Generatoren. Zwei Stück. Für die Polizei in Herat.“
Beim Wort Polizei zuckte ich unwillkürlich zusammen. Dann aber verstand ich. Deshalb also versperrten diese zwei großen Holzkisten ganz vorne den Blick und den Weg in den Laderaum. Eine wichtige Lieferung für die Polizei, die möglichst vom Rest der Ladung ablenken sollte. Ein raffinierter Hund, unser Dschingis Khan.
„Aufmachen! Und ich will die Papiere sehen!“ So leicht ließen die sich also doch nicht an der Nase herumführen. Ich hörte, wie der Fahrer nach vorne spurtete. Jetzt hatte er es auf einmal besonders eilig. Ich verstand auch gleich, warum. Jemand wuchtete sich schon hinten auf die Ladefläche hoch. Ich hörte die schweren Stiefel auf dem Boden kratzen.
Einen Moment blieb es still. Dann krampfte sich alles in mir zusammen. Ein Lichtkegel wanderte langsam über die Bretterwand über mir. Der Soldat suchte offenbar mit einer Taschenlampe systematisch den Laderaum ab. Was, wenn ihm mein ‚Schlafnest‘ ins Auge fiel. Wie ein zufällig verrutschter Stapel Autoreifen sah das wohl nicht aus. Ich hielt den Atem an.
Wieder ein lautes Kratzen. Schob der Soldat etwa die beiden Holzkisten auseinander?
Ich hörte, wie die Tür des Führerhauses zugeschlagen wurde und Dschingis Khan zurückgespurtet kam. „Hier die Papiere.“
Es knarrte und quietschte. Holz splitterte. Ein Stemmeisen? Jemand knurrte und murmelte etwas. Papier raschelte.
„In Ordnung.“
Ich hoffte inständig, dass es nun endlich wieder dunkel werden würde im Laderaum. Ich kauerte so verdreht in meinem engen Versteck, dass ich nicht richtig durchatmen konnte. Der Schmerz in den Knien wurde schier unerträglich. Dschingis aber fing nun auch noch eine Unterhaltung an. Ob es etwa wieder einen Zwischenfall gegeben habe.
Zu meiner Überraschung gab der Soldat bereitwillig Auskunft. Ein Anschlag der Taliban auf einen Militärkonvoi – am Tag zuvor – direkt an der Abzweigung nach Tschesht-i Sharif.
Wie denn die Lage auf der weiteren Strecke Richtung Herat sei, fragte Dschingis weiter. Am liebsten hätte ich laut gerufen, ob sie sich nicht anderswo unterhalten könnten.
Die nächsten hundert Kilometer seien problematisch. Die sollten wir auf jeden Fall in einem Stück durchfahren und dabei immer auf der Fahrbahn bleiben. Auch keine kurzen Ausweichmanöver auf die Seitenstreifen. Die verfluchten Sprengfallen … Ich hörte, wie Dschingis Khan sich bedankte.
„Aussteigen, Laderaum öffnen!“ Das galt jetzt offenbar schon dem nächsten Laster. Mit lautem Krachen wurde unsere Ladeklappe zugeworfen. Das Geräusch der einrastenden Verschlusshaken klang wie Musik in meinen Ohren. Dann fiel die Plane zu. Ich wartete nicht einmal ab, bis sie ganz zugezurrt war. Trotzdem hatte ich mich erst aus meinem Versteck herausgearbeitet, als unser Laster schon anruckte.
Unter uns breitete sich, sonnenüberglänzt, ein weites, grünes Tal aus. In der Talmitte durchströmte ein Fluss in zahlreichen Windungen, Nebenarmen und feinen Verästelungen ein breites, versandetes Bett. Ich musste ziemlich lange geschlafen haben. Ab dem Kontrollpunkt war die Straße wieder geteert gewesen und das Gerüttel hatte aufgehört. Unten lagen verstreut neben einzelnen Höfen auch größere Dörfer. Das Tal schien sehr fruchtbar zu sein. Meine Zuversicht wuchs, dass ich am Abend ausreichend zu essen bekommen würde. Ich machte mich über mein letztes Stück Fladenbrot und die verbliebenen Datteln her, die ich mir vorsorglich aufgespart hatte. Ob es an der Mittagssonne lag oder daran, dass wir tiefere Lagen erreicht hatten, jedenfalls wurde es bald so warm bei mir in dem finsteren Laderaum, dass ich meine gefütterte Jacke ausziehen und mir mein Nest zwischen den Reifen etwas bequemer auspolstern konnte.
Ein lautes Rauschen. Wir standen. Ein Luftzug streichelte mein Gesicht. Fahles Licht fiel auf die Kisten und Reifenstapel ringsum. Die Plane vor dem Einstieg stand halb offen!
Hastig rappelte ich mich hoch. Draußen wurde es schon dunkel. Als ich mich gerade zwischen den Kisten ganz nach vorne durchzwängen wollte, erschien ein Kopf über der Laderampe.
„Nur keine Angst. Hier sind wir sicher“, hörte ich Karim sagen.
„Wo sind wir?“, fragte ich.
„Dies ist das Dorf meiner Familie. Hier übernachten wir. Und bis Herat sind es morgen nur noch drei bis vier Stunden.“
Kurz vor dem Ziel und endlich mal wieder in einem Haus schlafen. Auf einer ebenen Unterlage, nach einem warmen Essen und ohne Sorge vor einer plötzlichen Kontrolle – oder gar Sprengfallen! Meine aufwallende Freude wurde aber sofort wieder erstickt.
„Der Laster steht hier am Dorfrand, hinter dem Haus meines Onkels. Danach kommen nur noch Reisfelder und der Fluss. Aber du musst trotzdem hier drinbleiben. Wenn dich die falschen Leute sehen würden, könnte es immer noch gefährlich werden, für dich – und für meinen Onkel. Ich bring‘ dir nachher was zu essen.“
Schon war Karim wieder verschwunden. Die Plane hatte er offengelassen. Wenigstens hinaussehen durfte ich also. Ein weiter Blick über Reisfelder, geflutet und mit den ersten Setzlingen bepflanzt. Dahinter das Flussbett. Das kam mir sogar noch breiter vor als das des Kabul-Flusses. Von dort kam das Rauschen. Obwohl es nun doch keine ruhige Nacht in einem richtigen Haus geben würde, keimte zum ersten Mal seit Tagen so etwas wie Hoffnung in mir auf. Schon am nächsten Tag würden wir in Herat sein. Von dort aus war es nur noch ein Tag bis zur iranischen Grenze. Und dann, wenn alles glattginge, wäre ich wenigstens niemand mehr, nach dem man gezielt fahndete, sondern nur noch ein ganz gewöhnlicher Flüchtling …
In Herat war alles ganz anders, als ich es mir vorgestellt hatte. Ich hatte gedacht, ich würde zum Abschied von meiner Heimat vielleicht – im Vorbeifahren, von fern – die große Zitadelle Alexanders des Großen zu sehen bekommen, von der mir mein Großvater erzählt hatte. Oder würde vielleicht noch einmal über einen Basar schlendern können, einfach nur so, wie damals, als ich noch Kind war. Von Karim wusste ich, dass sein Onkel nach Ablieferung seiner Fracht neue Ware einkaufen würde, die er jenseits der Grenze in Taybad verkaufen wollte.
Bei einem letzten kurzen Stopp an einer Tankstelle vor der Stadt schärfte mir Karim ein – während er so tat, als müsse er die Plane am rückwärtigen Ende des Laderaums noch mal überprüfen – mich ab sofort immer in der Nähe meines Verstecks an der Wand zum Führerhaus aufzuhalten. Von hier ab bis in die Stadt gebe es häufig Kontrollen.
So traute ich mich ab da kein einziges Mal mehr nach hinten zum Ausstieg, wo ich einen Blick durch meinen Sehschlitz hätte werfen können. Selbst dann nicht, als wir längst mitten in der Stadt sein mussten, wie mir der Lärm des Verkehrs, das ständige Bremsen und Anfahren, die Trillerpfeifen von Verkehrspolizisten und laute Rufe von Straßenverkäufern verrieten. Die Fahrt durch diese für mich inzwischen ungewohnte Geräuschkulisse schien kein Ende zu nehmen. Schließlich parkten wir rückwärts irgendwo ein, wie ich an dem Hin- und Hermanövrieren merkte. Als der Motor abgestellt war, fiel mir als Erstes auf, dass der Straßenlärm auf einmal seltsam gedämpft klang. Dann drang der Geruch von Öl und Abgasen zu mir in den Laderaum.
Ich kletterte Richtung Ausstieg. Da machte sich auch schon jemand von außen an der Plane zu schaffen. Diese wurde mit ungewohntem Schwung zur Seite geworfen. Da stand auf einmal ein Mann, den ich noch nie gesehen hatte, und streckte seine grobe, ölverschmierte Hand nach mir aus.
„Karim?“, stammelte ich.
„Komm schon“, grollte eine tiefe Bassstimme, „beeil dich!“
Der Mann machte sich nicht mal die Mühe, die Ladeklappe zu öffnen. Nachdem es mir gelungen war, auf der Kante sitzend die Beine nach außen zu bringen, zerrte er mich hinunter. Wir befanden uns in einer großen, zur Straße hin offenen Autowerkstatt. Die Türen des Führerhauses unseres Lasters standen offen, aber Dschingis und Karim waren nirgends zu sehen. Mir blieb auch keine Zeit, mich nach ihnen umzusehen. Der Mann – noch größer und breiter als Dschingis Khan und in einem fleckigen Overall – zerrte mich grob auf eine nur wenige Meter entfernte Metalltür zu. Dahinter durchquerten wir einen Innenhof, zwischen aufgestapelten Reifen und Haufen von Autoteilen hindurch. Durch ein düsteres, nur durch eine nackte Glühbirne schwach erleuchtetes Treppenhaus gelangten wir in den ersten Stock eines Hinterhauses. Vor einer weiteren Metalltür blieben wir stehen. Der Mann schob zwei schwere Riegel zur Seite, öffnete die Tür und schob mich hindurch. Knarzend wurden die Riegel hinter mir zugeschoben und die Schritte des Mannes entfernten sich. Ich fand mich in einem kleinen, halbdunklen Raum wieder. Nur durch ein schmales, weit oben gelegenes Fenster drang ein schwacher Lichtschein herein – der Wiederschein der nächtlichen Stadt.
„Salaam“, tönte es leise aus einer Ecke des Raums. Erst jetzt sah ich, dass dort jemand hockte.
„Salaam“, sagte ich. „Wer bist du? Wo sind wir?“
„Bist du mit dem Laster gekommen, der uns über die Grenze bringen soll?“, kam es statt einer Antwort zurück.
„Ja“, sagte ich, als ich mich von meiner Verblüffung erholt hatte. Dass auf dem letzten und entscheidenden Teil der Strecke noch ein weiterer Flüchtling dazukommen würde, hatte mir niemand gesagt. „Ich heiße übrigens Adib.“
„Abdul – aus Helmand“, sagte der Junge und erhob sich. Er war kleiner als ich, aber nicht ganz so abgemagert. Auch schien er noch etwas jünger zu sein. Wir umarmten uns.
„Ich hatte schon Angst, ihr kommt gar nicht mehr“, sagte mein neuer Freund. Er forderte mich auf, mich zu ihm auf die Matratze zu setzen, die in seiner Ecke auf dem Boden lag.
Wer denn der Grobian wäre, der mich hergebracht hatte und warum man uns hier überhaupt einsperrte, fragte ich.
Die hätten wohl Angst, dass wir weglaufen könnten und ihnen so ein einträgliches Geschäft entginge, meinte mein neuer Freund. Die bekämen ja viel Geld dafür, dass sie uns in den Iran brächten – aber erst dann, wenn Kadér die Bestätigung erhalten hätte, dass wir auch angekommen seien.
Kadér! Den Namen hatte mir auch Onkel Najib genannt. Den müsse ich mir unbedingt merken. Das sei der Mann, der meine Reise bis Italien organisieren würde. Dieser Mann musste unglaublich mächtig sein, wenn er von Kabul aus solche ‚Reisen‘ sogar für Flüchtlinge aus der weit entfernten Provinz Helmand arrangieren konnte …
Ja, vor dem Grobian aus der Werkstatt habe er anfangs auch Angst gehabt, gestand Abdul. Hier drin aber versorge uns dessen Frau mit Essen. Wenn man klopfe, führe sie einen auch zu einem Abort im Hinterhof. Dort stehe übrigens immer ein Eimer mit Wasser, mit dem man sich waschen könne.
Später hat Abdul mir in kurzen Sätzen seine Geschichte erzählt: Er stammte aus einem Bergdorf im Norden der Provinz Helmand. Seine Familie war arm. Ein paar Ziegen waren ihr wertvollster Besitz. Sein Vater war zweimal hintereinander nicht zum Freitagsgebet erschienen. Beim ersten Mal hatte er Kräuter in den Bergen gesammelt. Beim zweiten Mal hatte er nicht rechtzeitig von der Suche nach zwei verirrten Ziegen ins Dorf zurückkehren können. Als ihn der Mullah des Dorfes zur Rede gestellt hatte, hatte er im Zorn gesagt, vom Koran allein werde seine Familie nicht satt. Kurz darauf waren die Taliban ins Dorf gekommen und hatten seinen Vater auf den Dorfplatz geschleppt. Dort hatten sie ihn wegen Beleidigung des Koran vor den Augen aller Bewohner des Dorfes mit Knüppeln erschlagen. Auch Abdul selbst, seine Mutter und seine vier Schwestern hatten bei der Hinrichtung zusehen müssen. Noch in der Nacht war die Familie zu Verwandten nach Girishk geflüchtet. Abduls Mutter hatte befürchtet, dass man auch noch ihren Sohn entführen und ihn zwingen würde, für die Taliban in den Kampf zu ziehen. Irgendwie war es ihr gelungen, Geld für seine Flucht in den Iran aufzutreiben. Dort werde er nun arbeiten müssen, um dieses Geld zurückzuzahlen und das Überleben seiner Mutter und seiner Geschwister zu Hause zu sichern, beschloss Abdul seinen Bericht.
Der Junge tat mir leid. Ich sagte ihm, dass es mir ähnlich ergangen sei, seit mein Vater bei einem Anschlag der Taliban in Kabul ums Leben gekommen sei. Ich war froh, dass er nicht weiter nachfragte. „Dann sind wir Brüder“, sagte er nur.
Abduls Flucht bis Herat war allerdings wesentlich komfortabler gewesen als meine. Nur zwei Tage zwischen Säcken mit Rohbaumwolle auf der A 01, und auf der ganzen Strecke hatte es nicht eine einzige Kontrolle gegeben …
Ich dachte zuerst, das wäre ein anderer LKW, so verändert sah es im Laderaum aus. Vorne türmten sich Säcke und als wir hinaufkletterten, entdeckten wir dahinter Stapel von großen Kartons und kleineren Schachteln. Und dann der Duft: Wie auf dem Basar vor den Läden mit Gewürzen und Trockenfrüchten.
Wenige Minuten zuvor erst waren die Riegel an der Stahltür vor unserem Gefängnis mit dem inzwischen vertrauten metallischen Knarzen beiseitegeschoben worden. Anstelle der Frau des Werkstattbesitzers hatte Karim vor uns gestanden. Ich hatte schon befürchtet, noch einen dritten Tag in diesem Loch verbringen zu müssen. Und Abdul, der dort schon eine volle Woche eingesperrt gewesen war, hatte es erst recht kaum noch ausgehalten. Plötzlich aber war auf einmal alles ganz eilig. Der Motor lief schon, als Karim uns auf die Ladefläche hinaufscheuchte. Wir sollten bloß die Finger von den Kartons lassen, schärfte er uns noch ein, während er die Ladeklappe verriegelte. Und es werde nur noch einen ganz kurzen Zwischenstopp geben, bevor es über die Grenze ginge. Damit verschloss er die Plane.
Es war schon später Nachmittag, als unser Laster von der Straße abbog und wir ein Stück über unbefestigte Wege rumpelten. Dann ein kurzer Halt bei laufendem Motor und das vertraute Geräusch eines Metalltors, das vor uns aufgeschoben und hinter uns quietschend wieder geschlossen wurde.
Dass es ernst wurde, merkte ich daran, dass sich Dschingis Khan und Karim zu zweit zu uns auf die Ladefläche heraufschwangen. Durch die Öffnung in der Plane konnte man im blendenden Licht draußen das blaue Metalltor sehen, durch das wir gekommen waren. Dahinter, jenseits der Mauer, die den Innenhof umschloss, eine ausgedörrte, wüstenartige Landschaft. Kurz freute ich mich über den frischen Luftzug, der von draußen hereinkam, denn im Laufe der Fahrt war es unter der Plane immer heißer und stickiger geworden.
„Jetzt müsst ihr ins Versteck.“ Schon die Art, in der Dschingis Khan das sagte, ließ nichts Gutes ahnen. Da war Karim hinter uns aber auch schon dabei, Kartons beiseite zu räumen. Darunter, direkt an der Bretterwand, die den Laderaum zum Führerhaus hin abschloss, kam eine schmale Holzkiste zum Vorschein, die wie eine Sitzbank die gesamte Breite des Fahrzeugs einnahm. Jetzt verstand ich, wie es zu der Lücke gekommen war, in die ich mich zuvor bei der Kontrolle in den Bergen hineingequetscht hatte: Die Kartons, die damals dort auf der einen Seite gestanden hatten, waren zu groß gewesen, um sie auf diese schmale Bank hochzustellen.
Karim klappte den Deckel hoch und zeigte in die geöffnete Kiste. Wie ein Sarg, schoss es mir durch den Kopf.
„Da rein?“, fragte Abdul ungläubig. Er war ja nicht ganz so schmächtig wie ich. Aber selbst ich konnte mir kaum vorstellen, wie ich dort hineinpassen und es da drin womöglich längere Zeit aushalten sollte.
Dschingis bemerkte offenbar meine aufkommende Panik. Er packte mich, stellte mich in die Mitte der Kiste und legte mich im gleichen Moment um, so dass ich mit dem Kopf zum einen Ende dieses ‚Sargs‘ hin auf der Seite zu liegen kam. Das ging so schnell, dass ich gar nicht dazu kam, mich zur Wehr zu setzen. Während Karim mich niederhielt, führte Dschingis das gleiche Manöver mit dem zappelnden und schreienden Abdul durch. Ich zog meine Beine an, soweit das überhaupt ging, aber bei jedem Stoß von Abdul Füßen gegen die meinen wurden mir die Knie schmerzhaft gegen die Wand der Kiste gedrückt.
„Je mehr ihr hier rumzappelt, desto unangenehmer wird es für euch. Besser, ihr spart eure Energie. Ihr seid nicht die Ersten da drin. Und merkt euch: Nicht hektisch atmen!“ Damit drückte Dschingis den Deckel der Kiste auf uns herunter. Es fühlte sich an, als wollte er uns auch noch die Luft aus den Lungen pressen.
In Panik drückte ich meinen Unterarm, den ich zuvor gerade noch rechtzeitig angewinkelt hatte, gegen den Deckel. Der bewegte sich keinen Millimeter. Die hatten ihn offenbar sofort mit irgendetwas beschwert. „Nicht hektisch atmen, nicht hektisch atmen“, wiederholte ich in Gedanken unablässig, was Dschingis gesagt hatte. Dann sah ich, dass durch einen schmalen Schlitz unter dem überstehenden Deckel der Kiste etwas Licht und also auch Luft hereinkam. Am Kopfende der Kiste fühlte ich ebenfalls Löcher. Solange ich ruhig blieb, konnte die Luft reichen.
Nach und nach bekam ich die akute Panik unter Kontrolle. Abduls Tritte gegen meine Füße hatten auch aufgehört. Ich machte ein fragendes Geräusch. Keine Antwort. Ich erschrak, aber dann hörte ich, wie mein ‚Bruder‘ leise schluchzte. Mehrmals stieß irgendetwas gegen die Kiste. Die bauten sie offenbar zu, mit Säcken oder Kartons. Das Atmen in der heißen, staubigen Luft war eine Qual. Ich unterdrückte mühsam ein Niesen. Kurz waren noch gedämpfte Stimmen zu hören. Jemand lachte. Das Zuschlagen der Ladeklappe. Dann wurde es dunkel.
Am wiederholten Bremsen, längeren Stehen und Wiederanfahren merkte ich, dass unser Laster offenbar in einer Schlange stand, die langsam voranrückte. Ich hoffte flehentlich, dass dies endlich die Grenze wäre.
Die ganze Zeit hatte ich mir immer dann, wenn die Panik wieder hochkommen wollte, intensiv Szenen aus meiner Kindheit ins Gedächtnis gerufen. Wie meine Mutter sich über mich beugt und ihre nach Rosenwasser duftenden Haare mir über das Gesicht streichen. Wie ich aus dem kühlen Wasser des Qargha-Sees auftauche und Baba mir vom Ufer aus zuwinkt. Wie ich vor Zoor Aba auf dem Teppich sitze und er mir Gedichte von Maulana Rumi vorliest.
Jetzt ging ich dazu über, im Kopf immer und immer wieder das Gedicht aufzusagen, mit dem ich in der dritten Klasse den ersten Platz in einem Rezitierwettbewerb gewonnen hatte. Zwischendurch kamen mir auch Verse aus dem Koran in den Sinn. Damit hätte ich endlos die Zeit füllen können. Diese Verse aber verstärkten nur das Gefühl, erneut völlig ausgeliefert zu sein. Ich floh immer gleich zurück in mein Lieblingsgedicht.
Von Abdul war, nachdem sein Schluchzen aufgehört hatte, nur hin und wieder ein Flüstern zu hören. Wahrscheinlich betete er.
Draußen ertönten auf einmal kurze, harsche Rufe – offenbar Anweisungen oder Befehle. Nach jedem Anfahren und Bremsen wurden die lauter. Die Grenze! Vor diesem kurzen, aber entscheidenden Moment meiner Flucht aus Afghanistan hatte ich so große Angst gehabt. Jetzt aber betete auch ich, dass es tatsächlich die Grenze war, und nicht nur eine normale Straßenkontrolle.
Meine Kehle war ausgetrocknet, die Zuge klebte mir geschwollen am Gaumen. Jeder Atemzug war mühsam und schmerzte. Ich hatte das Gefühl, dass es immer stickiger wurde. Mein Hemd und meine Hose waren schweißnass. Dann stieg mir auch noch der beißende Geruch von Urin in die Nase. Mein kleiner Freund Abdul hatte es offenbar nicht mehr zurückhalten können.
Erneut ein lautes Kommando, diesmal ganz nah. Eine leichte Erschütterung. Jemand hatte die Tür des Führerhauses zugeschlagen. Nach kurzer Pause das Geräusch, das ich nur allzu gut kannte: Die Ladeklappe! Mit aller Kraft konzentrierte ich mich auf eine weitere Rezitation meiner Lieblingsverse von Rumi.
Wieder die Tür des Führerhauses, dann das Starten des Motors. War das etwa alles gewesen? Hatten wir es über die Grenze geschafft? Ich merkte, wie wir anfuhren. Wie wir an Fahrt gewannen. Wie wir in eine scharfe Kurve nach links gingen. Ich rutschte ein Stück und stieß mit dem Kopf gegen das Ende des Sargs. Abdul trat heftig gegen meine so weit wie möglich angezogenen Füße, so dass auch noch meine Knie wieder ruckartig gegen das Holz gedrückt wurden. Nur mühsam konnte ich einen Schrei unterdrücken. Schon ging es in eine weitere scharfe Kurve, diesmal nach rechts. Hilflos rutschte ich gegen Abdul, der statt eines Aufschreis zu wimmern begann. Eine Zeitlang summte ich leise eine kleine Melodie und das Wimmern hörte auf.
Anscheinend wurden wir schon wieder langsamer. Ein kurzes Herumrangieren, dann standen wir. Der Motor verstummte. Die eine Führerhaustür wurde zugeschlagen und gleich darauf auch noch die zweite. Dann wurde es still. Kurze Zeit später parkte ganz in der Nähe ein weiterer LKW ein. Wieder das Zuschlagen von Wagentüren und sich entfernende Schritte.
Waren wir etwa doch noch in Afghanistan? Hatten die bei der Kontrolle Verdacht geschöpft und Dschingis angewiesen, seinen LKW erstmal irgendwo abzustellen, bis sie mit den Spürhunden kamen? Irgendwo hatte ich mal gehört, dass Laster oft tagelang an der Grenze standen. Vielleicht wurden die Fahrer dann festgesetzt, damit sie nicht in der Zwischenzeit fliehen konnten?
Ich hatte das Gefühl, zu ersticken. Eben noch hatte mir jeder Knochen im Leib wehgetan, hatte mir die Haut am ganzen Körper gejuckt, hatte ich mich geekelt vor dem Schweiß und Urin. Jetzt plötzlich spürte ich gar nichts mehr. Ich kratzte am Holz vor meinem Gesicht, versuchte, die Beine zu strecken. Ja, es war doch noch Leben in mir.
Von Abdul kam wieder ein Wimmern. Hatte ich ihn etwa getreten? Wenn ich es nicht schaffte, ruhig zu bleiben, waren wir beide verloren. Ganz ruhig atmen. Ganz ruhig. Wieder fing ich zu summen an. Das hatte zuvor schon geholfen, die Gedanken unter Kontrolle zu bringen.
Dass wir so kurz hintereinander zum zweiten Mal standen, war das nicht geradezu der Beweis, dass wir tatsächlich soeben die Grenze passiert hatten? Nach der Kontrolle auf afghanischer Seite musste ja auch noch eine auf der iranischen kommen! Dschingis hatte Ware geladen. Schon die Soldaten in den Bergen hatten nach den Begleitpapieren gefragt. Hier würden sie die natürlich auch kontrollieren wollen. Ja, Dschingis und Karim waren mit solchen Papieren zum Zoll!
„Zoll, Stempel“, sagte ich laut. Abdul murmelte etwas. Er schien verstanden zu haben.
Ich weiß nicht, wie lange wir dort gestanden haben, wie oft ich im Stillen für mich das Wort Zoll wiederholt habe. Einige Male konnte man hören, wie in der Nähe Männer in schweren Stiefeln vorbeiliefen, wie Motoren angelassen wurden und wie Laster davonfuhren. Jedes Mal wurde meine Hoffnung enttäuscht, dass es Dschingis und Karim wären, deren Schritte sich näherten, und dass endlich auch wir einfach so davonfahren würden. Mit jeder Enttäuschung kam die Angst stärker zurück. Die wussten doch, dass sie uns hier eingesperrt hatten. Dass wir hier drin nicht mehr lange überleben konnten. Wenn sie immer noch nicht kamen, hatte man sie womöglich tatsächlich verhaftet. Nicht mal eine Flasche Wasser hatten sie uns mit in unseren Sarg gegeben. Wasser! Verzweifelt biss ich mir in die Faust.
Und wieder: Sich nähernde Schritte, Stimmen von Männern. Ganz nahe liefen die auf meiner Seite vorbei. Das waren eindeutig mehr als zwei Männer, aber die tiefe Stimme von Dschingis Khan hatte ich nicht herausgehört. Also wieder nichts …
Da aber blieben sie stehen. Offenbar direkt hinter unserem Laster. Das Poltern der Ladeklappe. Die waren gekommen, den Laderaum zu durchsuchen! Hatten sie Karim oder gar Dschingis etwa dazu gebracht, unser Versteck zu verraten? So oder so, wenn sie den Laderaum ernsthaft durchsuchten, würden sie uns hier mit Sicherheit finden.
Ein Wimmern! Abdul hatte vielleicht gerade das Gleiche gedacht. Am Ende würde womöglich er uns verraten. Ganz vorsichtig tippte ich ihn mit dem Fuß an. Er drückte zurück. Soweit hatte er sich also noch unter Kontrolle.
Jetzt musste die Erschütterung kommen, die man spürt, wenn ein Mann sich auf die Ladefläche heraufschwingt. Das Kratzen oder Poltern schwerer Stiefel auf Blech oder Holz. Worauf warteten die?
Plötzlich ein dröhnendes Lachen. Nur einen hatte ich je so lachen gehört: Dschingis! Dann eine fremde Stimme: „Alles in Ordnung“, auf Farsi! Die Ladeklappe wurde wieder verriegelt.
Unwillkürlich atmete ich so tief ein, wie es ging. Als ich den Staub schmeckte, war es zu spät. Mit aller Gewalt versuchte ich, ein Niesen zu unterdrücken. Genau in dem Moment, als es herausplatzte, schlug eine Tür des Führerhauses zu. Dann die zweite. Jemand rief etwas. Ein Vibrieren verriet den startenden Motor. Wir fuhren.
Endlich! Gleich würden sie anhalten und uns aus unserem finsteren Sarg befreien … Aber die hielten einfach nicht an. Wir fuhren und fuhren. Der Motor dröhnte, oder war es mein Kopf? Ich spürte meinen Körper nicht mehr. Da war auch kein Durst. Die Wände unseres Sargs schienen sich verflüchtigt zu haben. Es war, als versänke ich in einem Meer aus aufwallender Dunkelheit. Fühlte es sich so an, zu sterben? Mein Herz raste. Meine Faust presste gegen mein Gesicht. Mir war, als hätte ich laut geschrien.
Iran
Ich spürte eine Hand an meinem Hinterkopf. Jemand hielt mir eine Flasche an den Mund, „Trink“, sagte eine Stimme. Ich begann, gierig zu schlucken. Ich musste husten und riss meine Augen auf. Vor mir hing Karims lachendes Gesicht. „Wir haben’s geschafft.“
Sie hatten mich gegen einen der Säcke gelehnt. Hinten saß Abdul blass und apathisch auf dem geschlossenen Sarg. Ein Laster fuhr in hohem Tempo dicht an uns vorbei. Die Plane am Einstieg wurde kurz zur Seite geweht, so dass für einen Moment blendendes Licht in den Laderaum fiel. „Wir müssen weiter“, rief Dschingis von draußen.
. . .
„Unglaublich, was unser Junge auf seiner Flucht durchgemacht hat“, hat Martina an dieser Stelle gesagt und hat den schwarzen Hefter mit Adibs Bericht auf die Sessellehne sinken lassen. „Und wie lebendig er das alles schildert …“
„Ich bin sicher, da hat ihm Samira kräftig geholfen. Er wird ihr seine Erlebnisse kurz geschildert haben und sie hat dann eine ausformulierte Geschichte daraus gemacht. Das beweisen ja allein schon der Wortschatz und die korrekte Grammatik. Manches habe ich allerdings nicht so ganz verstanden. An der einen Stelle zum Beispiel schreibt er etwas von seiner ‚Zeit in den Bergen‘. Ich dachte immer, er hätte die ganze Zeit in Kabul gelebt.“
“Was ich noch viel weniger verstehe: Warum haben ihn seine Tante und deren Mann so einfach davongejagt? Seine Eltern sind, wie wir wissen verstorben. Aber es gibt ja noch diesen Großvater, an dem er offenbar sehr hängt. Und von Vaterseite gibt es anscheinend doch auch noch Verwandte. Warum hat ihn keiner von denen aufgenommen?“
„Das kommt sicher noch. Wir sind ja erst am Anfang seines Berichts. Aber jetzt lass mich weiter vorlesen.“ Damit habe ich Martina den Hefter aus der Hand genommen und habe es mir erst mal auf dem Sofa bequem gemacht.
. . .
„Wo sind wir hier?“, fragte ich, als ich hinter Abdul aus dem Laderaum kletterte.
„Kurz vor Taybad“, antwortete Karim. „Hier fallt ihr nicht weiter auf, solange ihr auf dem Gelände der Ziegelei bleibt.“
Ein breites Grinsen erschien auf seinem Gesicht. Er hatte offenbar bemerkt, dass mein Blick beim Herunterklettern an dem offenen Karton hängengeblieben war, der so auffällig ganz vorn an der Ladefläche stand. „Damit haben wir euch sicher über die Grenze gebracht“, erklärte er. Ich sah ihn verständnislos an. „Safran. Eine der Dosen da drin kostet mehr, als ein iranischer Grenzbeamter in einem ganzen Monat verdient. Und für euch haben wir sogar zwei davon opfern müssen.“
„Sind etwa alle diese Kartons voll mit so teuren Dosen?“, fragte ich.
„Glaub‘ nicht, dass wir mit dieser Ladung reich werden können. Als Afghanen können wir die hier im Iran nur weit unter Marktpreis losschlagen – und Zoll mussten wir auch noch dafür bezahlen.“
„Und die Säcke?“, fragte ich.
„Rosinen und getrocknete Aprikosen. Praktisch, um blinde Passagiere darunter zu verstecken. Aber so billig hier im Iran, dass uns keiner glauben würde, dass wir allein dafür die Reise über die Grenze machen. Und jetzt macht, dass ihr da rüberkommt. Und sagt, dass ihr von Kadér seid.“
Hungrig, durstig und immer noch unsicher auf den Beinen nach unserer stundenlangen Gefangenschaft in der Holzkiste liefen Abdul und ich mechanisch auf die Lücke in der niedrigen Mauer zu, auf die Karim gezeigt hatte. Auf halbem Wege blickte ich noch einmal zurück. Dschingis Khans Neffe schwang sich gerade auf seinen Sitz hinauf. Er schlug die Tür des Führerhauses zu, und der Laster, der zehn Tage lang mein Zuhause gewesen war, setzte sich sofort in Bewegung. Karim hat sich nicht einmal mehr nach mir umgedreht.
Durch die Mauer gelangten wir auf ein weites Gelände, das sich bis zum Fuß eines langgezogenen Hügels erstreckte. Nicht weit von uns war eine große quadratische Fläche mit in dichten Reihen zum Trocknen senkrecht aufgestellten Lehmziegeln bedeckt. Daneben hatte etwa ein Dutzend Kinder begonnen, ein weiteres solches Quadrat auf diese Weise mit Ziegeln zu füllen. Die schleppten sie von einem weiter entfernt liegenden Platz an, an dem andere Kinder damit beschäftigt waren, frischen Lehm in hölzerne Formen zu pressen. Der Lehm wiederum wurde von etwas größeren Jungs in Schubkarren vom Fuß des Hügels im Hintergrund herangekarrt. Kaum hatten wir uns so weit orientiert, als schon ein großer, hagerer Kerl, der offenbar die Arbeiten überwachte, auf uns zukam.
„Was lungert ihr hier herum“, herrschte er uns an. Da wir zu Hause Dari gesprochen hatten, verstand ich sein Persisch, auch wenn die Aussprache für mich ungewohnt war.
„Wir kommen von Kadér“, sagte ich.
„Mitkommen“, sagte er barsch und lief uns voraus auf ein zweistöckiges Gebäude zu. Der Raum, in den er uns führte, war mit Teppichen ausgelegt und wurde von mehreren Neonlampen hell erleuchtet. An der Rückwand hing ein Wandteppich mit dem Bild einer prächtigen Moschee darauf. Darunter saß ein rundlicher Mann mit spiegelnder Glatze und einem mächtigen Schnauzbart auf einem Sofa und wühlte in einem Haufen Papiere, die er auf dem niedrigen Tisch vor sich ausgebreitet hatte.
„Hier sind welche von Kadér“, stellte uns der Hagere vor. „Sagt ihm, wie ihr heißt.“
Ich nannte meinen Namen und stieß Abdul an, der die Aufforderung wohl nicht richtig verstanden hatte. „Abdul“, sagte der leise. Der Rundliche blickte von seinen Papieren auf, lehnte sich zurück und musterte uns.
„Ich habe euch schon vor drei Tagen erwartet“, sagte er, und nach einer Pause: „Du da“ – dabei zeigte er auf Abdul – „kannst gleich schon mal anfangen. Ist doch wohl noch mindestens eine Stunde hell draußen, oder?“, vergewisserte er sich bei seinem Mann.
„Aber klar doch“, sagte der grinsend und packte Abdul an der Schulter. Der wand sich los.
„Ich bleibe bei Adib. Wir gehören zusammen.“
„Er ist mein Freund“, sagte ich, aber ich wusste, es würde nichts nützen. Dies war offenbar die Ziegelei, in der Abdul ab jetzt arbeiten musste.
„Afghanizag“, sagte der Hagere, der uns hergebracht hatte, verächtlich, packte meinen Freund – diesmal fest an beiden Schultern – und schob ihn vor sich her aus der Tür.
Der Schnurrbart wühlte noch kurz in seinen Papieren, dann erhob er sich seufzend und kam auf mich zu. Er machte einen Bogen um mich und rümpfte die Nase.
„Wie kann man nur so erbärmlich stinken“, murmelte er, mehr zu sich selbst als zu mir, lief zur Tür vor und sah sich draußen um, als suche er etwas. Dann wandte er sich zu mir um. Es werde ein paar Tage dauern, bis er alles für meine Weiterreise arrangiert haben werde, sagte er. Vor allem das mit den Papieren werde dauern. Mir war das gerade recht. Dann würde es für mich ja wohl ein paar Tage Pause geben – Aussicht also, mich endlich einmal wieder richtig waschen und nachts ungestört schlafen zu können. Womöglich würde es sogar einigermaßen regelmäßig etwas zu essen geben. Der Schnurrbart winkte mich zu sich vor das Haus und zeigte auf einen separaten Eingang am Ende des Gebäudes. „Dort wird man sich um dich kümmern.“ Es klang nicht einmal unfreundlich.
Ein Klopfen riss mich aus dem Schlaf. Ich brauchte einen Moment, um mich zu orientieren. Durch das schmale, hochgelegene Fenster fiel ein Streifen Sonnenlicht in das kleine Zimmer mit den kahlen, weißen Wänden. Ich lag hoch über dem Boden, auf einer richtigen Matratze in einem Bettgestell aus Metall. Vor dem Bett, auf dem Boden, mein Rucksack. Das war das Zimmer, in dem ich nun schon zwei volle Tage zugebracht hatte. Wieder klopfte es.
„Ja“, sagte ich und setzte mich auf.
Statt der alten Frau, die mir hier regelmäßig etwas zu essen brachte, streckte ein großer, hagerer Mann mit schwarzgeränderter Brille den Kopf zur Tür herein. Ob er eintreten dürfe. So höflich hatte schon lange niemand mehr zu mir gesprochen. Ich sprang auf. Dunkle, traurige Augen musterten mich freundlich durch dicke Brillengläser. Das schwarze, gewellte Haar über der auffallend hohen Stirn dieses Mannes war schon ziemlich gelichtet.
„Du bist also der Adib“, stellte er fest. Ich nickte unsicher.
„Keine Angst, Ich heiße Jafar Ponyandeh. Ich werde dir helfen und dich, solange du hier bist, beschützen. Besitzt du ein Foto von dir?“ Eine seltsame Frage. Ich schüttelte den Kopf.
„Dann müssen wir eins machen“, sagte er, zog die Tür hinter sich zu und erst jetzt fiel mir auf, dass eine Kamera an seiner Seite baumelte. So eine Kamera hatte auch mein Vater besessen, und auch er hatte die immer an so einem Riemen über seiner Schulter hängen gehabt, wenn wir zusammen einen Ausflug gemacht hatten. Mein ‚Beschützer‘ bat mich, mich vor die weiße Wand zu stellen und machte mehrere Fotos von mir, wobei er mit der Kamera jedes Mal näher an mein Gesicht herankam.
„Du brauchst einen Ausweis, um sicher durch dieses Land zu kommen. Und dazu brauchen wir dieses Foto“, erklärte er mir, während er geschäftig mit der Kamera hantierte. Das also hatte der Dicke mit dem Schnauzer mit den ‚Papieren‘ gemeint, von denen er bei meiner Ankunft gesprochen hatte. Und dann erinnerte ich mich, dass ja auch in den geflüsterten Diskussionen von Tante Khosala und Onkel Najib von ‚Papieren‘ die Rede gewesen war.
„Spätestens in drei Tagen wird dich hier jemand abholen“, sagte der seltsame Herr Ponyandeh, als er fertig war. „Und ab da wirst du dich Reza Aslan nennen, aus der Stadt Gonabad, der Stadt des Safrans. Am besten, du prägst dir diese Namen jetzt schon mal ein.“ Damit verbeugte er sich vor mir – einem Jungen! – und verschwand so schnell durch die Tür, wie er erschienen war.
Die folgenden Tage verbrachte ich in wachsender Ungeduld. Ich vertraute diesem Herrn Ponyandeh. Schon weil er mich irgendwie an meinen Vater erinnert hatte. Jetzt, wo ich wusste, dass es jemanden wie ihn gab, der mir helfen wollte, sicher durch dieses Land zu kommen, hoffte ich, dass es so schnell wie möglich weiterginge. Dabei hatte ich keinen Grund, mich zu beklagen. Anders als in Herat war ich in meinem Zimmer nicht eingesperrt. Jederzeit konnte ich hinunter ins untere Stockwerk laufen. In den Waschraum etwa oder, lieber noch, in die große Küche, in der für alle auf dem Gelände gekocht wurde. Inzwischen nannten die Frauen dort unten mich schon ihren kleinen Jungen, wofür ich sie als Mann eigentlich hätte zurechtweisen müssen. Aber sie steckten mir auch immer mal wieder extra etwas zu essen zu. Nur außerhalb des Hauses solle ich mich nicht sehen lassen, hieß es. Besuchern von draußen würde es auffallen, wenn hier ein Junge wie ich einfach nur so herumliefe.
Natürlich hielt ich auch immer mal wieder Ausschau nach Abdul – aus meinem Fenster oder unten an der Tür. Ich wusste inzwischen, dass die Jungen und Mädchen abends, wenn es dunkel wurde, von den Aufsehern getrennt und in Gruppen in die beiden separaten Gebäude gebracht wurden, in dem, wie es hieß, ihre Schlafsäle lagen. Selbst aus der Entfernung konnte man sehen, wie erschöpft und schmutzig sie waren. Meinen Freund Abdul aber habe ich nie wiedergesehen …
Der junge Mann, der mich abholte, hieß Shahin und sagte, er sei Student. Als Erstes aber, kaum hatte ich mich zu ihm in den alten Peugeot gesetzt, reichte er mir meine ‚Papiere‘.
„Hier, Reza Aslan, dein Schenasnameh“, sagte er. Ich schlug das kleine, dünne Heftchen auf. Da, auf der ersten Seite, prangte tatsächlich mein Foto.
„Hast du noch nie einen Ausweis gesehen?“, fragte er und lachte. Er lachte ständig. Auch als ich ihn fragte, ob er der Sohn des Fotografen wäre.
„Du meinst Dr. Ponyandeh? Der war mein Lehrer an der Universität, an der ich Wirtschaftswissenschaften studiere. Jetzt ist er mein Mentor und Freund. Von irgendwas muss er ja leben, jetzt, wo die Taliban dafür gesorgt haben, dass er seine Stelle an der Uni verloren hat.“
„Die Taliban? Hier im Iran?“ Ich war geschockt. Auch weil ich noch nie erlebt hatte, dass jemand über die Taliban lachte.
„Sorry“, sagte er – das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich wieder ein englisches Wort hörte. „Du kommst ja von denen. Keine Angst, wir nennen unsere korrupten Mullahs so.“
„Ich komme nicht von den Taliban. Ich komme aus Kabul“, protestierte ich.
„Schon gut“, lachte er. „Ist mir auch egal, warum du da wegwillst. Hier wollen ja auch alle weg.“
Die gut ausgebaute, meist schnurgerade Straße führte durch eine karge, ausgedörrte Landschaft. Nur hin und wieder kamen wir durch kleinere Ortschaften. Ich war ein wenig durcheinander. Dass die Schiiten Ungläubige waren, sagten die Sunniten in meiner Heimat ja immer. Aber dass die hier so abfällig über ihre eigenen Mullahs redeten, hätte ich mir bis dahin nie vorstellen können.
„Falls die uns anhalten sollten und nach unseren Papieren fragen, halt bloß den Mund und lass mich reden“, sagte Shahin, ausnahmsweise mit ernstem Gesicht. „Sonst hören die an deiner komischen Aussprache gleich, dass du nicht von hier bist. Also pass auf: Ich bin dein großer Bruder, du bist hier nur auf Besuch, weil du unbedingt mal den Imam Reza Schrein besuchen willst. Und zwar, weil das deine letzte Hoffnung ist, dein Stottern zu kurieren.“
Wieder wollte ich protestieren, aber Shahin winkte ab.
„Vertrau mir. Diese kleine Lügengeschichte ist nur zu deinem Schutz. In letzter Zeit gibt es immer öfter Demonstrationen in Maschhad wegen der steigenden Preise für Lebensmittel. Seitdem sind die da oben nervös und es gibt mehr Kontrollen als sonst. Und glaub mir, wenn du denen in die Hände fällst, hast du nichts mehr zu lachen.“
Bald wurde die Straße vierspurig, als wir uns Maschhad näherten, sogar zu einem richtigen sechsspurigen Highway – wie in den amerikanischen Filmen. Ich traute meinen Augen nicht: Plötzlich tauchte rechterhand direkt neben uns ein riesiges Flugzeug auf. Ich dachte schon, es würde auf die Häuser am Rande der Autobahn stürzen, aber dann verschwand es direkt hinter einem großen, flachen Gebäude. Shahin lachte, als ich aufgeregt hinüberzeigte. Er stellte die Musik ab, die er die ganze Zeit hatte laufen lassen. „Unser Flughafen“, sagte er. Er erklärte mir, dass jedes Jahr mehrere Millionen Pilger nach Maschhad kämen, um den Imam Reza Schrein zu besuchen. Zum ersten Mal schien er auf irgendetwas in seinem Land stolz zu sein. Ich aber war nur froh, dass das Gebrüll des CD-Spielers verstummt war, das Shahin ‚Heavy Metal‘ nannte. Sowas hatte ich vorher noch nie gehört. Kurz danach kurvten wir durch ein ganzes Gewirr von Straßen neben- und übereinander. Gleich dahinter zeigte Shahin wieder auf die rechte Seite. „Unser großer Fernbusbahnhof – da setzen wir dich morgen in den Bus nach Teheran.“
Es kann nicht mehr als zehn Minuten später gewesen sein, als wir von der Stadtautobahn abfuhren und in ein Viertel mit dicht an dicht stehenden Wohnhäusern einbogen. Die waren alle nicht mehr als vier oder fünf Stockwerke hoch und sahen ziemlich neu aus. Gleich darauf hielten wir vor einem dieser Häuser. Sobald Shahin auf einen der Klingelknöpfe gedrückt hatte, gab es ein summendes Geräusch und er drückte die Tür auf.
„Sie haben Farhad verhaftet“, sagte Dr. Ponyandeh, kaum hatte er uns oben die Wohnungstür geöffnet.
Eigentlich hatte Shahin mich nur abliefern wollen, aber nach dieser offenbar sehr schlimmen Nachricht folgte er uns doch mit in die Wohnung. Sein ehemaliger Lehrer, der jetzt sein Freund war, führte uns in ein großes Zimmer mit hohen Regalen voller Bücher an den Wänden und einem Sofa und mehreren Sesseln in der Mitte des Raums. Er und Shahin liefen gleich zum Fenster hinüber und redeten aufgeregt miteinander.
Eine Zeit lang stand ich herum. Die beiden waren so vertieft, dass sie mich gar nicht beachteten. Da ließ ich meinen Rucksack einfach auf den Teppich fallen und versank in einem der riesigen, weichen Sessel.
Ich verstand nicht alles von dem, was sie sagten. Dieser Farhad aber war offenbar jemand von ihrer Universität. Der hatte auf der Straße Zettel verteilt – aus Protest gegen die ‚Zwangsverschleierung‘, wie Dr. Ponyandeh sagte. Dieses Wort verstand ich erst, als sie auch noch von ‚Kopftuchzwang‘ sprachen. Das schien alles sehr schlimm zu sein.
Ich wusste damals so vieles noch nicht. Die Frauen im Iran – die in der Küche der Ziegelei und die wenigen, die ich auf dem letzten Teil unserer Fahrt auf der Straße gesehen hatte – waren mir sehr freizügig vorgekommen in ihrer leichten Kleidung und mit ihren bunten Kopftüchern. Ich hatte vor meiner Flucht längere Zeit fast nur noch Frauen in Burka gesehen. Aber dann fiel mir wieder ein, dass meine Tanten so gut wie nie ein Kopftuch getragen hatten. Wie überhaupt viele Frauen in Kabul. Und auch kaum eins der Mädchen aus Babas Schule. Für meine Tante Khosala, auch daran erinnerte ich mich jetzt wieder, hatte das auch etwas mit Freiheit zu tun gehabt. Hier aber schien das Kopftuch seltsamerweise etwas mit öffentlicher Sicherheit zu tun zu haben.
„Wegen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit?“ Shahin fragte extra noch einmal nach.
„Ja, deswegen und wegen Beleidigung des Kopftuchs als Symbol des Islam“, sagte Dr. Ponyandeh und schüttelte den Kopf.
„Wir müssen etwas unternehmen“, rief Shahin.
„Dir ist klar, wie gefährlich das ist“, sagte Dr. Ponyandeh.
„Ich bin sicher, viele werden sich anschließen. Jetzt, wo sich die Leute selbst einfache Lebensmittel kaum noch leisten können. Sogar auf dem Land. Alle haben doch diese Mullah-Diktatur satt. Die Misswirtschaft, die Korruption, die brutale Unterdrückung jeder Kritik.“ Shahin redete sich immer mehr in Rage. Dabei fiel sein Blick plötzlich auf mich. „Ach, um den Jungen müssen wir uns ja auch noch kümmern. Ich fürchte, ihn schon morgen in den Bus nach Teheran zu setzen, wäre in dieser Situation kaum zu verantworten. Die werden die Kontrollen in den nächsten Tagen mit Sicherheit nochmal verschärfen.“ Dr. Ponyandeh überlegte kurz. Dann nickte er.
Da ahnte ich noch nicht, dass ich fast vier volle Tage in dieser schönen großen Wohnung zubringen würde, bis es endlich weiterging.
Gleich nachdem Shahin sich verabschiedet hatte, verließ auch mein Beschützer die Wohnung, in der er offenbar ganz allein lebte. Er werde nicht lange fortbleiben, sagte er. Ich solle auf keinen Fall vor die Tür gehen. Die Nachbarn seien sehr neugierig.
So setzte ich mich erst mal wieder in den großen Sessel, neben dem noch mein Rucksack lag. Als es mir zu langweilig wurde, ging ich zu den Regalen hinüber. Ich staunte, wie viele Bücher auf Englisch dort standen. Die meisten Titel verstand ich nicht, aber immer wieder kamen die Wörter ‚Economy‘ und ‚History‘ vor. Dieser Lehrer und Fotograf musste ein sehr kluger Mann sein. In einem der Regale stieß ich schließlich auf Bücher, deren Titel mir vertraut waren. Das Shahnameh mit den Geschichten von den alten persischen Helden, das Diwan-e Hafez von Hafis und von Rumi das Masnavi und seine vierzeiligen Rubaiyat. Ich zögerte, aber dann zog ich die Rubaiyat aus dem Regal. Damit setzte ich mich auf den Teppich und vertiefte mich in das Buch. Es war, als wäre ich auf einmal wieder Adib, der Schüler aus der 8. Klasse, und säße zu Hause im Zimmer meines Großvaters.
„Du kannst diese Gedichte lesen?“ Ich schrak zusammen, als ich plötzlich die Stimme von Dr. Ponyandeh hinter mir hörte. Die traurigen Augen hinter den dicken Brillengläsern blickten verwundert auf mich herab.
„Viele kenne ich auswendig“, sagte ich.
„Weißt du, dass das eine kostbare alte Ausgabe dieser Gedichte ist, die du da in der Hand hältst?“ Kurz krampfte sich alles in mir zusammen.
„Mein Großvater hatte eine, die noch viel älter war“, sagte ich.
„Hatte? Er hat sie doch nicht etwa verkaufen müssen? Womöglich, um damit deine Flucht zu finanzieren?“
„Oh, nein“, stotterte ich. Ich merkte, wie ich rot wurde.
„Na, das wäre ja auch ein Jammer gewesen“, sagte Dr. Ponyandeh. Er ließ sich in den Sessel neben mir sinken. Er seufzte tief auf. „Ich habe viele afghanische Freunde. Die ersten sind schon vor über dreißig Jahren vor den Russen hierher geflohen. Weitere kamen vor zwanzig Jahren, nachdem die Taliban Kabul erobert hatten. Und jetzt schon wieder Jungen wie du. Hört das denn nie auf? Gab es denn niemanden, der dort für dich sorgen konnte?“
So hatte schon lange niemand mehr mit mir geredet. Ich versuchte, meine Tränen zurückzuhalten. Aber dann war es, als bräche ein Damm. Ich erzählte meinem Beschützer, dass meine Eltern beide gestorben waren. Dass ich nicht wusste, wo mein Großvater war und ob er noch lebte. Dass meine Lieblingstante mich einfach so fortgeschickt hatte. Obwohl ich das gar nicht wollte, habe ich einfach immer weitererzählt. Am Ende kannte er fast meine ganze Geschichte. Er hat mir die ganze Zeit zugehört, ohne etwas zu sagen. Selbst dann, als er alles wusste, hat er mir keinerlei Vorwürfe gemacht.
„Du musst fest daran glauben, dass alles gut werden wird“, sagte er nur und legte mir dabei seine Hand auf die Schulter.
Auch in den nächsten Tagen musste Dr. Ponyandeh oft aus dem Haus. Ständig hatte er irgendwelche Treffen, und einmal musste er auch Fotos von einer Hochzeit machen. Aber wenn er zu Hause war, nahm er sich immer auch Zeit, sich mit mir zu unterhalten. Dabei sagte er manchmal auch Sachen, die ich nicht so richtig verstand. Dass die islamische Regierung eigentlich gar nicht islamisch sei, zum Beispiel. Oder dass die Mullahs den Koran für politische Ziele missbrauchten. Als ich ihm sagte, dass ich viele Verse des Koran auswendig gelernt hatte, fragte er, ob ich denn auch wüsste, was die arabischen Wörter bedeuteten. Das haben sie mir nicht beigebracht, gab ich zu.
„Wer die Menschen Worte auswendig lernen lässt, ohne ihnen deren Bedeutung zu erklären, der verhöhnt das größte Geschenk, das Allah dem Menschen gegeben hat, den Verstand“, erklärte er. Da sagte ich ihm, dass auch mein Vater und mein Großvater so ähnlich gesprochen hätten, wenn es um „die Bärtigen“ gegangen sei.
Er nickte mir zu. „Sogar das Wahrhaftigste und Weiseste, was der Islam jemals hervorgebracht hat, wollen sie auslöschen.“ Als ich ihn fragend ansah, meinte er, ich solle mir jetzt erst mal nur den Namen merken, der als mein Geburtsort in meinem iranischen Ausweispapier stehe: Gonabad. Für später, wenn ich in Sicherheit sei und wieder lernen könne. Denn das sei das Wichtigste: Ein Leben lang zu lernen und nach der Wahrheit zu suchen.
Auch wenn ich nicht alles verstand, was mein Beschützer mir zu erklären versuchte, durch diese Gespräche verstand ich zumindest sein Persisch immer besser.
Spätabends am zweiten Tag kam Shahin nochmal vorbei. Er wollte seinem Lehrer Bilder von einer ‚Demonstration‘ zeigen, an der er an dem Nachmittag teilgenommen hatte.
„Habe ich‘s dir nicht gesagt? Die schrecken vor nichts zurück“, stellte Dr. Ponyandeh fest, nachdem er eine Weile schweigend auf den kleinen Bildschirm geschaut hatte, den Shahin ‚Smartphone‘ nannte.
„Sieh dir das an, Reza aus Gonabad, so brutal ist dieses Mullah-Regime hier bei uns.“ Mit diesen Worten hielt Shahin dann auch mir diesen Bildschirm hin. Da war ein großer Platz voller Menschen zu sehen. Die hielten Schilder hoch und riefen etwas im Chor. Ich traute meinen Augen nicht: Eine junge Frau hielt ein Schild hoch, auf dem stand „Marg bar Taliban“, „Tod den Taliban“!
Was die Leute riefen, verstand ich erst, als ich genauer hinhörte: „Die Menschen betteln, die Mullahs herrschen wie Götter.“ Und plötzlich tauchten Männer mit Helmen auf und begannen, mit langen Stangen wahllos auf die Menschen einzuschlagen. Alle liefen durcheinander, manche stürzten und die Männer mit den Helmen traten sie auch noch mit ihren Stiefeln. Die machten selbst vor den Frauen nicht halt. Die Bilder wurden immer wackeliger und dann wurde der Bildschirm dunkel.
„Ich fürchte, das ist nur der Anfang“, meinte Dr. Ponyandeh. „Es wird wieder Massenverhaftungen geben. Jedenfalls wird sich die Lage nun doch nicht so schnell wieder beruhigen. Allzu lange sollten wir die Abfahrt des Jungen daher nicht mehr hinausschieben.“
„Am besten, ich bringe ihn übermorgen, wenn wohl die erste Verhaftungswelle vorbei ist, ganz früh an den Busbahnhof. Ich schätze, bei dem Gewimmel dort um die Zeit werden die höchstens Stichprobenkontrollen durchführen,“ meinte Shahin daraufhin.
Die letzten anderthalb Tagen nutzte mein Beschützer, mir noch ganz gezielt die richtige Aussprache einiger nützlicher Worte und Sätze in Farsi beizubringen. Zu meiner Sicherheit, wie er sagte. So werde man nicht sofort hören, dass ich aus Afghanistan käme, wenn ich in eine Polizeikontrolle geriete.
Die Fahrt von Maschhad bis nach Teheran kam mir unendlich lang vor. Dabei kam ich so schnell voran, wie noch nie, seit ich Kabul verlassen hatte. Der Bus war ganz früh am Morgen pünktlich abgefahren und spät in der Nacht fuhren wir in den Busbahnhof in Teheran ein.
Am Anfang der Fahrt hatte ich gestaunt, wie modern und sauber der Bus war und wie bequem die Sitze. Man konnte sogar die Rückenlehne nach hinten kippen. Shahin hatte mir einen Sitzplatz am Fenster in der Mitte des Buses besorgt. So würde ich am wenigsten auffallen, hatte er gemeint.
Ich habe fast die ganze Zeit aus dem Fenster geschaut. Auch das hatte Shahin mir empfohlen, damit möglichst keiner auf die Idee käme, mich anzusprechen. Am Anfang fand ich es auch interessant, dort draußen die weiten, wechselnden Landschaften und das Treiben in den Städten und kleineren Ortschaften, die wir durchquerten, vorüberziehen zu sehen. Die glatt geteerten Straßen, die vielen neuen und hohen Gebäude, die Geschäfte und sogar die Menschen, alles erschien mir ordentlicher, moderner, und bunter als in Afghanistan. Auf die Dauer aber wurde es langweilig und mir fielen immer wieder die Augen zu.
Meist wachte ich dann erst wieder auf, wenn der Bus an einer Tankstelle oder an einem Busbahnhof hielt. Dann stiegen immer alle aus, um sich die Beine zu vertreten, auf die sauberen Toiletten zu gehen, die es fast überall gab, oder sich etwas zu trinken oder zu essen zu kaufen.
Dr. Ponyandeh hatte mir am Morgen zwei Flaschen Wasser, eine Tüte mit Sonnenblumenkernen und ein paar iranische Geldscheine mitgegeben. Das Geld hatte ich erst gar nicht annehmen wollen. „Für den Notfall“, hatte er gesagt und dabei wieder so traurig gelächelt. Da hatte ich die Scheine doch eingesteckt und mir vorgenommen, sie wirklich nur für den Notfall aufzubewahren. Aber als wir – da war es schon Nachmittag – an einem größeren Busbahnhof hielten und ich die Stände der vielen Händler sah, die dort duftende Aprikosen, Orangen und Mangos, verlockende Fleischspießchen, süßes Gebäck und buntes Zuckerwerk anboten, konnte ich nicht widerstehen. Ich habe mir zum allerersten Mal seit meiner Abfahrt aus Kabul selber etwas zum Essen gekauft.
Auch Tante Khosala hatte mir Geld mitgegeben, dreihundert amerikanische Dollar, die sie mir separat in kleine Plastiktüten eingeschlagen und an drei verschiedenen Stellen versteckt hatte: Im Boden meines Rucksacks, im Gürtel meiner Hose, den sie dafür extra aufgetrennt und wieder zugenäht hatte, sowie in einem Ledertäschchen, das ich unter meinem Hemd an einer Schnur um den Hals trug. Dieses Geld wollte ich aber auf diesem Abschnitt der Reise noch auf keinen Fall anrühren. Es war für den letzten Teil meiner Flucht gedacht, auf dem ich mich ganz alleine würde durchschlagen müssen.
Als ich mit meinen Hühnerfleischspießchen in den Bus zurückkam, fand ich zuerst meinen Platz gar nicht wieder. Die ganze Zeit hatte ein alter Mann auf dem Gangplatz neben mir gesessen. Der hatte mich zu meiner Erleichterung kein einziges Mal angesprochen und die meiste Zeit auch geschlafen. Jetzt aber saß da in der Mitte des Busses ein Mädchen, und ich wollte erst gar nicht glauben, dass das da neben ihr mein Platz war. Das Mädchen – eigentlich eher schon eine junge Frau – schaute mich mit großen dunklen Augen herausfordernd an, als ich unschlüssig neben ihr stand. Ihr grellbuntes Kopftuch war so weit nach hinten geschoben, dass ihr volles Haar darunter hervorquoll. Sie trug eine Bluse, deren oberster Knopf offenstand und deren Ärmel nicht mal bis zu den Ellenbogen reichten. Ich brachte kein Wort heraus.
„Dein Sitz?“, fragte sie schließlich. Ich nickte nur stumm. „Na, dann komm“, sagte sie mit amüsiertem Gesichtsausdruck und erhob sich, blieb aber halb im Durchgang stehen, so dass ich mich kaum vorbeiquetschen konnte, ohne sie zu berühren.
„Aus welchem Dorf kommst du denn?“, fragte sie, als ich endlich saß.
„Gonabad“, murmelte ich.
„Ach so“, sagte sie, als sei für sie damit alles erklärt. Sie vertiefte sich wieder in ein Heft, in dem sie schon geblättert hatte, bevor sie mich bemerkt hatte. Ich habe zwei, drei Mal kurz hinübergeblickt, aber da waren immer nur Bilder von Frauen zu sehen, die ungewöhnliche Kleider anhatten.
Es dämmerte schon, als der Bus nochmal in einem kleineren Ort hielt. Diesmal stiegen nur fünf oder sechs Leute aus, darunter zwei Frauen, die direkt in der Reihe vor uns gesessen hatten. Auch ich wäre gern wenigstens kurz mal an die frische Luft gegangen, aber das Mädchen neben mir blieb sitzen und ich wollte mich nicht nochmal so an ihr vorbeidrängen.
Der Halt war kürzer als sonst. Alle saßen schon. Die Tür unseres Busses glitt zu. In dem Moment sah ich drei junge Männer in schwarzen Uniformen auf unseren Bus zulaufen. Polizisten! Sie hämmerten an die bereits geschlossene Tür. Der Fahrer fluchte, aber er öffnete. Die Polizisten stürmten herein. Der eine blieb vorne beim Fahrer stehen und fragte den irgendwas. Die beiden anderen aber kamen nach einem kurzen, prüfenden Blick über die Sitzreihen direkt auf mich zu. Jetzt ist es aus, dachte ich und schrumpfte in meinen Sitz, obwohl klar war, dass sie mich schon gesehen hatten. Der Vordere stützte sich mit dem Ellenbogen auf die Lehne des Sitzes direkt vor dem Mädchen. Er fixierte erst sie und dann mich.
„Was hast du dir denn da für einen netten kleinen Liebhaber ausgesucht. Du bist doch viel zu schade für den.“ Er grinste.
„Das ist mein kleiner Bruder. Und jetzt lass uns gefälligst in Ruhe!“, herrschte ihn meine Nachbarin an.
Der Polizist hob beide Arme hoch und ich erwartete, dass er zupacken oder gar zuschlagen würde.
„Schon gut, schon gut“, sagte er, „man wird doch noch einen Scherz machen dürfen.“ Er und sein Begleiter lachten laut und ließen sich mit Schwung in die Sitze direkt vor uns fallen.
Das Mädchen nickte mir zu, erkennbar zufrieden mit sich. Offenbar bemerkte sie jetzt erst, wie sehr ich in Panik geraten war. Ich fühlte, wie mir die Schweißperlen über das Gesicht liefen. Mit einem Kopfschütteln bedeutete sie mir, dass das alles ganz harmlos gewesen war. Ja, sie lächelte mich sogar an. Wenn ich an diese Szene zurückdenke, ist sie mir heute noch peinlich. Aber ich war ja noch nicht einmal sechzehn und kam aus einer anderen Welt.
Erst als unser Bus ungefähr zwei Stunden später endlich Teheran erreichte, verblasste der Schrecken, der mir die ganze Zeit noch in den Knochen gesteckt hatte. Auf einmal gab es so viel zu sehen. Diese Stadt, durch deren Verkehrsgewühl sich unser Bus langsam seinen Weg bahnte, kam mir noch viel riesiger und moderner vor als Maschhad, das mich auch schon beeindruckt hatte. Es dauerte unglaublich lange, bis wir die schier endlosen Vororte aus eintönigen Wohnblocks aus grauem Beton hinter uns gelassen hatten. Danach aber staunte ich nur noch über die mit bunten Lichterketten geschmückten Fassaden, die hell angestrahlten Monumente, die gläsern schimmernden Hochhaustürme, die farbenfrohen Auslagen der Geschäfte, die zahllosen Restaurants, die alle voll besetzt zu sein schienen, und die vielen gut gekleideten Menschen, oft ganze Familien mit Kindern, die hier um diese späte Zeit noch unterwegs waren und sich offenbar keinerlei Sorgen machten, dass eine Autobombe hochgehen oder ein Terrorkommando beginnen könnte, wahllos in die Menge zu schießen.
Mir schwirrte der Kopf, als wir in den riesigen Busbahnhof einfuhren. Das Mädchen neben mir stand schon auf, als der Bus noch am Einparken war. Sie winkte mir, ihr zu folgen. Ach ja, ich war ja ihr kleiner Bruder. Sofort, als der Bus stand, erhoben sich auch die beiden Polizisten vor uns. Sie starrten das Mädchen an, aber sie warteten höflich ab, bis wir an ihnen vorbei waren. Mich haben sie überhaupt nicht beachtet.
Vor dem Bus herrschte ein chaotisches Gewimmel. Das Mädchen packte mich einfach an der Hand und zog mich durch die Mauer der Männer, die uns ihre Taxis anpriesen. „Pass auf dich auf. Man merkt, dass du nicht von hier bist. Und auch nicht aus Gonabad“, sagte sie noch, dann war sie auf einmal verschwunden.
Ich folgte einfach dem Menschenstrom hinaus aus dem Busbahnhof. Davor werde der Mann von Kadér auf mich warten, hatte Shahin gesagt. Es war mir ein Rätsel, wie der mich in diesem Gewimmel jemals ausfindig machen sollte. Ich blieb einfach vor dem Ausgang stehen, am Rande der ununterbrochen vorbeiflutenden Menge, sah mich um und wartete. Nach wenigen Minuten kam ein schlanker junger Mann in Jeans und mit schwarzer Lederjacke über dem weißen Hemd auf mich zu. „Kadér?“, fragte er. Als ich nickte, schob er die Sonnenbrille, die er selbst jetzt in der Dunkelheit trug, in sein kurzgeschorenes Haar hinauf und lotste mich ein Stück weit vom Busbahnhof fort. Dort seien die Taxis billiger.
Bald waren wir aus dem Stadtzentrum mit seinen hell erleuchteten, breiten Straßen heraus, fuhren durch enge, verwinkelte Gassen und hielten schließlich in einem basarartigen Viertel vor einer Zeile zur Straße hin offener Läden. Zwischen einem Gemüsegeschäft und einer Schneiderei führte ein Eingang ins Dunkel. Das schwach beleuchtete Schild darüber zeigte an, dass die Treppe zu einer Pension hinaufführte. Der junge Mann lief mir voraus und schlug mit der Faust an die Tür. Der Mann, der uns öffnete, trug einen schmuddeligen Kittel und machte auch sonst nicht gerade einen vertrauenerweckenden Eindruck. Schon beim Eintreten schlug mir der Geruch von kaltem Zigarettenrauch und abgestandenem Essen entgegen. Der Mann, offenbar der Wirt dieser finsteren Herberge, führte mich in einen Raum, in dem bereits drei junge Männer auf dem Boden um eine große Schüssel mit undefinierbarem Inhalt herumsaßen. Der eine, klein und von gedrungener Gestalt, der mir am nächsten saß, sprang sofort auf. Im ersten Moment erschrak ich, als ich seine rötlichen Haare und den stechenden Blick seiner grünen Augen sah.
„Salaam, Bruder“, sagte er freundlich, „kommst gerade recht. Wie du siehst, ist das Festmahl bereits serviert. Übrigens, ich bin Faizal aus Miramshah in Waziristan.“ Dass er aus dieser wilden Grenzregion Pakistans kam, hatte ich schon an seinem verwegenen Aussehen erkannt. Es erklärte auch den fremdartigen Akzent seines Paschtu.
Er stellte mir auch gleich die beiden anderen vor: „Belal aus Kabul.“ Der hockte mir direkt gegenüber. Ein rundlicher Typ mit blitzenden Augen, der schon auf den ersten Blick einen sehr munteren Eindruck machte. Er nickte mir zu und statt „Salaam“ sagte er nur „Festmahl ist gut – für diesen Fraß.“ Dabei zeigte er auf die noch ziemlich volle Schüssel vor sich.
„Und Malik kommt aus Jalalabad.“ Bei diesem Ortsnamen zuckte ich kurz zusammen. Aber als sich dieser Malik zu mir umdrehte, entspannte ich mich sofort wieder. Ich war sicher, ich hatte ihn noch nie gesehen. Den hohen Wangenknochen und den schmalen Augen nach zu urteilen war er ein Hazara. Er war hager und wohl ungefähr so groß wie ich, schien aber zwei, drei Jahre älter zu sein. „Komm, setz dich zu mir, sagte er. Sein Gesichtsausdruck hatte etwas Melancholisches. Er war mir auf Anhieb der Sympathischste von den Dreien.
„Ich bin Adib aus Kabul“, sagte ich, „aber hier nennt man mich Reza.“ Alle lachten. „Wenn’s danach geht, heiße ich Darian“, meinte Malik. Ihn zumindest hatten Kadérs Leute für die Durchquerung des Iran offenbar auch mit örtlichen Ausweispapieren versorgt. Ich fragte, ob noch mehr kommen würden. Belal meinte, mehr Leute könne man in dieser Pension gar nicht unterbringen, das hier sei nämlich der einzige Raum für Gäste. Deshalb wolle der Wirt uns auch so schnell wie möglich wieder loswerden. „Je schneller der Umsatz, desto höher der Gewinn.“
Die anderen waren anscheinend schon mit dem Essen fertig. Der Reis in der Schüssel – „das nennt der Pilau“, sagte Belal – sah gräulich aus und war schon halb kalt. Ich aß trotzdem, denn man wusste ja nie, wann man das nächste Mal etwas zu essen bekam. Später erfuhr ich, dass die anderen, die alle schon am Vortag in dieser Pension zusammengefunden hatten und deshalb wussten, was sie am Abend erwartete, sich am Nachmittag in einem kleinen afghanischen Restaurant in der Nähe sattgegessen hatten. Faizal und Belal schienen über Geld zu verfügen, denn sie hatten ihrem neuen Freund Malik sogar das Essen bezahlt. Das hat der mir aber erst am nächsten Tag erzählt, als die beiden nicht in der Nähe waren.
Die Nacht habe ich kaum geschlafen. Der Raum erinnerte mich an das Zimmer, in das man Abdul und mich in Herat eingesperrt hatte, nur dass es hier noch schmutziger und die Matratzen noch durchgelegener waren. Die anderen schnarchten. In meinem Magen grummelte es die ganze Zeit. Die Zahl der Kakerlaken, die man schon bei Licht vereinzelt über Boden und Wände hatte huschen sehen, schien sich im Dunkeln – den leisen Kratz- und Raschelgeräuschen nach – vervielfacht zu haben. Ich verkroch mich so tief wie möglich in meine gefütterte Jacke und zog mir die Kapuze über die Ohren.
Kaum hatte der Wirt uns vier in den kleinen Lieferwagen gescheucht, der direkt vor dem Eingang der Pension bereitstand, warf er die Türen hinter uns zu. Wir saßen noch nicht einmal richtig auf dem Boden des ansonsten leeren Laderaums, da fuhren wir auch schon los.
Wieder schien es kreuz und quer durch die Stadt zu gehen, und immer wieder musste der Fahrer scharf bremsen. Da man sich nirgendwo festhalten konnte, blieb uns nichts anderes übrig, als uns jedes Mal schnell aneinander zu klammern, um nicht quer durch den Laderaum zu schlittern. Durchgeschüttelt und mit verkrampften Muskeln waren wir froh, als wir endlich hielten und die Türen geöffnet wurden. Draußen stand wieder der junge Mann mit Lederjacke und Sonnenbrille. Der Busbahnhof aber, vor dem wir hier standen, sah ganz anders aus, als der am Abend zuvor.
Zeit, uns näher umzusehen, hatten wir aber nicht. Der Lederjackentyp drückte jedem von uns einen Busfahrschein in die Hand und lief los. Wir drängelten uns hinter ihm her durch die Menge. Bevor wir in den Bus nach Täbris einstiegen, schärfte der Mann uns noch ein, uns unauffällig zu verhalten und so zu tun, als wären wir Touristen. Nach der Ankunft in Täbris sollten wir wieder so lange vor dem Busbahnhof warten, bis wir abgeholt würden.
Wie wir feststellten, hatte er für uns jeweils zwei Sitze nebeneinander gebucht. Belal und Faizal hatten Plätze im vorderen Teil des Busses bekommen. Ich freute mich, dass ich weiter hinten mit Malik zusammensaß. Schnell entdeckten wir Gemeinsamkeiten. Seine Eltern hatten sich genauso wie meine in einem Flüchtlingslager in Pakistan kennengelernt. Sein Vater stammte aus einer Familie mit Landbesitz in der Nähe von Jalalabad. Als erklärte Gegner der Taliban – einer der Brüder seines Vaters diente auch in der Armee – hatten sie bei deren Machtübernahme in der Provinz Nangarhar nach Pakistan fliehen müssen. Nach dem Sturz der Taliban Ende 2001 waren sie, wie meine Eltern auch, nach Afghanistan zurückgekehrt. Seine Mutter war eine Hazara aus Mazar-e-Sharif. Sie war die einzige aus ihrer Familie gewesen, die dem großen Massaker entkommen war, dass die Taliban 1998 unter den Hazara der Stadt angerichtet hatten. Als ich ihm sagte, dass mein Großvater mir von diesem schrecklichen Blutbad erzählt hatte, zeigte er sich gerührt. Die meisten wollten davon ja schon gar nichts mehr wissen, meinte er.
Nachdem die Taliban in letzter Zeit in der Provinz Nangarhar erneut immer stärker geworden waren, hatte Maliks Vater beschlossen, seinen Sohn auf den Weg nach Europa zu schicken. Mit dem Argument, ‚unser Malik soll es einmal besser haben‘, hatte er sich damit gegen den Widerstand seiner Frau und seines in der Armee dienenden Bruders durchgesetzt. Er hatte aber alles getan, seinem Sohn die Flucht so sicher wie möglich zu machen. Bis Maschhad hatte er Maliks Reise selbst organisiert – samt Pass und einem Studentenvisum, für das ein entfernter Verwandter mit Beziehungen zu einer Universität dort gesorgt hatte. Maliks Onkel, der Soldat, hatte die Fahrt über die pakistanische Grenze nach Peschawar arrangiert. Von dort war Malik direkt bis nach Maschhad geflogen. Ab da hatte sein Vater Kadér für Schlepperdienste bis nach Frankreich bezahlt. Wir hatten also auch noch das gleiche Ziel!
Als Malik hörte, was ich bei der Überquerung der Grenze in den Iran durchgemacht hatte, zeigte er sich ehrlich betroffen. Kurz vor unserer Ankunft in Täbris warnte er mich auch noch davor, Faizal allzu sehr zu vertrauen. Der habe ihm erzählt, dass er von Islamabad aus direkt mit dem Flugzeug nach Teheran gekommen sei, scheine eine Menge Geld dabeizuhaben, und als er am Anfang in der Pension etwas aus seinem Rucksack gekramt habe, sei ihm versehentlich ein Pass heruntergefallen. Den habe er zwar hastig wieder aufgehoben und weggesteckt, aber Malik war sicher, dass es ein türkischer Pass gewesen war. „Warum ist er dann nicht gleich in die Türkei oder bis nach Europa geflogen?“, fragte ich. Das wusste mein neuer Freund natürlich auch nicht.
Schon als unser Bus einparkte, fiel mir ein Mann mit der Statur eines Boxchampions auf, der in einiger Entfernung an einen Betonpfeiler gelehnt unsere Ankunft beobachtete. Um diese Zeit, es muss schon gegen Mitternacht gewesen sein, waren im überschaubaren Busbahnhof von Täbris nur wenige Menschen unterwegs. Der Boxer wartete, bis sich die anderen Passagiere zu verlaufen begannen und kam dann breitbeinig direkt auf uns zu.
„Kadér?“, fragte er. Fünf Minuten später saßen wir in seinem alten Peugeot und fuhren in die Nacht hinaus. Während der Fahrt erklärte er uns etwas in einer Sprache, die wie Farsi klang, aber mit Worten durchsetzt war, die ich nicht verstand. Mit dieser typischen Mischung aus Persisch und Kurdisch wurde ich erst später etwas besser vertraut. Immerhin wurde klar, dass wir erst mal in seinem Haus auf dem Land übernachten würden, und es noch nicht ganz sicher war, wann es weitergehen würde.
Nach etwa anderthalb Stunden Fahrt – der letzte Teil in steilen Kurven durch ein zerklüftetes Gebirge, das im fahlen Licht des Dreiviertelmonds richtig gespenstisch aussah – bogen wir auf ein baumbestandenes Grundstück ein und hielten neben einem recht ansehnlichen Steinhaus. Der Boxer führte uns hinter das Haus zu einem Anbau, ließ uns ein und forderte uns auf, es uns bequem zu machen. Beim Hinausgehen rief er uns – diesmal in klarer verständlichem Farsi – noch zu, er werde uns gleich etwas zu essen bringen, wir hätten ja sicher Hunger.
Wir sahen uns an. Wir hatten wohl alle zuerst ein mulmiges Gefühl gehabt, als dieser bullige Mann auf dem Busbahnhof auf uns zugekommen war. Malik hatte ich noch im Bus von Abdul erzählt, den ich in Taybad hatte zurücklassen müssen, und dass der dort jetzt praktisch als Sklave in einer Ziegelei schuften musste. Da gebe es noch Schlimmeres, hatte Malik erklärt. Er habe unterwegs Geschichten von Jungen gehört, die noch ganz anderen Männern in die Hände gefallen seien. Ich hatte gleich verstanden, was damit gemeint war …
Wir aber fanden uns in einem großen sauberen Raum wieder, sogar mit einer Waschgelegenheit nebenan, und kurze Zeit später brachte uns ein Junge – schon von der Statur her unverkennbar Sohn des Boxers – eine Schüssel voll duftendem, dampfendheissem Pilau mit großen Fleischstücken drin und eine Riesenkanne grünen Tee.
„Hier bleibe ich“, sagte Belal und strahlte.
Als der Sohn unseres ungewohnt freundlichen Wirts uns am nächsten Morgen das Frühstück brachte, sagte er, wir könnten uns auch draußen aufhalten, hinter dem Haus. Dort verbrachten wir dann tatsächlich viele Stunden, plauderten im Gras sitzend unter einem der Aprikosenbäume, spielten Karten oder dösten. Am Nachmittag des zweiten Tages überbrachte uns der Boxer die Nachricht, dass es am nächsten Morgen losgehen würde. Wir sollten möglichst viel schlafen, die kommenden zwei bis drei Tage würden sehr anstrengend werden.
Am folgenden Nachmittag saßen wir immer noch unter dem Aprikosenbaum. Es gebe Probleme an der Grenze. Da laufe offenbar gerade eine koordinierte Aktion von Polizei und Grenztruppen. Alle Kontrollposten seien ständig besetzt, und es gebe Patrouillen rauf und runter die ganze Grenze entlang. Das hätten ihm seine ‚Schlepperfreunde‘ mitgeteilt, klärte uns unser Wirt auf.
Auch am nächsten Tag keine Änderung der Lage. Der Boxer wurde langsam unruhig. „Die bezahlen einen für zwei Tage, aber wenn es Probleme gibt, und es wird eine ganze Woche draus, zucken sie die Achseln und erzählen was von Geschäftsrisiko. Und das schieben die natürlich demjenigen zu, der sich am wenigsten wehren kann.“ Aber selbst wenn man wolle, komme man aus diesem Geschäft nicht mehr raus, fügte er mit einem resignierenden Achselzucken hinzu.
„Hauptsache, wir kriegen weiter unser Essen“, sagte Faizal mit einem Grinsen, als unser Gastgeber fort war.
Am frühen Morgen des fünften Tages wurden wir noch vor Sonnenaufgang aus dem Schlaf gerüttelt. „Es geht los!“ Neben dem Haupthaus stand ein Kleinlaster mit offener Ladefläche. „Yallah, hoch da! Beeilt euch – und verkriecht euch zwischen den Säcken“, rief ein kleiner drahtiger Typ, offenbar der Fahrer.
„Allah sei mit euch!“, hörten wir noch die tiefe Bassstimme unseres freundlichen Wirts, da fuhren wir bereits an. Kaum waren wir auf die Landstraße eingebogen, kam vor uns eine weite Wasserfläche in Sicht. Gleich darauf erreichten wir einen Damm, der schnurgerade auf dieses Gewässer hinaus und weiter ins Nichts zu führen schien. Eine Weile begleitete uns links und rechts der mehrspurigen Fahrbahn noch ein breiter Landstreifen, der aussah, als wäre er schneebedeckt. „Salz“, rief mir Belal über den Sack zu, der zwischen uns lag. Da hatten wir aber schon die eigentliche Brücke erreicht und sahen auf beiden Seiten der Fahrbahn nur noch Wasser, soweit das Auge reichte. Diese Brücke führte über einen riesigen See! Erst als wir eine ganze Weile gefahren waren, tauchten allmählich die Umrisse des gegenüberliegenden Ufers aus dem Morgendunst auf.
Ich musste an den Sommernachmittag denken, an dem ich mit meinem Vater zusammen am Ufer des Qargha-Sees gesessen hatte und wir beide zu den Bergen am anderen Ufer hinübergeschaut hatten – ein Jahr bevor die Welt meiner Kindheit untergegangen war. Ich musste schlucken und spürte, wie mir Tränen in die Augen traten. Kein Wunder bei dem Zugwind während der schnellen Fahrt über den offenen See. Ich duckte mich zwischen die Säcke.
Später ging es auf Landstraßen über eine grüne Ebene, manchmal durch Baumalleen oder an Orangenplantagen vorbei, und hin und wieder auch durch kleine Dörfer, deren von Obstbäumen umstandene Steinhäuser sich hinter Mauern oder hohen Zäunen versteckten.
Eine Zeit lang hatte ich das Gefühl, wir führen im Kreis. Dann aber ging es lange eindeutig nach Norden, da mir die inzwischen schon höherstehende Sonne stetig von rechts ins Gesicht schien. Schließlich fuhren wir in Serpentinen immer weiter ins Gebirge und ich verlor die Orientierung.
Wir kamen auch an Kontrollposten vorbei, einmal kurz vor einem größeren Dorf, später noch zwei Mal mitten im Nirgendwo. Wir merkten das jedes Mal daran, dass der Fahrer seinen Arm aus dem Fenster des Führerhauses streckte und zu uns nach hinten brüllte, wir sollten uns verkriechen. Einmal hob ich vorsichtig den Kopf, sobald der Fahrer wieder beschleunigte, und sah noch, dass da hinter uns tatsächlich zwei mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten am Straßenrand standen.
Dem Sonnenstand nach war es längst später Nachmittag, meine rechte Gesichtshälfte brannte, aus meiner Wasserflasche kam kein einziger Tropfen mehr und alle Glieder schmerzten von dem stundenlangen Liegen oder Hocken zwischen den Säcken. Am Anfang hatten wir diese Unterlage noch einigermaßen komfortabel gefunden. Rohbaumwolle, hatte Belal mit Kennermine behauptet, nachdem er gleich nach unserer Abfahrt gegen einen der Säcke geboxt hatte. Inzwischen aber sehnten wir alle nur noch das Ende der Fahrt herbei.
Inzwischen ging es in Serpentinen wieder bergab in ein Tal, wir durchquerten ein kleines Bergdorf und hielten schließlich vor einem etwas abseits gelegenen Gehöft. Zwei finster aussehende Typen erwarteten uns schon. Der eine fragte unseren Fahrer etwas auf Farsi. Ich verstand nur „Hast du den Afghanen dabei?“ Unser Fahrer antwortete etwas, was ich überhaupt nicht verstand. Wahrscheinlich sprach er kurdisch. Dabei zeigte er auf die Säcke und lachte.
Ein dritter Mann erschien in der Tür des Hauses und winkte uns herein. „Kommt, gleich gibt‘s was zu Essen und ihr könnt euch etwas ausruhen, bevor ihr abgeholt werdet“, rief er uns zu. Ausgehungert stürzten wir uns auf das Lammfleisch mit Reis, das uns zwei kleine Jungs kurz darauf servierten. Zwischen zwei Bissen fragte ich, ob jemand verstanden hätte, was der Typ da draußen mit dem ‚Afghanen‘ gemeint hätten.
„Er hat schwarzer Afghane gesagt.“ Faizal lachte. „Weißt du etwa nicht, was das bedeutet? Aber hier ist das vielleicht eine Bezeichnung für noch wertvolleren Stoff aus Afghanistan.“
„Soll das etwa heißen, fragte Belal, „wir waren gar nicht die wertvollste Fracht auf diesem Transport?“ Auch er lachte.
„Vor allem würde das heißen, dass wir als eine Art Lebensversicherung für den Fahrer gedient haben. Schließlich wird Drogenhandel im Iran mit dem Tode bestraft. Bei einer Kontrolle hätten die sich vielleicht damit zufriedengegeben, uns ins Gefängnis zu stecken, und hätten sich um seine Säcke gar nicht weiter gekümmert“, gab Faizal grinsend zurück.
Malik und ich sahen uns an. Mein Freund fand die Vorstellung, dass wir als Tarnung für einen Drogentransport gedient haben könnten, offenbar auch nicht so witzig.
Der stets muntere Belal aber setzte sogar noch einen drauf. „Hauptsache, die stecken nicht auch noch etwas von dem Zeug in unsere Rucksäcke, bevor es über die Grenze in die Türkei geht.“
„Ich jedenfalls werde meinen Rucksack ab jetzt nicht mehr aus den Augen lassen“, sagte ich. Ich fürchte, mein Lachen klang etwas gezwungen.
Wir hatten die Riesenportion Fleisch mit Reis fast völlig vertilgt, als einer der kleinen Jungen uns einen Korb voller Äpfel sowie Tüten mit Rosinen, getrockneten Aprikosen, geschälten Mandeln und Nüssen ins Zimmer brachte. „Esst, so viel ihr könnt und packt euch auch noch die Rucksäcke voll. Da draußen in den Bergen weiß man nie, wann man wieder etwas zu essen bekommt“, sagte er. „Und legt euch noch etwas aufs Ohr. Kurz vor Mitternacht geht’s weiter.“
„Wacht endlich auf, es geht los!“
Im ersten Moment wusste ich gar nicht, wo ich überhaupt war. Instinktiv griff ich als Erstes nach meinem Rucksack. Malik neben mir schlief immer noch fest. Ich rüttelte ihn wach und wir stolperten hinter den anderen her.
Draußen war es dunkel. Am schwarzen Himmel funkelten die Sterne. Der Kleinlaster, mit dem wir gekommen waren, war verschwunden. Stattdessen wartete ein schwarzer Toyota-Geländewagen auf uns. Faizal und Belal waren schon eingestiegen. Der Fahrer, sportliche Lederjacke, nicht viel älter als wir, hielt die Tür zum Beifahrersitz auf. „Yallah, los, los!“ Malik zögerte und stieg dann vorne bei ihm ein. Ich drückte mich mit meinem Rucksack neben die beiden anderen auf den Rücksitz.
Der Fahrer machte sich nicht mal die Mühe, die Scheinwerfer einzuschalten, als er den Abhang hinunterfuhr und auf die Straße einbog. Schon bald verengte sich das Tal und die Straße wand sich wieder in Serpentinen in die Berge hinauf. Belal stieß mich an. „Der scheint diese Strecke im Schlaf zu kennen“, meinte er.
Selbst auf dieser engen, kurvenreichen Bergstraße fuhren wir die meiste Zeit ohne Licht. Vor dem sternenübersäten Himmel zeichneten sich nur schwach die gezackten Umrisse schroffer Felsen am Straßenrand und hin und wieder die schwarze Silhouette der umliegenden Berge ab. Der Fahrer hatte sein Fenster ein Stück weit geöffnet. Mit dem kühlen Fahrtwind drang der Duft von Wildblüten und Kiefernharz herein. Das eintönige Brummen des Motors und das Schaukeln des gut gefederten Toyota schläferten mich ein.
Ich schreckte erst wieder hoch, als der Wagen wild zu schaukeln begann. Wir waren von der Straße auf eine unbefestigte Piste mit tiefen Schlaglöchern eingebogen. Heftige Ausweichmanöver des Fahrers schleuderten uns gegeneinander. Wir bewegten uns über eine kahle Hochebene, die im Licht des inzwischen emporgestiegenen Halbmonds seltsam unwirklich glänzte. Ich fror in der eiskalten Luft, die zum immer noch offenen Fenster hereinblies.
Der Fahrer sagte etwas zu Malik. Der rief zu uns nach hinten, wir wären gleich da. Kurz darauf blinkte in der Ferne schräg vor uns mehrmals kurz hintereinander ein Licht auf. Der Fahrer verließ die Piste und hielt quer durch das Gelände direkt auf diese Stelle zu.
Als wir schließlich anhielten, erkannten wir, dass wir den Rand eines Waldes erreicht hatten.
„Aussteigen. Ab hier geht’s zu Fuß weiter.“
„Hier schmeißt der uns raus?“, protestierte Faizal, aber da öffnete der Fahrer schon die Tür auf seiner Seite. Er holte etwas aus der Brusttasche seiner Lederjacke. Der schrille Pfiff einer Trillerpfeife ertönte. Ein Antwortpfiff kam ein ganzes Stück weit entfernt vom Waldrand her. Kaum hatten wir uns ganz steif von der langen Fahrt und vor Kälte mitsamt unseren schweren Rucksäcken aus dem Wagen gewunden, warf der Fahrer die Türen zu. „Allah sei mit euch“, rief er uns durch das offene Fenster zu, ließ den Motor an, wendete und fuhr davon.
Aus dem Dunkel des Waldes löste sich ein großer Schatten. Erst als der näherkam, bemerkten wir, dass es ein Reiter war. „Hierher!“, rief er uns zu. Als er sah, dass wir uns in Bewegung setzten, wendete er sein Pferd. Wir beeilten uns, ihn einzuholen. An der Stelle, wo er aufgetaucht war, tauchte er in den Wald ein. Erst da sahen wir, dass da noch ein weiterer Reiter stand. Der hob schweigend die Hand zum Gruß, wartete, bis wir hinter dem anderen her an ihm vorbei waren und bildete dann die Nachhut unseres kleinen Zuges.
Der trotz Mondlicht kaum erkennbare Pfad, dem wir im Gänsemarsch folgten, führte in weiten Kehren bergab. Sobald wir das Plateau verließen, legte sich der kalte Wind. Ich war froh, dass ich mich endlich mal wieder richtig bewegen konnte. Schon nach kurzer Zeit war mir warm. Der Sternenhimmel, die Stille ringsum, die klare Luft, alles erinnerte mich an meine Zeit in den Bergen. Diesmal sollte mich der Weg durch die Nacht aber in die Freiheit führen. Wahrscheinlich hätte ich unseren lockeren Marsch bergab sogar genossen, hätte ich nicht gewusst, dass uns wieder ein Grenzübertritt bevorstand.
Fast wäre ich auf Malik geprallt, der die ganze Zeit vor mir gelaufen und plötzlich stehengeblieben war. Ein Zischen von vorn, dann standen wir alle und lauschten. Nach einer Weile, seitlich aus der Ferne, ein Ruf … ein Schuss … weitere Schüsse in ganz kurzem Abstand. Danach eine Stille, so tief, dass es einem in den Ohren nachhallte.
Ich kann nicht sagen, wie lange wir da so standen und lauschten. Schließlich hob der Reiter vor uns die Hand und es ging weiter. Kurz darauf erreichten wir die Talsohle und hielten vor einem breit ausgetretenen Pfad. Den überquerten wir erst, nachdem unser Führer sich längere Zeit nach links und rechts vergewissert hatten, dass sich nirgendwo etwas regte. Ein Stück weiter ging es über einen Bach, der eigentlich nicht sehr tief war. Ich aber glitt auf einem der Steine aus, auf denen wir hinüberbalancierten. Ich konnte noch froh sein, dass ich nicht der Länge nach im Wasser gelandet war. Am anderen Ufer hätte ich gerne erstmal das Wasser aus meinen Schuhen geleert und meine Hosenbeine ausgewrungen, aber die beiden Reiter trieben uns weiter und den Hang auf der anderen Talseite wieder hinauf.
Bald darauf wurde es so steil, dass unsere beiden Begleiter absteigen und ihre Pferde am Zügel führen mussten. Nicht lange, und mir zitterten die Beine und das Herz schlug mir bis zum Hals. Der Hang war felsig, und ständig auf kantige Steine zu treten machte das Marschieren zunehmend zur Qual. Ich war froh, als Belal hinter mir rief, er könne nicht mehr und sich einfach auf den Boden fallen ließ. Die Reiter schimpften, aber es blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als uns eine kurze Pause zu gönnen.
Nach einem weiteren steilen Anstieg erreichten wir endlich den Gipfel des Höhenzugs. Der jüngere der beiden Reiter – der, der die Nachhut gebildet hatte – saß gleich wieder auf. Sein vierschrötiger Kollege packte den immer noch jammernden Belal und hob ihn hinter seinem Kollegen aufs Pferd. Dann ging es weiter. Wenn ich gewusst hätte, wie weit wir noch laufen mussten, immer wieder bergab und bergauf, hätte ich mich wohl auch einfach auf den Boden fallen lassen wie Belal. Am Ende bin ich nur noch ganz automatisch vorangestolpert.
Es dämmerte schon, als wir auf halber Höhe eines Berges um eine Felsnase bogen und plötzlich eine von Kiefern umgebene Lichtung vor uns lag. Ich erschrak, denn da lagerten, jeweils in kleinen Gruppen zusammen, sicher mehr als zwei Dutzend Personen, die alle zu schlafen schienen. An einer Stelle am Rande der Lichtung saßen drei oder vier Männer beieinander, die offenbar Wache hielten. Neben ihnen waren Pferde angebunden. Unser Führer hielt direkt auf diese Gruppe zu.
Eine der Gestalten, ein hagerer junger Mann mit abstehenden Ohren, erhob sich und kam uns entgegen. „Von Kadér?“ Er brachte uns zu einer Stelle etwas abseits unter den Bäumen. „Ruht euch erst einmal aus. Vor morgen Mittag geht es sowieso nicht weiter“, sagte er. Ich schaffte es gerade noch, meine gefütterte Jacke fest um mich zu wickeln und mich auf den sandigen Boden fallen zu lassen, dann war ich fest eingeschlafen.
Als ich aufwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel, aber noch lag unser Plätzchen im Schatten der Bäume. Malik und Belal schliefen noch. Faizal entdeckte ich in einer Gruppe von bärtigen jungen Männern, die etwas entfernt im Kreis zusammensaßen und sich angeregt unterhielten. Erst wollte ich rübergehen, aber irgendetwas hielt mich dann doch davon ab. Es saßen oder standen noch mehrere solcher Runden auf diesem kleinen Plateau beieinander. Offenbar war dies ein Sammelplatz, an dem die Schlepper ihre ‚Kunden‘ zusammenführten, bevor sie sie über die Grenze brachten.
Am Ende haben wir drei Nächte und zweieinhalb Tage auf diesem Plateau zugebracht. Immer wieder hieß es, es ist noch nicht sicher. Die koordinierte Aktion der iranischen und türkischen Grenzer, von der schon der Boxer gesprochen hatte, war anscheinend immer noch nicht zu Ende. Angeblich hatte es bei den Grenztruppen drüben auf türkischer Seite kürzlich auch noch einen großen Personalaustausch gegeben. Dann dauere es immer eine Weile, bis alles wieder wie geschmiert laufe. Das jedenfalls wollte einer von Faizals bärtigen pakistanischen Landsleuten in Erfahrung gebracht haben.
Die Schlepper, die uns eigentlich schon längst wieder hatten los sein wollen, wurden immer gereizter. Auch unter den Flüchtlingen – ausschließlich junge Männer – wurde die Stimmung ab unserem zweiten Tag dort oben aggressiv. Am Abend unseres ersten Tages war noch eine kleine Eselskarawane mit Decken und Lebensmitteln eingetroffen. Fladenbrot, Oliven und Ziegenkäse reichten aber gerade bis zum Mittag des nächsten Tages.
Nicht alle waren vor ihrem Aufbruch zu diesem Ort so gut versorgt worden, wie wir. Wie hatten wir geflucht, als wir unsere schweren Rucksäcke über die Berge geschleppt hatten. Jetzt wurden wir von vielen um unsere Äpfel und Nüsse beneidet. Am zweiten Abend blieb uns schließlich nichts anderes übrig, als den Rest unserer Schätze mit den bärtigen Freunden von Faizal zu teilen. Die hatten besonders aggressiv unsere brüderliche Solidarität eingefordert. Dabei mochten sie mich und meine beiden afghanischen Freunde offenkundig genauso wenig, wie wir sie. Faizal aber meinte, wir würden vielleicht nochmal froh sein, auf ihre Hilfe zählen zu können. Besonders ihr Anführer, ein gewisser Zabiullah, habe überallhin beste Verbindungen, auch nach Afghanistan – vor allem in die Provinz Nangarhar.
Ich sah mir den bärtigen Mann, auf den er dabei zeigte, daraufhin nochmal genauer an. Ja, der war mir schon vorher aufgefallen. Nicht nur, weil er etwas älter und so groß und breitschultrig war. Meist hatte er sich auch etwas abseits von den anderen Pakistanern gehalten und hatte mit untergeschlagenen Beinen und gesenkten Augenlidern dagesessen, als wäre er ins Gebet versunken. Offenbar besaß er große Autorität bei seinen Landsleuten. Auch jetzt, als wir unsere letzten Vorräte mit denen teilten, wartete dieser Zabiullah etwas abseits darauf, bis ihm einer der anderen einen besonders schönen Apfel überreichte, den er von uns bekommen hatte.
Wie sich herausstellte, war Malik bei diesem Akt brüderlicher Solidarität schlauer gewesen als ich. Als wir später an unserem Schlafplatz nebeneinanderlagen, holte er plötzlich noch einen Apfel hervor, den er „vor denen gerettet“ hatte. „Mein letzter“, sagte er und hielt ihn mir hin. Ich wollte dieses Geschenk gar nicht annehmen, aber er bestand darauf, dass wir uns den Apfel dann wenigstens teilten, „wie Brüder“.
Gewieher von Pferden riss mich aus dem Schlaf. Im Osten wurde es gerade erst hell. Malik und Belal neben mir waren schon wach und sahen angespannt den Reitern entgegen, die gerade aus dem Wald auf unsere Lichtung herauskamen. Einer von denen war der Jüngere der beiden, die uns hergebracht hatten. Kaum waren sie abgesessen, hatten sich ihre Schlepperkollegen bereits um sie versammelt. Ihr Lagebericht löste eine erregte Auseinandersetzung aus. Auch wenn wir aus der Ferne kein Wort verstanden – untereinander sprachen unsere Schlepper, wie wir inzwischen festgestellt hatten, ohnehin immer nur Kurdisch – war klar, worum es ging: Die einen drängten auf sofortigen Aufbruch, während den anderen die Lage immer noch zu unsicher war. Erst kurz vor Mittag, einige der Flüchtlinge hatten gerade begonnen, in Sprechchören etwas zu essen zu fordern, fiel die Entscheidung: Zwei der Schlepper ritten davon. Sie sollten wohl sicherstellen, dass unser Zug nicht einer Patrouille der Sicherheitskräfte in die Arme lief.
„Yallah – beeilt euch!“ Die verbliebenen Reiter kreisten uns ein, als wären wir eine Viehherde. „Immer einer hinter dem anderen und dicht zusammenbleiben! Wehe, einer von euch tanzt aus der Reihe.“ Plötzlich waren die sogar mit Schlagstöcken bewaffnet. Einige unserer Mitflüchtlinge protestierten, aber auch die fügten sich schnell. Malik, Belal und ich waren ziemlich weit hinten in der Kolonne gelandet. Plötzlich kam Faizal angelaufen und flüsterte uns zu, die mit den Schlagstöcken würden den Zug von hinten her überwachen und antreiben. Wir schafften es gerade noch, nach vorne zu laufen und uns direkt hinter Faizals pakistanischen Freunden einzureihen, die sich die ersten Plätze in der Kolonne gesichert hatten. Da ertönte auch schon das nur allzu vertraute „Yallah, los, los!“ der ‚Treiber‘.
Nachdem wir uns warmgelaufen hatten, spürte ich meine von dem Gewaltmarsch davor immer noch nicht ganz verheilten Fußsohlen schon gar nicht mehr. Meine Hoffnung, dass es direkt bergab ins Tal gehen würde, erfüllte sich allerdings nicht. Im Gegenteil. Erneut mussten wir über Stunden bergauf und bergab marschieren. Wenigstens gönnten die Reiter uns mehrere längere Pausen. Dass dies nicht aus Menschenfreundlichkeit geschah, wusste mal wieder einer von Faizals Pakistanern. Unser Ziel sei ein Marktflecken unten im Tal und die Schlepper wollten dort erst ankommen, wenn es schon dunkel war. Das aber bedeutete, dass wir den ganzen Tag über erneut nichts zu essen bekommen würden. Dabei klang das Murren und Fluchen um uns herum bereits bedrohlich genug.
Die Stimmung verschlechterte sich weiter, als es auch noch zu regnen begann. Völlig durchnässt erreichten wir ein kleines Waldstück, wo wir einen letzten Halt einlegten. Im Tal unter uns lag eine Ortschaft, die offenbar ein Knotenpunkt für den grenznahen Handel war. Wir konnten beobachten, wie auf einem freien Platz am Ortsrand Säcke, Ballen und Kisten von Kleinlastern auf Packpferde und Esel geladen wurden. Diese Lasttiere machten sich dann einzeln oder in kleinen Karawanen in alle Richtungen auf den Weg. Währenddessen teilten uns die Schlepper schon mal in Gruppen zu fünft oder sechst auf. Aus Sicherheitsgründen, sagte man uns. Offenbar war es ein zu großes Risiko, eine so große Gruppe auf einmal über die Grenze zu bringen.
Ich dachte erst, Faizal würde sich seinen Pakistanern anschließen, aber im letzten Moment kam er mit deren Anführer, diesem Zabiullah, zu uns rüber. Als dieser Mann mir jetzt zum ersten Mal unmittelbar gegenüberstand, verstand ich, warum er unter seinen Landsleuten so große Autorität genoss. Der Blick seiner kohlschwarzen Augen war so durchdringend, dass ich das Gefühl hatte, er hätte mich bei etwas Verbotenem ertappt. „Salaam“, sagte er. Seine tiefe, volltönende Stimme war nicht unsympathisch – im Gegenteil. Eigentlich konnte es ja auch nur von Vorteil sein, dachte ich, wenn ein solche Autorität ausstrahlender Mann bei dem bevorstehenden Grenzübertritt unserer kleinen Gruppe dabei sein würde. Der würde wohl kaum zulassen, dass man uns in so eine Kiste sperrte, wie man es Abdul und mir beim Überqueren der Grenze von Afghanistan in den Iran zugemutet hatte.
Sobald es dunkel wurde, machten sich die einzelnen Grüppchen im Abstand von wenigen Minuten auf den Weg ins Tal. Zabiullah, Faizal, Malik, Belal und ich wurden von einem der Männer, die das Ende der Kolonne mit Knüppeln traktiert hatten, zu einer Pension direkt am Rande des Marktfleckens geführt. Kaum waren wir in dem kleinen Innenhof vor dem Haus, wandte der Mann sich zum Gehen, allerdings nicht ohne uns noch seine Verachtung zu demonstrieren: Er rate uns dringend, uns erst mal zu waschen. Sonst würde man uns in der Nacht an der Grenze ja schon drei Meilen gegen den Wind riechen. Eine grobe Beleidigung für jeden Muslim, für den das regelmäßige Waschen zu den religiösen Pflichten gehört. Ich fürchtete schon, Zabiullah würde sich auf den Kerl stürzen und ihn erwürgen, aber er beließ es bei einem hasserfüllten Blick.
Die kleine Episode war vergessen, sobald wir gewaschen und in trockenen Kleidern vor den gefüllten Tellern und Schüsseln saßen, die unsere Wirtin, eine energische Alte, auf einer Decke in der Mitte unseres Zimmers aufgebaut hatte. Heißhungrig machten wir uns über das Essen her. Kaum aber war das leere Geschirr weggeräumt, legten wir uns an Ort und Stelle hin, um wenigstens noch ein paar Stunden Schlaf zu bekommen. Wir wussten, dass es noch in der Nacht weitergehen würde.
Die resolute Alte selbst war es, die uns aus dem Schlaf riss und ohne weitere Umstände aus dem Haus scheuchte. „Möge Allah mit euch sein“, sagte sie zum Abschied.
Im Halbschlaf, unsere Rucksäcke an der Hand, traten wir auf den Platz vor der Pension hinaus. Wir hatten gedacht, dass uns wieder ein Fußmarsch bevorstehen würde, aber da stand ein Geländewagen, der wie eines der alten russischen Armeefahrzeuge aussah, wie man sie manchmal noch in Afghanistan herumfahren sieht. Der Fahrer lehnte sich über den Beifahrersitz und stieß die Tür auf.
„Leute von Kadér? Dann kommt“, rief er uns mit gedämpfter Stimme zu, obwohl auf dem weiten Platz um diese Zeit sonst niemand zu sehen war. Zabiullah stieg wie selbstverständlich vorne neben dem Fahrer ein, wir restlichen vier quetschten uns auf dem Rücksitz zusammen. Mit aufgeblendeten Scheinwerfern fuhren wir quer durch den Ort und dann auf der gut ausgebauten Landstraße weiter. Der junge Fahrer summte die ganze Zeit vor sich hin, als wären wir auf einem harmlosen Ausflug ins Grüne. Bald bogen wir in ein Seitental ein und gelangten auf eine holprige Piste, die sich in steilen Kehren in die Berge hinaufwand. Der Himmel klarte auf und der Fahrer schaltete die Scheinwerfer aus. Zabiullah fragte ihn irgendetwas, aber er antwortete nicht. Stattdessen begann er, eine flotte Melodie zu pfeifen und mit den Fingern auf dem Lenkrad herumzutrommeln. Der Motor dröhnte so laut auf der steilen Strecke, dass ich sicher war, man könne uns kilometerweit hören. Die Kurverei schien kein Ende zu nehmen. Waren wir etwa schon auf türkischer Seite? Kaum hatte ich das gedacht, hörte ich den Fahrer rufen: „Wir bald da!“
„In der Türkei?“, schrie Belal in den Motorenlärm. Der Fahrer nahm den Fuß etwas vom Gas.
„Türkei hinter Berg“, rief er nach hinten. „Gleich oben, dann nur noch Berg runter.“
Tatsächlich erreichten wir kurz darauf die Passhöhe. Zunächst ging es danach wieder in engen Serpentinen steil bergab, wobei hin und wieder in der Ferne unten im Tal ein paar Lichter ins Blickfeld gerieten. „Dorf Türkei“, machte uns unser Fahrer beim ersten Mal darauf aufmerksam.
Bald wurden die Kehren weiter und der Abhang weniger steil. Der Fahrer begann erneut, vor sich hin zu pfeifen. Jedes Mal, wenn nach einer Kurve die Lichter unten wieder für einen Moment auftauchten, stieg die Spannung im Wagen an. Belal neben mir bewegte die Lippen im Gebet. Dann sah ich das auch bei Malik. Das Dorf schien inzwischen zum Greifen nah. Wahrscheinlich waren wir schon in der Türkei. Aber wir alle waren zu angespannt, um nochmal zu fragen.
Plötzlich brach das Pfeifen ab. Es warf uns nach vorne, so heftig war der Fahrer auf die Bremse gestiegen. Noch bevor der Wagen ganz stand, lehnte er sich zu Zabiullah hinüber. Ein schneller Griff ins Handschuhfach, und plötzlich hielt er ein Fernglas vor Augen. Dort, wohin sich sein Blick richtete, sahen jetzt auch wir zwei kleine rote Lichter in der Ferne.
„Grenzpatrouille!“ Panik in der Stimme des Fahrers. „Raus aus dem Wagen, los raus!“ Zabiullah stieß als Erster die Beifahrertür auf, dann kapierte auch Malik, der neben mir an der Tür saß. „Lauft!“, brüllte der Schlepper uns an, „Nach Dorf hin!“ Wir waren schon aus dem Wagen gesprungen, da rief er uns noch hinterher, wir sollten uns trennen. „Einzeln! Sicherer!“
Faizal und Zabiullah spurteten los, jeder für sich. „Los!“, schrie ich Belal zu, der direkt vor mir stand. Hinter uns heulte der Motor auf, mit durchdrehenden Reifen wendete unser Geländewagen und nahm Fahrt auf in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Im gleichen Moment blendeten dort, wo wir die roten Lichter gesehen hatten, helle Scheinwerfer auf.
Belal verschwand gerade unter uns in der Dunkelheit.
„Komm, wir bleiben zusammen“, rief ich meinem Freund Malik zu, der immer noch in Schreckstarre neben mir stand. Ich packte ihn am Arm und zog ihn den Abhang hinunter. Der war nicht allzu steil, aber raue felsige Abschnitte wechselten mit grasbewachsenen Flächen, auf denen man leicht ausrutschen konnte. So schnell es ging, tasteten wir uns mit den Füßen voran.
Plötzlich fuhr ein Lichtstrahl quer über den Hang, glitt über uns hinweg und zuckte nach oben. Das Patrouillenfahrzeug musste seitlich von uns durch eine Kurve gegangen sein. Die hatten uns in dem freien Gelände ganz sicher bemerkt. Da hörten wir auch schon das lauter werdende Motorengeräusch über uns. Rutschend und springend arbeiteten wir uns in der Dunkelheit noch schneller nach unten.
Über uns quietschende Bremsen, über Schotter schlurfende Reifen und das ersterbende Motorengeräusch. Plötzlich erfasste uns eine breite Bahn weißen Lichts. „Halt, stehenbleiben!“
Wie die Hasen sprangen wir seitwärts, um der plötzlichen Helligkeit zu entfliehen. In dem Moment, in dem wir ins Dunkel tauchten, hörte ich Schüsse. Malik stürzte zu Boden und auf einmal lag ich über ihm. Ich wälzte mich zur Seite und rappelte mich hoch. „Los, weiter!“ Malik rührte sich nicht.
Ich habe noch versucht, meinen Freund mitzuziehen, aber da ruckte der breite Lichtstreifen schon auf mich zu. Wie von Sinnen rannte ich los, weg von dem Licht und weiter den Hang hinab, ein Wunder, dass ich nicht gestürzt und ebenfalls liegengeblieben bin.
. . .
„Boah ey! Ich denke, wir brauchen jetzt beide erstmal ne Teepause“, habe ich festgestellt, als Martina an dieser Stelle angelangt war. Sie war inzwischen auch schon ganz heiser vom langen Vorlesen.
„Okay“, hat sie nach einem tiefen Seufzer geantwortet, „aber keine so lange. Ich will schließlich wissen, wie’s weitergeht.“ Sie ist mir in die Küche gefolgt. „Glaubst du, dass sie diesen Malik tatsächlich einfach so erschossen haben?“ Sie hat meine Antwort gar nicht erst abgewartet. „Das muss dem Jungen doch schrecklich nahegegangen sein. Aber er deutet seine Gefühle ja immer nur an. Nicht mal an der Stelle, wo er bei der Beschreibung seiner Fahrt über diesen großen See vom ‚Untergang‘ der Welt seiner Kindheit spricht, gibt er offen zu, dass ihm die Erinnerung daran Tränen in die Augen getrieben hat. Stattdessen schreibt er nur irgendwas von Fahrtwind.“
„Ich finde es eher bemerkenswert, dass er überhaupt ein so emotionales Wort wie ‚Untergang‘ gebraucht hat. Das schreit doch förmlich nach einer Erklärung. Aber da kam ja nichts.“
„Stimmt. Manche Kleinigkeiten beschreibt er bis ins Detail. Aber über so etwas Entscheidendes wie die Gründe für seine Flucht hat er offenbar nicht einmal mit diesem Belal oder mit seinem Freund Malik sprechen wollen. Das finde auch ich äußerst seltsam.“
„In dem Fall will er uns vielleicht indirekt etwas sagen. Nämlich, dass er uns dankbar ist, dass auch wir ihn nie näher über die Gründe für seine Flucht ausgefragt haben.“
„Wie dem auch sei, ich habe jedenfalls das Gefühl, dass es hinter all dem, was er erzählt, noch etwas gibt, was er auch uns gegenüber selbst jetzt noch nicht preisgeben will.“
„Zumindest bestätigt das, was er schreibt, dass der Junge alles andere als islamistisch gesinnt ist. So brauchen wir uns wenigstens in dieser Hinsicht keine Sorgen zu machen“, habe ich noch gesagt, aber da kochte das Wasser schon. Noch während der Tee zog, habe ich schon wieder nach dem Hefter gegriffen und begonnen, weiter vorzulesen.
. . .
Türkei
„Jetzt iss erst mal was.“ Heißhungrig verschlang ich das Brot, den Ziegenkäse und die Oliven, die der junge Kurde vor mich hingestellt hatte. Mit einem leisen „Kadér?“ hatte er mich hinter der Mauer hervorgelockt, hinter der ich mich vor ihm versteckt hatte.
Es war der nagende Hunger gewesen, der mich dazu getrieben hatte, mich im Morgengrauen ins Dorf zu schleichen. Einen Tag und eine Nacht hatte ich mich in einer Schlucht oberhalb des Dorfes versteckt. Bevor ich am Ende der schrecklichen Nacht unseres Grenzübertritts einen Weg dort hinunter gefunden hatte, hatte ich noch vom Rand dieser Schlucht aus beobachtet, wie zwei Polizeifahrzeuge mit abwechselnd blau und rot blinkenden Lichtern ins Dorf gerast waren.
Mein Retter bestätigte mir, dass die Polizei nach meinen Freunden gefahndet hatte. Die aber waren zu der Zeit schon mit seinem Onkel auf dem Weg in die Stadt. Sie hatten angeblich versichert, es sei sinnlos, weiter zu warten. Malik und ich seien erschossen worden, oben am Berg. „Peng, peng“, sagte der junge Mann und zeigte nach oben. Dabei blickte er fragend auf den großen rotbraunen Fleck auf meinem Hemd. Den hatte ich selbst nach mehrmaligem Waschen in dem Bach unten in der Schlucht nicht herausbekommen. Mit Händen und Füßen und ein paar Brocken Farsi demonstrierte ich ihm, wie ich mich über Malik geworfen hatte, aber dass es da schon zu spät gewesen war. Ich müsse so schnell wie möglich hier weg, gab er mir zu verstehen. Er werde das sofort arrangieren.
Eine halbe Stunde später kam er zurück, mit einem alten, aber sauberen Hemd für mich und der Nachricht, jemand werde mich unter einer Ladung Teppiche versteckt in die Stadt Van bringen. Diesem Mann müsse ich als Erstes auch mein iranisches Ausweispapier aushändigen. Wenn man mich damit erwischte, würde man mich umgehend in den Iran abschieben, machte er mir klar. Ich erinnerte mich, dass auch Herr Ponyandeh schon gesagt hatte, in der Türkei würde ich neue Papiere benötigen. Ja, Papiere in Van, bestätigte mir der junge Kurde.
Die Fahrt nach Van hat nur ein paar Stunden gedauert, mir aber kam sie schier endlos vor. Den Transport auf der Ladefläche von Kleinlastern war ich inzwischen gewöhnt. Diesmal aber lag ich unter einem schweren, alten Teppich, den mein spontan rekrutierter Fluchthelfer wie zum Schutz über seine Ladung zusammengerollter brandneuer Teppiche gebreitet hatte. Schon durch das Gewicht über mir fiel mir das Atmen schwer. Obwohl mein Kopf zum Führerhaus hin unter dieser schweren Decke hervorragte, atmete ich noch dazu die ganze Zeit so viel Staub ein, dass mir bald vom ständigen Husten die Lunge wehtat. Man hatte mir auch eingeschärft, sofort den Kopf einzuziehen, wenn es eine Kontrolle gäbe, womit auf dieser Strecke zwei- oder dreimal zu rechnen sein würde. So kam ich mir die ganze Zeit wie eine Schildkröte vor, stets bereit, mich unter meinen Panzer zurückzuziehen.
Zweimal wurde unser Kleinlaster tatsächlich gestoppt. Obwohl mir beide Male das Herz bis zum Hals klopfte, schienen mir die Kontrollen im Nachhinein ziemlich oberflächlich gewesen zu sein. Keine nähere Inspektion der Ladung, und statt des barschen Befehlstons, den ich aus Afghanistan kannte, klang das, was ich hörte, eher wie eine freundliche Unterhaltung. Ich hatte den Eindruck, man kannte sich.
Viel schlimmer aber waren ohnehin die Momente, in denen ich erneut in den dunklen Fluten zu versinken drohte, die über mich gekommen waren, als ich beim Abstieg in die Schlucht im Morgengrauen das Blut auf meinem Hemd entdeckt hatte. Immer wieder erschien Maliks melancholisches Hazara-Gesicht vor meinen Augen. Immer wieder durchlebte ich die letzten Minuten mit meinem Freund. Warum bloß hatten wir nicht auf unseren Fahrer gehört und waren getrennt den Berg hinunter geflüchtet. Ich aber war derjenige gewesen, der gesagt hatte, „wir bleiben zusammen.“ Da konnte ich mir noch so oft sagen, dass ich meinen Freund doch nur hatte beschützen wollen. War ich wirklich dazu verdammt, nur Unglück zu bringen über alle Menschen, die mir nahe waren und die mir vertrauten?
Nur mit Mühe gelang es mir immer wieder, diese schwarzen Gedanken niederzuringen. Nein, was geschehen war, durfte keine Entschuldigung sein, auch die Zukunft verloren zu geben.
Der bullige Mann zog die Eisentür auf. Mir schlug der penetrante Geruch vieler Menschen entgegen, die sich schon tagelang nicht mehr richtig gewaschen hatten. Ich wurde durch die Türöffnung geschoben. Für einen Moment war ich geblendet. Grelles Neonlicht erfüllte den Raum.
Ein lautes Murren erhob sich. Die aggressive Stimmung unter den gut zwei Dutzend Männern in dem fensterlosen Kellerraum war mit Händen zu greifen. Einige von denen kannte ich schon von der iranischen Seite her. Sie waren auf der Lichtung oben im Wald dabei gewesen, wo wir so lange hatten warten müssen, bevor es weiter zur Grenze ging. Da erst sah ich, wie mir von ganz hinten im Raum jemand zuwinkte: Belal! Ich arbeitete mich zu ihm durch. Wir fielen uns in die Arme.
Nein, er habe wirklich nicht damit gerechnet, mich nochmal lebend wiederzusehen, versicherte er mir. Eine Weile seien sie sogar stehengeblieben, nach den Schüssen, und hätten gelauscht.
Ich berichtete ihm, was mit Malik passiert war.
„Diese Schweine“, sagte er nur.
Warum er überhaupt noch hier sei, fragte ich ihn. Faizal und Zabiullah waren nämlich schon weg
Die hätten ja offenbar Geld und gute Papiere, sagte Belal. Er selbst aber habe hier erst noch auf seinen neuen Ausweis warten müssen. Den hoffe er noch im Laufe des Tages zu bekommen, denn schon in der Nacht solle es weitergehen. Jetzt aber werde er natürlich warten, bis auch ich mein neues Ausweispapier hätte. Ich hätte ja hoffentlich noch Passfotos dabei. Ich holte das Tütchen mit den Fotos, die mir Dr. Ponyandeh noch mitgegeben hatte, aus der Seitentasche meines Rucksacks und zeigte es ihm.
Wenig später kam tatsächlich der Mann mit den Pässen. Es war ein junger Kerl mit breiten Schultern und groben Gesichtszügen. Der Bullige, der mich hergebracht hatte, kam mit ihm in den Raum, zeigte wortlos auf mich und verschwand. Schon als sich der Kerl seinen Weg durch den überfüllten Raum bahnte und dabei hier und da Pässe verteilte an Flüchtlinge, die sich zu ihm durchdrängelten, sah man ihm seine Übellaunigkeit an. Als er bei uns anlangte, hielt er mir meinen iranischen Ausweis unter die Nase. Den hatte der Teppichmann offenbar an ihn weitergegeben. Er tippte mit seinem dicken Zeigefinger auf das Foto. „Neues Foto!“ sagte er. Während ich ihm eines aus meinem Tütchen herausfingerte, erklärte Belal ihm mit Händen und Füßen, dass er nicht ohne mich weiterreisen werde.
Was wir uns überhaupt einbildeten, begann der Kerl zu schimpfen, so laut, dass alle in unsere Richtung starrten. Das wären ja vollkommen neue Sitten, dass die Herren jetzt auch noch tagelang durchgefüttert werden wollten. Kadér zahle immer nur für höchstens zwei Tage. Die Herberge seines Onkels sei keine Wohltätigkeitseinrichtung und auch kein Fünfsternehotel, wo man mal eben ein paar Tage dazubuchen könne. Damit warf er Belal seinen dunkelroten iranischen Reisepass vor die Füße. Für heute sei sein Platz auf dem Weitertransport reserviert. Was die nächsten Transporte angehe, könne er für nichts garantieren.
Wir verstanden zwar nichts von dem, was er sagte, aber als er fort war, erhob sich ein etwas entfernt sitzender älterer Mann, der eine auffällige Augenbinde trug, und übersetzte für uns aus dem Türkischen. Dabei musste er notgedrungen so laut sprechen, dass alle mithören konnten. Belal flüsterte mir zwischendurch zu, dass es sich bei dem Mann um einen iranischen Kurden handele.
Als der geendet hatte, standen in der einen Ecke des Raums mehrere junge Männer auf und begannen, Belal und mich anzupöbeln. Wenn wir hier weiter für Unruhe sorgten, könnten wir was erleben. Sie wollten nicht unseretwegen noch mehr Probleme mit den Schleppern bekommen. „Verfluchte Afghanen“, rief einer. Offenbar ein Pakistaner. Das laute Murren, das sich erhob, bewies aber schnell, dass die Afghanen in diesem Raum zahlenmäßig weit überlegen waren. Die Pöbler setzten sich daraufhin schnell wieder hin.
Als sich die Lage beruhigt hatte, bedankte ich mich bei Belal dafür, dass er meinetwegen das Risiko einging, noch tagelang weiter in diesem Keller hocken zu müssen. Inzwischen wusste ich nämlich, dass einige der anderen bereits über zwei Wochen in dem stickigen Kellerraum zugebracht hatten. Wohl, weil für sie das Geld für die nächste Etappe noch nicht gezahlt worden war.
„Kein Thema“, sagte er, „wir Kabuler müssen doch zusammenhalten.“
Am Abend lernte ich auch noch das kaum genießbare Essen dieser Herberge kennen. Zwei Männer mit dreckigen Schürzen schleppten einen Riesenkessel mit einer dünnen, undefinierbaren Suppe mitten in den Raum. Daraus konnte sich dann jeder mit seinem Blechnapf selber etwas herausschöpfen. Aber erst, als ich den Waschraum und den Abort zu Gesicht bekam – in der Nacht, gleich nachdem alle anderen wie geplant abgeholt worden waren – konnte ich ermessen, welch großes Opfer mein Freund gebracht hatte, indem er darauf verzichtet hatte, seinen schon sicheren Platz für die Weiterreise zu nutzen. Ich hatte ihn unterschätzt.
Wir konnten unser Glück kaum fassen, als der bullige Wirt unserer Herberge schon am späten Abend des folgenden Tages persönlich zu uns hereinkam und auch mir so einen dunkelroten iranischen Reisepass in die Hand drückte. Offenbar hatte er es eilig, seinen Keller zu leeren. Wenn wir das richtig verstanden haben, erwartete er eine größere Gruppe von Familien mit Kindern, die man ihm kurzfristig angekündigt hatte. Wenig später saßen Belal und ich auf den bequemen Rücksitzen eines kleinen Toyota und wurden aus der Stadt Van hinaus in die Nacht kutschiert.
Während wir noch darauf gewartet hatten, dass man uns abholte, hatte Belal mich aufgeklärt, warum man uns ausgerechnet wieder iranische Pässe gab. Mit irgendwelchen türkischen Ausweispapieren würden wir mangels türkischer Sprachkenntnisse bei einer Kontrolle sofort auffliegen. Mit einem iranischen Pass würde man uns in einem solchen Fall aber wenigstens nicht gleich bis nach Afghanistan abschieben können, selbst wenn der türkische Polizeibeamte den afghanischen Akzent unseres Persisch bemerkte.
Jetzt, während der Fahrt, gab mein Freund mir die nächste Lektion weiter, die er in seinen Tagen im Keller von anderen Flüchtlingen gelernt hatte. Mit dem Touristenvisum in unseren Pässen müsse man bei Kontrollen mit Nachfragen rechnen. So alltäglich sei ein touristischer Besuch eines jungen Iraners in der Türkei ja nicht. Es sei daher auch wichtig, für diesen Fall eine möglichst glaubwürdige Erklärung bereit zu haben. Er selber habe sich die Geschichte zurechtgelegt, dass ein Onkel von ihm bei einer türkischen Firma in Istanbul angestellt wäre, um von dort aus deren Bauprojekte im Iran zu betreuen. Dieser Onkel hätte ihn eingeladen, ihn zu besuchen und sich auf dem Weg nach Istanbul ein wenig die Türkei anzusehen. Falls man uns nicht gerade zusammen erwische, könne ich ja die gleiche Geschichte benutzen, bot Belal mir großzügig an.
Jedes Mal, wenn sein rundes Gesicht während unserer Fahrt durch die Außenbezirke von Van im Schein einer der seltenen Straßenlaternen aufleuchtete, überkam mich ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit. Wie hätte ich mich ohne einen so guten Kameraden in diesem Land mit wieder völlig anderen Bedingungen zurechtfinden sollen. Und selbst, als ich meinen neuen Freund dann versehentlich einmal mit Malik anredete, verzog der keine Miene.
Wir hatten Van schon eine ganze Weile hinter uns gelassen, als unser Fahrer plötzlich anhielt, sein Beifahrer ausstieg und uns aufforderte, mit ihm zu kommen. Außer einem schwachen Lichtschein vor uns in der Ferne war es stockdunkel. „Walk“, sagte der junge Mann nur. Uns blieb gar nichts anderes übrig, als ihm zu folgen, nachdem der Toyota davongefahren war. Wir liefen zuerst parallel zur Straße über die Felder, immer dicht dran an unserem schweigsamen Führer, der den Weg anscheinend im Schlaf kannte. Nur gelegentlich ließ er seine Taschenlampe kurz aufblitzen. Schließlich bogen wir von der Straße auf einen Acker ab, um einen kleinen Hügel zu umgehen. Als wir danach wieder auf die Straße stießen, sahen wir in der Ferne hinter uns Lichter. Hundegebell drang zu uns herüber. Offenbar hatten wir einen Kontrollposten umgangen.
Kurz darauf tauchte wie eine Fata Morgana der weiße Toyota wieder neben uns auf. Erleichtert ließen wir uns nach dem mehr als zweistündigen Marsch in die Sitze fallen. Wenn wir gewusst hätten, dass sich dieses Spiel bis zum Morgengrauen noch drei Mal wiederholen würde, hätten Belal und ich uns nicht so zufrieden angesehen. Schon zu dem Zeitpunkt machte uns der Hunger zu schaffen. Zuletzt hatten wir am Mittag etwas zu essen bekommen. Selbst das war nur eine Schüssel Reis ohne jede Beilage gewesen.
Die nächsten beiden Fußmärsche kamen uns wesentlich länger vor. Der dritte und letzte führte auch noch durch bergiges Gelände. Belal, der zwischendurch schon immer mal wieder schwer gekeucht hatte, begann so laut zu jammern, dass unser Führer ihn anzischte, nicht so einen Lärm zu machen. Ich hätte meinem Freund gerne geholfen, aber ich konnte mich zuletzt selber kaum noch auf den Beinen halten. Meine Fußsohlen brannten und waren sicher schon wieder blutig gelaufen.
Der Morgen dämmerte schon, da trafen wir nach diesem letzten Marsch endlich wieder auf die Straße. Diesmal mussten wir längere Zeit warten, bis unser weißer Toyota in Sicht kam. Der aber hielt – da waren wir kaum eine Viertelstunde gefahren – schon wieder an. „Nein!“, riefen Belal und ich gleichzeitig.
„All okay, all okay.“ Zum ersten Mal sagte auch der Fahrer etwas, während sein Kumpel schon wieder von außen die Wagentür aufriss. Er wies auf den Feldweg, der von der Straße abging. „Here“, sagte er, „you wait.”
Kaum hatten wir unsere Rucksäcke aus dem Auto gezogen, schlug er die Tür zu, sprang vorne zu dem Fahrer ins Auto und wir konnten nur noch dem davonfahrenden Wagen hinterherstarren, bis seine roten Rücklichter in der Ferne verschwunden waren. Wir waren zu verblüfft und auch zu erschöpft, um etwas zu sagen. Wir ließen unsere Rucksäcke hinter einer hohen Platane fallen, die an der Abzweigung stand, setzten uns so an den Stamm, dass man uns von der Straße aus nicht sofort sah, und streckten die schmerzenden Beine von uns. Es dauerte keine Minute, da fing Belal neben mir laut zu schnarchen an.
„Kadér?“ Ich schreckte hoch. Ein kleiner Lieferwagen stand direkt neben uns auf dem Feldweg. Der Beifahrer hatte das Fenster heruntergekurbelt und grinste zu uns herunter. Ich nickte, stieß Belal an und wir erhoben uns mühsam.
„Yallah, yallah!“ Der Mann wies hinter sich auf die offene Ladefläche. Ich half Belal hinauf und kletterte hinterher. Währenddessen kam der Mann zu uns nach hinten, warf mir irgendwas in Zeitungspapier Eingewickeltes zu und reichte Belal eine große, zerbeulte Teekanne. Der hob kurz den Deckel an. „Tatsächlich – warmer Tee“, sagte er. Das in dem Zeitungspapier war Fladenbrot. Während unser Wohltäter wieder nach vorne lief, verzogen wir uns mit diesem Schatz in den Windschatten des Führerhauses.
Belal goss sich geschickt einen dicken Strahl Tee direkt in den weit aufgesperrten Mund. Dann gab er die Kanne an mich weiter. Ich reichte ihm dafür eines der Fladenbrote. „Service nicht schlecht“, stellte mein Freund zufrieden fest und biss in das weiche Brot. Er schien erstaunlich schnell aus dem Tief der hinter uns liegenden Nacht herausgefunden zu haben und spielte schon wieder ganz den ‚Businessman‘.
Dass er sich als solchen sah, hatte er mir eröffnet, als wir beide noch allein in dem großen Kellerraum der Herberge in Van gesessen hatten. Da hatte er erzählt, in Kabul habe er ein gut gehendes Geschäft mit Mobiltelefonen betrieben, gleich neben dem Stoffladen seines Vaters auf dem Basar. Auf meine Frage, warum er dann überhaupt geflohen sei, hatte er gemeint, Afghanistan sei kein guter Ort für einen Businessman. Jetzt erklärte er mir, er wolle nach Deutschland. Da könne man gute Geschäfte machen. Mit dem Geld, dass er für sein Handygeschäft bekommen habe, habe er selbst nach der Bezahlung der Dienste von Kadér immer noch ein kleines Startkapital übrig. Und in Deutschland bekäme man, wenn man es erst einmal dorthin geschafft habe, auch gleich eine Wohnung und sogar ein Gehalt vom Staat.
Die gleiche Geschichte, die ich schon von Onkel Najib gehört hatte. Dass ich das nicht so recht glaubte, sagte ich nicht. Stattdessen erzählte ich ihm, dass ich lieber nach Frankreich wolle.
Er lächelte mitleidig. Ob ich nicht wüsste, dass Flüchtlinge dort nicht willkommen seien, und dass man sie in Regen und Kälte im Freien kampieren ließe.
Ich verzichtete darauf, ihm zu erzählen, wie oft mein Großvater von seinen Kollegen aus Frankreich geschwärmt hatte. Erstmal gab es ohnehin Dringenderes als fruchtlose Diskussionen über unsere Zukunftspläne. Während der Lieferwagen Fahrt aufnahm, zog ich meine Schuhe und Strümpfe aus, opferte einen Schluck Tee, um die Stellen zu säubern, an denen sich von den Märschen der Nacht wieder blutige Blasen gebildet hatten. Ich wickelte die letzte saubere Binde darum, die ich noch in meinem Rucksack fand. Belal tat es mir nach. Er opferte sogar ein ganzes Stück von einem Hemdsärmel, um damit seine Fußsohlen abzupolstern, die genauso schlimm aussahen wie meine.
Als der Kleintransporter anhielt, waren wir vorbereitet. Der folgende Fußmarsch dauerte zum Glück nur weniger als eine halbe Stunde. Auch den Rest des Tages kamen wir schnell voran. Wir mussten nur noch zwei Mal kürzere Strecken zu Fuß laufen. Nach dem ersten Mal hielt am Ende statt unseres kleinen, offenen Lieferwagens ein etwas größerer mit einer Plane über dem Laderaum neben uns. Wir waren heilfroh über diesen Schutz, denn wir hatten die ganze Zeit vorher in der prallen Sonne gesessen.
Es war schon dunkel, als wir auf eine holprige Piste einbogen und ein Stück weit in ein enges Seitental hineinfuhren. Als wir hielten und der Motor abgestellt wurde, hörten wir ein lautes Rauschen. Wir warteten ergeben auf das, was jetzt kommen würde. Den Planungen und Launen der Schlepper und ihrer Helfer ausgeliefert zu sein, waren wir ja inzwischen gewöhnt. Wir hörten, dass der Fahrer aus dem Führerhaus stieg. Er kam aber nicht zu uns nach hinten. Stattdessen hörten wir ein Knacken und Knistern und dann eine laute Stimme, die zu telefonieren schien. Eine immer wieder vom Knacken unterbrochene Stimme antwortete. „Funkgerät“, sagte Belal. Mehrmals fiel das Wort Kadér, aber das war auch das Einzige, was wir von dem kurzen Austausch verstanden.
„Los, aussteigen“, hörten wir die Stimme von draußen. „Nun los, beeilt euch!“ Als wir von der Ladefläche sprangen, stellten wir fest, dass der Laster direkt an einer Felswand parkte, die rechterhand aufragte. Die Scheinwerfer erhellten nur noch ein kurzes Stück Piste vor uns, bis dahin, wo diese hinter der nächsten Biegung verschwand. Dahinter verlor sich ihr Lichtschein im Dunkel eines Abgrunds. Von dort unten drang das Rauschen herauf, das wir die ganze Zeit gehört hatten. Der Fahrer rief uns etwas zu, was wir nicht verstanden und zeigte dabei tiefer ins Tal hinein. Ohne weitere Erklärung kletterte er ins Führerhaus, setzte ein paar Mal vor und zurück, um auf dem schmalen Streifen zwischen Felswand und Abgrund zu wenden und fuhr in hohem Tempo davon.
Wir waren mit dem Rauschen des unsichtbaren Flusses allein, in einem engen Tal, das anscheinend von hohen Bergen eingefasst war, von denen wir im Dunkeln aber nur schemenhafte Umrisse gegen den Sternenhimmel wahrnahmen. Ein Gefühl totaler Verlassenheit überkam mich. Ein Gefühl, das mir nur allzu vertraut war. Da half es auch nichts, das Belal neben mir stand und in seinem offenbar unerschütterlichen Optimismus meinte, irgendwie werde es schon weitergehen. Schließlich wollten die Geld verdienen mit uns.
Wir liefen vorsichtig bis zur nächsten Biegung vor. Dahinter aber war nichts auszumachen, was uns als Orientierung oder Ziel hätte dienen können. Einfach so weiter in die Dunkelheit zu stolpern, ohne zu wissen, wohin es ging, kam uns beiden sinnlos vor. Wir beschlossen, zu warten, bis es hell würde und ließen uns an der Felswand nieder.
Belal sagte längere Zeit nichts mehr. Aber ich merkte, dass er allmählich doch Angst bekam. Bei jedem Vogelschrei vom Hang gegenüber, jedem Platschen unten in der Schlucht, jedem Rascheln noch näher bei uns zuckte er zusammen. Ich fragte ihn, ob er denn noch nie nachts allein in den Bergen gewesen sei.
„Du etwa?“, fragte er zurück.
„Du, da kommt jemand“, sagte ich. Gerade in dem Moment hatte ich einen Lichtpunkt bemerkt, der in der Ferne auf und ab tanzte. Ja, der bewegte sich eindeutig auf uns zu.
Der Platz unten am reißenden Bergfluss war ideal für eine Übernachtung so vieler Menschen, die niemand bemerken sollte. Obwohl er kaum eine Viertelstunde von dem Ort entfernt war, an dem Belal und ich uns niedergelassen hatten, war von dort kein Laut und kein Lichtstrahl zu uns gedrungen. Die Stelle unten an der steilen Uferböschung, an der der große Laster stand, war von der Piste aus wohl selbst bei Tageslicht nicht einsehbar, ebenso wie der Fahrweg, der dort hinunterführte, wohl nur jemandem auffiel, der die Stelle gut kannte.
Der Mann mit dem Funkgerät und der Taschenlampe, der uns abgeholt hatte, wies uns einen Platz auf dem sandigen Uferstreifen an, wo wir uns hinlegen sollten. Und dass wir ja niemanden aufweckten. Er wolle keinen Ärger mehr heute. Die Mahnung war überflüssig. Die Leute, die dort schon lagen, waren anscheinend genauso erschöpft wie wir und regten sich nicht. Auch ich wurde schon nach kurzer Zeit vom Schlaf überwältigt.
Erst im Morgengrauen, als das Yallah-Geschrei losging und die Schlepper Belal und mich sowie ein paar weitere Nachzügler unter Einsatz ihrer Fäuste und Schlagstöcke auf die bereits überfüllte Ladefläche des Lasters prügelten, wurde uns klar, dass wir die Flüchtlingsgruppe aus dem Keller in Van eingeholt hatten. Einige erkannten uns auch und begannen zu schimpfen, bis ein Afghane, der schon durch seine hünenhafte Gestalt aus der zusammengedrängten Masse herausragte, Ruhe gebot.
Die folgende Etappe meiner Flucht durch die Türkei schien kein Ende nehmen zu wollen. Dabei kann sie insgesamt nicht viel länger als drei Wochen gedauert haben, wie ich mir später ausgerechnet habe. Auf dem Weg durch Afghanistan und durch den Iran war ich die meiste Zeit trotz aller Ängste und Strapazen noch neugierig gewesen auf Landschaften, Orte und Menschen, und auf das, was mich als Nächstes erwarten würde. Je länger aber diese Flucht andauerte, desto gleichgültiger wurde mir alles.
Es gab nur noch diesen ständigen aufreibenden und schließlich abstumpfenden Wechsel zwischen endlosen Fahrten als häufig stinkendes menschliches Frachtgut, Märschen auf durchgelaufenen Füßen bis zur Erschöpfung und Stunden oder Tagen nervtötenden Wartens in irgendwelchen Ställen, Kellern oder verdreckten Wohnungen, bis es endlich weiterging. Zwischen Hunger und quälendem Durst und plötzlicher Dankbarkeit für ein Stück Brot oder einen Schluck Wasser. Zwischen schwindender Hoffnung auf ein Ankommen irgendwo und Angst vor der nächsten Kontrolle oder gar dem, was Einzelne der Flüchtlinge in irgendwelchen Polizeistationen oder Gefängnissen bereits hatten durchmachen müssen. Zum Glück hatte ich schon lange Übung darin, alle Gefühle auszuschalten, die Frage nach dem Warum zu vergessen und nur noch automatisch zu funktionieren.
So habe ich aus diesen Tagen und Wochen nur wenige Szenen in klarer Erinnerung. Und wenn – wie im Fall der Situation, in der der hünenhafte Afghane die Beschimpfungen aus der Gruppe gegen uns Nachzügler durch sein Machtwort gestoppt hat – so hat sich das möglicherweise auch gar nicht beim Aufbruch aus dem Versteck in der Schlucht ereignet, sondern erst ein oder zwei Tage später.
Dass etwas nicht stimmte, merkten wir daran, dass die Pausen, bevor es jeweils ein Stück weiterging, immer länger wurden, die Telefonate der Schlepper und ihrer Wachleute immer nervöser klangen und ihre Ausreden immer weniger glaubhaft. In Van hatte es noch geheißen, spätestens in acht Tagen wären wir in Europa. Knapp drei Wochen später erfuhren wir schließlich, dass die Stadt, in der wir seit drei Tagen in einem heruntergekommenen Wohnblock festsaßen, Kayseri hieß und mitten in der Türkei lag.
Belal hatte das herausgefunden. Er hatte es in der engen Wohnung, in der wir eingesperrt waren, nicht mehr ausgehalten. Er hatte etwas Geld geopfert und einen der Wachleute bestochen, ihn für zwei Stunden rauszulassen – angeblich, um eine Medizin zu kaufen, die er dringend benötigte.
Als mein Freund nach der Rückkehr von seiner Entdeckung berichtete, explodierte Gaffar, unser hünenhafter Anführer. „Diese Betrüger haben uns im Kreis rumgefahren. Jetzt weiß ich auch, warum die uns hier die Mobiltelefone weggenommen haben. Von wegen zu unserer Sicherheit.“ Dabei hämmerte er mit beiden Fäusten gegen die Wohnungstür.
Im nächsten Moment wurde die aufgerissen und die vier Wachleute, die sich die meiste Zeit in der Nachbarwohnung aufhielten, stürmten mit Schlagstöcken bewaffnet herein. Gaffar erhielt einen Schlag vor den Kopf und Belal, der neben ihm stand, wurde von einem Faustschlag vor die Brust getroffen, der ihn mir vor die Füße warf. Unser Hüne fasste sich ins Gesicht und erstarrte, als er das viele Blut sah. Zum Glück war er im Kopf noch klar genug, um zu begreifen, dass selbst er gegen diese vier bewaffneten Männer chancenlos war.
Ob wir alle im Knast landen wollten, rief einer von denen mit mühsam unterdrückter Stimme, sobald sie die Tür nach draußen geschlossen hatten. Sie rissen sich ein Bein aus, um dafür zu sorgen, dass wir sicher ans Ziel kämen, aber offenbar gebe es hier ein paar Idioten, die uns alle in Gefahr bringen wollten.
Dabei wussten wir, dass es diesen Typen nur ums leicht verdiente Geld ging und sie sich nebenan die Zeit mit Telefonieren, Videos und Kartenspielen vertrieben, wenn sie uns nicht gerade etwas zum Essen besorgen mussten. Aber keiner von uns wagte, noch etwas zu sagen.
Die Männer hakten Gaffar unter und schleppten ihn nach draußen. Bevor der letzte von ihnen von außen die Tür zuzog, rief er uns zu, wenn sie noch einen Mucks hören würden, würden sie erst so richtig aufräumen kommen.
Ich kümmerte mich erst mal um Belal. Zum Glück schien der außer einer Prellung – dort, wo ihn der Schlag getroffen hatte – keinen ernsthaften Schaden erlitten zu haben.
Immerhin führte dieser Vorfall dazu, dass noch am gleichen Abend Rezan mal wieder vorbeikam, der Schlepper, der uns auf diesem Abschnitt ‚betreute‘. Der Kurde hatte sich zwei Tage lang nicht blicken lassen. Er kam mit zweien der Schläger von nebenan zu uns rein und versuchte, zu beruhigen. Die Route über das Meer zu den griechischen Inseln sei in diesen Tagen so gut wie unpassierbar. Man arbeite an einer Alternative, aber das dauere eben, und derweil hier im Landesinneren zu warten, sei einfach sicherer. Das aber nur, solange wir uns ruhig verhielten. Als Zeichen seines guten Willens werde er uns ab sofort auf drei statt bisher auf zwei Wohnungen aufteilen, damit die restliche Wartezeit für alle etwas erträglicher werde.
Er fragte, wie viele von uns von Kadér seien. Außer Belal und mir waren da nur noch zwei ältere Afghanen aus Mazar, die sich immer etwas abseits hielten. Er werde uns vier abholen, sobald er auch denen in der anderen Wohnung die Lage erklärt habe, sagte Rezan und verschwand erst mal wieder.
Die andere Hälfte der im Haus untergebrachten Flüchtlinge war die ganze Zeit in der Wohnung auf der anderen Seite der Wachleuteunterkunft eingeschlossen gewesen. Wir wussten daher nicht, wer da alles dabei war. Umso größer die Überraschung, als ich in der Gruppe von drüben, die Rezan wenig später auf dem Korridor vor unserer Wohnung versammelt hatte, neben vier anderen Kadér-Afghanen aus unserer Van-Gruppe und zwei Jungs, die ich nicht kannte, noch zwei Gesichter entdeckte, die wiederzusehen ich nicht mehr erwartet hatte: Faizal und Zabiullah! Obwohl mir insbesondere Letzterer nie besonders sympathisch gewesen war, weckte der Anblick der vertrauten Gesichter spontan ein warmes Gefühl der Zugehörigkeit in mir. Und dann umarmte Zabiullah mich auch noch. „Du lebst, Bruder – Allah-u aqbar“, sagte er und wischte sich vor allen anderen eine Träne aus dem Auge.
Wir erfuhren, dass die beiden schon zwei Tage früher als wir in der Wohnung drüben gelandet waren. Zu den anderen aus unserer Gruppe, die man dort untergebracht hatte, waren am Vortag dann noch sieben weitere Flüchtlinge gekommen. Eine dritte Wohnung bereitzustellen, was Rezan uns als großzügige Geste verkauft hatte, war daher ohnehin unumgänglich geworden.
Man führte unsere Gruppe von zusammen zwölf Mann durchs enge Fluchttreppenhaus einen Stock höher in die Wohnung direkt über der der Wachleute. In einem der beiden Zimmer lag schon jemand, auf eine Matratze gebettet: Gaffar, unser Anführer. Die hatten ihm eine dicke Bandage quer übers Gesicht geklebt, so dass er kaum aus den Augen sehen konnte. Die Nase sei gebrochen, erklärte er uns, überraschend milde gestimmt. Möglicherweise hatten die ihm irgendetwas versprochen, weil sie erkannt hatten, dass er ihnen aufgrund seiner besonderen Stellung unter uns vielleicht mal nützlich sein konnte.
Ein Krachen und lautes Gebrüll rissen mich aus dem Schlaf. Ich lag auf meiner Matratze. Um mich war Finsternis. Ein Alptraum? Jemand rüttelte mich.
„Was war das?“ Belals Stimme.
„Das kam von unten“, sagte eine andere Stimme.
Im Nebenzimmer polterte es. „Seid still – eine Razzia“, rief jemand
Alle drängelten sich zur Wohnungstür vor, um besser zu hören. Wieder krachte es. „Polizei! Keine Bewegung!“
Kein Zweifel, jetzt hatten sie unten auch noch die zweite Wohnungstür aufgebrochen.
„Ruhe – vielleicht wissen die von dieser Wohnung noch nichts.“ Unverkennbar Gaffars grollender Bass aus Richtung der Wohnungstür. Obwohl durch den Verband über seine zugeschwollene Nase gedämpft, hatte seine tiefe Stimme nichts von ihrer Autorität eingebüßt. Mit angehaltenem Atem lauschten wir alle auf die weiteren Geräusche, die zu uns heraufdrangen: Irgendwas polterte unten gegen die Wand – weitere Kommandorufe – ein Schrei.
Mitten in die folgende Stille hinein ein Kratzen an unserer Tür, das uns alle vollends erstarren ließ. Ein Schlüssel wurde leise ins Schloss geschoben. Ein klickendes Geräusch und die Tür schwang auf. Im schwachen Licht der Notbeleuchtung auf dem Flur erkannten wir einen unserer Bewacher.
„Los, alle abhauen!“, rief er gedämpft in der uns inzwischen bestens vertrauten Mischung aus Persisch und Kurdisch. Er rannte voran auf die Nottreppe zu und alles rannte hinterher.
„Die Rucksäcke“, rief Belal mir zu und stürzte zurück in unser Zimmer. Ich ließ mich mitreißen und griff mir auch noch schnell meine Sachen. So kam es, dass wir zu den Letzten gehörten, die ins enge, spärlich beleuchtete Treppenhaus drängten. Belal vor mir wand sich ungewohnt flink zwischen den vor uns Laufenden hindurch und war auf einmal verschwunden.
Als ich den ersten Treppenabsatz erreichte, wurde direkt vor mir die Tür aufgestoßen. Ein Mann mit Maschinenpistole und kugelsicherer Weste versperrte den Weg. Er brüllte etwas und richtete den Lauf seiner Waffe auf mich.
Ich konnte gerade noch rechtzeitig stoppen und riss meine Hände hoch. Der ältere Afghane neben mir stürzte dem Bewaffneten direkt vor die Füße. Der brüllte erneut und trat zu, einmal, zweimal, wobei die Mündung seiner Waffe mich jedes Mal von unten bis oben bestrich. Ich stand wie festgefroren und spürte, wie mir der kalte Schweiß ausbrach.
Wie in Zeitlupe sah ich, wie sich der Polizist umdrehte, nur um festzustellen, dass der letzte von denen, die vor uns gelaufen waren, unten gerade um die Ecke verschwand. Wieder dieses Brüllen. Daraufhin stürzten weitere Bewaffnete durch die Tür hinter ihm und machten sich auf seinen Wink hin an die Verfolgung nach unten.
Während sich das Trampeln und Brüllen weiter unten im Treppenhaus verlor, befahl der Beamte mir, mich auf dem Treppenabsatz auf den Boden zu legen, mit dem Gesicht nach unten und den Händen über dem Kopf. Dabei verlieh er seinen mir unverständlichen Worten mit dem Lauf seiner Waffe unmissverständliche Klarheit. Als ich beim Hinlegen gegen den älteren Afghanen stieß, der zuvor gestürzt war, stöhnte der auf, was ihm einen weiteren Tritt in den Rücken eintrug.
Noch heute sehe ich den gezackten Verlauf des feinen Risses in aller Deutlichkeit vor mir, der sich dort auf dem Treppenabsatz unmittelbar vor meinen Augen durch den Betonboden zog.
Das Schlimmste waren die Stunden, bevor sie endlich auch mich zum Verhör holten. Wir mussten aufgereiht an der Wand eines langen Korridors auf dem Boden sitzen, im hellen Licht nervös flackernder Neonröhren, bewacht von mehreren Polizisten mit ausdruckslosen Gesichtern.
Einige von uns hatten es offenbar geschafft, zu entkommen. Gaffar zum Beispiel fehlte in unserer Reihe. Auch nach Belal hatte ich schon vor dem Appartementhaus, wo sie uns am Ende zusammengetrieben und in die Gefangenentransporter verfrachtet hatten, vergebens Ausschau gehalten. Sicher hätte ich mich etwas weniger verlassen gefühlt, hätte auch er dort in diesem trostlosen Flur bei mir gesessen.
Die ganze Zeit, während ich auf mein Verhör warten musste, hatte ich das Bild des kleinen Pakistani vor Augen, den sie sich als Ersten vorgenommen hatten, und – noch schrecklicher – die Geräusche im Ohr, die durch die gepolsterte Tür des Verhörzimmers ganz am Ende des Korridors zu uns gedrungen waren.
Nach nur wenigen Minuten war diese Tür wieder aufgestoßen worden. Zwei muskelbepackte Polizisten hatten den dürren Jungen über den Korridor an uns vorbei in den Fahrstuhl geschleppt. Als sie ihn wiedergebracht hatten, hatte er aus dem Mund geblutet und am ganzen Körper gezittert.
Sie hatten ihn ein zweites Mal in das Zimmer am Ende des Korridors gebracht. Diesmal war kaum etwas zu hören gewesen. Nur gelegentlich etwas, das wie ein Wimmern klang, zwei Mal unterbrochen durch einen kurzen Bums, als setzte jemand einen wassergefüllten Tonkrug grob auf einer hölzernen Tischplatte ab. Dann hatten sie ihn zu uns auf den Korridor hinausgeschleift und nicht weit von mir am Ende der Reihe auf den Boden sacken lassen.
Die ganze Aufführung hatte insgesamt wohl nicht mal zwanzig Minuten gedauert, aber das hatte mehr als gereicht, um uns alle in eine Art Schockstarre zu versetzen.
Wir hätten den Jungen gerne gefragt, was die von ihm hatten hören wollen und wohin sie ihn zwischendurch gebracht hatten. Aber selbst, wenn seine untere Gesichtshälfte nicht so geschwollen gewesen wäre, wäre er kaum in der Verfassung gewesen, uns vernünftig zu antworten. Normalerweise hätte er mir leidgetan, aber in dieser Situation flößte mir sein Zustand nur Angst ein.
Als nächster war Zabiullah an der Reihe. Als er seinen Gang antrat, zeigte er allerdings keinerlei Anzeichen von Nervosität oder gar Angst. Die Polizisten hatten ihn beiderseits an den Oberarmen gepackt, aber es wirkte, als sei er derjenige, der das Tempo bestimmte, in dem die drei auf die ominöse Tür zumarschierten.
Diesmal dauerte es länger, bis sich diese Tür wieder öffnete, ohne dass wir in der Zwischenzeit mehr als ein gelegentlich etwas lauteres Wort gehört hätten. Unser Mann – diesmal in Begleitung von drei Beamten – trat so aufrecht auf den Gang hinaus, wie er hineingegangen war. Als er an der Stelle vorbeikam, wo Faizal saß, wurde dieser aufgefordert, mitzukommen. Mir warf Zabiullah im Vorbeigehen einen kurzen Seitenblick zu. Sein leises „Allah-u aqbar“ schien mir zu gelten. Sein üppiger Bart sah zerzaust aus, aber sonst konnte ich an ihm kein Anzeichen grober Behandlung erkennen. Die fünf verschwanden im Fahrstuhl.
„Vielleicht ist es am besten, man sagt einfach die Wahrheit“, flüsterte ich meinem Nachbarn zu, dem älteren Afghanen, mit dem zusammen ich in die Falle gegangen war.
„Willst du etwa, dass sie dich direkt wieder nach Afghanistan abschieben?“, fragte er leise zurück. „Dann sollen sie mich lieber gleich hier erschießen.“
„Ist es etwa besser, in den Iran abgeschoben zu werden?“ Ich nahm an, dass Kadérs Leute auch ihn mit einem iranischen Pass ausgestattet hatten.
„Von da aus ist es eine Grenze weniger bis nach Europa“, stellte er nüchtern fest. Er wollte noch etwas hinzufügen, aber der Blick eines unserer Bewacher brachte ihn zum Schweigen. Eine Grenze weniger! Dieses Argument überzeugte mich auf der Stelle. Wieder und wieder ging ich daraufhin im Kopf die ‚Geschichte‘ durch, die mir Belal anvertraut hatte.
Währenddessen holten sie einen nach dem anderen von uns ab, und der Zustand, in dem sie alle aus dem Verhörzimmer zurückkamen, verriet, dass sie keinem Einzigen von ihnen seine Geschichte geglaubt hatten. Jetzt aber war es zu spät. Selbst wenn ich gewollt hätte, wäre ich nicht mehr in der Lage gewesen, mir in der Kürze noch etwas Überzeugenderes zurechtzulegen.
Die beiden Polizisten, die mich abgeholt hatten, blieben hinter mir stehen, nachdem sie mich auf den niedrigen Hocker hinuntergedrückt hatten. Der Vernehmungsbeamte auf der anderen Seite des Tisches war ein breitschultriger, drahtiger Mann. Mit seinem hellen Khakihemd und dem kurz getrimmten Schnauzbart erinnerte er mich an das Bild eines britischen Offiziers in einem Buch meines Vaters über die Geschichte Afghanistans. Er lehnte scheinbar entspannt in seinem bequemen Bürostuhl und sah mich schweigend an.
Ich bemühte mich, extra gerade zu sitzen, so wie früher, wenn ich vor Großvater saß, und der mir etwas mitzuteilen hatte. Der Offizier klopfte mit der Spitze seines Kugelschreibers einen unregelmäßigen Rhythmus auf den dunkelroten iranischen Pass, der vor ihm auf dem Tisch lag. Ich dachte schon, ich halte dieses Schweigen nicht länger aus, da hörte das Klopfen auf. Mit einem Ruck richtete sich mein Gegenüber auf – wie eine Schlange, bevor sie zuschlägt.
„Du bist die Nummer 24“, sagte er. „Alle vor dir haben am Ende die Wahrheit gesagt.“ Nach einer kurzen Pause, die diesem Satz eine unheilvolle Schwere verlieh, beugte er sich zu mir herüber. Dabei erhob er sich halb aus dem Sessel und stützte sich mit seinen behaarten Händen auf dem Tisch ab. Sein nach Tabak riechender Atem wehte mir ins Gesicht. „Ausgerechnet du wirst doch wohl nicht am Ende noch unnötig unsere Zeit verschwenden wollen.“ Dabei sah er mich durchdringend an.
Seltsamerweise hatte er Farsi gesprochen. Gingen die davon aus, dass ich tatsächlich Iraner wäre? Ein Fünkchen Hoffnung glimmte in mir auf.
„Name?“
„Adib.“
„Alter?“
„fünfzehn.“
„Geburtsort?“
„Gonabad.“
Der Schnauzbart wischte den Pass vom Tisch. Klatschend fiel der neben mir auf den Boden. „Du willst uns also tatsächlich weismachen, dass du iranischer Staatsbürger bist! Dann erklär uns mal, wieso dein Persisch wie Dari klingt.“
Mit dieser Frage hatte ich gerechnet. Belal und ich hatten uns auch schon eine passende Antwort darauf überlegt. „In der Baufirma meines Vaters gibt es viele afghanische Arbeiter. Mit deren Kindern bin ich aufgewachsen. Mein Vater sagt immer, ich sei ein halber Afghane.“
„Na, dann können wir dich ja immerhin schon mal halb nach Afghanistan abschieben. Sag bloß, du kannst uns auch noch etwas über deinen Geburtsort Gonabad erzählen.“
Ich dachte an das, was Dr. Ponyandeh über diese Stadt gesagt hatte, die man in Van einfach aus meinem gefälschten iranischen Ausweispapier in den neuen iranischen Reisepass übernommen hatte. „Das ist die Stadt des Safrans“, sagte ich. “Und für die Sufis ist es eine heilige Stadt.“
Halb amüsiert, halb verblüfft sah mich der Vernehmungsoffizier an. „Du hältst dich wohl für besonders schlau – und uns für Idioten!“ Die letzten Worte brüllte er. „Du glaubst tatsächlich, du könntest uns mit einem primitiven Kartoffelstempel täuschen, der aussehen soll wie ein türkisches Touristenvisum?“ Er legte die Fingerspitzen an seine Schläfen, als dächte er nach. „Na, dann gebt ihm mal einen Vorgeschmack auf unser spezielles Programm für Touristen wie ihn.“
Ich wurde von beiden Seiten an den Haaren gepackt, mein Kopf mit der Stirn auf den Tisch geschmettert und sofort wieder hochgerissen. Für einen Moment wurde mir schwarz vor Augen und fast wäre ich von meinem Hocker gekippt. Vor Schmerz konnte ich keinen klaren Gedanken mehr fassen. Durch einen Tränenschleier hindurch sah ich den Schnauzbart nur noch verschwommen. Durch das Dröhnen in meinen Kopf hörte ich, wie er sagte, „Spätestens morgen wirst du uns alles erzählen.“ Dann sagte er noch etwas auf Türkisch zu den anderen. Die packten mich unter den Armen, schleiften mich hinaus auf den Flur und ließen mich an der Wand fallen wie einen Sack Mehl.
Ich hatte schon alles zugegeben, bevor sie überhaupt richtig angefangen hatten. Jetzt aber wollten sie immer noch mehr. Es waren ganz andere diesmal. Der Offizier mit dem Schnauzer war nur noch als Dolmetscher dabei. Sie haben erst von mir abgelassen, als sie sich abreagiert hatten. Vielleicht waren sie auch einfach nur erschöpft.
Dabei hätte ihnen doch von Anfang an klar sein müssen, dass man von einem knapp Sechzehnjährigen nicht erwarten kann, dass er sich an jedes Detail einer wochenlangen erschöpfenden Reise erinnert, an jeden Namen, jeden Ort und sogar an Adressen. Am Ende war mir alles egal. Ich hatte schließlich gelernt, wie man sich ganz in sich selbst verkriecht – so weit, dass man außen fast gar nichts mehr wahrnimmt und einfach fließen lässt, was nicht mehr zu halten ist.
Als sie mich zurück in die Zelle brachten und den anderen vor die Füße warfen, haben die sich sogar ein wenig um mich gekümmert und mir einen Platz an der Wand freigemacht. Von denen, die sie an diesem Morgen zum zweiten Mal ‚verhört‘ hatten, muss ich wohl so ziemlich am schlimmsten zugerichtet gewesen sein.
Als man uns Flüchtlinge am Vorabend in diese Zelle gepfercht hatte, waren die zwei Doppelstockbetten in der einen Ecke schon mit vier türkischen Kriminellen belegt gewesen – Drogendealern, wie wir später erfuhren. Während ich hilflos in meiner Ecke lag – es muss schon gegen Mittag gewesen sein – sprangen die vier plötzlich wie auf Kommando von ihren Betten und arbeiteten sich mit ihren Ellenbogen bis zur Zellentür vor. Minuten später wurde klar, warum. Von draußen wurde aufgeschlossen und ein Wärter schob mit dem Fuß einen großen Topf Reis und einen Stapel Blechschüsseln herein. Die Vier bildeten vor den Augen des grinsenden Wärters sofort einen Schutzwall um ihre Beute und begannen, in aller Ruhe große Portionen Reis in sich hineinzustopfen. Als der Wärter sich zurückzog, grinste er immer noch.
„Los, denen zeigen wir’s“, rief einer von uns, sobald draußen der Riegel vorgeschoben worden war. Mit unserer Übermacht wäre es in der Tat ein Leichtes gewesen, die vier Gauner zu überwältigen. Und wir hatten seit fast zwei Tagen nichts mehr zu essen bekommen …
Ein älterer Paschtune aus Kandahar hielt alle zurück. „Wollt ihr etwa, dass diese Kerle um Hilfe schreien? Die da draußen warten ja nur darauf, sich nochmal mit ihren Knüppeln auf uns zu stürzen.“
Ich lag in meiner Ecke und konnte mich sowieso noch kaum rühren. Aber als ich jemanden sagen hörte, „Jetzt spucken diese Schweine auch noch auf den restlichen Reis in der Schüssel“, drehte sich mir noch mal der Magen um.
Mir war klar, dass ich mich damit abfinden musste: Wenn ich diese Gefängnishölle jemals verlassen würde, dann nur, um nach Afghanistan abgeschoben zu werden – dorthin, wo zweifellos nur noch Schrecklicheres auf mich wartete. Seltsamerweise wünschte ich mir trotzdem nichts sehnlicher, als dass das alles möglichst schnell passieren würde. Nichts ist schlimmer, als auf das Unausweichliche auch noch warten zu müssen.
Wie es um unsere Sache stand, erfuhren wir dann ausgerechnet durch diese vier Gauner. Jedes Mal, wenn die Wärter hereinkamen, fingen die an, zu lamentieren, wann denn endlich dieses ‚dreckige Pack‘ aus ihrer Zelle verschwinden würde. Zum Glück hatten wir noch den älteren iranischen Kurden bei uns, den mit der Augenbinde, der schon in dem Keller in Van für Belal und mich aus dem Türkischen übersetzt hatte. Der gab an uns weiter, was er von dem Austausch zwischen den Gaunern und den Wärtern mitbekam.
So erfuhren wir, man erwarte nur noch einen Konsularbeamten der afghanischen Botschaft in Ankara, der nach Prüfung unserer Identität die Rücknahme aller afghanischen Staatsbürger bestätigen würde. Dann würde alles ganz schnell gehen. Am dritten Tag unserer Gefangenschaft hieß es dann allerdings, die Botschaft könne zurzeit Niemanden schicken. Das Ganze könne sich noch um Tage, wenn nicht um Wochen verzögern.
Das nächste Gerücht, das sich herumsprach, elektrisierte mich geradezu: Unsere Botschaft verlange, dass die Abzuschiebenden ihren Flug nach Kabul selber bezahlten. Wer das Geld für den Flug nicht aufbringen könne, werde auf dem Landweg über den Iran abgeschoben.
In meinem Kopf begannen sich die Gedanken zu überschlagen. Gab es vielleicht doch noch einen Ausweg aus meiner so hoffnungslos erscheinenden Lage? Meinen Rucksack mit den hundert Dollar von meiner Tante Khosala konnte ich abschreiben. Gleich bei unserer Ankunft in der Polizeistation hatte man uns unsere Habseligkeiten abgenommen. Bei meinem zweiten Verhör hatten sie auch noch den Brustbeutel mit den weiteren einhundert Dollar entdeckt und ihn mir vom Hals gerissen. Blieben die hundert Dollar, die in meinem Gürtel eingenäht waren. Die würden sicher nicht reichen, den Flug zu bezahlen.
„Wenigstens nicht gleich nach Afghanistan“, jubelte eine Stimme in mir. Die iranischen Behörden würden uns auf dem Landweg weiter bis zur afghanischen Grenze befördern. Da könnten sich ja Möglichkeiten ergeben, zu fliehen. Vielleicht sogar nahe Maschhad. Dann konnte ich versuchen, noch einmal bei Dr. Ponyandeh Unterschlupf zu finden. Es gab so viel, was ich von dem noch würde lernen können.
Natürlich war mir klar, dass das wohl eher unrealistische Träumereien waren. Und doch, ab diesem Tag – es muss mein fünfter oder sechster im Gefängnis gewesen sein – spürte ich tatsächlich wieder einen winzigen Funken der Hoffnung in mir.
Wenige Tage später hatten die Gefängniswärter auf einmal gute Neuigkeiten für unser Gaunerquartett. So wie die reagierten, verstanden wir das auch schon ohne die Übersetzung unseres Iraners. Der erklärte uns dann, man wolle uns in ein Gefängnis nach Ankara verlegen. Die seien dort besser eingerichtet für größere Gruppen von aufgegriffenen Flüchtlingen und die Botschaften zur raschen Bestätigung unserer Staatsbürgerschaft seien vor Ort.
Der Tag unserer Verlegung begann mit einer großen Überraschung: Statt direkt zum Bus führten uns die Wachen erst einmal zu dritt oder zu viert in einen kleinen fensterlosen Raum, in dem wir unsere Sachen identifizieren sollten. Meinen Rucksack entdeckte ich gleich vorne in einem der Regale und angeknotet an einen der Tragriemen auch gleich noch den Brustbeutel, den man mir beim zweiten Verhör abgenommen hatte. Ich war so verdattert, dass mich einer der Wärter zweimal auffordern musste, endlich meine Sachen zu nehmen und Platz für die nächste Gruppe zu machen.
Im Bus, in dem wir uns jeweils zu Dritt in die Zweiersitze quetschen mussten, zeigte mir schon kurzes Betasten des Rucksacks von außen, dass die in Plastik eingerollten Geldscheine noch da waren. Unauffällig zog ich das Röllchen heraus und stopfte es mir in die Hosentasche, in die ich vorher auch schon den Brustbeutel gestopft hatte. Die Aussicht, nun womöglich doch direkt nach Afghanistan ausgeflogen zu werden, versetzte mich in Panik. Fieberhaft überlegte ich nur noch, wie ich das überschüssige Geld vor unserer Ankunft in Ankara unauffällig loswerden könnte.
Mitten in meine wirren Gedanken hinein platzte die Ansage, dass es auf der siebenstündigen Fahrt nur eine einzige Pinkelpause geben werde.
„Das ist unsere letzte Chance, zu entkommen“, flüsterte mir der kleine Pakistani ins Ohr, der neben mir saß.
„Du bist verrückt“, flüsterte ich zurück „Hast du nicht die Pistolen gesehen, die unsere fünf Bewacher dabeihaben?“
Vier Stunden später hockten wir alle auf einem offenen Acker. Jeder duckte sich so gut wie es ging in die Furche, um möglichst unbeobachtet von den anderen – und von den Wachen, die uns umstanden – sein Geschäft zu verrichten.
Dass einige das nur vortäuschten, merkte ich erst, als plötzlich mehrere von uns gleichzeitig aufsprangen und zurück auf die Straße rannten. Sie teilten sich auf, um links und rechts um den auf der anderen Straßenseite parkenden Bus herum das jenseits davon gelegene Wäldchen zu erreichen.
Dieses tollkühne Manöver kam selbst für unsere Bewacher so überraschend, dass sie erst reagierten, als der Erste der Flüchtenden bereits um den Bus herum außer Sicht verschwand. Drei der Polizisten nahmen die Verfolgung auf und alarmierten mit lauten Rufen ihren einen im Bus zurückgelassenen Kameraden. Ein Schuss fiel.
„Yallah! Sofort zurück in den Bus!“, brüllte der Polizist, der bei uns zurückgeblieben war, und fuchtelte nervös mit seiner Pistole. Ich kam als einer der Letzten auf die Beine, und als ich endlich meine Hose zugeknöpft hatte, hatten die anderen bereits die Straße erreicht. In diesem Moment näherte sich ein kleiner Lieferwagen mit hoher Geschwindigkeit auf unserer Seite der Straße. Der Fahrer bremste scharf ab, als er bemerkte, dass da plötzlich Leute auf die Fahrbahn liefen. Direkt auf Höhe des Busses kam er zum Stehen. Der Polizist sprang vor ihm auf die Straße, scheuchte die anderen von uns mit der Pistole rüber zum Bus, wo sein Kollege sie schon erwartete, und brüllte gleichzeitig auf den Fahrer des Lieferwagens ein.
Es muss alles völlig automatisch vor sich gegangen sein. Plötzlich fand ich mich an der Rückseite des Lieferwagens wieder, hievte mich in einem Schwung auf die Ladefläche hinauf und verschwand unter der Plane. Mein Herz raste und meine Arme zitterten von dem plötzlichen Kraftakt. Ein jäher Schmerz brachte mir zu Bewusstsein, dass ich mir das eine Knie angeschlagen hatte. Erst als der Lieferwagen anruckte und mit mir davonfuhr, wurde mir so richtig bewusst, was ich soeben getan hatte.