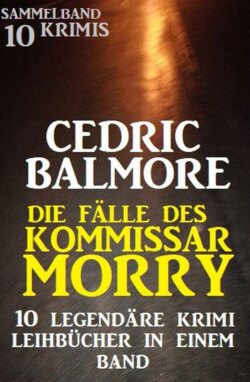Читать книгу Die Fälle des Kommissar Morry - 10 legendäre Krimi Leihbücher in einem Band - Cedric Balmore - Страница 50
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Unheimliche
ОглавлениеAshton Cabott glaubte zu wissen, daß ihn eine der üblichen, tödlich langweiligen Cocktailparties erwartete. Dessen ungeachtet war er entschlossen, die Burleys zu besuchen. Er hoffte, einige brauchbare Informationen über Leute aufschnappen zu können, denen sich durch geschickt arrangierte Erpressungen ein paar tausend Pfund abnehmen ließen.
Wenn ein Mann sich den häßlichen Vorwurf gefallen lassen muß, ein Erpresser zu sein, und trotzdem zur Creme der Gesellschaft gehört, muß angenommen werden, daß diese Gesellschaft entweder faul, oder daß der Betreffende ungemein raffiniert ist. Das letztere war der Fall. Ashton Cabott besaß Charme, er war gebildet, und er war klug. Man schätzte sein Unterhaltungstalent, das es ihm erlaubte, mit den Damen gut Freund zu sein. Trotzdem verdankte er seinen Reichtum keineswegs der wankelmütigen Großherzigkeit des schwachen Geschlechtes, als vielmehr der ausgeprägten Begabung, seine Kenntnisse über interne Vorgänge innerhalb der oberen Zehntausend gewinnbringend zu verwerten. Seine bewährteste Methode war die der Erpressung. Er trat dabei nie persönlich hervor, und die Betroffenen wußten nie, woher der Schlag kam, und an wen sie das Geld zahlten.
Ashton Cabott arbeitete allein; er war absolut dagegen, einem Komplicen zu vertrauen, und so kam es, daß er sich nach fünf Jahren einer verbrecherischen Tätigkeit frei, sicher und erfolgreich fühlte. Cabott bewohnte einen hübschen, modernen Klinker-Bungalow auf einem der bevorzugten Hügel von Chelsea. Er beschäftigte nur einen Diener, den Butler Harvey, der allgemein als das Muster eines vorbildlichen Domestiken galt. An jedem Vormittag erschien eine Frau zum Saubermachen im Haus; zum Essen fuhr Cabott regelmäßig in ein bestimmtes Speiselokal. Die meisten Abende verbrachte er im Club.
Es gab Monate, wo er kein einziges Pfund einnahm, aber es gab auch solche, wo er sein Bankkonto um zehn- zwanzig- oder dreißigtausend Pfund zu bereichern vermochte. Er spekulierte geschickt an der Börse, und er transferierte regelmäßig beträchtliche Summen in die Schweiz und nach Amerika. Er war, wie man so sagt, auf alle Eventualitäten vorbereitet, aber er empfand keine Furcht. Wenn er jemand erpreßte, bewegten sich seine Forderungen in erträglichen Grenzen. Er trieb zwar oft schwindelnd hohe Summen ein, aber er kalkulierte sie so, daß dem Erpreßten niemals die Substanz entzogen wurde.
Ashton Cabott machte eigentlich überall eine gute Figur, besonders auf den Rennplätzen von Ascot oder Epsom, wo er mit dem silbergrauen Cut und dem eleganten Zylinder viele bewundernde Blicke auf sich zu ziehen pflegte. Aus Frauen machte er sich nicht viel. Er fürchtete, daß er sich mit seinen zweiunddreißig Jahren in eine von ihnen verlieben könnte. Da er gehört hatte, daß die elementare Wucht der Liebe zu allerlei törichten Geständnissen verleitet, ging er ihr nach Möglichkeit aus dem Wege. Natürlich hatte er hier und da einen Flirt, doch wenn er ein handfestes Verhältnis wünschte, engagierte er im allgemeinen irgendeine hübsche Nachtklubsängerin oder ein Ballettmädchen, weil er sicher zu sein glaubte, auf diese Weise von den Infektionen der Liebe verschont zu werden. Ashton Cabott besaß eine schlanke, sportliche Figur, und er gab sich große Mühe, daß seine Taille nicht durch einen Fettansatz entstellt wurde. Er spielte viel Tennis und brachte oft ganze Tage auf dem Golfplatz zu. Sein gebräuntes Gesicht mit den gesunden, weißen Zähnen, dem dichten, dunklen Haar und den tiefblauen, etwas verträumten Augen, erinnerte an einen berühmten englischen Filmschauspieler der ersten Garnitur, und Ashton mußte sich immer wieder sagen lassen, daß er diesem Star zum Verwechseln ähnlich sehe.
Man hatte ihm das so oft versichert, daß er bereits seine kriminelle Phantasie in Bewegung gesetzt hatte, um herauszufinden, ob sich damit ein Geschäft machen ließe. Bis jetzt war ihm jedoch noch nichts Passendes eingefallen. Nichtsdestoweniger hatte er ein Detektivbüro damit beauftragt, alles Wissenswerte über den Schauspieler zusammenzutragen. Abends las er amüsiert die ausführlichen Berichte. Er studierte die törichten Bemerkungen, die der eitle Schauspieler zu machen pflegte, er lächelte über die Liebeleien, denen sich Tab Bromley aussetzte, und er lernte alles über den sozialen Hintergrund und die recht entbehrungsreiche Jugend, die Tab Bromley durchgemacht hatte.
Auch mit Ashton Cabotts Kindheit war es nicht weit her. Er hatte zwar nie wirkliche Not kennengelernt, aber sein Vater, ein pensionierter Oberst, hatte leider einer unseligen Spielleidenschaft gefrönt, die den Cabotts viel Nerven und Geld gekostet hatte. Ashtons Mutter war früh gestorben. Mit seinem Vater hatte ihn nichts verbunden. Vielleicht war es dem Mangel elterlicher Liebe zuzuschreiben, daß er zu einer besonders selbstsüchtigen Einstellung gelangt war. Merkwürdig war nur, daß es ihn nie nach menschlicher Liebe und Wärme verlangte. Er liebte das Geld und den Besitz, und das genügte ihm.
Ashton verreiste nie. Er blieb in London, seinem bevorzugten Jagdrevier, obwohl es ihn in den Sommermonaten übers Wochenende oft nach Brighton verschlug. Im Grunde genommen haßte er Brighton mit seiner Menschenfülle und seinem Jahrmarktstrubel, aber in den besseren Hotels ergatterte er immer wieder gute Informationen, denen sich nachzugehen lohnte.
Er redete sich ein, ein sattes und friedliches Leben mit einer wohldosierten Portion Aufregung zu führen. Er verachtete die Leute, die jeden Morgen pünktlich um neun Uhr mit Bowlerhut und Regenschirm ihre Büros in der Londoner City betraten, und er machte sich über jene lustig, die sich aus innerer Überzeugung zu Recht und Moral bekannten. Ashton Cabott trieb keinen allzu aufwendigen Lebenswandel. Er verkehrte zwar in der besten Gesellschaft, aber er vermied es, wie ein Snob aufzutreten. Er hatte gelernt, daß die Kunst des ,Understatements', der Tiefstapelei, die beste Empfehlung ist, um sich der allgemeinen Sympathien zu versichern. Auch an dem Abend, als er den großen Salon der Burleys betrat, gab er sich mit der ihm eigenen charmanten Bescheidenheit, die ihn so gewinnend erscheinen ließ. Er kannte die meisten der Anwesenden. Den wenigen, die er noch nicht gesehen hatte, wurde er vorgestellt. Unter den Neuankömmlingen befand sich ein etwa zwanzigjähriges Mädchen von bezwingender, strahlender Schönheit, eine Amerikanerin, die den Pol bildete, um den sich alles zu drehen schien.
Ashton beobachtete sie verstohlen. Er bemerkte, daß ihre bloße Gegenwart die Männer faszinierte und elektrisierte, während die Frauen neidvolle und mißtrauische Blicke auf das Mädchen warfen. Ganz sicher waren dem Mädchen diese Reaktionen nichts Neues. Sie hinterließ einen natürlichen, selbstsicheren Eindruck. Im Moment plauderte sie mit der Gastgeberin, der dicken, gutmütigen Mrs. Burley, die so alt und so reich war, daß sie sich den Luxus dummer Eifersüchteleien versagen konnte.
„Hallo, Ashton!" sagte jemand hinter ihm.
Es war Gilbert Ferguson, ein hagerer Mittvierziger, dem man ansah, daß er wiederholt unter Malariaanfällen zu leiden hatte. Ashton hatte Ferguson vor kaum einem Jahr um zehntausend Pfund erleichtert. Gilbert Ferguson, der verheiratet war, hatte den Fehler begangen, eine Verkäuferin zur Freundin zu wählen, und er hatte das Pech gehabt, daß die Verbindung nicht ohne Folgen geblieben war. Ashton hatte davon erfahren und seine kleine gut funktionierende Erpressermaschine in Tätigkeit gesetzt. Ferguson wußte bis zum heutigen Tag noch nicht, an wen die zehntausend Pfund gegangen waren, und es wäre ihm nicht einmal im Traum eingefallen, den bescheiden-freundlichen Ashton Cabott dieser Tat zu verdächtigen.
„Guten Abend, Gilbert", grüßte Ashton lächelnd. „Wie geht es dir, mein Junge?"
„Blendend, wirklich blendend . . . obwohl ich nicht leugnen will, daß daran weniger dein Anblick, als die Gegenwart der entzückenden blonden Amerikanerin die Schuld trägt. Wie findest du sie?"
„Reizend. Ich habe ihren Namen nicht richtig verstanden. Heißt sie nicht Britton?"
„Ja, Constance Britton. Sie ist die Tochter eines der reichsten Männer Amerikas. Ihm gehören die meisten Anteile der ,Times Corporation', der größten Uhrenfabrik der Welt, und es wird behauptet, daß er einen erheblichen Prozentsatz der größeren nordamerikanischen Chemietrusts kontrolliert."
„Ist sie allein in England?"
„Nein. Sie reist mit der älteren Schwester. Die Schwester ist Archäologin oder so etwas Ähnliches. Sie arbeitet an einem Buch über die keltischen Einflüsse im frühen Mittelalter, oder irgendeinem damit verwandten Unsinn. Man hat die beiden noch nie miteinander gesehen."
„Sind sie verfeindet?"
„Keine Ahnung. Ich glaube eher, daß sie entgegengesetzte Interessen haben."
Ashton nickte. Er spürte mit leiser Beunruhigung, daß er dem Fluidum von Constance Britton zu erliegen drohte. Ihre schlanke Figur, die zarte Haut, das mädchenhaft-anmutige Profil und die großen, silbergrauen Augen unter den edel geschwungenen Brauen verliehen seinem Herzen eine Gangart, die es bisher noch nicht kennengelernt hatte.
„Sie ist superb", seufzte Ferguson, „einfach superb. Ich gehöre zu den Leuten, die niemals dem beliebtesten englischen Gesellschaftsspiel, dem Anti-Amerika-Rummel, erlegen sind. Deshalb freut es mich, daß das Mädchen von drüben kommt. Ich könnte niemand nennen, der von dieser Insel stammt und in der Lage wäre, es an Schönheit, Charme und Grazie mit Constance Britton aufzunehmen."
„Na na, jetzt übertreiben Sie!" meinte Ashton, obwohl er am liebsten in die Lobeshymne eingestimmt hätte.
„Aber mein Lieber! Sehen Sie sich doch dieses bezaubernde Gesicht an! Rein wie ein Engel, und doch, wenn sie lächelt, gewinnen die Züge etwas Wissendes, dann dämmert eine Andeutung von lockender Süße, von Versprechen, Abwehr und Hingabe darin . . . eine höchst aufregende Mischung, der sich ganz offensichtlich keiner der anwesenden Herren zu entziehen vermag.“
„Sie geraten ins Schwärmen, Gilbert."
„Na, und? Man findet so selten Gelegenheit, etwas vorbehaltlos schön zu finden. Ich gebe zu, daß ich mich im Augenblick nur an den äußeren Eindruck halte. Vielleicht hat auch die reizende Constance Britton ihre Fehler; fürs erste sehe ich in ihr nur eine hinreißende Schönheit. Wenn ich jung und ledig wäre wie Sie, mein Freund, würde ich mich um sie kümmern. By Jove!"
Ashton merkte, daß es ihm einen leisen Stich gab. Er hatte nie an Heirat und Ehe gedacht, und er hatte stets jene belächelt, die sich diesem Joch aussetzten. Aber hier, bei Constance Britton, erfuhren seine Gefühle eine plötzliche Umwertung. Erstens einmal brachte sie sicher mehr Geld in die Ehe, als er jemals mit seinen Erpressungen zu verdienen vermochte, zweitens war sie tatsächlich unvergleichlich schön, und drittens konnte es nicht schaden, mit einem verlockenden Gedanken zu spielen . . .
Leider mußte Ashton Cabott die betrübliche Feststellung treffen, daß ihm das Mädchen nicht die geringste Aufmerksamkeit schenkte. Es stimmte zwar, daß sie auch die anderen Männer ignorierte... aber er war in dem Kreis der jüngste, und, wie er glaubte sich schmeicheln zu können, bei weitem der am besten aussehendste.
Es war eine der üblichen, langweiligen Cocktailparties, bei denen man mit einem Glas in der Hand herumsteht und mehr oder weniger gezwungen Konversation macht. Es war weder beabsichtigt, zu tanzen, noch war eine andere Unterbrechung zu erwarten. In ein, zwei Stunden würde man nach Hause gehen, nicht ohne vorher den Gastgebern versichert zu haben, daß es ein ,ganz entzückender' Abend gewesen sei.
Blech!
Zum ersten Mal in seiner gesellschaftlichen Laufbahn hatte Ashton Cabott einen faden Geschmack im Mund. Vielleicht ist unser englischer Lebensstil doch nicht der Weisheit letzter Schluß, ging es ihm durch den Kopf. Er fühlte eine nagende Ungeduld am Herzen. Mit einemmal fand er sein Leben nicht mehr so aufregend, wie er immer geglaubt hatte, und er verspürte den brennende Wunsch, von einem schönen und reichen Mädchen wie Constance Britton begehrt zu werden.
Hinter ihm sagte jemand: „Wie ich höre, hat der alte Osborne eine neue Sekretärin. Wie ich den Burschen kenne, läuft das auf eine Liaison hinaus..."
Bemerkungen dieser Art hatten Ashton bislang die Ohren spitzen lassen. Heute beachtete er sie gar nicht. „Aber wahrscheinlich haben nicht einmal Sie eine Chance bei dem Mädchen", sagte Gilbert Ferguson nachdenklich. „Constance Britton kann sich das beste nehmen, was die Welt bietet . . . den reichsten und begehrenswertesten Mann. Sicher haben schon Dutzende hoffnungsvoller Aspiranten um ihre Hand angehalten, um diese Hand, die Fortunas Füllhorn zu halten scheint. Flirt, Liebe und Anbetung sind ihr gewiß geläufige Begriffe; sie wird sie entweder aufregend oder langweilig finden, je nach Partner und Laune. Was könnte eine solche Frau noch reizen?"
„Ich weiß es nicht."
„Ich wette, daß sie uns alle für vertrocknete, spießige Gesellen hält. Für Leute, die man zwar kennen muß, wenn man sich schon einmal in London befindet, über die man aber später lächelt und spottet, und mit denen einen nicht verbindet."
„Sie stellen unserem Kreis nicht das beste Zeugnis aus."
„Ich versuche objektiv zu sein. Sehen Sie sich doch einmal in der Runde um! Glauben Sie wirklich, daß hier auch nur ein Mann anwesend ist, der eine Frau wie Constance Britton reizen könnte?"
Ashton lächelte gezwungen.
„Es scheint Ihnen Spaß zu machen, uns als glatte Versager einzustufen!"
Ferguson zuckte mit den Schultern. „Es fällt mir nicht leicht, mein Lieber. Aber ich habe es immer gehaßt, mir etwas vorzumachen. Darum beurteile ich die Dinge so, wie sie nun einmal liegen."
Er klopfte Cabott leicht auf die Schulter und ging weiter, um einen anderen Bekannten zu begrüßen. Ashton führte den Sektkelch an die Lippen. Normalerweise trank er Whisky, aber den Burleys gehörten unter anderem ein paar bedeutende Sektkellereien auf dem Kontinent, und so war es nur natürlich, daß man in diesem Haus Sekt angeboten bekam. Der Sekt war ausgezeichnet, aber Ashton vermochte dem Getränk keinen Geschmack abzugewinnen. Das lag nicht am Inhalt des Glases, sondern an Fergusons Worten, die seine Eitelkeit verletzt hatten. War er, Ashton Cabott, wirklich schon abgeschrieben? Konnte er mit seinem bewährten Charme nur noch die Damen der mittleren Altersklassen bezaubern?
Er merkte, daß sein Leben zwar einen Inhalt gehabt hatte, aber er begriff auch, daß dieser künstlich geschaffene Inhalt nicht länger ausreichte, um ihn zu befriedigen. Er war ein Mann, trotz allem, und er brauchte ein Ziel, für das sich zu kämpfen lohnte. Er schaute Constance Britton an und merkte, wie sich ihre feinen Augenbrauen irritiert zusammenzogen. Sie wandte den Kopf und schenkte ihm einen flüchtigen Blick. Dann wandte sie sich wieder ihrer Gesprächspartnerin zu, als sei nichts geschehen. Es war ja auch nichts geschehen . . . nur ein zufälliger Blickwechsel,
dem keine tiefere Bedeutung zugeschrieben werden konnte. Oder?
Ashton hatte auf einmal Mühe, normal zu atmen. Der Blick des Mädchens war in das Zentrum seiner geheimsten Seelenbezirke vorgestoßen. Ashton wußte, daß er Constance Britton begehrte, so wie er noch nie zuvor etwas begehrt hatte.
Mache dich nicht lächerlich! schoß es durch seinen Kopf. Du willst nur ihr Geld, so wie du immer nur das Geld wolltest . . . aber irgendwie glaubte er zu spüren, daß es diesmal mehr war. Er zermarterte sich das Hirn, auf welche Weise er sich den beiden Frauen nähern konnte, ohne plump zu wirken. Ihm fiel nichts ein, und ihm war völlig klar, daß er im Moment nicht die notwendige Sicherheit aufzubringen vermochte, um auf Anhieb imponieren zu können.
Eine halbe Stunde später fand er sich allein auf der Straße wieder. Die letzten Abschiedsworte, die höflichen Phrasen und leeren Gemeinplätze, die die Garnierung des Aufbruchs gebildet hatten, waren längst verklungen. Keines der Worte war in ihm haftengeblieben. Er dachte nur an Constance Britton, an ihre Schönheit, an ihre Jugend und an ihren Reichtum.
Sie war mit einem gemieteten Rolls Royce davon gefahren. Es konnte nicht schwerfallen, ihre Adresse ausfindig zu machen. Aber wie sollte er sich ihr nähern? Wie konnte er ihren Respekt und, was wichtiger war, ihre Liebe gewinnen? Er war vermögend, aber nicht vermögend genug, um ihr damit imponieren zu können. Wahrscheinlich war Geld für Constance Britton so selbstverständlich, daß sie es kaum zu würdigen mußte. Was aber reizte sie, was vermochte ihre Aufmerksamkeit zu wecken und ihr Herz zu infizieren? Liebte sie die Männlichkeit, den Mut, den Geist? Wie sollte er ihr beweisen, daß er sich einbildete, diese Eigenschaften zu besitzen? Es gab wohl nur einen Weg: er mußte einen Fall konstruieren, mit dessen Hilfe es möglich sein würde, Constance Brittons Zuneigung zu erobern. Er spazierte durch die Nacht und überlegte; er zog eine Reihe von Gedanken in Erwägung, die er jedoch wieder verwarf, weil sie ihm nicht sicher genug schienen, das Ziel zu erreichen.
Er hatte noch keine Lust, nach Hause zu gehen, und so winkte er ein Taxi heran, das ihn ins ,Carlton' brachte. In der Bar des Hotels fühlte er sich so wohl wie in seinem Club; hier hatte schon so manche Geschichte ihren Anfang genommen. Er saß kaum eine halbe Stunde, als das Mädchen, mit dem er sich die ganze Zeit in Gedanken beschäftigt hatte, die Bar betrat. Sie war allein und trug jetzt ein schulterfreies Cocktailkleid aus rotem Nylon-Chiffon. Wieder war es wie vorhin bei den Burleys: die Männer atmeten rascher und die Luft schien mit Elektrizität geladen. Als Constance an dem Bartisch Platz nahm, kreuzten sich ihre Blicke. Er neigte grüßend den Kopf und sie lächelte ihm flüchtig zu.
Er spürte das verrückte Hämmern seines Herzens. Sie wohnte also hier im Carlton! Wahrscheinlich hatte sie mit der Schwester die teuerste Suite bezogen: ganz sicher aber hatte sie keine Lust, schon vor Mitternacht das Bett aufzusuchen. Diese Amerikanerinnen! Es war erstaunlich, woher sie die Selbstsicherheit nahmen, allein eine Bar zu betreten. Eine junge Engländerin aus vergleichbaren Kreisen würde das nie gewagt haben. Bei Constance Britton wirkte es völlig natürlich. Man merkte ihr an, daß sie einen guten Teil ihrer freien Abende in exklusiven Bars und Lokalen verbrachte.
Zu seinem Erstaunen bestellte sie sich ein alkoholfreies Getränk. Sie legte die schlanken Hände um das Glas, als ob sie Kühlung suchte. Ihre Unterlipppe war leicht nach vorn geschoben und sie starrte ins Leere. Ashton erkannte plötzlich, daß sie sich über etwas ärgerte oder Kummer machte. Es war für ihn in der Tat eine höchst erstaunliche Entdeckung, daß ein Luxusgeschöpf dieser Klasse solchen Stimmungen ausgesetzt sein konnte. Er hatte immer geglaubt, daß ein Maximum an Jugend, Schönheit und Reichtum die Welt in eine helle, strahlende Bühne verwandeln müßte, auf der es keine düsteren Szenen gab.
Neben Constance Britton war ein Barhocker frei. Ashton zögerte. Er wollte nicht aufdringlich erscheinen, andererseits wußte er, wie dankbar die Rolle des geschickten Trösters zu sein vermag. Er bedeutete dem Mixer, das Glas umzustellen, und nahm dann neben Constance Platz.
„Gestatten Sie?" fragte er lächelnd. „Wie ich sehe, liegt es in Ihrer Absicht, die Aufregungen einer englischen Cocktail-Party bei einem Glas Fruchtsaft zu vergessen."
Sie lächelte ihm in die Augen. Jetzt, wo er nur durch eine Körperbreite von ihr getrennt war, empfand er die Schönheit des Mädchens als makellos und atemberaubend. Constances Augen flimmerten wie tiefe, silbrige Schächte, und die Haut war so glatt, daß man in Versuchung geriet, mit den Fingerspitzen zärtlich darüber hinweg zu streichen. Das leuchtende Blondhaar war seidenweich und gepflegt. Es saß wie eine kostbare Krone auf dem schmalen Gesichtsoval.
Er spürte ihr Parfüm . . . einen herbsüßen Duft, der ihm das Herz zusammen schnürte.
Hau ab, warnte er sich, verschwinde und zieh dich unter irgendeinem Vorwand zurück! Denke an den Standpunkt, den du solange erfolgreich vertreten hast! Begehe nicht den Fehler, dein Herz an dieses junge Manchen zu verlieren . . .
Aber die Einwände seines Verstandes zerfaserten unter ihrem zauberhaft liebenswürdigen Lächeln.
„Anscheinend haben Sie keine sehr hohe Meinung von den Annehmlichkeiten des englischen Party-Lebens."
Ihre Stimme war überraschend dunkel und samtig . . . viel dunkler, als Ashton das von einem so licht wirkenden Geschöpf erwartet hatte.
Er lächelte leise. „Unsere Parties sind sterbenslangweilig", bekannte er. „Ich wette, daß Sie sich innerlich über die Gesellschaft lustig gemacht haben. Sicher sahen Sie in uns spießige, trockene Gesellen, mit denen Sie nichts verbindet."
Er äußerte das lächelnd, fest von dem überzeugt, was er sagte, und ohne daran zu denken, daß er Fergusons Gedanken fast wörtlich übernommen hatte.
„Unsere Parties sind ebenfalls weit davon entfernt, vollkommen zu sein", wich sie aus, „Immer treffen sehr viele und sehr reizende Leute zusammen; es wird viel gesprochen und noch mehr getrunken, und am Schluß fragt man sich, was das Ganze für einen Sinn gehabt haben soll."
Er seufzte und drehte sein Glas zwischen den Fingern. „Es ist unser gutes Recht, immer nach dem Sinn der Geschehnisse zu fragen, aber ich muß gestehen, daß dabei selten eine befriedigende Antwort herauskommt. Uns fehlt die Basis, uns fehlt die Antwort auf die grundlegende Frage: wir wissen nicht, woher wir kommen, und wir wissen nicht, wohin wir gehen."
Während er sprach, bemühte er sich, die Mitte zwischen einem charmanten Plauderton und grüblerischem Ernst zu halten. Er wußte noch nicht, was ihr gefiel, und er wollte unter allen Umständen vermeiden, als langweilig zu gelten.
„Das Leben hat einen Sinn", sagte sie und blickte geradeaus, als lese sie den Text von den vielen buntetikettierten Flaschen ab. „Es hat den Sinn, daß wir in Güte und Würde eine tiefere Befriedigung finden. Es ist vor allem unsere Pflicht, niemand weh zu tun."
Er fand ihre Antwort enttäuschend banal und erwiderte mit einem leicht spöttischen Unterton: „Niemand wehtun? Das ist leicht gesagt, gnädiges Fräulein. In der Praxis ist es schlechthin unmöglich. Ich möchte wetten, daß besonders Sie, wenn auch oft gegen Ihren Willen, gezwungen sein dürften, anderen Menschen weh zu tun."
„Wie meinen Sie das?"
Er zuckte mit den Schultern, die von dem tadellos geschnittenen Abendanzug bekleidet waren und eine außergewöhnliche Breite aufwiesen.
„Es liegt nahe, daß man sich oft um Ihre Gunst bemühen wird“, sagte er. „Es ist ebenso klar, daß Sie dieses verständliche männliche Streben nicht in jedem Fall anzuerkennen vermögen."
Der Blick ihrer silberhellen Augen ruhte mit einem schwer definierbaren Ausdruck auf ihm. „Ich habe Angst", erklärte sie plötzlich.
Ashton legte die Stirn in Falten. Die überraschende Feststellung des Mädchens stand in keinem Zusammenhang mit den bisher gemachten Bemerkungen; sie kam so unvermittelt, daß er sich unwillkürlich umschaute, um die Quelle von Constances Furcht zu entdecken. Aber er gewahrte nur die Leute, die er schon vorher gesehen hatte: eine Gruppe eleganter Müßiggänger beiderlei Geschlechts, die in dieser fashionablen Bar ihren .Nightcap' einzunehmen pflegten.
„Angst?" fragte er verblüfft. „Wovor?"
Constance Britton lächelte gezwungen. Sie starrte ihr Glas an und preßte erneut die Hände um die glatte, kühle Fläche. Plötzlich glaubte er zu wissen, warum sie das tat. Sie bemühte sich, ein Zittern der Hände zu unterdrücken. Wie erklärte sich dieses sonderbare Benehmen? Er dachte an das nachdenklich-sorgenvolle Gesicht, das sie kurz nach ihrem Erscheinen an der Bar gezeigt hatte, und er fragte sich verwundert, welche Ursache diesem Phänomen zugrunde liegen mochte.
Constance hob die glatten, runden Schultern und ließ sie wieder fallen. Es war eine hilflose Geste, die jeden Mann gerührt hätte, die aber bei Ashton Cabott nur eine Mischung von Neugier und Begehren auslöste.
„Ich weiß es nicht", sagte sie leise.
Er war ein bißchen ratlos und nippte einige Male an seinem Glas. Nachdem er es abgestellt hatte, fragte er: „Fühlen Sie sich bedroht?"
„Nein . . . und ja. Ich spüre, daß etwas in der Luft liegt. Etwas Unheimliches . . . Schreckliches."
„Was veranlaßt Sie, diese Befürchtungen zu hegen?"
„Ich habe mich schon wiederholt danach gefragt. Ich kann nur sagen, daß die Befürchtungen bis jetzt — zum Glück! — auf intuitiven Regungen beruhen. Sie mögen vielleicht darüber lächeln und meine Furcht für das Ergebnis überspannter Mädchengefühle halten . . . aber ich kann mich einfach nicht dagegen wehren."
„Hängt es möglicherweise mit Ihrer Schwester zusammen?"
Sie musterte ihn erstaunt. „Kennen Sie meine Schwester?"
Er begriff, daß er einen Fehler begangen hatte, und schüttelte heftig den Kopf. „Nein, nicht persönlich. Bei den Burleys erwähnte nur irgend jemand, daß Sie mit Ihrem Fräulein Schwester nach London gekommen seien."
„Das stimmt. Ich bin mit Britta hier."
„Britta Britton", murmelte Ashton. „Ein hübscher Name!"
„Ich hatte sie gebeten, mir heute Abend Gesellschaft zu leisten. Aber sie ist ziemlich menschenscheu."
„Das kann ich verstehen. Heute habe ich zum ersten Mal etwas ganz Ähnliches empfunden. Diese langweiligen Parties! Diese sich ewig gleichbleibenden Gesichter und Gespräche! Der dumme Klatsch! Manchmal fragt man sich, warum man seine Zeit mit derlei Banalitäten vergeudet."
Sie schwiegen einen Moment, dann sagte Constance: „London hat mich immer gefesselt. Es lebte in meiner Phantasie als die Stadt des Nebels . . . aber auch als die Stadt des düsteren Verbrechens, als die Stadt, die Scotland Yard hervorbrachte. Natürlich habe ich diese etwas kindlichen und höchst einseitigen Regungen nie ganz ernst genommen, aber als ich in der vergangenen Woche mit Britta hier ankam, packte es mich mit seltsamer Gewalt . . . die Furcht vor dem Unheimlichen."
„Wollen Sie damit andeuten, daß Ihre Furcht einer bestimmten Person gilt?"
„Ich muß annehmen, daß es sich so verhält. Ich bin schon mehrmals nachts wach geworden und war überzeugt, daß sich ein Mann in meinem Zimmer aufhielt. Ich kann nicht erklären, was mich jeweils weckte . . . ein Luftzug, ein leises, wohl nur erahntes Geräusch . . . irgend etwas! Ich fand nie den Mut, das Licht anzuknipsen, und früher oder später schlief ich wieder ein. Am nächsten Morgen überprüfte ich stets den Inhalt meiner Schmuckschatulle; es fehlte nie etwas."
Das Wörtchen Schmuck ließ ihn aufhorchen. Er war der festen Überzeugung gewesen, daß sie ihre Preziosen im Hotelsafe aufbewahren ließ, und mußte nun erkennen, daß das gar nicht der Fall war. Sein Herz schlug rascher. Hier bot sich eine grandiose Möglichkeit! Warum machte er sich die Angstträume und Einbildungen des jungen Mädchens nicht zunutze? Warum drang er nicht zu nächtlicher Stunde in ihrem Zimmer ein und raubte den Schmuck? Wenn es ihm gelingen sollte, sich in den Besitz des Schmuckes zu setzen, gab es zwei Möglichkeiten: er konnte ihn entweder behalten und verkaufen, oder er konnte ihn ein paar Tage später wieder abliefern und erklären, daß es ihm gelungen sei, die Preziosen einem unbekannten Gangster abzujagen. So etwas würde seinen Eindruck auf ein unverbildetes Mädchengemüt kaum verfehlen.
„Haben Sie Ihr Fräulein Schwester von Ihren Beobachtungen und Befürchtungen schon in Kenntnis gesetzt?"
„Nein, es wäre töricht, Britta mit diesen Geschichten kommen zu wollen. Vermutlich würde sie mich auslachen. Sie ist zwar menschenscheu, aber durchaus nicht furchtsam."
„Warum wechseln Sie nicht einfach das Hotel?"
„Britta fühlt sich hier sehr wohl. Außerdem hätte das doch keinen Zweck. Wenn wirklich jemand die Absicht haben sollte, uns zu berauben, so kann er das auch in einem anderen Hotel tun."
Gegen seine Absicht sagte Ashton: „Ich finde, Sie handeln recht leichtsinnig, wenn Sie den Schmuck im Hotelzimmer aufbewahren.“
„Es ist so schrecklich umständlich, immer erst die Hotelleitung wegen des Safes zu bemühen. Man muß Quittungen bei der Ein- und Auslieferung unterschreiben und unangenehme Wartezeiten in Kauf nehmen. Ich hasse diese dummen, wenngleich notwendigen Umstände. Im übrigen führe ich nur einen Teil meines Schmuckes bei mir ... ich schätze, daß sein Wert dreihunderttausend Dollar kaum überschreiten dürfte."
Ashton senkte die Lider, um sich nicht durch das triumphierende Aufblitzen seiner Augen zu verraten. Dreihunderttausend Dollar! Das war die Jagdbeute eines ganzen Jahres! Hier lag sie griffbereit in einem Hotelzimmer des ,Carlton‘!
„Das ist ein beträchtliches Vermögen", sagte er ruhig. „Ich wiederhole, daß es leichtsinnig ist, den Schmuck nicht im Safe aufzubewahren. Man hört immer wieder von dreisten Hoteldiebstählen."
Sie lächelte zerstreut. „Natürlich, das ist richtig. In diesem Zusammenhang muß ich Ihnen ein Geständnis machen. Sie sind ein Mann und werden mich wahrscheinlich nicht verstehen. Aber in meiner Furcht gehe ich so weit, zu glauben, daß ein nächtlicher Eindringling sich mit dem Schmuck zufriedengeben und mich nicht belästigen würde." Sie hob den Blick und schaute ihn an. „Ich betrachte den Schmuck gewissermaßen als Unterpfand für meine persönliche Sicherheit."
„Ist Ihre Furcht denn so ausgeprägt?" fragte er erstaunt.
„Ja."
„Sind diese Angsterscheinungen typisch für Sie?"
„Keineswegs. Ich habe sie zum ersten Mal hier in London bemerkt."
„Fühlen Sie sich beobachtet?"
„Ja."
Ashton zwang sich zu einem Lächeln. „Ich hoffe, Sie halten mich nicht für einen Ignoranten Ihrer Gefühle, wenn ich meine, dafür eine plausible Erklärung gefunden zu haben. Ist es nicht ganz selbstverständlich, daß eine junge Dame mit Ihren Attributen von Jugend und Schönheit Beachtung findet? Aber es wäre, finde ich, grundverkehrt, diese echte Bewunderung in ein Beobachten ummünzen zu wollen."
Sie schüttelte den Kopf. „So ist es nicht, Ich bin nicht hysterisch, Ich bilde mir ein, mit beiden Füßen fest im Leben zu stehen. Ich weiß, wie ich aussehe, und ich weiß, wie man darauf reagiert. Ich habe gelernt, ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit als selbstverständlich hinzunehmen. Aber ich kann sehr wohl zwischen dem unterscheiden, was Sie freundlicherweise Bewunderung nennen, und dem anderen, das mich frösteln läßt."
„Richtet sich Ihr Verdacht gegen einen bestimmten Menschen?"
„Nein. Ich sagte Ihnen doch bereits, daß es nichts Greifbares, Konkretes gibt, um meine Befürchtungen zu untermauern. Das Gefühl der Angst ist nur zu jeder Stunde um mich, es ist da, wenn ich nachts erwache, und es ist da, wenn ich einen Einkaufsbummel durch die Regent Street mache. Manchmal ist es so stark, daß ich plötzlich stehenbleibe und die Gesichter der Passanten betrachte. Nie finde ich das Gesicht, das ich suche."
„Es ist also ein bestimmtes Gesicht . . . ein Gesicht, das nur in Ihrer Einbildung existiert?"
Constance Britton sah gequält aus. „So kann man es umschreiben. Ich fühle, daß ich es erkennen würde, wenn ich es sähe."
„Wie lange beabsichtigen Sie sich in London aufzuhalten?"
„Noch drei Wochen."
„Trotz Ihrer Furcht?"
„Britta hat solange hier zu tun. Sie muß viele Daten Zusammentragen, um eine wissenschaftliche Arbeit abschließen zu können. Ich will sie dabei nicht mit meinen Sorgen belästigen . . . vielleicht beruhen sie tatsächlich nur auf Einbildungen."
„Aber Sie sind im tiefsten Inneren davon überzeugt, daß Sie kein Opfer einer überreizten Phantasie geworden sind?"
Sie blickte ihm ernst in die Augen. „Ja, davon bin ich überzeugt."
Er beugte sich ihr ein wenig zu. „Kann ich Ihnen helfen?" fragte er eindringlich. „Ich bin bereit, alles zu tun, um Sie von Ihren Kümmernissen zu befreien."
Sie lächelte leise. „Wie sollten Sie mir helfen können? Ich danke Ihnen für Ihr Entgegenkommen. Eigentlich ärgere ich mich, das Thema überhaupt angeschnitten zu haben. Wahrscheinlich amüsieren Sie sich über mich und sagen jetzt diese Amerikanerinnen! Nach außen hin keß und selbstsicher, aber innerlich völlig unausgereifte Kinder! Ist es nicht so? Ich kann dazu nur erklären, daß ich früher weder an düsteren Vorahnungen, noch an Furcht litt. Ich will nicht behaupten, daß es unmöglich gewesen wäre, mich zu erschrecken . . . aber das, was ich jetzt und hier durchmache, ist für mich ein völlig neues Leben . . . und leider kein sehr angenehmes. Immerhin bin ich froh, daß Sie mir erlaubt haben. Sie mit meinen dummen Sorgen zu belästigen. Wenn einem Gelegenheit gegeben wird, seine Gedanken in Worte zu kleiden, wird vieles klar und deutlich..."
„Trifft das auch für diesen Fall zu?"
Traurig schüttelte sie den Kopf. „Nein."
Sie öffnete das goldschimmernde Brokathandtäschchen und nahm einen Schein heraus, den sie dem Mixer hinschob. Dann glitt sie vom Barhocker und lächelte Ashton Cabott in die Augen. „Ich glaube, es wird Zeit, daß ich mich zurückziehe. Britta und ich wollen morgen nach Brighton fahren. Wir haben uns vorgenommen, früh aufzustehen. Gute Nacht, Mr. Cabott!"
„Wie schade!" sagte er ehrlich enttäuscht. „Ich hatte gehofft, Sie würden mir gestatten, Ihnen noch ein wenig Gesellschaft zu leisten.“
„Vielleicht ein andermal." Sie gab ihm die Hand. „Gute Nacht . . . und nochmals vielen Dank für Ihr geduldiges und verständnisvolles Zuhören!"
Er blickte ihr hinterher, als sie aufrecht und selbstsicher auf den Ausgang zustrebte, ein schönes und elegantes Mädchen, dem kein Mensch anmerkte, wie es in ihrem Inneren aussah. Ashton wandte sich seufzend seinem Glas zu. Es war leer.
„Noch einen Whisky!" bat er.
Als der Mixer das Glas vor ihm hinstellte, fragte Ashton: „Kennen Sie die Schwester von Miß Britton?"
„Ja, ich habe sie einmal gesehen, oben im Restaurant. In die Bar kommt sie nicht."
„Ist sie genauso schön wie Miß Constance?"
„Nein . . . aber sie ist enorm attraktiv. Ernster, gesammelter. Dabei blendend gewachsen. Eine aufregende Dame, daran gibt es keinen Zweifel."
„Wie alt ist sie?"
„Keine Ahnung. Ich würde sagen, daß sie gerade die fünfundzwanzig überschritten hat." Ashton nickte zerstreut und führte das Glas an die Lippen. Seine Gedanken waren schon wieder bei Constance und ihrem Schmuck.
Dreihunderttausend Dollar!
Selbst wenn man annahm, daß die Schätzung zu hoch gegriffen war, und selbst wenn man unterstellte, daß der Verkauf von gestohlenem Schmuck im günstigsten Falle dreißig Prozent seines Handelswertes einbringen würde, verblieb doch die reelle Chance, gleichsam über Nacht einhunderttausend Dollar zu verdienen.
Ashton zog die Unterlippe zwischen die Zähne und nagte darauf herum. War es nicht am klügsten, den Schmuck zu stehlen und ihn ein paar Tage später wieder auszuliefern? Wenn er sich dazu eine aufregende Geschichte einfallen ließ, die ihn als mutigen Gangsterjäger, als Ritter ohne Furcht und Tadel und als Held bester Machart erscheinen ließ, bestand die Möglichkeit, daß dadurch in Constance jene Liebesgefühle ausgelöst würden, die er sich erträumte. Ashton glaubte nach dem ersten Zusammentreffen mit Constance die berechtigte Hoffnung nähren zu dürfen, daß sie ihn sympathisch und höchst anziehend fand. Einem Menschen, den sie mißtraute oder ablehnte, hätte sie schwerlich die Nöte ihres Herzens anvertraut.
Im übrigen brauchte er sich wirklich nicht vor den Erkundigungen zu fürchten, die der alte Britton vor dem Zustandekommen einer Verlobung ohne Zweifel über ihn, Ashton Cabott, einziehen würde.
Wenn es die Cabotts auch nie geschafft hatten, in den Besitz eines Adelstitels zu gelangen, wurden sie doch als eine der besseren Familien betrachtet.
Am besten wird es sein, ich gehe noch heute nacht an die Arbeit, überlegte er. Es könnte ja sein, daß sie sich meine Worte zu Herzen nimmt und den Schmuck ab morgen tatsächlich der Hotelleitung zur Aufbewahrung übergibt. Er spürte das alte, aufregende Kribbeln, das ihn immer wieder überfiel, wenn er sich entschlossen hatte, ein neues Risiko einzugehen. Er leerte das Glas.
„Noch einen Whisky, bitte!"
Das Getränk brannte in seinem Inneren. Es gab ihm Mut und Zuversicht. Er lächelte spöttisch vor sich hin. Ja, das sollte der größte Coup seines Lebens werden . . . gleichsam der krönende Abschluß! Die Vorstellung, die junge und unermeßlich reiche Constance Britton zu erobern und zu heiraten, war wie ein Griff nach den Sternen . . . aber gerade dieser Gedanke faszinierte ihn?
An der Seite dieses begehrenswerten Geschöpfes würde er es sich leisten können, ein wahrhaft seriöser Gentleman zu werden. Die betrügerischen Manipulationen, die lange Zeit die Grundlage seines Einkommens gebildet hatten, würden damit für immer von einem Vorhang barmherzigen Vergessens bedeckt werden. Niemand, weder Constance noch ein anderer Mensch, würden je erfahren, daß er ein Mann mit krimineller Vergangenheit war, ein Dieb und Verbrecher . . .
Er atmete tief. In seinen Augen glitzerte es erregt. Diese Nacht bildete den Auftakt zu dem größten Fischzug, den er jemals geplant hatte!
*
Die Dunkelheit des Zimmers umschloß ihn wie ein großes, weiches Tuch. Er atmete mit offenem Mund, um sich nicht zu verraten. Die Erregung peitschte sein Herz mit unbarmherzigen Schlägen. Er sah die beiden hohen Balkontüren mit den nur angelehnten Fensterläden. Durch die Querrippen schimmerte das Licht naher Leuchtreklamen; es hatte nicht die Kraft, die Dunkelheit des Raumes zu durchdringen.
Er preßte den Rücken gegen die Wand und bemühte sich, gewisse Einzelheiten der Einrichtung wahrzunehmen. Es gelang ihm nicht. Eine Uhr tickte beruhigend, und durch die Balkontüren drang das monotone Rauschen des Großstadtverkehrs, der nicht einmal zu dieser Stunde schlief. Wie kam es, daß er die Atemgeräusche des Mädchens nicht hörte? Lag es daran, daß die unerträgliche Spannung, der er sich ausgesetzt sah, das Blut in seinen Schläfen zum Brausen brachte?
Ich werde klapprig, dachte er ärgerlich. Noch vor einem Jahr hätte mich so eine Sache völlig unberührt gelassen. Wo ist meine viel gerühmte Kaltblütigkeit geblieben? Er kannte die Antwort. Es war nicht so, daß er sich vor der Entdeckung fürchtete. Er war inzwischen zu Hause gewesen, um den Anzug zu wechseln. Außerdem trug er ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. In der rechten Hand hielt er eine Pistole. Selbst wenn Constance Licht machen und um Hilfe rufen sollte, war er sicher, unerkannt entkommen zu können.
Nein, seine augenblickliche Erregung bezog sich auf die Erkenntnis um die Höhe des Einsatzes, und damit auf die Furcht, daß er in diesem Spiel eine falsche Karte ziehen könnte. Er stand hier, um den ersten Schritt zur Eroberung des schönsten und reichsten Mädchens zu machen, das er je kennengelernt hatte, und er war entschlossen, sich dabei keinen Fehltritt zu leisten.
Ein schiefes Lächeln stahl sich auf seine Züge. Zu denken, daß er vielleicht schon in wenigen Monaten mit der schönen Constance Britton, die dann freilich den Namen Cabott tragen würde, ein gemeinsames Schlafzimmer zu teilen beabsichtigte!
Aber noch war er nicht soweit, noch war er nichts anderes als ein Krimineller, der sich mit klopfendem Herzen um die Verwirklichung seiner Pläne bemühte.
Allmählich gewöhnten sich seine Augen an die Dunkelheit. Obwohl er die Finsternis, die in den Ecken und Winkeln hockte, nicht zu durchdringen vermochte, bemerkte er jetzt das Bett, das mit seiner Stirnseite zwischen den beiden Balkontüren stand. Das einfallende Licht zauberte schwache Lichtreflexe auf die weißen Laken. Ashton ging unendlich langsam auf das Bett zu. Nachdem, was Constance ihm verraten hatte, mußte er annehmen, daß der Schmuck auf dem Nachtschränkchen neben dem Bett lag.
Er bewegte sich mit größter Vorsicht, da er von Constance gehört hatte, wie sensibel und geräuschempfindlich sie war. Endlich hatte er das Kopfende des Bettes erreicht. Er brauchte nur die Hand auszustrecken und seine Finger würden die weiche, zarte Haut des schlafenden Mädchens berühren. Nun, er hatte nicht die Absicht, eine Dummheit zu begehen, aber es kostete ihn Mühe, den wahnsinnigen Wunsch zu unterdrücken, seinen Mund auf die Lippen der Schlafenden zu legen.
Er vernahm jetzt deutlich ihre Atemzüge . . . sie schlief offenbar ganz fest und ruhig. Er knüpfte die Gesichtsmaske ab und wischte sich mit dem weichen, schwarzen Tuch über die schweißnasse Stirn.
Dann griff er nach der Schatulle, die er jetzt als schwarzen Fleck auf dem Nachtschränkchen stehen sah. Sie war nicht verschlossen. Er hob den Deckel. Seine Finger tasteten über den weichen Samt, mit dem die Schatulle ausgeschlagen war.
Er merkte, wie ihn ein scharfer Schmerz der Enttäuschung durchzuckte.
Die Kassette war leer. Was war schiefgegangen . . . und warum? Was hatte er falsch gemacht?
Er ertappte sich dabei, daß er laut und scharf atmete. Die Wut über die fehlgeschlagene Expedition hatte ihn unvorsichtig werden lassen. Rasch öffnete er den Mund. Dann band er sich das Tuch um, während seine Gedanken einen irren Tanz vollführten.
Er glaubte zu wissen, was geschehen war. Constance hatte seine Warnungen allzu rasch beherzigt und den Schmuck in das Hotelsafe gegeben! Er hätte vor Zorn aufschreien mögen, aber er wußte natürlich, daß er sich diesen gefährlichen Luxus nicht leisten konnte. Vorsichtig näherte er sich der Tür und lauschte. Draußen war alles ruhig. Er betrat den Korridor und riß sich die Maske vom Gesicht. Mit wenigen Schritten hatte er eines der Zimmer erreicht, das die Stubenmädchen zur Aufbewahrung der Wäsche benutzen. Mit Hilfe eines Nachschlüssels gelangte er hinein. Dann stieg er durch das Fenster in den Lichtschacht und schaffte es ohne Mühe, das Erdgeschoß zu erreichen. Fünf Minuten später spazierte er durch die nächtlichen Straßen. Er war sicher, von niemand gesehen worden zu sein und rauchte eine Zigarette, um sich zu beruhigen.
Jetzt, wo die Spannung verklungen war, fühlte er sich beinahe wohl. Er hatte zwar die erste Phase der Auseinandersetzung verloren, aber er war keineswegs bereit, deshalb den Kampf aufzugeben. Im Gegenteil. Die aufgetretenen Schwierigkeiten hatten; lediglich zur Folge, daß sein Ehrgeiz noch weiter angestachelt wurde.
Ein paar Straßenzüge weiter stieg er in seinen dort abgestellten Wagen. Als er vor seinem Haus in Chelsea den Wagenschlag hinter sich schloß, zeigten sich die ersten trübgrauen Streifen des herauf dämmernden Tages am Horizont. Er ging zu Bett und schlief bis elf Uhr. Als er erwachte, fühlte er sich frisch und ausgeruht. Er nahm eine kalte Dusche, absolvierte dann die tägliche Morgengymnastik und klingelte schließlich dem Butler, um sich das Frühstück servieren zu lassen.
Er konnte bereits über den Ausgang des nächtlichen Abenteuers lächeln, obwohl es ihn noch immer wurmte, mit leeren Händen aus dem ,Carlton‘ weggegangen zu sein.
Nach dem Frühstück kleidete er sich an. Es war ein leidlich hübscher Tag; nicht ganz wolkenlos, aber doch recht sonnig, und so beschloß er, seinen Schneider aufzusuchen. Gerade, als er die Wohnung verlassen wollte, klingelte das Telefon. Der Butler war nicht in der Nähe und so nahm Ashton das Gespräch selbst an.
„Mister Cabott?" fragte eine spröde, männliche Stimme, die sich fast so anhörte, als käme sie aus dem Trichter eines alten Grammophons.
„Am Apparat", erwiderte er. Dabei spannten sich seine Muskeln, als müsse er einer drohenden Gefahr ins Auge blicken.
Warum? Es war nichts geschehen, was seinen Argwohn wecken konnte. Wurde er plötzlich ein Opfer des schlechten Gewissens? Trotz seiner demonstrativ zur Schau getragenen Ruhe und trotz der Sicherheit seines Auftretens, die in krassem Gegensatz zur Art seiner Lebensführung standen, war auch Ashton Cabott von derlei Regungen nicht ganz frei. Aber warum meldeten sie sich gerade jetzt zu Wort?
Am anderen Ende der Leitung herrschte Ruhe .. . eine lastende, bedrückende Ruhe, die seine Befürchtungen verstärkte.
„Wer spricht dort?" fragte er scharf.
„Mein Name tut nichts zur Sache", erklärte der Teilnehmer in seiner kühlen, distanzierten Art. „Sie dürfen mich Meister nennen. Wie ich in Erfahrung zu bringen vermochte, verfügen Sie über ein beträchtliches Vermögen. Soweit mir bekannt ist, beläuft es sich zur Zeit auf fünfzigtausend Pfund. Etwa die Hälfte davon ist in Aktien und Obligationen angelegt. Ich möchte Sie bitten, diese Papiere binnen einer Woche flüssig zu machen. Nach Ablauf dieses Termins lasse ich Ihnen Bescheid zukommen, wann und wo Sie den Gesamtbetrag von fünfzigtausend Pfund an mich zu zahlen haben."
Jetzt, da sich Ashtons instinktiver Argwohn bestätigte und die ungeheuerliche Forderung wie ein dröhnender Gong in seinem Inneren nachklang, wurde er eiskalt. Am anderen Ende der Leitung stand ein Mann, der mit den gleichen Waffen kämpfte wie er selbst. Ein rücksichtsloser Erpresser. Ashton lächelte düster.
Mich legst du nicht herein, dachte er. Irgendwie stelle ich dir eine Falle, und du wirst hineinlaufen. Ich kehre den Spieß einfach um. Es gibt keinen Mann in ganz England, der es in dieser Hinsicht mit Ashton Cabott aufzunehmen vermag. Keinen! Er war freilich auf der Hut. Der Fremde rief nicht ohne Grund an. Er mußte etwas in Erfahrung gebracht haben . . . irgendeine Kleinigkeit, die er jetzt als seinen großen Trumpf auszuspielen versuchte. Was war es? Wo lag der Fehler, der ihm, Ashton Cabott, bei einem seiner wohlvorbereiteten Unternehmen unterlaufen war? Ashton zwang sich zu einem lauten Lachen. Unter den gegebenen Umständen fiel es bemerkenswert natürlich aus.
„Bist du es, Bill? Oder du, James?" trompetete er mit gekünstelter Fröhlichkeit in die Muschel. „Gib dir keine Mühe! Ich kenne deine faulen Witze zur Genüge und habe nicht die Absicht, auf sie hereinzufallen!"
Ein paar Sekunden lang war es ruhig, dann sagte der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung: „Hier ist weder Bill noch James. Hier spricht der Meister. Sie werden sich meinem Befehl fügen, wenn Sie nicht wollen, daß Ihre Karriere im Zuchthaus endet. Sie wissen, daß Sie genug auf dem Kerbholz haben, um für die nächsten zehn Jahre dort landen zu können."
„Wer, zum Teufel, sind Sie?"
„Sie werden mich nie kennenlernen."
„Vermutlich sind Sie aus dem Irrenhaus entsprungen!" sagte Ashton wütend. Er merkte, daß ihm die überlegene Ruhe des anderen an die Nerven ging.
Der Fremde räusperte sich.
„Lassen Sie den Unsinn, Cabott. Sie mögen glauben, daß ich bluffe und auf vage Vermutungen angewiesen bin, aber in diesem Punkt täuschen Sie sich. Ich habe konkrete Beweise vorliegen. Einen davon finden Sie in der Morgenpost. Den anderen entdecken Sie in den Mittagsausgaben der Zeitungen."
Ashton durchzuckte es scharf. Warum hatte er die Morgenpost noch nicht durchgesehen? Der Butler hatte sie mit dem Frühstück hereingebracht, aber Ashton hatte sie unbeachtet auf dem silbernen Tablett liegen gelassen. Er war in Gedanken zu sehr mit Constance beschäftigt gewesen, als daß er Lust verspürt hätte, die Briefe zu lesen.
„Ich rufe heute Nachmittag nochmals an", sagte der Fremde. „Und zwar um drei Uhr. Ich erwarte, daß Sie zu Hause sein werden."
Es klickte. Das Gespräch war beendet. Ashton ließ den Hörer sinken und schaute ihn an wie etwas Fremdes, Ungeheuerliches. Er hatte das Telefon oft genug benutzt, um mit verstellter Stimme und genau einstudierten Worten seine Opfer zu erschrecken. Jetzt wurde die gleiche Technik gegen ihn zur Anwendung gebracht. Das schockierte ihn mehr, als er im Moment zuzugeben wagte. Er legte den Hörer langsam auf die Gabel zurück und spürte, daß kalter Schweiß an den Innenflächen seiner Hände klebte. Mit einem Taschentuch rieb er sie geistesabwesend trocken.
Seine gute Laune war verflogen. Er bebte bei dem Gedanken, daß er jetzt, kurz vor dem erstrebten Höhepunkt seiner Karriere, von einem rücksichtslosen Erpresser in die schmachvolle Publizität eines Gesellschaftsskandals gestoßen werden könnte.
Was wußte der Unbekannte?
Ashton ging wie betäubt in den kleinen Salon. Der Butler war gerade dabei, das Frühstücksgeschirr abzuräumen. Ashton nahm die Post und stellte sich ans Fenster, und zwar so, daß Harvey sein Gesicht nicht zu sehen vermochte. Er hielt ein knappes Dutzend Briefe in der Hand. Es waren ein paar Rechnungen darunter, ein Brief von Tante Amely, die in Leeds von ihrer kleinen Rente lebte, zwei Einladungen für Bälle. . . und schließlich ein weißer Umschlag aus gutem Bütten. Ashton legte die andere Post beiseite und befingerte das Kuvert.
Es fühlte sich dünn und leer an . . . aber es mußte etwas enthalten, das seine gesamten Zukunftsaussichten in Frage stellen konnte. Hinter ihm fiel leise die Tür ins Schloß, Harvey hatte das Zimmer verlassen. Ashton riß den Umschlag auf. Er enthielt nichts weiter als ein Foto.
Das Bild zeigte ihn, Ashton Cabott, an der Stirnseite eines Bettes in einem Hotelzimmer. Er war im Halbprofil zu sehen, ganz deutlich und unverkennbar. Seine linke Hand griff nach einer Schmuckschatulle, die auf einem Nachtschränkchen stand. Der Kopf der schlafenden Constance Britton war zur Hälfte von seinem Körper bedeckt.
Ashton Cabott hatte das Gefühl, daß eine Hand an seine Kehle griff und sie unbarmherzig zusammendrückte. Die Aufnahme war grobkörnig und doch detailgetreu. Er entdeckte immer mehr schockierende Einzelheiten, die kalten Schweiß auf seine Stirn treten ließen. Er sah zum Beispiel, daß er in der Rechten das schwarze Gesichtstuch hielt, das ihm als Maske gedient hatte, und er bemerkte deutlich die Konturen der Pistole, die sich unter dem Stoff der Jacketttasche abzeichneten. Es gab keinen Zweifel, daß der Mann, der sich am Telefon ,Meister' genannt hatte, zum gleichen Zeitpunkt in Constance Brittons Hotelzimmer gewesen sein mußte wie er. Es stand auch fest, daß der Fremde die Aufnahme mit einer Infrakamera gemacht hatte, mit jenem erstaunlichen Material, das ohne Blitzlicht die tiefste Dunkelheit zu durchdringen vermag.
Der Fremde war schon vor ihm in Constance Brittons Zimmer gewesen; er hatte sich ganz einfach still verhalten und die Aufnahme gemacht, als er, Ashton Cabott, nach dem Schmuck gegriffen hatte. Das Bild war kompromittierend; Maske und Pistole bewiesen zur Genüge, daß er keineswegs in friedlicher Absicht gekommen war. Zu allem Überfluß zeigte eine kleiner Reisewecker neben der Schatulle noch die ungewöhnliche Einbruchszeit.
Ashton mußte sich setzen. Ihm wurde erschreckend klar, warum er die Kassette leer vorgefunden hatte. Der Meister hatte sie kurz vor ihm geleert! Das war schlimm genug, noch schlimmer aber war, daß das Foto ihn, Ashton Cabott, als den Dieb auszuweisen schien!
Natürlich gab es eine Reihe von formaljuristischen Einwänden, die dieses Argument schwächen konnten. Da war zum Beispiel die unleugbare Tatsache, daß er, wie das Vorhandensein der Aufnahme bewies, nicht allein im Zimmer gewesen war. Aber was nützte das schon? Für ihn kam es nur noch darauf an, daß der Mann, der sich ,Meister' nannte, mundtot gemacht wurde. Aber wie war das zu erreichen?
Ashton erinnerte sich plötzlich an die Unterhaltung, die er am Vorabend mit Constance Britton in der Bar des ,Carlton' geführt hatte. Das Mädchen hatte sich anscheinend ein konkretes Bild jenes Mannes gemacht, von dem sie sich bedroht und verfolgt fühlte. Ashton wußte jetzt, daß dieser Mann existierte. Constance war also durchaus nicht das Opfer einer überreizten Phantasie geworden; sie hatte nur mit großer Sensibilität die tatsächlichen Ereignisse registriert. Es war wichtig, auch das kleinste Detail ihrer Beobachtungen und Überlegungen zu notieren. Vielleicht half ihm das weiter.
Ashton war zu verliebt in sich und sein Vermögen, als daß er auch nur im entferntesten den Gedanken erwogen hätte, die Forderungen des Fremden zu akzeptieren. Der .Meister' hatte ihm eine Woche Zeit gegeben. Ashton schob den Knöchel seines Zeigefingers in den Mund und biß so hart darauf, daß es schmerzte.
Er wußte, daß es in dieser Woche notwendig werden würde, einen Mann zu finden und von seinem Vorhaben abzubringen.
*
Auf dem umfangreichen Programm krimineller Vergehen, das Ashton Cabott im Laufe der Jahre zusammengestellt hatte, war kein Mord verzeichnet. Er verachtete jeden Eingriff brutaler Gewalt als töricht und höchst unnötig. Mörder waren in seinen Augen instinktlose, gemeine Geschöpfe. Jetzt glaubte er freilich zu wissen, daß es Gründe und Situationen gab, die sogar einen Mord geschehen lassen konnten. Aber wie sollte er in der Millionenstadt London den Mann entdecken, der sich so großspurig ,Meister' nannte? Im ersten Moment war ihm die Gnadenfrist von einer Woche sehr lang erschienen, aber jetzt, bei näherem Nachdenken, begriff er, daß es fast unmöglich sein würde, innerhalb von sieben Tagen einen Menschen zu finden, von dem man nicht mehr kannte als die wahrscheinlich verstellte Stimme.
Nun, der Mann hatte zugesagt, sich am Nachmittag nochmals zu melden. Es kam darauf an, bei dieser Gelegenheit ein paar Details in Erfahrung zu bringen, die die Nachforschungen erleichterten. Vielleicht war es möglich, ein Treffen zu arrangieren, das die entscheidende Auseinandersetzung bringen würde.
Nach allem, was bis jetzt geschehen war, stand freilich fest, daß es sich um einen kühlen und ungemein geschickten Gegner handelte, der kaum bereit sein würde, in eine plumpe Falle zu laufen. In gewisser Weise waren sie einander ebenbürtig. Nun, das machte die bevorstehende Auseinandersetzung noch spannender und reizvoller, als sie ohnehin schon war.
Ashton Cabott bemühte sich, das Ereignis mit einem Anflug von Sportsmannsgeist auszunehmen, aber das gelang ihm nur unvollkommen. Er mußte immer wieder daran denken, daß sein Name und seine Karriere, vor allem aber sein Vermögen auf dem Spiele standen.
Er fuhr mit dem Wagen in die Stadt, besuchte seinen Schneider und kaufte dann, auf der Fahrt zum Club, wo er zu essen beabsichtigte, ein paar Mittagszeitungen. Auf den Frontseiten der Blätter fand er die erwarteten Schlagzeilen. Hoteldiebstahl im Carlton. Millionendiebstahl in exklusivem Hotel.
Seine Mundwinkel zuckten spöttisch. Diese Reporter! Sie neigten stets zu Übertreibungen. Constance hatte von dreihundertfünfzigtausend Dollar gesprochen, die Zeitungsleute machten einfach eine Million daraus. Aber beim Lesen wurden seine Augen groß und weit. Der Londoner Vertreter der in Mitleidenschaft gezogenen Versicherungsagentur hatte von der New Yorker Verwaltung ein Kabel erhalten, aus dem hervor ging, daß es sich bei dem Schmuck um einen Gesamtwert von einer Million Dollar handelte.
Auf Ashton Cabotts Stirn bildete sich kalter Schweiß, als er diese Information schluckte. Eine Million Dollar! In dem Artikel wurde unter anderem erwähnt, daß der berühmte Kommissar Morry den Fall übernommen habe. Ashton krümmte beim Lesen des Namens verächtlich die Unterlippe. Er kannte den Hang gewisser Zeitungsschreiber, einen Glorienschein um die Person von Detektiven und Inspektoren zu legen, zur Genüge. Auf diese Weise hoffte man zu erreichen, daß die Leser in jedem Mitarbeiter von Scotland Yard gleichsam einen zweiten Sherlock Holmes sahen.
Aufhorchen ließ ihn ein kurzer, nebensächlich behandelter Abschnitt, in dem es hieß:
„Gleichfalls gestohlen wurde der Schmuck von Britta Britton, die im Nebenzimmer schlief. Der Wert des Schmuckes beläuft sich auf rund siebzigtausend Dollar."
Neben dem Wert von Constances Schmuck erschien die Summe ziemlich unbedeutend. Aber für Ashton Cabott, den kühlen Rechner, waren es glatte fünfundzwanzigtausend Pfund, die ihm durch die Lappen gegangen waren. Nun, er war einfach zu spät gekommen, es hatte keinen Zweck, sich noch länger darüber aufzuregen.
Im übrigen war nichts verloren. Noch gar nichts! Wenn er es schaffte. Constance zu erobern, würde er das Vielfache von dem gewinnen, was dem ,Meister' in die Hände gefallen war. Wahrscheinlich würde die Versicherung den Schaden abdecken. Oder nicht? Sie konnte Constance Fahrlässigkeit vorwerfen. Vielleicht enthielt die Police einen Paragraphen, der verlangte, daß der Schmuck auf Reisen in Safes unterzubringen sei . . .
Nun, das sollte ihn jetzt nicht weiter beschäftigen. Es kam vor allem darauf an, zwei Dinge zu erledigen. Erstens mußte er den Meister finden und unschädlich machen, und zweitens mußte es ihm gelingen, Constance Brittons Herz zu gewinnen. Nach dem Essen rief er das Carlton an, um mit Constance zu sprechen und ihr sein Mitgefühl auszudrücken, aber der Portier teilte ihm mit, daß die beiden Brittons ausgegangen seien. Nein, in Anbetracht der besonderen Umstände hätten sie es vorgezogen, nicht nach Brighton zu reisen. So viel er wisse, hätten sie die Absicht geäußert, am Nachmittag zurückzukehren.
Ashton fuhr zurück nach Chelsea. Er konnte im Moment nichts weiter unternehmen, als sich auf den Anruf des unheimlichen Fremden vorzubereiten. Als er die Halle seines Hauses betrat, kam ihm der Butler Harvey entgegen, Die grauen Augen des Dieners zeigten einen bei ihm sonst ungewohnten Ausdruck verblüfften Erstaunes.
„Ein Herr von Scotland Yard erwartet Sie, Sir."
Ashton Cabott hob erstaunt die Augenbrauen. Er streifte betont langsam die Handschuhe ab und überreichte sie dem Butler.
„Ah, wirklich? Was will er denn?"
„Das hat er nicht gesagt. Ich habe einige diesbezügliche Fragen an ihn gerichtet, aber er bestand darauf, mit dem gnädigen Herrn zu sprechen."
„Hat er seinen Namen genannt?"
„Sehr wohl, Sir. Er heißt Morry."
Ashton befeuchtete sich die Lippen mit der Zunge. Noch vor einer Stunde hatte er beim Zeitunglesen über den Nimbus gelächelt, den die Presse dem Kommissar anzudichten versuchte. Jetzt fühlte er, daß er selbst ein Opfer dieser Kampagne zu werden drohte. Da der Kommissar die Diebstahlsaffäre Britton untersuchte, gab es keinen Zweifel über den Grund seines Kommens.
„Sitzt er im kleinen Salon?"
„Ganz recht, Sir."
Ashton nickte und ging auf die Tür zu dem besagten Raum zu. Er war entschlossen, sich nichts von der Betroffenheit anmerken zu lassen, die ihn gefangenhielt. Zum Teufel, er war ein Mann, der gelernt hatte, das gefährliche glatte Parkett der höheren Gesellschaftskreise zu meistern; wie sollte es da einem simplen Beamten und Gehaltsempfänger gelingen, ihn in Verwirrung zu setzen? Der Kommissar erhob sich, als Ashton Cabott mit einem kühlen Lächeln auf ihn zukam. Die beiden Männer reichten einander die Hände und betrachteten sich mit jener höflichen Reserve, hinter der sich tiefe Aufmerksamkeit verbirgt.
Kommissar Morry war gut einen halben Kopf größer als Ashton Cabott, von dem sich gewiß nicht sagen ließ, daß er klein war. In den straffen, gebräunten Zügen des Kommissars, die von den klaren, hellen Augen beherrscht wurden, zeigte sich nichts von jener muffigen Beamtenautorität, die sich manche Staatsdiener so gern zu eigen machen. Er wirkte wie ein Mann, der mit beiden Füßen fest im Leben steht. Nichts an seiner dezenten, tadellosen Kleidung deutete darauf hin, daß er über weniger Geschmack verfügen mochte als der elegante Hausherr.
Es war besonders diese Beobachtung, die Ashton Cabott verwirrte und irritierte. Er hatte gehofft, dem Kommissar schon durch die äußere Erscheinung um zwei Nasenlängen voraus zu sein. Damit war, wie er zugeben mußte, nichts zu machen.
„Behalten Sie doch Platz, Kommissar", sagte Ashton und hielt dem Besucher das geöffnete, goldene Zigarettenetui unter die Nase. „Rauchen Sie?"
Der Kommissar setzte sich und schüttelte lächelnd den Kopf.
„Nein, vielen Dank."
„Wie wär's mit einem Drink? Ich habe gestern von einem Onkel aus Amerika einen alten Bourbon bekommen..."
„Sehr freundlich. Aber im Dienst trinke ich nicht."
Ashton nahm dem Kommissar gegenüber Platz und legte ein Bein über das andere.
„Richtig, Sie sind im Dienst", meinte er lächelnd. „Das erinnert mich an meine Pflichten. Sie erwarten natürlich, daß mich Ihr Kommen zutiefst beeindruckt, nicht wahr? Ich habe Ihren Namen vorhin in den Zeitungen gelesen, und ich kann mir denken, warum Sie mich aufsuchen. Ich bin gern bereit, Ihnen all die Fragen zu beantworten, die Sie mir zu stellen wünschen, aber ich fürchte, ich werde Ihnen keine große Hilfe sein."
Ashton war innerlich nicht wenig stolz darauf, daß er so ruhig und überlegen zu sprechen vermochte. Nichts imponierte den Leuten von der Polizei mehr als eine so demonstrativ zur Schau getragene Pose des inneren Unbeteiligtseins.
„Sie haben sich vermutlich als letzter vor dem Diebstahl mit Miß Britton unterhalten."
„Wir verabschiedeten uns in der Hotelbar voneinander. Ich kann nicht mehr genau sagen, wie spät es war. Der Mixer wird Ihnen bestätigen, daß ich noch eine weitere halbe Stunde blieb und dann nach Hause fuhr. Ich ging sofort ins Bett."
„Gibt es Zeugen dafür?"
„Kommissar, ich muß doch sehr bitten! Was versuchen Sie mir zu unterstellen? Ich..."
Morry hob lächelnd eine Hand.
„Wir wollen uns nicht ereifern, Mister Cabott. Sie sind sicher alt und erfahren genug, um zu verstehen, daß ich nicht daran vorbei komme, gewisse Routineermittlungen zu erheben."
Ashton seufzte.
„Klar. Aber es ist doch recht peinlich, mit derlei Fragen, die ja doch nur schlecht verhüllte Verdächtigungen sind, in Berührung gebracht zu werden. Sie sind Polizist, Kommissar. Es mag eine Menge Dinge geben, die zum täglichen Rüstzeug Ihres Berufes gehören, Dinge, die Ihnen völlig normal und verständlich erscheinen mögen, die uns brave Bürger aber erschrecken. Wir sehen in der Polizei den zuverlässigen Bobby an der nächsten Straßenecke. Ein Besuch von Scotland Yard ist uns selbst dann zuwider, wenn man sich völlig unschuldig weiß. Ich vermute, daß da noch ein Stück Kindheit in uns nachwirkt, die oft beschworene Furcht vor dem schwarzen Mann...“
Der Kommissar lächelte flüchtig.
„Ich verstehe das sehr gut, Mister Cabott. Diese Regungen sind uns nichts Neues. Aber bei allem Verständnis für derlei Reaktionen können wir doch nicht umhin, die vorgeschriebenen Richtlinien zu beachten. Also: gibt es Zeugen für Ihr Nachhausekommen?"
„Nein", antwortete Ashton. „Harvey, der Butler, ist die einzige Person, die außer mir im Hause wohnt. Er schläft, wie er Ihnen gern versichern wird, außerordentlich fest. Sie können nicht erwarten, daß ich in jeder Nacht an sein Bett trete und mich zurück melde, nur um für alle Fälle und für alle Verbrechen, die sich in London ereignen, stets ein Alibi zu haben. Selbst wenn er mich kurz nach zwei Uhr gesehen und gehört haben sollte, wäre doch nicht von der Hand zu weisen, daß ich das Haus ohne sein Wissen erneut verlassen hätte, nicht wahr? Wie Sie sehen, wäre diese Art von Alibi eine höchst zweifelhafte Sache."
„Kehren wir zu der Unterhaltung zurück, die Sie mit Miß Britton geführt haben. Was fiel Ihnen an dem Gespräch und an Miß Britton besonders auf?“
„Am bemerkenswertesten war ohne Zweifel Miß Brittons Furcht. Sie fühlt sich seit Tagen bedroht, ohne genau angeben zu können, worin die Bedrohung eigentlich besteht. Sie ist überzeugt, beobachtet zu werden, hat aber nie jemand dabei zu ertappen vermocht. Ich vermute, sie hat Ihnen eine ganz ähnliche Erklärung gegeben?"
„So ist es. Haben Sie in der Bar eine Person bemerkt, die Miß Britton folgte?"
„Ich muß Ihnen gestehen, daß ich nicht darauf achtete. Ich wechselte noch ein paar Sätze mit dem Mixer..."
„Worüber sprachen Sie?" unterbrach der Kommissar.
„Ist das so wichtig?"
„Vielleicht."
Ashton hob die Schultern und ließ sie wieder fallen.
„Worüber sollen zwei Männer schon sprechen? Wir unterhielten uns natürlich über Miß Britton, ja, und über die Schwester."
„Seit wann kennen Sie Miß Constance?"
„Seit gestern Abend. Ich lernte sie auf einer Cocktailparty kennen, die die Burleys gaben. Später fuhr ich ins Carlton, ohne eine Ahnung zu haben, daß ich dort Miß Britton antreffen würde. Ich bin ein häufiger Besucher der kleinen Bar. Als überraschend Miß Britton auftauchte, war es bloß natürlich, daß ich ihr Gesellschaft leistete. Sie schien froh zu sein, einmal ihr Herz ausschütten zu können. Ich muß gestehen, daß ich die Schilderung ihrer Befürchtungen für übertrieben und überspannt hielt. Jetzt freilich, im Licht der nächtlichen Ereignisse, weiß ich, daß die junge Dame in der Tat einen erstaunlich guten Instinkt entwickelte und nur allzusehr im Recht war."
„Welcher Punkt der Unterhaltung blieb Ihnen am deutlichsten im Gedächtnis haften?"
Ashton dachte kurz nach. Dann sprach er: „Merkwürdigerweise schien sie von dem Mann, den sie noch nie gesehen hatte, eine ziemlich fest umrissene Vorstellung zu haben."
Morry nickte. Er erhob sich plötzlich.
„Vielen Dank", sagte er. „Das ist zunächst alles."
Ashton brachte den Besucher an die Tür.
„Ich stehe Ihnen selbstverständlich jederzeit gern zur Verfügung. Ich werde Miß Britton nachher anrufen oder aufsuchen, und mich bemühen, sie über den empfindlichen Verlust hinwegzutrösten."
Nachdem der Kommissar gegangen war, genehmigte sich Ashton Cabott einen doppelstöckigen Whisky. Er war zufrieden mit sich und der Art, wie er den berühmten Kommissar abgespeist hatte. Er hatte ihm genau die richtige Mischung von Hilfsbereitschaft und Polizeifurcht vorgegaukelt, die man von einem ehrsamen Bürger im allgemeinen erwarten darf.
Aber weder der Kommissar noch die Polizei bildeten sein eigentliches Problem. Sie waren ihm noch niemals hinderlich gewesen; er hatte seine ,Arbeit' stets so aufgebaut, daß Scotland Yard in keinem Fall Ursache gehabt hatte, sich einzuschalten.
Er grinste zufrieden, als er einen tüchtigen Schluck aus dem Glas nahm und den herb-rauchigen Geschmack auf der Zunge spürte. Gefahr bedeutete Leben, und solange man tüchtig genug war, sie zu meistern, war das Leben erregend und schön! Ja, er hatte es auf seine Weise weit gebracht, und er hatte nicht die Absicht, sich von einem Mann, der sich großspurig ,Meister' nannte, in der weiteren Entwicklung bremsen zu lassen.
Er rief Harvey herein und beauftragte ihn, sofort in die Stadt zu fahren und ein paar Angelköder aus einem ziemlich weit entfernten Sportartikelgeschäft zu besorgen. Harvey notierte sich die Wünsche seines Herrn und verschwand. Ashton war allein und zufrieden. Er hielt es für besser, die bevorstehende Unterhaltung mit dem Fremden ohne zufällige Zeugen zu führen.
Pünktlich um drei Uhr klingelte das Telefon. Ashton Cabott meldete sich mit gemacht kühler, überlegener Stimme.
„Hier spricht der Meister", drang die Stimme des Unbekannten sehr klar und deutlich an sein Ohr. Es gab kaum einen Zweifel, daß der Unbekannte einen Privatapparat benutzte; vielleicht sprach er auch aus der schalldicht isolierten Zelle eines Hotels. Die üblichen Zwischen- und Nebengeräusche, die bei Gesprächen auftreten, die aus öffentlichen Fernsprechzellen geführt werden, fehlten ganz.
„Ich habe Ihren Anruf mit beträchtlicher Neugier erwartet", sagte Ashton Cabott, der wohl wußte, daß es jetzt darauf ankam, zu bluffen und zu improvisieren.
„Das kann ich mir denken. Wie gefiel Ihnen die Aufnahme, die ich Ihnen ins Haus sandte?"
„Ich fand sie recht eindrucksvoll, obwohl ich bezweifle, daß man vor Gericht damit viel beginnen kann. Das Bild beweist, daß es nicht nur einen Fotografierten, sondern auch einen Fotografierenden gab."
„Das hat wenig zu bedeuten", meinte der Sprecher ruhig. „Es würde Ihnen schon das Genick brechen, wenn bekannt würde, daß Sie das Hotelzimmer des Mädchens in der Einbruchsnacht aufgesucht haben. Ist Ihnen aufgefallen, daß es sich bei der Uhr auf dem Nachtschränkchen um einen Datumwecker handelt?"
„Das ist mir nicht entgangen."
„Ein Regisseur hätte das Bild nicht besser zusammenstellen können", meinte der Unbekannte stolz. „Sie werden verstehen, daß ich mit meiner Arbeit sehr zufrieden bin und die Überzeugung vertrete, dafür entsprechende Bezahlung fordern zu können."
„Das haben Sie bereits heute morgen getan."
„In der Tat. Ich habe meine Wünsche dahingehend präzisiert, daß ich fünfzigtausend Pfund in bar von Ihnen wünsche. Es liegt in meiner Absicht, diesem Wunsch ein sehr wichtiges Detail hinzuzufügen. Was würden Sie davon halten, wenn ich darauf bestehe, daß Sie mir morgen früh pünktlich um zehn Uhr eine Vorauszahlung in Höhe von fünfundzwanzigtausend Pfund zukommen lassen?“
Ashton merkte, daß sein Herzschlag stockte. „Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst?"
„Lassen Sie uns eines klarstellen", informierte ihn die metallisch klingende Stimme des Unbekannten. „Ich bin niemals zum Scherzen aufgelegt. Ich stelle lediglich bestimmte Forderungen, auf deren peinlich genaue Erfüllung ich bestehen muß. Falls Sie glauben sollten, ihnen ausweichen zu können, sorge ich dafür, daß Sie im Zuchthaus landen und für immer der gesellschaftlichen Ächtung ausgesetzt werden."
„Moment, bitte. Ich bin in der Lage, nachzuweisen, daß Sie mich zu erpressen versuchen. Es wird Sie interessieren, daß unser Gespräch von einem Bandgerät mitgeschnitten wird. Zusammen mit dem Foto und dem abgestempelten Büttenumschlag wird es als Beweismaterial dienen, daß nicht ich den Schmuck gestohlen habe, sondern daß Sie der Haupttäter sind."
Der Unbekannte räusperte sich. Dann sagte er: „Seien Sie nicht kindisch. Selbst wenn ich den Schmuck gestohlen haben sollte, bildet das Foto einen klaren Beweis, daß ich lediglich zu spät gekommen sind. Ein Raubversuch ist bereits strafbar, das brauche ich Ihnen nicht näher zu erläutern. Im übrigen geht es hier nicht um die Schuldfrage in einem Schmuckdiebstahl. Ich bin völlig anonym . . . von Ihnen aber wüßte bald die ganze Presse, daß Sie nicht der vornehme Ashton Cabott, sondern ein ganz gewöhnlicher kleiner Schurke sind. Von dem Foto lassen sich beliebig viele Abzüge herstellen. Ich kann sie an alle Nachrichtenagenturen geben. Wie denken Sie darüber? Es wäre ohne Zweifel die Sensation des Jahres!"
Ashton schluckte. Die bloße Vorstellung war in der Tat entsetzlich. „Ich bin sicher, daß wir uns einigen können", sagte er hastig.
„Dieser Meinung bin ich auch. Fünfzigtausend Pfund scheinen mir eine vernünftige Einigungsgrundlage zu bilden."
„Wollen Sie mich ruinieren?"
„Machen Sie sich nicht lächerlich! Haben Sie jemals an die persönliche Wohlfahrt Ihrer Opfer gedacht! Na also! Kommen wir zur Sache. Die Banken öffnen um neun Uhr. Zehn Minuten nach neun werden Sie vor Ihrer Bank erscheinen. Kurbeln Sie das Fenster auf der Lenkradseite nach unten. Gehen Sie dann mit einem kleinen Lederköfferchen von der Art, wie sie Anwälte benutzen, ins Innere der Bank und heben Sie zwanzigtausend Pfund in kleinen und mittleren Noten ab. Packen Sie das Geld in den Koffer und kehren Sie zu Ihrem Wagen zurück. Sie werden auf dem Vordersitz einen Zettel finden. Der Zettel enthält einen Streckenplan, der über mehrere Meilen in einen bestimmten Außenbezirk führt. Halten Sie sich beim Fahren genau an diesen Streckenplan! Stellen Sie vor allem das Autoradio an. Achten Sie besonders auf laute Störgeräusche . . . sobald Sie das internationale Seenotzeichen zweimal kurz hintereinander hören, werfen Sie den Koffer aus dem Fenster. Sie kennen das Zeichen, nehme ich an?"
„Ich war im Krieg bei der Navy."
„Ich weiß", sagte die Stimme des Unbekannten mit leiser Verächtlichkeit, „als Zahlmeister! Dort fingen Sie an, sich an fremden Geldern zu bereichern. Aber das soll uns jetzt nicht interessieren. Sie werfen also, nachdem Sie das Zeichen gehört haben, den Koffer aus dem Fenster. Sobald das geschehen ist, fahren Sie mit erhöhter Geschwindigkeit weiter. Verstanden?"
„Ich bin nicht so schwer von Begriff, wie Sie zu glauben scheinen.“
„Es ist wichtig, daß kein Detail außer acht gelassen wird. Es ist vor allem wichtig, daß der Streckenplan ohne die kleinste Abweichung eingehalten wird. Ich darf Sie ersuchen, auf Tricks und Bluffs verzichten zu wollen. So etwas würde nur dazu führen, daß sofort die Fotos an die Nachrichtenagenturen gehen . . . mit einem entsprechenden Begleittext natürlich!"
„Können wir uns vorher treffen? Ich brauche eine Garantie, daß Sie nicht fortfahren werden, die Forderungen ins Uferlose zu treiben! Zwanzigtausend Pfund sind kein Pappenstiel. Ich habe Jahre gebraucht, um das Geld zu verdienen und bin verständlicherweise nicht von der Idee entzückt, es gleichsam über Nacht wieder loszuwerden. Ich wünsche eine bindende, schriftlich abgesicherte Zusage, daß es bei den fünfzigtausend Pfund bleiben wird!"
„Es bleibt dabei. Mehr kann und mehr will ich Ihnen nicht versprechen. Ich habe Sie mit den Bedingungen vertraut gemacht und erwarte, daß Sie sich daran halten. Auf Wiederhören!"
*
„Sind Sie ein Detektiv?" fragte die elegante junge Dame, die er in Miß Constances Zimmer antraf.
Sie war nur ein wenig größer als Constance und ebenso schlank. In ihrem klaren, harmonischen Gesicht wohnte ein leiser Hochmut, der ihn innerlich frösteln ließ. Es gab keinen Zweifel, daß es sich bei der jungen Dame um Britta Britton handelte; sie stand in der Nähe der offenen Balkontür und hielt ein dickes Buch in der Hand, aus dem verschiedene Lesezeichen ragten. Ashton zog die Tür hinter sich ins Schloß und lächelte.
„Nein", sagte er und verbeugte sich. „Mein Name ist Ashton Cabott. Ich habe mir erlaubt, mein Kommen telefonisch anzumelden, und hoffte, Miß Constance Britton in diesem Zimmer anzutreffen. Sie ist doch zu sprechen, nehme ich an?“
Das Gesicht des Mädchens entspannte sich. Sie ging auf ihn zu und reichte ihm eine schmale kühle Hand.
„Constance sagte mir, daß Sie kommen würden. Entschuldigen Sie meine törichte Frage. Aber den ganzen Nachmittag hindurch geben sich Polizei- und Presseleute einander die Türklinke in die Hand." Sie schob ihm einen Armlehnstuhl der Sitzgruppe zurecht. „Wollen Sie nicht Platz nehmen? Meine Schwester wird in wenigen Minuten zurück sein. Sie ist auf einen Sprung zum Hotelfriseur gegangen."
Britta Britton nahm auf der Sitzbank Platz. Ashton Cabott setzte sich gleichfalls. Er hatte inzwischen genügend Zeit gehabt, Vergleiche zwischen den beiden Schwestern anzustellen, und er mußte einräumen, daß diese Vergleiche durchaus zum Vorteil der jüngeren Constance ausfielen. Britta erschien zwar damenhafter und distinguierter, aber auch kühler und weniger anmutig als Constance.
Britta Britton trug ein hellblaues Jersey Jumperkleid, das einen lebhaften Kontrast zum leuchtenden Kastanienbraun des Haares bildete. Alles in allem wirkte sie keineswegs wie ein Mädchen, das einem archäologischen Hobby nachgeht. Sie hielt das dicke Buch mit ihren schlanken Fingern umschlossen und betrachtete ihn aufmerksam.
„Meine Schwester hat mir von Ihnen erzählt", erklärte sie mit ihrer etwas hochmütigen, aber durchaus fesselnden Stimme. „Wie ich höre, waren Sie gestern Abend mit ihr zusammen."
„Wir wurden einander bei den Burleys vorgestellt und trafen uns später zufällig in der Bar des Hotels."
Britta nickte. „Ja, das erwähnte Constance. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht zu ahnen, welche Aufregungen uns erwarteten."
„Ich bedaure den Verlust, der Sie und Ihr Fräulein Schwester betroffen hat, aufs tiefste."
Britta lächelte ein wenig. „Vielen Dank für die liebenswürdige Anteilnahme — aber ich fürchte, es ist eine reine Gefühlsverschwendung. Man macht einfach zuviel Aufhebens davon. Die Versicherung hat eine hohe Belohnung für die Ergreifung des Täters ausgesetzt. Ich bin sicher, daß man ihn schon bald stellen wird."
„Diese Aussicht besteht nur dann, wenn der Täter Mitwisser hat."
„Es wird Hehler geben, denen er den Schmuck anzubieten versucht. Diese Hehler werden sich überlegen, ob es nicht ratsamer ist, die Belohnung zu kassieren, als sich durch einen Weiterverkauf der Strafverfolgung auszusetzen."
„Hehler sind es gewohnt, dieses Risiko auf sich zu nehmen. Man darf nicht übersehen, daß es das Ende ihres kriminellen Berufes wäre, wenn sie einen ,Kunden' der Polizei preisgeben würden. Es gibt auch in diesem Kreis eine etwas verschrobene Auffassung von Ehre, und jeder, der sie mißachtet, muß mit der völligen Isolierung, wenn nicht mit Schlimmerem rechnen."
Britta zuckte mit den schmalen Schultern.
„Ach, wenn schon! Die Versicherung wird auf alle Fälle zahlen, das wurde uns bereits fest zugesagt. Warum also die ganze Aufregung? Was ist schon Schmuck? Ich selbst habe nicht viel besessen, und ich bin keineswegs sicher, daß ich den gesamten Versicherungsbetrag für eine Neubeschaffung verwenden werde."
Ashton, der sich bei aller Verbindlichkeit jenes männlichen sicheren Tones befleißigte, der bei den meisten Damen gut ankommt, war überzeugt, daß es nicht leicht sein würde, die Zuneigung und Sympathie von Britta Britton zu gewinnen. Er spürte ihre innere Reserve, die zweifelsohne nicht nur ihm, sondern allen Menschen galt. Es wird ein schweres Stück Arbeit sein, sie auf meine Seite zu ziehen, überlegte er. Schwer, aber nicht unmöglich.
„Die Polizei war heute auch bei mir", sagte er. „Ein gewisser Kommissar Morry. Ich war überrascht, ihn bei mir anzutreffen. Ich muß zugeben, daß er sich sehr korrekt und zivilisiert benahm. Er stellte nur ein paar Routinefragen und verließ nach wenigen Minuten das Haus."
Britta lächelte mit leichtem Spott. „Warum sollte sich die Polizei nicht zivilisiert benehmen?" fragte sie. „Ich muß gestehen, daß der von Ihnen erwähnte Kommissar Morry auf mich einen ungemein starken Eindruck hinterlassen hat. Er ist ohne Zweifel ein sehr gebildeter und gewandter Mann. Verblüffenderweise wußte er sogar über mein Fachgebiet Bescheid, und zwar viel besser, als manche meiner pseudowissenschaftlichen Kollegen. In der Tat, ein erstaunlicher Mann!"
Die Zimmertür öffnete sich und Constance kam hereingewirbelt. Sie sah jung und frisch aus. Das Lächeln, mit dem sie Ashton, der sich erhoben hatte, begrüßte, war von strahlender Liebenswürdigkeit. Nichts in ihren frohen, entspannten Zügen deutete darauf hin, daß sie den Verlust ihres Schmuckes als bedrückend oder gar schmerzlich empfand.
„Nett, daß Sie mal hereinschauen!" sagte sie burschikos und drückte ihm die Hand. „Aber warum so ernst? Es ist nichts geschehen, das zur Trauer Anlaß gäbe!"
Ashton seufzte erleichtert. „Ich bin wirklich froh, daß Sie es so auffassen!"
„Behalten Sie doch bitte Platz. Darf ich Ihnen einen Drink anbieten?! Möchten Sie einen Whisky . . . oder sind Sie so stockenglisch, daß Sie um diese Tageszeit auf Ihren Tee bestehen?"
„Ich fürchte, ich bin tatsächlich stockenglisch. Gegen eine Tasse Tee hätte ich nichts einzuwenden."
„Trinkst du mit uns?" fragte Constance und blickte die Schwester an.
Britta erhob sich und ging zur Verbindungstür. „Tut mir leid, Constance. Du weißt, daß ich die Sitte des Teetrinkens sehr schön finde, aber für dieses Mal muß ich darauf verzichten. Ich bin mit Sir Macolm verabredet."
„Du lieber Himmel!" sagte Constance.
„Schon wieder? Er ist doch ein gräßlich langweiliger Kerl!"
Britta lächelte nachsichtig. „Du findest ihn langweilig, weil er fast immer nur von archäologischen Dingen spricht. Schließlich ist er einer der Direktoren des Britischen Museums. Er verfügt über eine profunde Sachkenntnis und es ist wahnsinnig interessant, ihm zuzuhören."
„Hast du bei ihm jemals das Gefühl, eine Frau zu sein?" fragte Constance.
Britta errötete leicht. „Aber Conny! Darauf kommt es doch wirklich nicht an. Ich verkehre nicht mit ihm, um mir schale Komplimente anzuhören, sondern um mit ihm zu fachsimpeln."
„Na, dann viel Vergnügen!"
Nachdem Britta das Zimmer verlassen hatte, klingelte Constance nach dem Etagenkellner und bestellte den Tee. Sie befand sich nach wie vor in einer recht aufgeräumten Stimmung, die, wie es Ashton schien, durchaus nicht zu den Ereignissen der vergangenen Nacht passen wollte.
Anscheinend erriet sie, was er dachte, denn sie sagte: „Gewiß wundem Sie sich über meine blendende Laune. Sie hat ihren guten Grund. Nichts ist so häßlich und depremierend als das Gefühl der Furcht. Mit dem Verlust des Schmuckes ist auch dieses Empfinden geschwunden. Ich bin überzeugt, daß ich jetzt endlich vor dem Unheimlichen Ruhe haben werde."
„Wie schade!" spöttelte Ashton Cabott galant. „Ich hatte zu hoffen gewagt, daß auch meine Gegenwart ein klein wenig zur Hebung Ihrer Laune beigetragen hätte."
„Das hat sie auch", gab Constance unbekümmert zurück. „Schließlich gibt sie mir Gelegenheit, mit einem guten Freund eine Tasse englischen Tees zu trinken."
Es läuft wunderbar, registrierte Ashton zufrieden. Das Mädchen beißt an. Ich müßte mich schon sehr täuschen, wenn ich das Glänzen in ihren hellen Augen und die lebhafte Röte auf den Wangen nicht richtig bewerte. Sie ist drauf und dran, ihr Herz an Ashton Cabott zu verlieren!
Wenn sie wüßte, wer ihr gegenüber sitzt, und wenn sie ahnte, daß ich ihr in dieser Nacht einen Besuch abstattete, wäre sie kaum bereit, in dieser Weise zu reagieren. Aber zum Glück wird sie nie erfahren, wer ich in Wahrheit bin und was ich bezwecke.
„Ich erklärte vorhin Ihrer Schwester, daß ich heute ebenfalls Polizeibesuch hatte", sagte er.
„Wirklich?" fragte Constance erstaunt. „Was wollte man denn von Ihnen?"
„Ich war der letzte Mann, der vor dem Einbruch mit Ihnen gesprochen hat."
„Wie töricht! Deshalb kam man zu Ihnen?"
„Der Kommissar schien zu hoffen, daß ich irgendeinen Verdächtigen bemerkt hätte, der Ihnen folgte."
Constance winkte ab. „Lassen wir das unersprießliche Thema beiseite. Soviel ich gehört habe, wird die Versicherung den Schaden decken. Vermutlich wird die Polizei früher oder später den Täter stellen . . . aber bis dahin werden Britta und ich längst wieder in Amerika sein."
Ashton seufzte und blickte dem jungen Mädchen in die Augen. „Ich hoffe, Sie mißverstehen mich nicht, wenn ich jetzt erkläre, daß mich der Gedanke Ihrer Abreise sehr bedrückt."
Constance lachte. „Mr. Cabott! Sie werden sich doch nicht aufs Komplimente machen verlegen wollen? Ich habe bei meinen Stadtspaziergängen immer wieder festzustellen vermocht, wie viele hübsche junge Mädchen es in London gibt. Da sollte Ihnen die Abreise zweier Amerikanerinnen wirklich gleichgültig sein!"
„Ich dachte dabei nicht an zwei Personen . . . sondern nur an eine", erwiderte er.
Es klopfte. Der Zimmerkellner schob den Wagen herein, auf dem für zwei Personen gedeckt war. Nachdem er sich zurückgezogen hatte, nippte Constance an ihrem Tee und sagte dann ruhig: „Sie waren mir von Anbeginn sympathisch. Ich würde es bedauern, wenn dieses Empfinden durch falsche Töne Schaden erlitte. Ich bin keineswegs eine Gegnerin von Artigkeiten und Komplimenten . . . aber ich kann solche Dinge nach wenigen Stunden Bekanntschaft einfach nicht ernst nehmen."
Verdammt, dachte Ashton, ich bin zu rasch vorgeprellt.
Er lächelte. „Es ist mein Fehler, daß mir das Herz zuweilen auf der Zunge liegt. Ich gelobe Besserung!"
In diesem Moment klingelte das Telefon. Constance erhob sich und trat an den Apparat. Er beobachtete sie und sah, daß sie blaß wurde. Einen Moment hatte es den Anschein, als wolle sie zu Boden sinken. Dann hatte sie sich wieder fest in der Gewalt. Sie legte den Hörer auf die Gabel zurück und blickte Ashton aus großen, schreckensstarren Augen an.
„Das war er", flüsterte sie.
Ashton stand auf. „Er?"
Constance nickte. „Ja. Er . . . der Unheimliche!"
Ashton trat zu ihr. In ihrem Blick flatterte die Furcht.
„Ich hatte gehofft, daß nach dem Schmuckdiebstahl alles vorbei sein würde . . . und nun beginnt die Tortur von neuem. Ich werde abreisen. Noch heute reise ich ab!"
„Was ist geschehen? Was hat er gesagt?"
„Er fordert fünfzigtausend Pfund . . . oder mein Leben!"
„Das ist doch nicht ernst zu nehmen! Ich wette, irgendein Ganove hat durch den Schmuckdiebstahl von Ihrem Reichtum erfahren und versucht daraus auf seine Weise Profit zu schlagen."
Constance ging zurück zu ihrem Stuhl. Sie setzte sich. „Ich nehme es aber ernst", sagte sie und blickte durch die offene Balkontür ins Freie. „Sie würden nicht anders denken und handeln, wenn Sie die Stimme gehört hätten."
„Können Sie die Stimme beschreiben?"
„Das ist nicht schwer. Sie ist ungewöhnlich kühl und distanziert, vielleicht ein wenig metallisch . . . wie bei einem Roboter, bei einem Wesen ohne Herz und Seele."
Er ist es! schoß es Ashton durch den Sinn. Jetzt greift er sogar nach Constances Leben! Das darf nicht sein.
Constance gab sich einen Ruck. „Ich muß sofort den Kommissar anrufen", sagte sie.
„Das wird ohne Zweifel das klügste sein", meinte Ashton.
Constance telefonierte mit Scotland Yard. Da der Kommissar nicht zu erreichen war, berichtete sie einem Hilfskommissar namens May, was sich ereignet hatte. Nachdem sie eine Reihe detaillierter Fragen beantwortet hatte, nahm sie wieder Platz.
Ashton fragte: „Werden Sie jetzt meine Hilfe annehmen?"
Sie musterte ihn erstaunt. „Ihre Hilfe?"
Er nickte. „Ich möchte Sie beschützen. Ich möchte etwas tun, um sicherzustellen, daß Ihnen nichts geschieht. Es quält mich, mit Ihnen nur Tee trinken zu dürfen. Ich möchte aktiv in das Geschehen eingreifen. Natürlich bin ich kein Polizist und mir ist völlig klar, daß mir alle Hilfsmittel und Voraussetzungen zur Verbrecherjagd fehlen. Aber ich bin so gut wie jeder andere in der Lage, eine Situation zu analysieren. Ich kann keine anderen Fragen an Sie richten, als die, die die Polizei bereits gestellt haben dürfte. Aber es gibt da einen Punkt, der mich besonders interessiert. Er bezieht sich auf die gestrige Äußerung von Ihnen, derzufolge Sie überzeugt sind, den Unheimlichen sofort zu erkennen, wenn Sie ihn sehen. Worauf beruht diese Annahme?"
Constance zögerte mit der Antwort. Dann sagte sie: „Es liegt im Wesen der menschlichen Natur, daß wir uns alle Dinge plastisch vorstellen, Sobald wir an einen Schurken denken, oder im Radio eine Stimme hören, versuchen wir uns ein Bild des Betreffenden zu formen. Es ist durchaus möglich, daß diese jeweiligen Vorstellungen keine Beziehung zur Wirklichkeit haben; das hält uns nicht davon ab, nach immer neuer Nahrung für die Gestaltungskraft unserer Phantasie zu suchen."
„Gut. Wie also ist das Bild beschaffen, das Sie sich von dem Unheimlichen gemacht haben?"
„Ich denke, daß er ein schwerer, massiger Mann mit einem kurzen, gedrungenen Nacken und einer niedrigen, zurückfliehenden Stirn ist. Er hat schwere, auffallend weiche, teigige Hände von großer Blässe. Er lächelt nie. Er lacht nie. Seine Augen sind dunkel und undurchdringlich wie die Keller eines verlassenen Hauses. Es ist etwas Animalisches an ihm, etwas Unwägbares, Düsteres, eine Mischung von Raubtier im allgemeinen und Katze im be- sondern. Ich stelle mir vor, daß er stets leicht gebückt geht . . . wie jemand, der sich auf einen plötzlichen Sprung, auf einen Angriff oder auf eine Abwehr vorbereitet."
„Hm", machte Ashton. „Dieser Typ, den man gewiß unter Tausenden erkennen würde, erinnert mich ein wenig an die Schurken bestimmter amerikanischer Gruselfilme. Sind Sie sicher, daß Sie sich von diesen Schablonen nicht beeinflussen ließen?"
„Ich kann nicht sagen, welche Einflüsse bei dem von mir geschilderten Bild bestimmend wirkten. Ich weiß nur, daß ich ihn mir so vorstelle."
„Was hat er eben am Telefon gesagt? Wörtlich, meine ich."
„Er sagte: .Hier spricht der Besitzer des Schmuckes. Ich benötige von Ihnen fünfzigtausend Pfund in bar. Bereiten Sie die Auszahlung in kleinen Noten vor. Weitere Nachrichten folgen. Falls Sie sich weigern sollten, die Summe zu bezahlen, müssen Sie sterben."
„Klingt ziemlich wild, was? Ich nehme an, daß die Polizei nach diesem Vorfall die Telefonleitung dieses Zimmers überwachen und abhören wird. Wahrscheinlich wird es gar nicht so schwer sein, auf diese Weise den Anrufer zu ermitteln."
„Mir ist es ziemlich egal, was die Polizei tut. Ich reise mit Britta zurück in die Staaten! Meine Schwester wird mich möglicherweise auslachen . . . aber ich habe jetzt einfach die Nase voll!"
Ashton spürte das heftige Klopfen seines Herzens. Nein, sie durfte London jetzt nicht verlassen! Mit ihr würde seine größte Chance über den Ozean verschwinden!
„Ich muß sagen, daß ich eine Flucht für übertrieben halte", meinte er. „Wollen Sie sich wirklich von einem kleinen Schurken ins Bockshorn jagen lassen? Ich finde, das ist Ihrer einfach nicht würdig. Die Polizei dieses Landes ist bekannt tüchtig. Sie wird nicht erlauben, daß man Ihnen auch nur ein Härchen krümmt."
„Sie konnte nicht verhindern, daß der Fremde in dieses Zimmer eindrang und den Schmuck an sich nahm."
„Ich bedaure sagen zu müssen, daß Sie daran nicht ganz schuldlos sind. Das Zimmer war nicht abgeschlossen. Der Schmuck lag leicht erreichbar auf dem Nachtschränkchen...“
„Woher wissen Sie, daß das Zimmer nicht abgeschlossen war?" unterbrach sie ihn erstaunt.
„Es stand in der Zeitung."
Seine Antwort kam so rasch und sicher, daß Constance die Lüge gar nicht bemerkte.
Ashton verfluchte innerlich sein Ungeschick. Er mußte vorsichtiger sein! Constance war nicht dumm; wenn er seine Rolle nicht mit größter Umsicht spielte, konnte er leicht in kaum vorstellbare Schwierigkeiten geraten.
„Ja, es ist teils meine Schuld", gab das Mädchen zu. „Ich verspreche Ihnen, in Zukunft vorsichtiger zu sein."
„Sie bleiben also?"
„Ich weiß es noch nicht. Ich werde mit meiner Schwester darüber sprechen. Sie soll entscheiden."
Er kletterte aus dem Wagen, nachdem er vorher das Seitenfenster herabgekurbelt hatte. Einen Moment stand er wie unentschlossen neben dem Wagen und blickte interessiert um sich. Es herrschte der gewöhnliche Morgentrubel; er sah die dunkel gekleideten Männer mit ihren Regenschirmen und Bowlerhüten auf dem Wege in die Büros der City. Er sah die grau-schwarze Menschenmenge, die ameisenhaft einem bestimmten Ziel zustrebte, und er sah hier und da ein einzelnes Gesicht, das sich durch Schnitt und Einprägsamkeit aus der Masse hervor hob. Aber er sah nirgendwo
einen Mann, der der Beschreibung entsprochen hätte, die Constance von dem Unheimlichen gegeben hatte. Ashton warf einen Blick auf das Zifferblatt seiner Armbanduhr. Zehn Minuten nach neun. Der Fremde hatte eine generalstäblerisch präzise Einhaltung seiner Weisungen verlangt, und Ashton hatte Ursache, sie im Moment strikt zu befolgen. Er war sogar bereit, sich von den zwanzigtausend Pfund zu trennen, weil er glaubte, daß es im Augenblick nur auf einen Zeitgewinn ankam. Binnen einer Woche hoffte er den notwendigen Anhaltspunkt zur Rückgewinnung des Geldes gefunden zu haben.
Etwas steif näherte er sich dem Bankeingang. In der Rechten trug er das reichlich abgewetzte Lederköfferchen, dessen Benutzung der Fremde zur Bedingung gemacht hatte. Es war leicht und leer. In zehn Minuten würde es bis zum Rand prall mit Pfundnoten gefüllt sein. Ashton Cabott unterdrückte auf der obersten Stufe des Bankeinganges mannhaft das Verlangen, sich umzuwenden. Es war kaum anzunehmen, daß der Fremde ausgerechnet jetzt den Streckenplan ins Innere des Wagens werfen würde. Wahrscheinlich hatte er irgendeinen Straßenjungen damit beauftragt, den Zettel in den Wagen zu legen.
In der Bank war Ashton keineswegs überrascht, festzustellen, daß sich der Kasierer über die ungewöhnlich hohe Auszahlungsanweisung schockiert zeigte. Mr. Cumber, der Leiter der Bank, eilte höchstpersönlich aus seinem dunklen Office, um ein paar Worte mit seinem guten Kunden Ashton Cabott zu wechseln.
„Mißverstehen Sie uns bitte nicht", sagte er, „aber im Zeitalter des bargeldlosen Zahlungsverkehrs ist es mehr als ungewöhnlich, daß ein Klient die Auszahlung einer hohen Summe in kleinen und mittleren Banknoten fordert. Erfahrungsgemäß wissen wir, daß es sich dabei nicht selten um Kunden handelt, die durch . . . eh . . . Erpresser in eine höchst unangenehme Situation gebracht wurden. In diesen Fällen raten wir den Kunden stets, zur Polizei zu gehen. Es hat keinen Zweck, einem Erpresser zu vertrauen. Diese Burschen sind unersättlich. Wünschen Sie, daß wir
Ihnen mit der erforderlichen Diskretion unseren Hausdetektiv zur Verfügung stellen? Oder sollen wir die Polizei..."
„Vielen Dank", unterbrach Ashton kühl. „Sie sollen mir nur die gewünschte Summe auszahlen, weiter nichts."
Mr. Cumber verbeugte sich. „Selbstverständlich, Sir. Ich hielt es nur für meine Pflicht, ein paar allgemein gehaltene Worte zu äußern."
Zehn Minuten später stand Ashton wieder im Freien. Es war ein klarer, wolkenloser Tag, der nahezu vollkommen gewesen wäre, wenn nicht ein heftiger Wind geblasen hätte. Ashton ging zu seinem Wagen und stieg ein. Das Köfferchen legte er neben sich. An dem Haltegriff des Armaturenbrettes steckte ein weißer Umschlag. Ashton nahm ihn in die Hand. Das Kuvert war offen und enthielt einen zusammengelegten Papierbogen. Auf dem Bogen befand sich eine sorgfältig angefertigte Streckenskizze; sie führte quer durch die Innenstadt und einige Außenbezirke nach Purley. Die Tiefe der mit Tinte nachgezogenen Linienrillen ließ vermuten, daß man die Zeichnung mit Hilfe eines Bogen Blaupapieres von einem Stadtplan abgepaust hatte. Ashton prägte sich die Strecke genau ein; er legte den Bogen neben sich auf das Köfferchen, stellte das Radio an, und fuhr los.
Er behielt im Rückspiegel die ihm folgenden Wagen im Auge, ohne sagen zu können, ob das Fahrzeug des Unheimlichen darunter war. Er bezweifelte jedoch, daß er von dem Fremden schon jetzt verfolgt wurde. Wahrscheinlich wartete sein Gegner in irgendeiner kleinen, unbelebten Seitenstraße der Außenbe- bezirke auf sein Erscheinen, bereit, mittels eines elektrischen Gerätes die abgesprochenen Störimpulse im SOS-Rhythmus zu senden.
Zum ersten Mal in seinem Leben bedauerte Ashton, nicht die Dienste eines Komplicen in Anspruch nehmen zu können. Ein Helfer wäre gerade jetzt von unschätzbarem Wert gewesen. Aber leider kannte er niemand, der sich für diese diffizile Aufgabe eignete, und im übrigen fürchtete er noch immer das Risiko, das sich mit jeder Mitwisserschaft verbindet.
Er fuhr in normaler Geschwindigkeit durch die City und merkte, daß er allmählich in einen schläfrigen Zustand geriet. Die latente Spannung, die ihn erfüllte, wirkte sich so aus, daß er von einem Empfinden lauer Zerschlagenheit befallen wurde. Wenig später erreichte er die ersten Außenbezirke; der Verkehr war noch immer recht lebhaft, aber es fiel ihm schon leichter, die ihm folgenden Wagen im Auge zu behalten. Er bemerkte sehr bald, daß ihm ein Bentley älterer Bauart unablässig auf den Fersen blieb. Zufall? Vielleicht! Aber als der Bentley auch dann nicht verschwand, als die Straßen immer stiller und einsamer wurden, glaubte Ashton zu wissen, daß das Fahrzeug von dem (Unheimlichen' gesteuert wurde. Der Abstand zwischen den beiden Wagen war freilich zu groß, um den Fahrer des Bentley erkennen zu können.
Ashton prägte sich die Nummer des Verfolgerwagens ein, obwohl er wenig Hoffnung hatte, daß ihm das weiterhelfen würde. Sehr wahrscheinlich war der Bentley eigens zu diesem Zweck gestohlen worden. Ashton, der jetzt durch fast menschenleere Straßen rollte, rechnete jede Sekunde damit, das abgesprochene Störungszeichen zu vernehmen. Aber außer einigen Knackgeräuschen, die das Musikprogramm gelegentlich übertönten, hörte er nichts.
Eine halbe Stunde später hatte er Purley, und damit das Ende des Streckenplanes erreicht. Er bremste und sah im Rückblickspiegel, daß der Bentley etwa hundert Meter hinter ihm an den Rand des Bürgersteigs rollte und anhielt. Ashton holte eine Zigarette hervor. Er setzte sie in Brand und rauchte dann in langen, nervösen Zügen. Was sollte jetzt geschehen? War es dem Unbekannten nur darum gegangen, ihn auf die Probe zu stellen? Oder hatte er, Ashton, das Signal überhört? Nein, das war unmöglich. War etwas dazwischen gekommen? Oder hatte den Unheimlichen plötzlich der Mut verlassen, weil er annahm, beobachtet zu werden?
Ashton fand keine Antwort auf diese Fragen. Er rauchte die Zigarette zu Ende und setzte den Wagen zurück, um zu wenden. Der Bentley führte das gleiche Manöver aus und verschwand in einer Seitenstraße. Aber später, als Ashton nach Hause fuhr, entdeckte er den Bentley wiederum hinter sich. Erst in der Nähe seines Hauses verlor er ihn aus den Augen. Ashton betrat wenig später mit dem Geldkoffer sein Haus.
Der Butler empfing ihn in der Diele.
„Ist ein Anruf für mich gekommen?" wollte Ashton wissen.
„Nein, Sir."
Ashton ging in sein Arbeitszimmer. Dort nahm er das Geld aus dem Koffer und verschloß es im Wandsafe. Dann füllte er sich ein Glas mit Eis und Whisky und nahm Platz. Er hatte einen faden Geschmack im Mund, den auch der Whisky nicht zu beseitigen vermochte, und er dachte voller Furcht und Unbehagen an den Fremden, dem er auf Gedeih und Verderb ausgeliefert war.
Als das Telefon schrillte, stolperte Ashton so überhastet an den Apparat, daß er sich den Inhalt des Whiskyglases über die Hosen schüttete. Er riß den Hörer ans Ohr und meldete sich.
Am anderen Ende der Leitung blieb alles ruhig.
„Hallo!" rief Ashton. „Hallo..."
„Schicken Sie den Butler weg!" befahl die metallische Stimme des Unbekannten nach kurzer Pause. „Schicken Sie ihn weg und vergessen Sie keine Sekunde, daß Ihr Haus überwacht wird!"
Bluff, dachte Ashton. Trotzdem verspürte er ein Gefühl der Erleichterung. Die Fotos waren also noch nicht an die Presse gegangen; der .Unheimliche' hatte es lediglich für gut befunden, ihn gründlich zu prüfen.
„In Ordnung", sagte Ashton. „Aber..."
Es klickte. Das Gespräch war unterbrochen. Ashton legte den Hörer auf die Gabel zurück und klingelte nach Harvey. Er trug ihm eine Besorgung auf, die den Butler für mindestens zwei Stunden dem Haus fernhalten würde.
Wenige Minuten später hörte er, wie Harvey das Gebäude verließ. Ashton befand sich in einem Zustand untergründiger Erregung. Er war jetzt überzeugt, daß der Unheimliche zu ihm kommen würde, um das Geld abzuholen. Er glaubte auch zu wissen, daß man ihn mit dem Bentley nur deshalb verfolgt hatte, um zu sehen, inwieweit er die befohlenen Anordnungen einhielt.
Ashton nahm seine Pistole aus dem Schreibtisch und überprüfte das Magazin. Es war voll. Sieben Schuß. Er schob die Waffe in die Jackettasche und ging in den Keller, um einen großen Koffer, der nicht mehr benutzt wurde, nach oben zu holen. Er untersuchte das Gepäckstück gründlich. Es enthielt weder aufgeklebte Hotelmarken noch die Initialen des Besitzers; keinerlei Anhaltspunkte würden der Polizei später irgendwelche Hinweise auf die Herkunft des Koffers geben.
Ashton nickte zufrieden. Der Koffer war groß genug, um den Mann aufzunehmen. Er würde das Gepäckstück später im Kofferraum seines Wagens aufbewahren, bis sich Gelegenheit bot, ihn irgendwann zu nächtlicher Stunde in die Themse zu werfen. Das war alles. Höchst unkompliziert und ungefährlich!
Ungefährlich! Diese Feststellung war möglicherweise verfrüht und ungerechtfertigt. Noch stand nicht fest, ob der Unheimliche allein oder mit einem Komplicen arbeitete.
Ashton glaubte freilich zu wissen, daß der Fremde einer ganz ähnlichen Linie folgte wie er selbst . . . der klassischen Linie des typischen Einzelgängers! Das sicherte im vorhinein einen Erfolg der Aktion!
Ashton stellte den Koffer in der Garderobe ab. Dann betrat er das Arbeitszimmer und trat an das Fenster. Alles würde davon abhängig sein, ob sich eine Chance bot, die Pistole zu benutzen . . .
Minute um Minute verstrich. Ashton zwang sich zur Ruhe. Jetzt kam es darauf an, die Nerven zu behalten. Natürlich legte es der Fremde darauf an, ihn zappeln zu lassen. Er wollte seine Nerven strapazieren. Aber er, Ashton Cabott, würde am Schluß doch triumphieren . . .
Das Telefon klingelte.
„Hier spricht der feister'", meldete sich die Stimme des Unbekannten. „Ist der Diener gegangen?"
„Ich denke, Sie lassen das Haus beobachten? Dann dürfte Ihnen nicht verborgen geblieben sein, daß Harvey sich auftragsgemäß abgesetzt hat."
„Wie lange wird er wegbleiben?"
„Mindestens zwei Stunden."
„Sie sind jetzt ganz allein.“
„Ja."
„Das Geld befindet sich bei Ihnen?"
„Allerdings. Hören Sie, weshalb haben Sie mich heute morgen..."
Der Fremde unterbrach ihn. „Öffnen Sie die Haustür. Lehnen Sie sie an. Setzen Sie sich dann in Ihr Arbeitszimmer, mit dem Gesicht zum Fenster. Lassen Sie die Tür des Arbeitszimmers offen, so daß ich Sie vom Flur aus sehen kann. Legen Sie das Geld in den Koffer, und stellen Sie den Koffer an die Schwelle des Arbeitszimmers. Haben Sie mich verstanden?"
„Ja."
„Gut. Im Laufe der nächsten Stunde bin ich bei Ihnen..."
„Hallo!" rief Ashton, aber der Teilnehmer hatte bereits aufgelegt.
Im Laufe der nächsten Stunde! Das bedeutete, daß der Unbekannte seine Zermürbungstaktik durch eine lange Wartezeit fortzusetzen beabsichtigte. Ashton überlegte. Solange er den ,Unheimlichen' nicht zur Strecke gebracht hatte, mußte er dessen Anweisungen strikt befolgen. Er öffnete den Safe, packte die Noten in den Koffer und stellte ihn in die Nähe der Tür.
Dann öffnete er die Haustür und die Tür des Arbeitszimmers. Er setzte sich so, daß ihn der Fremde bei seinem Kommen vom Flur aus sehen konnte. Auftragsgemäß wandte Ashton seinen Rücken der Tür zu. Er überlegte fieberhaft. Er suchte nach einer rettenden Lösung, aber ihm fiel nichts ein. Wieder erkannte er voll Bitterkeit, daß er ohne einen Helfer in dieser Auseinandersetzung aufs Improvisieren angewiesen war. Der andere war ihm stets einen halben Schritt voraus!
Die Zeit verstrich. Fünf Minuten, zehn Minuten, eine halbe Stunde . . .
Dann war es soweit. Ashton vermochte nicht zu sagen, woher seine innere Sicherheit rührte, daß der Fremde gekommen war. Er hatte nicht das leiseste Geräusch vernommen. Aber er merkte, daß er plötzlich fröstelnd die Schultern hob und eine Gänsehaut bekam.
Er spannte die Muskeln und bekämpfte den Impuls, sich einfach umzudrehen und auf den Eindringling zu schießen. Nein, das wäre Wahnsinn. Es stand zu erwarten, daß ihn der Fremde im Auge behielt und bedeutend schneller am Drücker sein würde.
Dann sprach der Fremde. Seine Stimme klang voller und kräftiger als am Telefon. Sie hinterließ einen durchaus kultivierten Eindruck und war frei von jeder mundartlichen Färbung.
„Sie haben Glück", sagte der Fremde. Als er das Zucken von Ashtons Schulter bemerkte, fügte er rasch und scharf hinzu: „Stop! Wenden Sie nicht den Kopf! Sie würden mich sonst zwingen, auf Sie zu schießen! Ja, entspannen Sie sich! So ist's schon besser. Wie gesagt, Sie haben Glück. Ich war heute morgen drauf und dran, den vorbereiteten Brief mit dem Foto an die Associated Press zu schicken."
„Warum?" fragte Ashton heiser. „Warum wollten Sie das tun? Ich habe mich peinlich genau an die Abmachungen gehalten!"
„Ich hatte Ursache, zu glauben, daß Sie mir eine Falle stellen wollten."
„Das ist infam!" empörte sich Ashton. „Ich gab Ihnen keine Gelegenheit, mir zu mißtrauen."
„Abgesehen von dem Bandgerät, das Sie angeblich an das Telefon angeschlossen hatten!" spottete der Fremde. „Natürlich erkannte ich sofort, daß es Ihnen nur darauf ankam, mich zu bluffen. Aber bleiben wir bei dem heutigen Morgen. Ich bemerkte, daß Ihnen im Abstand von etwa einhundert Yards ein dunkler Bentley älterer Bauart folgte. Ich mußte annehmen, daß Sie sich einen Mitarbeiter engagiert hatten, der mich bei der Entgegennahme des Geldkoffers stellen sollte.
Das war der Augenblick, wo ich mit dem Gedanken spielte, das belastende Material an die Presse zu schicken. Aber dann erkannte ich hinter dem Steuer des Bentley den Detektiv der Bank. Ich vermute, daß er Sie auf eigene Faust beschattete. Oder", fuhr der Fremde mit plötzlich schärfer werdender Stimme fort, „handelte er in Ihrem Auftrag?"
„Der Direktor bot mir seine Hilfe und Unterstützung an", erwiderte Ashton wahrheitsgemäß. „Es konnte nicht ausbleiben, daß das Abheben der hohen Summe in kleinen und mittleren Banknoten die. Direktion zu gewissen Spekulationen über den möglichen Zweck der Transaktion veranlaßte. Ich lehnte alle diesbezüglichen Vorschläge und Angebote ab, ohne mich auf eine Diskussion einzulassen. Halten Sie mich für einen Selbstmörder? Ich kann zwar den Verlust meines Vermögens, aber nicht den meines Rufes verschmerzen."
„Das dachte ich mir."
„Natürlich bemerkte ich den Bentley. Ich war jedoch der Ansicht, daß Sie am Steuer sitzen. Wenn es tatsächlich der Bankdetektiv war, so kann ich dafür nichts."
„Ich will Ihnen glauben."
Ashtons Muskeln spannten sich abermals, als er das leise Schnappen hörte, das beim Öffnen der Kofferschlösser entstand.
„Ich kann die Summe jetzt nicht nachprüfen", meinte der Fremde. „Aber ich werde es zu Hause nachholen. Wenn auch nur eine einzige Pfundnote fehlen sollte..."
„Hören Sie auf mit den verdammten Drohungen!" brach es wütend aus Ashton hervor. Er krampfte die Hände fest um die Armlehnen des Stuhles, so daß die Knöchel weiß und spitz hervortraten. „Was erwarten Sie eigentlich von mir? Ueberspannen Sie den Bogen nicht t Sie können von Glück reden, daß ich bis jetzt mitgespielt habe. Entweder Sie sind bereit, ebenso fair und korrekt zu handeln wie ich, oder ich sehe mich gezwungen..."
Er wußte plötzlich nicht mehr, wie er den Satz beenden sollte; er unterbrach sich und schwieg.
„Fair!" spottete der Fremde. „Korrekt! Das sind hübsche, klangvolle Worte. Haben Sie sich in Ihrem Leben bisher immer daran gehalten? Fühlen Sie die innere Berechtigung, anderen diesbezügliche Vorhaltungen zu machen?"
„Ich fühle nur, daß Sie entschieden zu weit gehen! Ich habe keine Lust, mich in die Hände eines Erpressers zu begeben, dessen Geldgier keine Grenzen kennt!"
„Warum die plötzliche Aufregung? Ich dachte, alles sei abgesprochen? Fünfzigtausend Pfund in bar! Keinen Penny mehr oder weniger. Das ist doch ein Deal?"
„Welche Sicherheit bieten Sie mir, daß das Negativ und die Abzüge vernichtet werden?"
„Keine", spottete der Fremde. „Es kann nicht schaden, wenn Sie sich auch weiterhin den Kopf zerbrechen, was aus mir und dem belastenden Material geworden sein mag. Aber Sie können sich beruhigen. Ich habe nicht vor, Sie nach Zahlung des abgemachten Betrages noch ein weiteres Mal zu belästigen."
„Das behauptet jeder Erpresser!"
„Ah, wirklich? Sie scheinen sich in der Materie auszukennen!"
„Unsinn. Das liest man doch jeden Tag in der Zeitung."
„Hören Sie, Cabott. Ich bin nicht irgendein kleiner, schmieriger Gauner. Ich bin ein Meister meines Faches. Sie können mich nicht täuschen. Ich durchschaue Sie und Ihre kleinen simplen Tricks ganz genau. Zum Beispiel der Koffer in der Garderobe... er ist nichts anderes als ein improvisierter Sarg, nicht wahr? Sie haben es verdient, daß ich Ihnen dafür das Fell über die Ohren ziehe. Aber ich will nur Ihr Geld. Noch eins. Wenn Sie sich das nächste Mal eine Pistole einstecken, dann achten Sie darauf, daß sich die Waffe nicht unter dem Stoff der Jackettasche abzeichnet. Ich habe Augen, denen nichts entgeht, mein Freund."
„Sie arbeiten allein, nicht wahr?"
„Ich habe keine Lust, Fragen zu beantworten, die sich auf meine Arbeitsmethoden beziehen."
„Was wissen Sie eigentlich von mir?"
„Oh, eine ganze Menge, mein Lieber. Genug, um Sie fest in der Hand zu haben."
„Das meine ich nicht. Sie haben gewisse Informationen über mich und meine Vergangenheit gesammelt. Sie wissen zum Beispiel, daß ich Zahlmeister bei der Navy war. Sie kennen sich im Inneren meines Hauses aus und Sie vermochten genaue Angaben über die Höhe meines Bankkontos zu machen. Woher stammen diese Kenntnisse?"
„Ist das so wichtig? Es kommt mir nun mal darauf an, daß jede Aufgabe mit der größtmöglichen Umsicht vorbereitet wird. Ich pflege erst dann zuzuschlagen, wenn ich auch das kleinste Detail in Erfahrung gebracht habe. Die Vorarbeiten sind meistens recht kostspielig und mühsam, aber ich glaube behaupten zu können, daß sie sich in fast jedem Fall lohnen."
Ashton holte tief Luft. „Haben Sie schon einmal den Gedanken erwogen, mit einem Kompagnon zu arbeiten?"
„Warum sollte ich?" fragte der Fremde amüsiert. „Das habe ich nicht nötig! Ich gehöre zu den Leuten, die nur ungern teilen. Deshalb ziehe ich es vor, auf eigene Faust zu arbeiten."
Ashton Cabott jubilierte innerlich. Jetzt hatte sich der neunmalkluge Meister endlich verraten! Er war also tatsächlich ein Einzelgänger; sein Tod würde kaum irgendwelche Konflikte auslösen. Aber schon die nächsten Worte des Unbekannten ließen Ashton Cabotts Hoffnungen jäh in sich zusammensinken.
„Das bedeutet keineswegs, daß ich mich schutzlos dem Haß meiner Gegner preisgebe. Nehmen wir als ein Beispiel das Negativ des Fotos, das Sie in dem Hotelzimmer des Bariton zeigt. Es befindet sich in einem versiegelten Umschlag bei meinem Notar. Sollte lieh eines gewaltsamen Todes sterben, wird das Bild mitsamt einer Kopie des dazugehörigen Textes an die Associated Press gehen."
„Das ist unfair!" stieß Ashton erbittert hervor. „Ein Mann wie Sie hat tausend Feinde! Was ist, wenn einer dieser Leute Sie einfach über den Haufen schießt? Dann müßte ich darunter leiden, obwohl ich mit dem Mord nicht das geringste zu schaffen hätte!"
„Wirklich?" fragte der Fremde mit leisem Spott. „Aber Sie wollen doch meinen Tod, nicht wahr? Der alte Koffer im Flur und die Pistole in Ihrer Tasche beweisen das zur Genüge. Wenn Sie also durch einen dummen Zufall und durch meinen von anderer Seite inszenierten Mord ins Unglück schlittern sollten, so können Sie sich dafür bei den eigenen lauteren Absichten bedanken..."
„Das ist doch kompletter Unsinn! Wenn es in meiner Absicht gelegen hätte, Ihnen zu Leibe zu rücken, hätte ich mich im Garten verborgen gehalten und bei Ihrer Ankunft auf Sie geschossen. Ich kann mir schmeicheln, ein äußerst zielgenauer Schütze zu sein."
„Erzählen Sie mir keine Märchen. Ich bezweifle zwar nicht Ihre Schießtüchtigkeit, aber Sie wissen so gut wie ich, daß die Nachbarn den Schuß gehört hätten. Im übrigen wußten Sie nicht, ob meine Forderung mit der angelehnten Haustür ein wohlberechneter Trick war und ob ich tatsächlich das Haus auf diesem Weg zu betreten wünschte. Hätte ich nicht ebensogut von einem Nachbargrundstück kommen und durch ein Fenster hier eindringen können? Nachdem Sie heute morgen auf der Fahrt nach Purley vergebens auf das verabredete Zeichen warten mußten, sollten Sie gelernt haben, daß ich recht unorthodox arbeite und daß es sich nicht auszahlt, mich auf einem festgefahrenen Gleis überraschen zu wollen."
Ashton fühlte sich erschöpft. Er hatte immer von dem Gefühl seiner Überlegenheit gezehrt und es machte ihn krank, daß jetzt Stück um Stück dieser Selbstsicherheit abbröckelte.
„Ich könnte ein wertvoller Helfer für Sie sein", meinte er. „Ich habe die Verbindungen und gleichzeitig die Fähigkeit, wertvolle Informationen auszubaldowern..."
„Das kann ich selbst", unterbrach ihn der Fremde. „Es ist doch recht aufschlußreich und zudem erstaunlich, wie sich plötzlich der vornehme Mister Cabott, der eben noch von Fairneß und Korrektheit zu sprechen geruhte, in seiner Ausdrucksweise ändert. Sie biedern sich an wie ein schäbiger Hungerleider, wie ein gemeiner Strolch. Wahrscheinlich würden Sie für weniger als zehn Pfund einen Menschen überwältigen."
„Das verbitte ich mir!" rief Ashton wütend. „Ich habe noch nie in meinem Leben Gewalt angewendet!"
„Das ist Ihr Pech", sagte der Unbekannte unmittelbar hinter ihm. „Es gibt Augenblicke, wo sich Derartiges als äußerst nützlich und unumgänglich erweist."
Im nächsten Moment durchzuckte Ashton Cabott ein jäher, heißer Schmerz. Das Fenster seines Zimmers mit dem vertrauten Ausblick in den Garten schien sich mit Flammen zu bedecken; ein greller Wirbel zuckender Farben tanzte vor seinen Augen. Sie wurden abgelöst von einem tiefen Schwarz. Er spürte, daß er fiel, fiel, fiel, bodenlos und mit zunehmender Geschwindigkeit. In seinen Ohren brauste es. Dann fühlte er überhaupt nichts mehr.
*
Als er erwachte, brauchte er einige Zeit, um einen klaren Gedanken zu fassen. Dann formte sich die Erinnerung rasch zu einem festen Bild. Er griff sich an die Schläfe und spürte noch immer den Schmerz, den der harte, mit Schwung und anatomischer Sachkenntnis geführte Schlag mit dem Pistolenkolben hinterlassen hatte. Wie lange war er ohne Bewußtsein gewesen? Es spielte keine Rolle, ob die Ohnmacht fünf oder zehn Minuten gedauert hatte. Fest stand, daß der Unbekannte mit dem Geld schon längst über alle Berge war. Ashton erhob sich. Er ging in sein Schlafzimmer und zog sich aus. Dann nahm er ein Bad. Nach dem Umkleiden fühlte er sich bedeutend wohler. Aber der fade Geschmack in seinem Mund, den er schon vor der Ankunft des Fremden gespürt hatte, blieb. Er hatte auch diese Runde verloren. Es war beileibe kein Trost, zu hoffen, daß am Ende einer Reihe von verlorenen Schlachten ein gewonnener Krieg stehen konnte. Nach allem, was der Unbekannte bisher an Beweisen seines Könnens und seiner Unverfrorenheit geliefert hatte, war klar, daß es schwer sein würde, ihn auszuschalten. Dann begann er, sich im Flur und im Arbeitszimmer umzusehen. Man konnte nicht wissen: vielleicht hatte der Fremde eine Spur hinterlassen.
Aber es war nichts zu finden. Nicht einmal ein Fußabdruck! Ashton trat vor das Haus.
Über die schmale Zufahrtsstraße ging er zu dem Gartenportal. Die Straße war ziemlich menschenleer. Ganz in der Nähe tollte ein Junge mit seinem Hund herum. Ashton kannte den Jungen. Es war Tom, der Sohn des Nachbarn.
„He, Tommy, komm doch mal her!"
Tom war ein achtjähriges Bürschlein mit rotem Haar, vielen Sommersprossen und sehr blauen, aufgeweckten Augen.
„Ja, Mister Cabott?"
„Seit wann spielst du hier?"
„Ach, schon ‘ne halbe Stunde. Warum?"
„Hast du den Mann gesehen, der hier herausgekommen ist?"
„Meinen Sie den Hausierer?"
„Den Hausierer?" fragte Ashton verblüfft.
„Na ja ... der hatte doch einen Koffer bei sich. Ich dachte, er würde noch zu uns gehen und habe ihm gesagt, daß wir nichts brauchen. Mama hat für Hausierer nichts übrig. Er hat mich nur kurz angeblickt und ist rasch weitergegangen."
„Wohin?"
„Da, runter zur Hillcrest Road."
„Hast du bemerkt, ob er in einen Wagen gestiegen ist?"
„Nö, Mister Cabott. Was war denn mit dem Mann?"
„Ich habe etwas von ihm gekauft. Er hat mir zuviel Wechselgeld herausgegeben. Ich möchte ihn wiederfinden, damit er keine Einbuße erleidet."
„Ach, wenn der merkt, daß ihm Geld fehlt, wird er schon von allein kommen!"
„Sah er denn so schäbig aus?“
Tommys Augen rundeten sich erstaunt.
„Ich denke, Sie kennen ihn?"
Ashton räusperte sich.
„Klar, ich habe doch eben etwas von ihm gekauft. Dummerweise habe ich ihn nur flüchtig angeschaut. Ich interessiere mich mehr für den Inhalt seines Koffers, weißt du."
„Der Mann war prima in Schale."
„Kannst du ihn näher beschreiben?"
„Er war ungefähr so alt wie Sie — vielleicht noch etwas älter. Hatte einen dunklen Anzug an. Mit Nadelstreifen. Dazu eine silbergraue Krawatte. Wenn er nicht den miesen Koffer dabei gehabt hätte, hätte ich gar nicht gewußt, daß es ein Hausierer ist."
„Kannst du dich an sein Gesicht erinnern?"
„An sein Gesicht? Na, er sah so aus, wie Männer eben aussehen!" erwiderte Tommy verwirrt. Er fand es schwer, ein Gesicht zu beschreiben. Was konnte man dazu schon sagen? Die Erwachsenen sahen sich doch alle ziemlich gleich!
„Trug er eine Brille?"
Tommys Verwirrung wuchs.
„Sie haben aber wirklich schlecht aufgepaßt, Mister Cabott..."
„Mir ist so, als habe er keine getragen. Stimmt das?"
„Ja, das stimmt."
„Aber er hatte ein Bärtchen, nicht wahr?"
„Nö, ich habe keins gesehen."
„Er hatte meine Größe, würde ich sagen."
„Ja, so ungefähr."
Ashton blickte in gespielter Bekümmertheit die Straße hinab.
„Der Bursche tut mir leid. Es waren immerhin sechs Schilling. Für einen Hausierer ist das viel Geld..."
Tommy faßte sich plötzlich in die Hosentasche und brachte eine zerknüllte Visitenkarte hervor.
„Nützt Ihnen das was?" fragte er.
Erstaunt nahm Ashton das Kärtchen entgegen. Es enthielt in Prägedruck die Anschrift des Britischen Museums. Darunter stand in kleineren Buchstaben: ,Representative‘.
Ein Name fehlte. „Ja, das nützt mir was", murmelte Ashton.
„Der Hausierer zog ein Taschentuch hervor, als ich ihn ansprach. Dabei riß er das Kärtchen aus der Tasche. Ich wollte sie aufheben und ihm wiedergeben, aber er lief so rasch die Straße hinab, daß ich's bleiben ließ."
„Brauchst du das Kärtchen?"
„Nö, können Sie haben."
„Vielen Dank, Tom. Hier hast du einen Schilling. Wenn du den Mann nochmals sehen solltest, sagst du mir sofort Bescheid, ja?"
„Wird gemacht, Mister Cabott."
Ashton ging in sein Haus zurück. Er setzte sich ins Arbeitszimmer und drehte das Kärtchen ein wenig ratlos zwischen den Fingern hin und her. Wer hatte in den letzten Tagen oder Stunden das Britische Museum erwähnt? Jetzt erinnerte er sich! Britta Britton hatte am Vortag davon gesprochen, sich mit einem der Direktoren dieses Museums treffen zu wollen. Mit einem gewissen Sir Macolm.
Zufall? Wahrscheinlich! Ashton gelang es nicht, eine Beziehung zwischen Sir Macolm, einem Direktor des Britischen Museums, und dem Erpresser herzustellen.
Und doch...
Wenn Sir Macolm Britta kannte, wußte er sicher auch, daß die beiden Mädchen ihren Schmuck sehr leichtfertig im Hotelzimmer aufbewahrten. Warum sollte sich hinter der respekteinflößenden Fassade eines Sir Macolm kein Gauner verbergen? Schließlich ahnte auch niemand etwas vom Doppelleben eines Ashton Cabott. Er spürte, wie seine innere Erregung wuchs. Sir Macolm! War das der Schlüssel? Er trat ans Telefon und stellte eine Verbindung mit dem Britischen Museum her.
„Sir Macolm, bitte!"
„Bedaure, mein Herr, aber der Herr Direktor ist heute nicht im Hause. Er hat sich einen Tag freigenommen."
Ashton legte auf. Seine Erregung wuchs. Einen Tag freigenommen. Natürlich — er war ja schon seit dem frühen Morgen auf den Beinen! Erst an der Bank, dann auf dem Weg nach Purley, und schließlich hier, im Haus...
Ashton durchblätterte das Telefonbuch, bis er auf die Privatadresse des Museumdirektors stieß. Sir Macolm wohnte ebenfalls in Chelsea, kaum fünf Minuten von diesem Haus entfernt. Ashton verlor keine Zeit. Er fuhr sofort hin und klingelte an der messingbeschlagenen Tür der alten, viktorianischen Villa. Ein Butler öffnete die Tür.
„Ich möchte Sir Macolm sprechen, bitte. Hier ist meine Karte", sagte Ashton.
Der Butler nahm erstaunt das zerkrumpelte Kärtchen entgegen, das ihm Ashton gab. Es war das Kärtchen mit dem Aufdruck des Britischen Museums.
„Das muß ein Irrtum sein, mein Herr..."
„So?"
„Das ist nicht Ihre Visitenkarte. Sie haben das Kärtchen offensichtlich verwechselt. Diese Karte hier ist von der Art..."
„... wie sie Sir Macolm verwendet, nicht wahr?" fragte Ashton lächelnd.
„In der Tat — nur gibt der gnädige Herr nie eine Visitenkarte aus, die nicht seine Unterschrift trägt."
„Es handelt sich um einen kleinen Scherz", sagte Ashton. „Bitte bringen Sie ihm das Kärtchen. Er wird sofort wissen, worum es sich handelt."
„Tut mir leid, Sir — aber der gnädige Herr ist nicht im Hause. Er ist nach Brighton gefahren."
„Wann erwarten Sie ihn zurück?"
„Er hat keinen Termin genannt, Sir."
„Wissen Sie, wo er sich in Brighton aufhält?"
„Bedaure Sir, darüber bin ich nicht informiert. Wünschen Sie eine Nachricht für Sir Macolm zu hinterlassen?"
„Nein", erwiderte Ashton und nahm das zerknüllte Kärtchen wieder an sich. „Danke. Ich komme wahrscheinlich heute Abend oder morgen früh nochmals vorbei. Noch eine Frage. Welchen Anzug trägt Sir Macolm?"
„Den dunkelblauen mit den Nadelstreifen, Sir."
Ashton grinste düster. „Das dachte ich mir!"
Nach dem Mittagessen fuhr Ashton nach Hause. Er befand sich in einer sehr aufgeräumten Stimmung. Für ihn gab es nicht den geringsten Zweifel, daß er durch einen kaum glaublichen Zufall dem .Unheimlichen' auf die Spur gekommen war.
Sir Macolm war der von ihm gesuchte Erpresser und Schmuckräuber. Jetzt, wo diese Tatsache nur der letzten Erhärtung durch eine Überprüfung der Stimme bedurfte, war es Zeit, sich Gedanken über die Fortführung der Aktion zu machen.
Es würde klug und reizvoll sein, den Spieß einfach umzukehren und Sir Macolm nicht nur um den Schmuck der Brittons, sondern auch um sein Vermögen zu bringen.
Es war zu erwägen, ob er, Ashton Cabott, den Damen dann den Schmuck zurückgeben würde, gleichsam als sichersten Unterpfand für die geplante Ehe mit Constance.
Ashton hielt sich während des Nachmittags zu Hause auf, obwohl es ihn drängte, Constance zu besuchen. Er sonnte sich in dem Hochgefühl, alle Fäden wieder fest in der Hand zu halten. Insbesondere freute es ihn, endlich an dem Unheimlichen Vergeltung üben zu können.
Es war klar, daß er dabei äußerst um und vorsichtig auftreten mußte. Sir Macolms Butler würde seinem Herrn von dem seltsamen Besucher berichten, und nach ein paar diesbezüglichen Fragen mußte es dem Museumsdirektor aufgehen, welche Wende sich in den Ereignissen angebahnt hatte. Ohne Zweifel würde Sir Macolm sofort dazu übergehen, das Heft wieder in seine Hände zu bekommen. Dieser Gedanke war es, der Ashton aufspringen ließ.
Er schob die Whiskyflasche und das halbvolle Glas beiseite, die vor ihm auf dem Schreibtisch standen. Wie viele Gläser hatte er geleert? Drei oder vier? Lieber Himmel, welcher Leichtsinn. Jetzt kam es darauf an, einen klaren Kopf zu behalten. Vielleicht befand sich Sir Macolm schon auf dem Weg, um den gefährlichen Widersacher zu töten, möglicherweise war er sogar in diesem Moment dabei, in die Wohnung einzudringen. Ashton lauschte mit klopfendem Herzen. Im Haus war es fast unnatürlich still.
Wie kam es, daß Harvey noch nicht wieder zurück war? Ashton drückte auf die Klingel. Nichts rührte sich. Alles blieb ruhig. Nervös fuhr er in die Jackettasche. Als er den soliden Griff der Pistole zwischen den Fingern spürte, entspannte er sich ein wenig.
Unsinn. Sir Macolm würde es nicht wagen, bis zum Äußersten zu gehen. Er war zu klug, um sich durch einen Mord zu belasten. Aber war ein Mord für ihn nicht die einzige Möglichkeit, die Situation in letzter Sekunde zu retten?
Ashton hob den Telefonhörer ab und wählte Sir Macolms Nummer. Der Butler meldete sich. Nein, der gnädige Herr sei nicht zu sprechen. Er käme erst gegen Abend aus Brighton zurück. Erleichtert legte Ashton auf. Er verließ das Haus, holte den Wagen aus der Garage und fuhr los. Vor Sir Macolms Grundstück parkte er am Bürgersteig, ohne den Wagen zu verlassen. Er steckte sich eine Zigarette in Brand und stellte das Radio an. Dann lehnte er sich zurück und wartete.
Jetzt konnte nichts mehr schiefgehen. Sobald Sir Macolm auftauchte, würde er ihn zur Rede stellen und das weitere Geschehen diktieren. Zunächst würde es genügen, dem Unheimlichen', der längst nicht mehr unheimlich war, den Schmuck der Brittons und den Koffer mit dem Bargeld abzunehmen. Alles weitere würde sich finden.
Ashton lachte sich ins Fäustchen, als ihm einfiel, mit welchen beißend hohnvollen Sätzen er die Arroganz des .Meisters' zerfetzen konnte. Meister. Es war lachhaft . . . nach allem, was sich bisher ereignet hatte. Was war das schon für ein Meister, der an der Aufmerksamkeit eines Achtjährigen scheitern konnte?
Stunde um Stunde verrann, ohne daß sich das geringste ereignete. Es war eine wenig belebte Straße, und Ashton war dankbar für die kleinste Abwechslung, die sich seinen Augen bot. Er flirtete ein bißchen mit einem hübschen Dienstmädchen, das im Vorgarten des Nachbargrundstückes den Rasen harkte, und er pfiff bewundernd, als zwei flotte Teenager kichernd vorbeikamen und ihm neugierige Blicke zuwarfen.
Plötzlich zuckte er zusammen. Aus dem Autoradio drangen zweimal kurz hintereinander kratzende Störgeräusche, die laut und deutlich das Musikprogramm übertönten. Die Störgeräusche erklangen im Rhythmus des internationalen Seenotrufes.
Er schluckte und warf einen Blick auf Sir Macolms Haus. Es stand, von der goldenen Abendsonne übergossen, still und friedlich in dem gepflegten Park. Lauerte hinter einem der Fenster Sir Macolm auf sein Opfer? War er durch einen Hintereingang ins Haus gekommen? Bemühte er sich ein letztes Mal, durch diesen grausamen Scherz seinem Ruf als der ,Unheimliche" gerecht zu werden?
Nein, das konnte nicht sein. Für Sir Macolm gab es in diesem Augenblick keinerlei Grund, sich zu verraten. Aber wie erklärten sich die merkwürdigen SOS-Geräusche, auf die er am Morgen so fieberhaft gewartet hatte?
Er stieg aus und schloß den Wagenschlag hinter sich. Ihm war eingefallen, daß er für einen guten Gewehrschützen ein fabelhaftes Ziel bot. Wenn Macolm von einem der Fenster aus schoß, mußte er unweigerlich treffen. Straßenpassanten würden die zusammengesunkene Gestalt am Lenkrad unter Umständen für einen schlafenden Chauffeur halten. Und nach dem Einbruch der Dunkelheit konnte der Mörder dann sein Opfer unbemerkt beseitigen . . .
Ashton ging auf das Haus zu. Er klingelte. Der Butler öffnete.
„Ist Sir Macolm zurück?“
„Noch nicht, Sir. Aber er hat angerufen."
„Aus Brighton?"
„Ja, Sir."
„Wann?"
„Etwa vor einer Stunde."
„Haben Sie ihm von meinem Besuch berichtet?"
„Ja, Sir."
„Hat er gesagt, wann er zurück sein wird?“
„Nein, Sir."
„Danke, das genügt."
Ashton ging zum Wagen zurück. Er fühlte wieder den faden Geschmack im Mund.
Sir Macolm war jetzt gewarnt. Er wußte Bescheid. Wie würde er darauf regieren?
Ashton blieb neben dem Wagen stehen. Es hatte keinen Zweck, in der Stadt herumzufahren und bei angestrengtem Nachdenken die Nerven zu verschleißen. Er wandte sich mit einem Ruck um und marschierte auf die Tür des Hauses zu. Er klingelte. Als der Butler die Tür öffnete, schob er ihn kurzerhand beiseite und trat ein.
„Führen Sie mich ins Arbeitszimmer!"
„Mein Herr . . .!" sagte der Butler protestierend.
„Ich habe mich entschlossen, die Rückkehr Sir Macolms hier im Haus abzuwarten."
„Ich bedaure, Sir. Ich habe keine Befugnis, Besucher im Arbeitszimmer des gnädigen Herrn warten zu lassen. Wenn Sie es wünschen, können Sie gern im kleinen Salon Platz nehmen."
„Okay."
Der Butler führte Ashton in den kleinen Salon und fragte dann mit eisiger Miene, ob er dem Besucher etwas anbieten dürfe.
„Nein, danke."
Nachdem sich der Butler zurückgezogen hatte, fand Ashton Zeit, sich in dem Raum umzublicken. Er war mit Stilmöbeln eingerichtet. Man spürte, daß der Besitzer ein Mann mit Sinn für Wohnkultur war. Ashton erinnerte sich, daß der ,Meister' eine kultivierte Stimme besessen und auf diese Weise klargemacht hatte, daß er zu einer gehobenen Schicht gehörte.
Es dämmerte. Im Zimmer verdichteten sich die Schatten. Da sich der Butler nicht sehen ließ, stand Ashton auf und knipste das Licht an. Die Warterei zerrte an seinen Nerven. Immer, wenn ihn Zorn und Unmut zu überwältigen drohten, machte er sich deutlich, daß sich sein Gegenspieler in einer bedeutend schlechteren Lage befand. Das half. Einmal hörte er irgendwo im Hause das Telefon klingeln. Wenige Minuten später erschien der Butler.
„Der gnädige Herr hat angerufen", berichtete er. „Er wird in einer Viertelstunde hier sein."
„Vielen Dank."
Trotz der Voranmeldung verging eine weitere halbe Stunde, bevor Ashton in der Halle Stimmen hörte. Dann näherten sich Schritte dem Zimmer. Vor der Tür verhielten sie ein paar Sekunden; kurz darauf ging die Klinke nach unten. Die Tür öffnete sich. Ashton stand auf. Er hatte die rechte Hand in die Jackettasche geschoben. Seine Finger umspannten den Griff der entsicherten Pistole. Der eintretende Mann zog die Tür hinter sich ins Schloß. Er war etwa fünfundvierzig Jahre alt und sah recht distinguiert aus.
Er trug einen dunkelbraunen Anzug mit Nadelstreifen und eine silbergraue Krawatte.
Er war groß und breitschultrig. Der schmale, wohlgeformte Kopf mit dem dunklen, an den Schläfen leicht angegrauten Haar, verriet den Mann von Bildung und Erziehung. Er hatte helle, aufmerksame Augen, die Ashton mit leiser Verwunderung, aber keineswegs furchtsam betrachteten.
Die ringlosen Hände des Mannes waren lang, schmal und sensibel. Sie hingen lose an den Seiten herab. Nicht das leiseste Zucken eines Muskels deutete darauf hin, daß in dem Mann Angst oder Nervosität wohnten.
Ashton war enttäuscht. „Sir Macolm?" fragte er.
Der Mann an der Tür nickte. Ashton grinste. Das nützt dir nicht viel, dachte er. Du wirst sprechen müssen. Deine Stimme wird dich verraten. Sie wird dich verraten, wenn du sie verstellst, und sie wird dich verraten, wenn du normal sprichst . . .
„Ich habe lange auf Sie gewartet."
„Das erzählte mir der Butler."
Ashton schluckte. Er spürte, daß seine Hand am Pistolengriff schweißfeucht wurde. Beim Klang dieser dunklen Stimme, die nicht das geringste mit der des ,Unheimlichen' gemein hatte, fielen seine Hoffnungen und Pläne wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Das hier war nicht der Mann, der ihn am Vormittag aufgesucht und zu ihm gesprochen hatte.
„Darf ich erfahren, was Sie zu mir führt?"
„Ich . . . ich . . ." begann Ashton stotternd. Er merkte, daß er einen roten Kopf bekam.
„Nun?"
„Sie waren in Brighton?“ fuhr Ashton fort, um etwas Zeit zu gewinnen.
„Ich meine, der Butler hat Sie davon unterrichtet?"
Es war zu spüren, daß Sir Macolm ganz frei und natürlich sprach. Wenn seine Stimme eine gewisse Reserve erkennen ließ, so lag das sicher an dem Erstaunen, das er über den unerwarteten Besuch empfand.
„Ich ... ich glaube, daß ich das Opfer einer Verwechslung geworden bin", erklärte Ashton und zog das verknitterte Kärtchen aus der Tasche. „Kennen Sie diese Karte?"
Sir Macolm nickte. Er vermied es, die nicht ganz saubere Karte mit den Fingern zu berühren.
„Natürlich, Karten dieser Art werden von unseren leitenden Angestellten benutzt. Warum fragen Sie?"
„Das Kärtchen wurde von einem Mann verloren, dem ich auf den Fersen bin."
„Auf den Fersen?" erkundigte sich Sir Macolm verblüfft. „Soll das heißen, daß Sie von der Polizei sind?"
„Nein", versicherte Ashton rasch. „Die Erhebung ist privater Natur. Mein Name ist Cabott . . . Ashton Cabott!"
Sir Macolm legte die Stirn in Falten. „Cabott? Mir ist so, als hätte ich den Namen erst kürzlich gehört."
Ashton verspürte keine Lust, den Hausherrn darauf hinzuweisen, daß der Name vermutlich durch Britta Britton erwähnt worden war. Ihm lag nichts daran, daß die beiden Schwestern etwas von diesem Besuch erfuhren,
„Sie sagen, die Karten werden von den leitenden Angestellten des Museums benutzt. Wie groß ist dieser Kreis?"
„Oh, es sind etwa zwölf Leute. Natürlich schicken wir gern gelegentlich ein paar Einkäufer und Experten der zweiten Garnitur auf die Reise. Die erhalten dann die gleichen Kärtchen. Ich würde sagen, daß sie von insgesamt zwanzig Personen benutzt werden."
„Können Sie mir verraten, ob einer dieser Leute durch eine besonders kühle, sachliche und etwas metallisch klingende Stimme auffällt?"
Sir Macolm dachte kurz nach. Dann schüttelte er den Kopf. „Metallisch? Nein, daran könnte ich mich erinnern."
Ashton murmelte ein paar Entschuldigungen und verließ nach dem holprigen Abschied das Haus. Er war froh, als er wieder in seinem Wagen saß. War jetzt alles verloren, oder hatte er nur einen kleinen Rückschlag erlitten? Die einzige Spur, die zu dem Täter führte, war die Visitenkarte. Zwanzig Leute benutzten die gleichen Karten. Keiner von ihnen hatte, nach Sir Macolms Angaben, eine metallisch klingende Stimme. Ashton fuhr nach Hause. Da er sich müde und zerschlagen fühlte, suchte er nach einem Bad das Bett auf. Mitten in der Nacht erwachte er.
*
Er vermochte nicht zu sagen, was ihn geweckt hatte. Es war völlig still im Haus. Nur neben ihm, auf dem kleinen Nachtschränkchen, tickte leise und emsig der Wecker.
Er richtete sich auf. Das Fenster des im ersten Stockwerk liegenden Schlafzimmers stand offen. Ihm fielen die Ereignisse des Tages ein, und er fragte sich, ob es nicht leichtsinnig gewesen war, bei offenem Fenster zu schlafen. Über den Balkon konnte jeder, der sich einigermaßen geschickt anstellte, in das Schlafzimmer eindringen.
Aber wer hätte das tun sollen? Der .Unheimliche' besaß das Geld und den Schmuck. Er wartete darauf, den Rest des Vermögens in seine Hände zu bekommen. Da er nicht mit Sir Macolm identisch war, bestand für ihn nicht der geringste Anlaß, dem Haus einen nächtlichen Besuch abzustatten. Ashton knipste das Licht an.
Immerhin war er erleichtert, festzustellen, daß sich niemand im Zimmer befand. Vorsichtshalber blickte er sogar unter das Bett. Erst dann war er beruhigt. Die Zeiger des Weckers wiesen auf zwei. Was hatte ihn geweckt? Ein Geräusch? Oder einfach die innere Unruhe?
Er fand keine Antwort auf diese Fragen. Er wußte nur, daß es ihm nicht leicht fallen würde, wieder einzuschlafen. Er verlöschte das Licht und dachte nochmals über die Ereignisse des Tages nach. Er spürte1, daß es irgendwo einen Punkt gab, den er übersehen oder falsch bewertet hatte. Wo lag der Fehler?
Die größte Enttäuschung des Tages war die Entdeckung gewesen, daß zwischen Sir Macolm und dem Unheimlichen keine Personengleichheit bestand.
Sir Macolm. . .
Noch einmal zeichnete Ashton in Gedanken die seltsame und für ihn zutiefst enttäuschende Begegnung des Abends nach. Sein Herz klopfte stärker. Ihm schien es so, als sei er der Lösung ganz nahe gerückt. Was hatte an der kurzen Unterhaltung nicht gestimmt? Was war daran falsch gewesen? Nichts. Oder doch?
Plötzlich wußte er es. Der Anzug. Der Anzug mit den Nadelstreifen. Er war in den Schultern zu knapp und in der Taille zu locker gewesen. Die Hosen hatten gestaucht . . .
Nun weiß jedermann, daß besonders Intellektuelle ihr Äußeres oft vernachlässigen. Aber da das Innere des Hauses von Sir Macolm einen vollendeten Geschmack bewiesen hatte, war nicht einzusehen, warum der Besitzer in Dingen persönlicher Eitelkeit versagen sollte. Ashton knipste erneut das Licht an. Er atmete heftig. War das die Lösung?
Hatte der richtige Sir Macolm nur einen Strohmann vorprellen lassen, um selbst nicht in Gefahr zu geraten? War die Komödie inszeniert worden, um ihn, Ashton Cabott, zu täuschen?
Das würde sich rasch zeigen. Er kleidete sich an und eilte hinab in sein Arbeitszimmer. Dort knipste er die Schreibtischlampe an und sah sich um. Er konnte nichts Verdächtiges bemerken. Bevor er an das Telefon trat und Sir Macolms Nummer wählte, überzeugte er sich davon, daß die Pistole in seiner Jackettasche war.
Er mußte lange warten, bevor sich am anderen Ende der Leitung der Butler meldete.
„Ich möchte Sir Macolm sprechen, bitte. Es ist sehr dringend. Das Museum brennt!"
„Augenblick, bitte. Ich wecke sofort den gnädigen Herrn..."
Nach zwanzig Sekunden meldete sich der Butler erneut. Seine Stimme klang verwundert. „Bedaure, Sir. Aber Sir Macolm ist nicht zu Hause. Ich bleibe auf, bis er zurückkommt, damit er sofort das Museum anrufen kann. Darf ich erfahren..."
Ashton legte auf. Das Klopfen seines Herzens nahm zu. Sir Macolm befand sich hier im Haus, das unterlag keinem Zweifel. Er war in die Wohnung eingedrungen, um sich seines gefährlichsten Gegners zu entledigen. Ashton zog die Pistole aus der Tasche. Er glaubte zu wissen, was ihn geweckt hatte: es mußte das Geräusch eines brechenden Fensters, einer sich öffnenden Tür gewesen sein.
Ihm fiel auf, daß die Vorhänge an den Fenstern nicht geschlossen waren. Vom Garten her konnte man ihn gut sehen. Er bildete ein hervorragendes Ziel. Ashton knipste das Licht aus und setzte sich in den Armlehnstuhl. Das Zimmer hatte nur einen Zugang: die Tür zur Halle.
Diese Tür besaß die Eigenart, leise zu quietschen. Harvey hatte sie schon einige Male geölt, aber das Quietschen war stets wieder durchgekommen. Wenn der „Unheimliche" versuchen sollte, das Zimmer durch diese Tür zu betreten, so konnte das nicht unbemerkt geschehen. Ashton hatte sich so gesetzt, daß er die zum Garten weisenden Fenster im Auge behalten konnte.
Er fieberte vor Erregung, weil er zu spüren glaubte, daß sich die Entwicklung dem Kulminationspunkt näherte. Aber als Minute um Minute verstrich, ohne daß sich das geringste ereignete, wurde er allmählich ruhiger. Seine Gedanken ordneten sich. Er überlegte, ob er nicht das Opfer falscher Kombinationen geworden sein konnte.
Warum sollte ein Mann wie Sir Macolm zu nächtlicher Stunde nicht sein Haus verlassen dürfen? Er war nicht verpflichtet, den Butler davon zu unterrichten. Was den schlecht passenden Anzug betraf, konnte gesagt werden, daß es sich beileibe um keinen wirklichen Beweis handelte . . .
Ich muß seine Stimme hören, sagte er sich. Ich muß ihn in seinem Büro oder am Telefon überraschen . . .
Warum saß er eigentlich hier? War er das Opfer der Dunkelheit und seiner Befürchtungen geworden? Plötzlich fuhr er zusammen. Alle seine Muskeln spannten und verkrampften sich. Die Tür quietschte leise.
Ashton kämpfte den Impuls nieder, nach dem Lampenschalter zu greifen. Er hielt die Pistole in der Rechten und atmete mit weit geöffnetem Mund, um sich nicht zu verraten. Jetzt habe ich dich, dachte er triumphierend. Jetzt sitzt du in der Falle . . .
Als das Deckenlicht aufflammte, mußte er für eine Sekunde die Augen schließen. Dann riß er sie wieder auf und starrte blinzelnd auf den Eindringling. Es war ein etwa fünfzigjähriger Mann, den er noch niemals vorher gesehen hatte. Der Unbekannte verschränkte die Arme vor der Brust und blickte ernst, aber keineswegs überrascht auf den sitzenden Ashton. Der Mann war groß und schlank. Er trug einen dunklen, unauffälligen Flanellanzug mit einer karierten Schottenkrawatte. Auf seinem Kopf saß ein sportlicher Hut aus grauem Velour. Das schmale, gut geschnittene Gesicht wurde von dunklen, etwas stechend wirkenden Augen beherrscht. Der Nasenrücken war schmal und gerade, das Kinn kantig und fest. Die Lippen bildeten einen blassen, nahezu farblosen Strich.
„Sir Macolm, nehme ich an?" fragte Ashton mit einem höhnischen Grinsen. Jetzt, wo er der Gefahr Auge in Auge gegenüber saß, war er völlig ruhig.
„Stimmt. Ich bin Sir Macolm."
Ja, das war sie . . . die kühle, sachliche Stimme mit dem metallischen Klang! Die Stimme des „Unheimlichen". Aber er sah keineswegs unheimlich aus. Er war ein gut gekleideter, seriöser Endvierziger, ein Gentleman, der Träger eines Adelstitels . . .
„Sehr erfreut", sagte Ashton spöttisch. „Ich habe mich auf diese Bekanntschaft seit langem gefreut."
„Mir ist klar, daß Sie Bescheid wissen. Dabei hätte ich Sie um ein Haar zu bluffen vermocht. Mein Klubkamerad hat seine Sache gut gemacht, nicht wahr? Er tat mir den Gefallen, sich als Sir Macolm auszugeben. Ich konnte ihm einreden, daß es sich dabei um eine Wette handelt. Der Gute hatte keine blasse Ahnung, worauf er sich da einließ."
Wenn ich schieße, wird der Butler wach, überlegte Ashton. Aber das muß ich notfalls auf mich nehmen. Ich kann noch immer behaupten, einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt zu haben . . .
„Sind Sie nicht überrascht, daß ich Ihnen so schnell auf die Schliche gekommen bin?"
„Sie hatten das Glück, sich eine Serie banaler Zufälligkeiten zunutze machen zu können."
„Keineswegs. Ich konnte nur feststellen, daß Sie durchaus nicht der große Meister sind, für den Sie sich hielten."
„Als mir der Butler von Ihrem Besuch berichtete, wußte ich sofort, was passiert war. Mit Hilfe meines Freundes gelang es mir, Sie zu täuschen. Trotzdem war mir klar, daß Sie den Bluff früher oder später bemerken würden. Darum entschloß ich mich, heute Nacht persönlich nach dem Rechten zu sehen."
Ashton führte eine kleine, auffordernde Geste mit der Pistolenmündung aus. „Nehmen Sie die Hände hoch!"
Sir Macolm gehorchte.
„Setzen wir den Fall", sagte er dabei ruhig, „daß in diesem Moment mein Freund hinter einem der Fenster steht und mit einer Pistole genau auf Ihren Rücken zielt..."
Ashtons Hände waren feucht. Er brachte es jedoch fertig, sich soweit zu beherrschen, daß er den Kopf nicht zur Seite drehte, sondern den Gegner im Auge behielt.
„Mich legen Sie mit Ihren billigen Tricks nicht herein!"
„Tüchtig, tüchtig!" lobte Sir Macolm spöttisch. „Es ist in der Tat schwer, Sie aus der Ruhe zu bringen."
„Wo haben Sie das Geld?"
„Welches Geld?"
„Fragen Sie nicht so dumm! Wo sind die zwanzigtausend Pfund, die Sie mir heute morgen abgenommen haben?"
„Sie werden sich denken können, daß ich das Geld nicht bei mir trage."
„Weshalb sind Sie hier eingedrungen?"
„Es war meine Absicht, mit Ihnen zu sprechen."
„Sie lügen! Um mich zu sprechen, bedarf es keines Einbruches. Sie wollten mich töten!"
„Warum?"
„Weil ich Sie demaskiert habe! Weil es in meinen Händen liegt, Sie zu ruinieren!"
„Ich bedaure, daß Sie offensichtlich zu Übertreibungen neigen. Ist es nicht eher so, daß wir pari stehen?"
„Nein, mein Freund. Sie irren. Ich befinde mich Ihnen gegenüber entschieden im Vorteil. Das drückt allein die unbestreitbare Tatsache aus, daß es mir gelungen ist, Sie vor die Mündung meiner Pistole zu bringen."
„Machen Sie sich nicht lächerlich. Sie werden nicht den Mut aufbringen, mich zu erschießen. Das können Sie sich einfach nicht leisten! Haben Sie nicht selbst gesagt, daß Sie die Mittel der plumpen Gewalt verabscheuen?"
„So ist es. Aber ich erinnere mich auch daran, daß Sie meine Worte zu korrigieren versuchten. Vielleicht hatten Sie damit recht. Es gibt Situationen, wo man den Mut aufbringen muß, sich der nackten Gewalt zu bedienen. Sie bilden für mich fraglos eine Gefahr, Sir Macolm. Ich werde diese Gefahr zu bannen wissen."
„Mit einem Schuß? Sie scherzen! Schließlich ist Ihnen bekannt, was im Falle meines gewaltsamen Todes geschehen würde. Der Notar würde Bild und Text an die ,Associated Press' gehen lassen..."
„Wissen Sie, was ich glaube? Die Geschichte mit dem Notar ist gleichfalls ein Trick!"
„Wollen Sie es wirklich auf einen Versuch ankommen lassen?" fragte Sir Macolm spöttisch. Er machte eine kurze Pause und erkundigte sich dann: „Darf ich jetzt erfahren, was Sie zu tun beabsichtigen?"
„Ich kann Ihnen die gleiche, oder doch zumindest eine ähnliche Antwort geben wie jene, mit der Sie eine meiner Fragen abspeisten. Es liegt nicht in meiner Absicht, Sie mit meinen Plänen bekannt zu machen. Ich kann Ihnen nur mein unmittelbares Nahziel nennen: heute Nacht, schon in wenigen Minuten, fahren wir gemeinsam zu Ihrem Haus. Dort werde ich das Geld und den Schmuck in Empfang nehmen. Ein reizender Einfall, nicht wahr?"
Sir Macolm schien nicht beeindruckt. „Nicht alle hübschen Einfälle lassen sich verwirklichen", meinte er. „Ich habe nichts dagegen, daß Sie mich, nach Hause begleiten. Aber Sie werden dort weder das Geld noch den Schmuck finden."
„So? Dann fahren wir eben dorthin, wo Sie das Zeug versteckt halten."
„Das wird kaum möglich sein."
„Oh doch, das wird gehen", erwiderte Ashton mit scharfer Stimme. „Verfallen Sie nicht in den für Sie gefährlichen Fehler, meine Entschlossenheit zu unterschätzen. Entweder Sie gehorchen meinem Befehl aufs Wort, oder..."
„Oder?"
„Ich schieße!"
„Hören Sie, Cabott. Ich bin ein alter Hase und weiß genau, was in Ihrem Köpfchen vor sich geht. Sie würden mich liebend gern in der Hölle braten sehen, aber Sie wissen genau, daß das einfach nicht geht. Es würde nämlich bedeuten, daß Sie auf das Geld und den Schmuck für immer verzichten müßten. Genau das läßt aber Ihr ausgeprägter Eigentums- und Erwerbssinn nicht zu. Deshalb lassen mich Ihre Drohungen verdammt kalt, und deshalb nehme ich jetzt, wenn Sie nichts dagegen haben, meine Hände herab. So!"
Ashton erhob sich. Auf seiner Stirn klebte ein Netz winziger Schweißtropfen.
„Lassen Sie die Hände oben!"
„Ich denke nicht daran."
Ashton atmete hart. „Es stimmt", stieß er zwischen den Zähnen hervor. „Wenn ich schieße, bedeutet das einen Verzicht auf das Geld und auf den Schmuck. Aber diesen Preis zahle ich gern, um mir damit meine Ruhe und Sicherheit zu erkaufen..."
„Denken Sie an den Notar!" warnte Sir Macolm.
„Ein lausiger Trick! Einer Ihrer Bluffs!"
Sir Macolm lächelte plötzlich dünn. „Ja, ich muß Ihnen beipflichten. Es war ein Bluff, ein Mittel, um Sie einzuschüchtern und Sie an der Leine zu halten. Aber er hat geholfen. Ich bin nun mal dafür, die größtmögliche Wirkung mit dem kleinstmöglichen Einsatz zu erzielen. Das ist eine simple kaufmännische Regel, an die ich mich gern halte."
Ashton schluckte. Seine Augen hatten sich vor Erstaunen geweitet. „Das geben Sie zu?"
„Warum nicht? Ich besitze das Geld und den Schmuck. Obwohl ich einsehe, daß ich auf den Rest Ihres Vermögens verzichten muß, scheint es mir doch so, daß ich von uns beiden das bessere Geschäft gemacht habe. Es wird am besten sein, wir einigen uns auf dieser Linie. Ab sofort besteht zwischen uns ein Waffenstillstand, der gegenseitig respektiert und geachtet wird...“
„Sie müssen mich für schwachsinnig halten!" keuchte Ashton empört. „Glauben Sie wirklich, ich würde mich nach Lage der Dinge darauf einlassen, kampflos auf mein Geld zu verzichten? Hoffen Sie allen Ernstes, daß ich vor Ihrer Frechheit kapituliere?"
„Warum nicht? Es liegt doch in Ihrer Absicht, die süße kleine Constance Britton zu heiraten, nicht wahr? Sie müssen sich sagen, daß Ihnen die Heirat ein hundertfaches Entgelt bringt!"
Ashton fuhr sich mit dem Jackenärmel über die schweißfeuchte Stirn. Er meinte seinen Ohren nicht trauen zu dürfen. „Constance heiraten?" wiederholte er heiser. „Was reden Sie da für einen Unsinn?"
„Sie sollten den Mut besitzen, es zuzugeben", sagte Sir Macolm ruhig.
„Woher wissen Sie überhaupt . . .“
„Ich weiß gar nichts", meinte Sir Macolm gelassen. „Ich kombiniere nur. Es ist wirklich nicht schwer, zu erraten, was Sie planen. Jeder junge Mann, der mit einem der Britton- Mädchen in Berührung kommt und auch nur einen Tropfen roten Blutes in seinen Adern hat, träumt den gleichen Traum. Er hofft eines der Mädchen zu heiraten. Warum sollte es bei Ihnen anders sein? Es gibt zwei gute Gründe, sich in die Britton- Girls zu verlieben. Sie sind ungewöhnlich schön, und sie sind ungewöhnlich reich..."
„Soll das heißen, daß Sie sich mit den gleichen Absichten tragen wie ich?" fragte Ashton konsterniert.
„Genau", nickte Sir Macolm. „Ich werbe um Britta Britton. Ich bin zwar wesentlich älter als sie, aber ich habe herausgefunden, daß sie sich aus jungen Leuten glücklicherweise nicht viel macht. Außerdem genieße ich den unschätzbaren Vorzug, in ihrem Fachgebiet eine Koryphäe zu sein."
Ashton stieß die Luft aus. Er wußte nicht, ob er die Situation verhängnisvoll oder einfach komisch finden sollte.
„Sir Macolm!" spottete er bitter. „Das wäre in der Tat ein Schwager nach Maß!"
„Wir würden uns nicht viel nehmen, glaube ich behaupten zu dürfen", bemerkte Sir Macolm trocken.
„Eins verstehe ich nicht. Warum haben Sie die Mädchen bestohlen, wenn Sie den Wunsch haben, Britta zu heiraten?"
„Ich nehme an, daß unsere Gründe, in die Suite der Mädchen einzudringen, dem gleichen Plan entsprangen. Ich möchte den Schmuck an die Mädchen zurückgeben. Auf diese Weise hoffe ich Britta zu beweisen, daß ich mehr bin als ein nüchterner Museumsdirektor."
Ashton setzte sich stöhnend.
„Das wirft mich um! Da sage einer noch, es gäbe keine Duplizität der Ereignisse!"
„Regen Sie sich nicht auf. Jetzt kommt die letzte Runde. Wir brauchen uns nur zu arrangieren..."
„Wenn Sie unter arrangieren den Verzicht auf meine zwanzigtausend Pfund meinen sollten, werden Sie allerdings auf Granit beißen!"
„Was sind schon zwanzigtausend Pfund, wenn Ihnen die Chance geboten wird, Constance zu heiraten?"
„Sie übersehen ein paar wichtige Punkte. Erstens einmal gilt das gleiche Argument für Ihre Eheabsichten mit Britta. Zweitens wünsche ich nicht als armer Schlucker in die Ehe zu treten, und drittens sehe ich nicht ein, warum ich auf das Geld verzichten soll!"
„Sie werden einfach darauf verzichten müssen. Ich denke nicht daran, mich davon zu trennen!"
„Woher nehmen Sie angesichts meiner Pistole eigentlich den Mut, so kühn aufzutreten?"
Sir Macolm grinste. „Sehr einfach. Ich bin vorhin über den Balkon in Ihr Zimmer eingestiegen. Dort nahm ich die Pistole aus der Jackettasche und entfernte das Magazin..."
Ashton richtete die Pistole auf den Fußboden und zog den Abzug durch. Es klickte. Sonst geschah nichts . . .
Er warf die Pistole auf den Schreibtisch und stand auf.
„Lassen Sie uns einen Whisky trinken", sagte er.
„Eine ausgezeichnete Idee", meinte Sir Macolm. „Trinken wir auf eine lichte Zukunft im Hause Britton!"
Constance nahm seine Einladung an, mit ihm Tennis zu spielen. Sie verbrachten einen amüsanten Nachmittag auf den Courts in Addington. Über den gestohlenen Schmuck wurde dabei kein Wort verloren. Später brachte er Constance zurück ins Hotel. Sie verabredeten sich für den Abend und Ashton sagte zu, Constance kurz vor acht Uhr zu einem Theaterbesuch abzuholen. Sie wollten sich das südafrikanische Musical „King Kong" ansehen und nach dem Theater noch eine Bar aufsuchen.
Ashton hatte alle Ursache, zufrieden zu sein. Im Grunde genommen hatte Sir Macolm mit seinen Argumenten recht. Die zwanzigtausend Pfund waren zu verschmerzen, wenn es gelang, die Britton- Millionen zu erobern. Aber Ashton Cabott wäre nicht der Gauner gewesen, der er nun einmal war, wenn er sich nicht gewisse Gedanken über die finanziellen Aspekte der erhofften und geplanten Verbindung mit Constance Britton gemacht hätte. Er kannte den alten Britton nicht und hatte keine Ahnung, in welcher Weise die Mitgift- und Erbschaftsfragen geregelt waren. Aber er kannte Sir Macolm und glaubte zu wissen, daß es Not tat, äußerste Vorsicht walten zu lassen.
Sir Macolm, davon war er überzeugt, würde weder vor einem Mord noch vor einem Doppelmord zurückschrecken, wenn er dadurch seinen persönlichen Anteil an den Britton-Millionen erweitern konnte. Mit Kaltblütigkeit und Geschick ließ sich das leicht konstruieren; ein gemeinsamer Autounfall, ein Jagdunglück . . .
Ashton nahm sich vor, Sir Macolm nicht über den Weg zu trauen. Er war auch entschlossen, zu irgendeinem Zeitpunkt wieder in den Besitz der zwanzigtausend Pfund zu gelangen. Für den Augenblick genügte es ihm, sich um die Gunst der schönen Constance zu bewerben. Er war klug genug, seine diesbezüglichen Anstrengungen nicht zu forcieren. Er benahm sich freundlich-korrekt und war bemüht, das Mädchen nicht durch plumpe Komplimente zu verwirren. Er ließ seinen bewährten Charme spielen und glaubte schon bald erkannt zu haben, daß diese bescheiden-jungenhafte Manier reife Früchte trug. Als er, im Abendanzug und in bester Laune, zur verabredeten Zeit im Hotel erschien, war er überzeugt, an der Schwelle eines unterhaltsamen Abends zu stehen.
Er fuhr mit dem Lift ins erste Stockwerk und klopfte an Constances Tür. Niemand meldete sich. Er klopfte ein zweites Mal, diesmal etwas stärker. Keine Antwort erfolgte.
Er ging ein paar Schritte weiter und versuchte sein Glück an Brittas Tür. Auch hier drang kein einladendes „Herein" an seine Ohren. Ashton legte die Stirn in Falten. Er warf einen Blick auf seine Uhr. Fünfzehn Minuten vor acht. Es wurde höchste Zeit, daß sie sich auf den Weg ins Theater machten. War irgend etwas dazwischen gekommen? Er klopfte ein letztes Mal an Constances Tür, dann eilte er ins Erdgeschoß, um sich bei dem Portier zu erkundigen, ob eine Nachricht für ihn hinterlassen worden sei.
„Bedaure nein, Sir."
„Haben Sie bemerkt, daß Miß Constance Britton das Hotel verlassen hat?"
„Nein, Sir. Der Schlüssel ist oben. Soll ich durchrufen?"
„Ja, bitte."
Der Portier trat an das Telefon und wählte eine Nummer. Er lauschte einige Sekunden und legte dann den Hörer kopfschüttelnd auf die Gabel zurück.
„Es meldet sich niemand. Vielleicht sind die Damen im Hotelrestaurant?"
„Ich sehe nach."
Ashton fand Constance weder im Restaurant noch in der Halle. Auch beim Hotelfriseur war sie nicht. Er eilte erneut ins erste Stockwerk. Als sein Klopfen auch diesmal unbeantwortet blieb, drückte er kurz entschlossen die Klinke herab und betrat Constances Zimmer. Er zog die Tür hinter sich ins Schloß nnd blieb an der Schwelle stehen. Quer über dem Bett lagen der Rock und der Pulli, die Constance am Nachmittag getragen hatte. Der eingebaute Kleiderschrank war weit geöffnet und gab den Blick auf die vielen Kleidungsstücke frei, die Constance für die Reise ausgesucht und mitgebracht hatte. Irgendwie entstand der Eindruck, daß Constance sich in großer Hast umgekleidet hatte. Dieser Eindruck verstärkte sich noch, als Ashton einen Blick in das angrenzende Bad warf. Ein Paar Strümpfe waren achtlos über den Rand der Wanne geworfen; eine Flasche mit Gesichtsmilch und eine Puderdose waren nicht geschlossen worden.
„Miß Constance?" rief er und ging auf die Verbindungstür zu Brittas Zimmer zu. Sie war nur angelehnt und er stieß sie nach kurzem Anklopfen auf.
In Brittas Zimmer herrschte peinliche Ordnung, aber auch hier war kein Mensch zu sehen. Er betrat wieder Constances Zimmer und nahm einen Augenblick in der Nähe des Fensters Platz, um sich eine Zigarette anzuzünden. Er dachte nach. Gab es irgendein Ereignis, das eine Erklärung für Constances Abwesenheit bot? Selbst wenn sie durch eine dringende Botschaft dazu veranlaßt worden sein sollte, das Rendezvous nicht einzuhalten, hätte sie ihm eine Nachricht zukommen lassen sollen.
Seine Blicke schweiften durch den Raum, aber er entdeckte nichts, was ihm Aufschluß über Constances rätselhaftes Benehmen gab.
Er erhob sich und drückte die kaum angerauchte Zigarette in einem Ascher aus. Seine gute Laune war verflogen. Er fand, daß der schöne und vielversprechende Abend gründlich verdorben worden war. Plötzlich vernahm er ein leises, kaum wahrnehmbares Stöhnen. Er spürte, wie es ihn kalt überlief.
„Hallo?“ rief er und erschrak vor dem unnatürlich heiseren Klang seiner Stimme.
Alles blieb ruhig. Verwirrt blickte er um sich. War das Stöhnen durch die geöffnete Balkontür ins Innere des Raumes gedrungen? Hatte einer der Fensterläden geknarrt?
Er trat an den Kleiderschrank und schaute hinein. Halb unbewußt griff er nach einem Kleid und prüfte den weichen Stoff zwischen seinen Fingern. Dann ging er hinüber in Brittas Zimmer und öffnete dort den Kleiderschrank. Britta hatte nur die Hälfte von dem mitgenommen, was Constance besaß. Das war alles, was er festzustellen vermochte. Die Quelle des unheimlichen Stöhnens blieb ihm verborgen.
Er schaute unter Brittas Bett und lächelte zerstreut, als er ein Paar golddurchwirkte Pantöffelchen bemerkte. Als er in Constances Zimmer unter das Bett blickte, durchzuckte ihn ein jäher, stechender Schmerz. Unter dem Bett lag ein Mensch.
Constance!
Er kniete sich neben das Bett und faßte nach einem kühlen, schlanken Arm. An diesem Arm zog er Constance unter dem Bett hervor. Wieder hörte er ihr leises, qualvolles Jammern. In seiner Kehle würgte es. Auf dem schulterfreien, champagnerfarbenen Abendkleid des jungen Mädchens zeichnete sich oberhalb der Brust ein großer Fleck ab.
Blut!
„Constance!" stammelte er. „Constance!"
Tiefe Bestürzung überfiel ihn, als er das leichenblasse Gesicht der Bewußtlosen betrachtete. Er fragte sich, ob und wie lange sie noch zu leben hatte. Für einige Sekunden dachte er nicht an den Verlust, der ihm durch Constances Tod persönlich entstehen mochte, sondern nur daran, wieviel Jugend, Anmut und Schönheit durch die Hand eines skrupellosen Verbrechers dem Untergang geweiht schienen.
„Constance!" wiederholte er murmelnd. „Constance!"
Seine Augen wurden feucht, ohne daß er es merkte. Im Moment hätte er beinahe alles getöpfert, um diesem jungen, brutal überfallenen Menschen helfen zu können. Aber er vermochte nichts zu tun, um das Furchtbare ungeschehen zu machen . . .
Er raffte sich auf. Ein Arzt mußte her . . . ja, und natürlich die Polizei! Alles andere hatte Zeit . . .
Er hastete ans Telefon und berichtete dem Portier in knappen Sätzen, was geschehen war.
„Zuerst ein Arzt!" schloß er. „Es geht wahrscheinlich um Tod und Leben!"
„Wird sofort erledigt. Einer unserer Gäste ist Doktor. Er sitzt in der Halle..."
Ashton hing auf und kniete sich wieder neben Constance auf den Boden. Würde sie sterben? War sie bereits tot? Das schöne junge Gesicht wirkte wie aus weißem Marmor gemeißelt. Er spürte in sich einen tiefen, verzehrenden Haß gegen den Täter.
Sir Macolm!
Er war der einzige, der als Täter in Betracht kam. Der Schuß auf Constance war sein erster Schlag gewesen. Würde sich der zweite Schlag gegen ihn, Ashton Cabott, richten? Das war unwahrscheinlich. Sir Macolm hatte sein Ziel erreicht. Jetzt war Britta Britton, die zukünftige Lady Macolm, die Alleinerbin des ungeheuren Britton- Vermögens.
Ashton preßte die Zähne so fest aufeinander, daß es schmerzte.
Nein, schwor er sich. Das lasse ich nicht zu! Ich weigere mich, untätig zuzusehen, wie er Constance und mein Glück vernichtet. Ich werde nicht erlauben, daß dieses Ungeheuer straffrei davonkommt . . .
Es klopfte.
„Herein!"
Ein gut gekleideter Herr mit einer randlosen Brille und einem runden, intelligenten Gesicht trat ein. Er übersah mit einem Blick die Situation und ließ sich neben der Bewußtlosen auf den Knien nieder.
„Doktor Wolverton", murmelte er, während er Constances Puls prüfte. „Wurde eben vom Portier informiert. Habe leider keine Instrumente bei mir. Bat den Portier darum, einen Kollegen anzurufen."
„Wird sie durchkommen, Doktor?"
Doktor Wolverton beugte sich über die Bewußtlose.
„Kein Blut auf den Lippen", konstatierte er. „Wenn sie Glück hat, wurde die Lunge nicht getroffen." Er schaute plötzlich Ashton in die Augen. „Haben Sie es getan?"
Ashton wurde puterrot.
„Wofür halten Sie mich? Mein Name ist Ashton Cabott. Ich war mit dieser Dame für einen Theaterbesuch verabredet. Ich . . .“
„Schon gut", unterbrach der Doktor leidenschaftslos. Er hob eines der Augenlider an. „Es war nur eine Frage."
„Wird sie durchkommen?" wiederholte Ashton ängstlich.
Der Doktor zuckte mit den Schultern. „Schon möglich. Alles hängt vom Ausgang der Operation und vom Sitz der Kugel ab. Der Puls schlägt nur sehr schwach und unregelmäßig. Es besteht kein Zweifel, daß es sich um eine lebensgefährliche Verletzung handelt. Wir müssen, fürchte ich, mit dem Allerschlimmsten rechnen."
Das Telefon klingelte. Ashton trat an den Apparat und nahm den Hörer ab. Der Portier meldete sich mit gedämpfter, etwas besorgt klingender Stimme.
„Die Polizei wird bald hier sein. Die Beamten kommen selbstverständlich in Zivil, um keine unnötige Aufregung unter den Gästen zu verursachen. Sie werden verstehen, daß wir an den guten Ruf unseres Hauses denken müssen..."
„Zum Teufel mit Ihrem Haus!" sagte Ashton wütend. „Zum Teufel mit der Polizei! Ich möchte nur wissen, ob es Ihnen gelungen ist, einen Arzt und den Krankenwagen zu alarmieren. Alles andere ist sekundär. Doktor Wolverton kann nichts machen. Er hat keine Instrumente bei sich.“
„Der Krankenwagen dürfte bereits unterwegs sein, Sir. Außerdem hat sich Doktor Shi- ne, der dem Hotel schräg gegenüber wohnt, bereits auf den Weg gemacht."
Ashton legte auf. Er merkte plötzlich, daß ihm die Knie zitterten . . .
Doktor Wolverton richtete sich auf. „Nun?" fragte er.
„Der Krankenwagen wird gleich kommen."
Doktor Wolverton zog ein Lederetui aus dem Jackett und nahm eine Zigarre heraus. Er roch daran und drehte sie zwischen den Fingern. Als er sie in Brand steckte, warf er einen nachdenklichen Blick auf das Mädchen. Er hielt das Streichholz so lange in der Hand, daß er zusammenzuckte, als die Flamme seine Haut berührte.
„Verdammt!" fluchte er unterdrückt. Er warf das Streichholz beiseite und seufzte. „Zu jung, um zu sterben!" schloß er leise.
„Können Sie denn gar nichts unternehmen?" fragte Ashton verzweifelt.
„Gar nichts. Der Blutverlust ist erstaunlich gering. Sonst würde ich einen Notverband anlegen. Sie muß schnellstens auf den Operationstisch. Das ist alles."
„Sie muß ihren Mörder gesehen haben", meinte Ashton.
Der Doktor nickte.
„Das ist in der Tat sehr wahrscheinlich. Der Schuß wurde von vorn auf sie abgefeuert. Aus unmittelbarer Nähe, würde ich sagen. Die verbrannten Pulverränder an der Einschußstelle des Kleides lassen erkennen, daß der Schütze höchstens drei Meter von ihr entfernt war."
„Der Täter!" murmelte Ashton mit trockenem Mund. „Ich bringe ihn um..."
Doktor Wolverton zuckte mit den Schultern. „Überlassen Sie dieses häßliche und wenig dankbare Geschäft lieber dem Henker."
Ashton zog die Unterlippe zwischen die Zähne. Sein Herz hämmerte schmerzhaft gegen die Rippen. Ein erschreckender Gedanke überfiel ihn.
„Lieber Himmel, wenn er erfährt, daß sie noch lebt..."
„Nun?"
„Er würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um sein Maß voll zu machen."
„Sie haben recht. Er kann es sich nicht erlauben, daß sie ihn an den Galgen liefert."
„Wann wird sie in der Lage sein, auszusagen?"
Doktor Wolverton warf Ashton einen prüfenden Blick zu.
„Weshalb sind Sie so stark daran interessiert?"
„Weil ich an ihrer Sicherheit interessiert bin!" brach es aus Ashton hervor. „Weil ich will, daß man den Mörder schnellstens verhaftet und unschädlich macht!"
„Ach so", meinte der Doktor, in dessen Brille sich die Reflexe der Deckenbeleuchtung spiegelten. „Ich dachte schon ..." Er nuckelte an der Zigarre und schwieg.
„Sie müssen von Sinnen sein!" sagte Ashton ärgerlich. „Hätte ich wohl die Polizei und den Arzt alarmiert, wenn ich für die Tat verantwortlich wäre?"
Doktor Wolverton betrachtete die weiße Asche der Zigarre. „Ich kann nicht sagen, ob und wann die junge Dame in der Lage sein wird, etwas auszusagen. Ich erwähnte ja bereits, daß alles vom Gelingen der Operation abhängt..."
„Sie darf nicht sterben!"
Der Doktor trat an die offene Balkontür und blickte hinaus. Ueber den Dächern der Weltstadt verdämmerten die Pastellfarben des Abendrotes. Ashton hörte, wie vor dem Hoteleingang ein Wagen scharf bremste. Die Polizei!
Er fühlte einen dumpfen Ärger in sich aufsteigen. Was wollten die Burschen überhaupt hier? Sie würden ihn stundenlang auskneten und dutzende dummer Fragen an ihn richten. Dabei kam es doch nur darauf an, Constances junges, bedrohtes Leben zu retten . . .
Oder rührte sein Ärger nur von der Angst her, sich den Beamten gegenüber verplappern zu können? Es war scheußlich, den Täter zu kennen, und nichts darüber aussagen zu dürfen. Scheußlich, scheußlich, scheußlich . . .
Das waren die Nachteile eines Gewerbes, das gegen Recht und Gesetz verstieß. Er haßte plötzlich sich und die Methoden, mit denen er bislang sein Leben gefristet hatte. Zum ersten Male seit langem war er nicht stolz auf sich und seine Gerissenheit. Zum ersten Male war er mit sich unzufrieden. Die Polizei erschien mit fünf Leuten. Ashton kannte nur einen von ihnen. Das war Kommissar Morry.
Der Kommissar begrüßte Ashton durch einen kurzen Händedruck. Indessen beugte sich der Polizeiarzt schweigend über die Verletzte. Noch ehe er mit der Untersuchung zu Ende gekommen war, klopfte es abermals an die Tür. Doktor Shine, ein hochaufgeschossener, hagerer Mensch mit schütterem grauem Haar, betrat das Zimmer. In seinem Gefolge kamen zwei Krankenträger mit einer Bahre.
„Muß sofort operiert werden", murmelte der Polizeiarzt und wies die Krankenträger an, die Bewußtlose mit der nötigen Vorsicht auf die Bahre zu betten.
Der Kommissar tippte Ashton auf die Schulter. „Gehen wir ins Nebenzimmer", empfahl er. „Dort können wir uns ungestört unterhalten, während meine Kollegen hier die notwendige Spurensicherung vornehmen."
In Brittas Zimmer setzten sie sich. Der Kommissar bat um einen möglichst genauen Bericht, und Ashton, der über ein nahezu fotografisch genau arbeitendes Gedächtnis verfügte, gab jede Einzelheit preis, an die er sich zu erinnern vermochte. Selbstverständlich erwähnte er weder Sir Macolm noch seinen damit in Zusammenhang stehenden Verdacht.
„Was halten Sie von dem Ereignis?" fragte der Kommissar freundlich, als Ashton seine Schilderung beendet hatte.
„Was ich davon halte?" fragte Ashton ehrlich verblüfft. „Ich finde, es ist nicht meine Aufgabe, irgendwelche Schlußfolgerungen zu ziehen. Dafür ist die Polizei zuständig!"
„Wissen Sie zufällig, wo sich Miß Britta aufhält?"
„Keine Ahnung."
„Ist der Portier darüber informiert?"
„Nein."
„Halten Sie es für möglich, daß zwischen den beiden Schwestern irgendwelche Spannungen bestanden?"
Ashton dachte kurz nach. Dann schüttelte er den Kopf.
„Ausgeschlossen! Natürlich bin ich nicht in der Lage, eine umfassende Charakteranalyse der jungen Damen abzugeben, aber ich meine doch, gewisse Gegensätze erkannt zu haben, die gar keine echten Spannungen aufkommen lassen können. Constance ähnelt ein wenig der genialen Unordnung, die in ihrem Zimmer herrscht; sie ist unbekümmert und lebhaft. Britta läßt sich ebenfalls mit dem gegenwärtigen Zustand ihres Zimmers vergleichen. Sie ist sachlich und korrekt. Zwischen zwei so verschieden gearteten Menschen kann es keine Spannungen geben, weil die Interessen der Betreffenden einfach aneinander vorbei gehen."
„Kennen Sie Sir Macolm?" fragte der Kommissar plötzlich.
Es kostete Ashton einige Mühe, seinen Schrecken zu verbergen. Was wußte der Kommissar? Hatte man ihn beobachten lassen?
„Ja, ich kenne ihn. Er ist, soviel ich weiß, mit Miß Britta befreundet."
Der Kommissar ließ das Thema so schnell fallen, wie er es aufgegriffen hatte, aber in Ashton blieb eine leise Unruhe zurück. Er begriff, daß es viele Fragen gab, auf die er nur eine improvisierte Antwort geben konnte. Eine dieser Antworten konnte ihm leicht zum Verhängnis werden.
„Ich fürchte, daß wir unsere Zeit mit recht nutzlosen Erörterungen verschwenden", meinte Ashton. „Miß Constance lebt. Sie wird, so ist zu wünschen und zu hoffen, schon bald in der Lage sein, eine genaue Beschreibung des Täters abzugeben."
Es klopfte. Der Polizeiarzt trat ein. Diesmal nahm sich der Kommissar die Mühe, die Herren einander vorzustellen.
„Doktor Hamilton, Mister Cabott."
Die Männer verbeugten sich knapp.
„Nun, Doktor?" fragte Morry. „Wie steht's?"
„Schlecht. Miserabel!" seufzte der Doktor griesgrämig. „Sollte mich wirklich wundern, wenn sie durchkommt."
„Ist sie schon auf dem Weg ins Krankenhaus?"
„Ja. Ich habe angerufen. Die Operation wird vorbereitet. In ein paar Stunden wissen wir mehr."
Die Tür öffnete sich und ein anderer Beamter kam herein. Er schenkte Ashton nur einen flüchtigen Blick. Dann wandte er sich an den Kommissar und sagte:
„Ich habe mich mit dem Etagenkellner und dem Stubenmädchen unterhalten. Der Kellner war um neunzehn Uhr dreißig das letzte Mal in Miß Constances Zimmer. Sie hatte ihn gebeten, eine leere Champagnerflasche abzuholen."
„Champagner!" sagte der Doktor und zog die Nase kraus. „Haben diese Dämchen ein Leben! Haben Sie den Kleiderschrank gesehen? Junge, Junge! Ein Glück, daß meine Frau keinen Blick hineinwerfen kann. Sie würde mich sonst zum x-ten Male fragen, was mich auf die Idee gebracht hat, ein lausig bezahlter Polizeiarzt zu werden!"
Der junge Beamte lächelte etwas gequält und fuhr dann fort: „Als der Kellner Miß Constances Zimmer betrat, war sie bereits umgezogen. Außer ihr befand sich niemand im Raum. Allerdings konnte er nicht ins Bad blicken. Der Kellner behauptet, daß sie blendender Laune gewesen sei."
„Warum nicht? Sie wollte ausgehen und sich amüsieren", sagte der Doktor.
„Dummerweise kann sich niemand erinnern, einen Schuß gehört zu haben", kommentierte der junge Beamte. „Vermutlich benutzte der Täter eine Pistole mit Schalldämpfer."
„Haben Sie sonst noch etwas herausgefunden?" erkundigte sich der Kommissar.
„Ja, Sir. Der Portier erinnert sich, einen Verdächtigen gesehen zu haben. Ein großer, gut gekleideter Mann ging zur fraglichen Zeit mit abgewandtem Kopf die Treppe zum ersten Stockwerk hinauf. Wenig später kam er wieder und verschwand durch den Hotelausgang. Der Portier hielt den Mann nicht auf, weil er, wie er sagte, keine Ursache sah, dem Fremden nachzusteigen. Sie wissen, wie das in einem Hotel zugeht. Vermutlich glaubte der Portier, daß es sich um eine diskrete Liebesaffäre handeln mochte..."
„Hm", machte Morry. „Wir dürfen freilich annehmen, daß der Besucher keineswegs amou- röse Absichten hegte, sondern aus einem anderen Grund kam."
„Der Portier war in der Lage, den Besucher ziemlich genau zu beschreiben. Nur das Gesicht hat er nicht gesehen."
„Na, das ist ja auch nicht so wichtig!" spottete Doktor Hamilton.
Der junge Beamte warf dem Polizeiarzt einen ärgerlichen Blick zu. „Ich kann nur das wiederholen, was ich erfahren habe. Gemessen an der Art, wie sich der Unbekannte bewegte, schätzte der Portier den Mann auf etwa dreißig Jahre."
Lachhaft! schoß es Ashton durch den Sinn. So etwas nennt sich nun Portier und Menschenkenner! Sir Macolm ist knapp fünfzig. Die Tatsache, daß er sich eine gewisse Elastizität der Bewegung erhalten hat, sagt nichts über sein wahres Alter aus.
Es juckte Ashton, laut zu sagen:
,Ich kenne den Mörder, meine Herren. Sein Name ist Sir Macolm. Er tötete Miß Constance . . . oder versuchte es zumindest . . . damit Miß Britta, die von alledem nichts ahnt, zur Alleinerbin des gewaltigen Britton- Vermögens wird. Sir Macolm, der Miß Britta zu heiraten beabsichtigt, hofft auf diese Weise zum Nutznießer der verdoppelten Erbschaft zu werden . . .'
Aber das ging natürlich nicht. Wenn Sir Macolm aufgrund dieser Verdächtigung verhaftet wurde, war es auch mit ihm, Ashton Cabott, endgültig aus. Sir Macolm würde dann keinen Grund sehen, ihn zu schonen. Wirklich, er befand sich in einer Zwickmühle, aus der es scheinbar nur einen einzigen Ausweg gab: Sir Macolm mußte zum Schweigen gebracht werden.
Aber ging das überhaupt noch? Jetzt, wo sich bereits die Polizei für den Museumsdirektor interessierte, konnte sich jede Aktion als Bumerang erweisen.
„Eines scheint mir von größter Bedeutung zu sein", hörte er sich sagen. „Miß Constance muß gegen einen weiteren Mordanschlag geschützt werden. Es ist anzunehmen, daß sie den Mörder kennt. Das bedeutet, daß der Täter mit allen Mitteln versuchen wird, sich der gefährlichen Zeugin zu entledigen..."
„Machen Sie sich deswegen keine Sorgen", riet Kommissar Morry jovial. „Miß Constance befindet sich bei uns in den besten Händen!"
„Fest steht", sagte der junge Beamte, „daß der Schmuckräuber nicht mit dem Schützen von heute identisch sein kann."
„Warum nicht?" fragte der Doktor verblüfft.
„Ganz einfach: wenn es dem Schmuckräuber darum gegangen wäre, Miß Constance zu töten, hätte er in der fraglichen Nacht dazu die Zeit und die Gelegenheit gehabt."
„Vielleicht übersehen Sie etwas", korrigierte der Kommissar mit milder Stimme. „Es könnte ja immerhin sein, daß sich seit dem Schmuckdiebstahl die Perspektiven für den Täter ein wenig verschoben haben."
„Der Perspektiven?" fragte der junge Mann ratlos.
Der Kommissar nickte.
„Ja, mein Freund. Aber das werden wir bald wissen. Gehen Sie jetzt wieder an die Arbeit. Ich möchte mich noch ein wenig mit Mister Cabott unterhalten."
Doktor Hamilton und der junge Mann verließen das Zimmer.
Der Kommissar faltete die Hände im Schoß und sagte:
„Nun?"
„Nun?" wiederholte Anton verblüfft.
Der Kommissar lächelte.
„Sie verbergen mir etwas, mein Lieber. Ich bin lange genug in der Branche, um mich da genau auszukennen."
Ashton bekam einen roten Kopf. Er hätte sich dafür am liebsten ohrfeigen mögen.
„Was sollte ich Ihnen verbergen?"
„Das weiß ich nicht. Mir ist nur klar, daß Sie mit irgendeiner Information hinter dem Berg halten."
„Hören Sie, Kommissar. Ich bin an der Bestrafung des Täters mindestens ebenso stark interessiert wie die Polizei.
„Hm. An der Bestrafung? Mag schon sein. Aber wie steht es mit der Ergreifung?"
Ashton blickte in die hellen, ein wenig ironisch funkelnden Augen des Kommissars und merkte, daß ihn ein leises Frösteln überkam. Ich darf mich nicht bluffen lassen, überlegte er. Der Kommissar hat eine feine Nase, aber nicht einmal das großartigste Gespür wird mich dazu bringen können, aus der Schule zu plaudern. Es geht schließlich auch um meinen Hals.
„Was wollen Sie eigentlich?" fragte Ashton ärgerlich.
„Das wissen Sie genau. Ich wünsche den Täter Zu verhaften. Und Sie, Mister Cabott, kennen ihn!"
*
Ashton sprang auf. „Herr Kommissar. Ich muß auf das schärfste gegen diese Unterstellung protestieren!"
Morry lächelte. „Nur keine Szenen!" beschwichtigte er. „Meine Erfahrungen haben gezeigt, daß sich die Leute, die etwas zu verbergen haben, immer am lautstärksten aufführen."
Ashton setzte sich wieder. „Ich pfeife auf Ihre Erfahrungen!" sagte er wütend. „Ich habe es nicht nötig, mich verdächtigen zu lassen!"
„Ich behaupte nicht, daß Sie der Täter sind. Aber ich fühle, daß Sie mehr wissen, als Sie zu sagen bereit sind."
Ashton erwiderte höhnisch: „Wenn ich nicht irre, erwartet man von der Polizei keine Gefühlsduseleien, sondern konkrete Beweise."
„Bei Gelegenheit werde ich Ihnen den gewünschten konkreten Beweis liefern", sagte der Kommissar, der seine freundliche Ruhe und Überlegenheit auch dann nicht verlor, als das Gespräch sich zusehends verschärfte.
„Da bin ich wirklich neugierig."
Der Kommissar erhob sich. „Wenn Sie wollen, können Sie jetzt gehen."
„Ich bin schon entlassen?" erkundigte sich Ashton verblüfft.
Der Kommissar lächelte. „Haben Sie damit gerechnet, verhaftet zu werden?"
„Natürlich nicht“, sagte Ashton und ärgerte sich darüber, daß er schon wieder rot anlief. Er benahm sich wirklich wie ein Pennäler. Steif ging er zur Tür. Dort verbeugte er sich. Dann verließ er das Zimmer. Im Erdgeschoß machte er am Portierstisch halt. Der Portier sah ziemlich mürrisch aus.
„Es ist zum Heulen", erklärte er halblaut und mit ein paar scheuen Seitenblicken auf die in der Halle sitzenden Gäste. „Immer, wenn ich Dienst habe, passiert etwas. Wenn das so weiter geht, wird die Hotelleitung noch behaupten, ich brächte dem Haus kein Glück. Was kann ich dafür, daß hier die Herren Mörder geradezu mühelos ein und aus zu gehen vermögen? Ich könnte sechs Hände und zwei Köpfe haben und hätte noch immer genug zu tun. Die eingehende Post will sortiert und verteilt sein, das Telefon klingelt in einem fort, ungeduldige Gäste äußern ihre Wünsche und...“
Ashton unterbrach den Redestrom des Portiers. „Bitte beschreiben Sie mir den Verdächtigen."
„Ich habe ihn doch kaum gesehen. Mir fiel nur auf, daß er heim Durchqueren der Halle sein Gesicht abgewandt hielt. Aber das ist nichts Besonderes, wissen Sie. Viele der Affären, die sich in einem großen Hotel abspielen, werden von den Beteiligten mit größtmöglicher Diskretion betrieben. Im übrigen ist es erfahrungsgemäß so, daß gerade die Leute, die so ungeschickt und scheu auftreten, die harmlosen Anfänger sind. Am ausgekochtesten sind die, die hoch erhobenen Hauptes und ganz kühl zu einem unerlaubten Rendezvous schreiten . . ."
„Groß und schlank, das habe ich dem Beamten doch schon gesagt. Er trug einen dunklen Anzug von tadellosem Schnitt. Prima Stoff, das war zu sehen."
„Etwa meine Größe?"
„Ja, so ungefähr.“
„Jünger, älter?"
„Gleichaltrig, würde ich sagen."
„Besondere Kennzeichen oder Merkmale?"
„Ich sagte Ihnen doch bereits, daß ich den Burschen nur flüchtig gesehen habe. Ich kann mich nicht einmal an die Farbe seines Haares erinnern. Auf dem Kopf trug er einen schwarzen Hut. Das fiel mir besonders auf. Im allgemeinen nehmen die Gebildeteren unter den Gästen in der Halle den Hut ab."
„Blickten Sie ihm hinterher, als er die Treppe benutzte?"
„Nur kurz."
„Kam dem Unbekannten ein Gast oder ein Angestellter entgegen?"
„Nein. Die Gäste und die Angestellten benutzen im allgemeinen selbst dann den Lift, wenn sie nur in die erste Etage müssen."
„Danke, das ist alles."
Ashton gab dem Portier ein Trinkgeld und trat dann auf die Straße. Er kam sich in dem eleganten Abendanzug und dem dreiviertellangen Umhang selten deplaciert vor. Er winkte ein Taxi heran und ließ sich nach Chelsea bringen.
Als er sein Haus betrat, fragte er den Butler: „Ist ein Anruf für mich gekommen?"
„Nein, Sir."
„Ich habe Kopfschmerzen. Ich werde noch ein bißchen lesen und mich dann schlafen legen. Wenn es geht, möchte ich nicht mehr gestört werden. Keine Anrufer, bitte."
„Sehr wohl, Sir!"
Ashton ging in sein Schlafzimmer. Er stellte das Radio an und zog sich um. Dann schob er ein gefülltes Magazin in seine Pistole und steckte die Waffe in die Jackettasche. Wenig später kletterte er über den Balkon und die Regenrinne hinab in den Garten. Das Radion in seinem Zimmer ließ er laufen, damit Harvey annahm, er sei noch immer zu Hause. Er benutzte besonders einsame, menschenleere Straßen, um auf Umwegen zu der Villa von Sir Macolm zu gelangen.
Als er das Grundstück seines Gegners erreicht und betreten hatte, atmete er auf. Dabei wußte er nicht einmal genau, was jetzt geschehen sollte. Ihm war nur klar, daß er Sir Macolm auf alle Fälle zur Rede stellen mußte. In Ashtons innerem brannte noch immer der Haß. Er war entschlossen, Gewalt anzuwenden, falls es Macolm einfallen sollte, einen seiner alten Tricks zu versuchen.
Im Erdgeschoß und im ersten Stock des Hauses brannte Licht. Es war anzunehmen, daß sich Macolm im ersten Stockwerk aufhielt. Ashton, der im Schatten eines Baumes stand, und die Hausfassade betrachtete, stellte befriedigt fest, daß es nicht schwer sein würde, an den vielen Mauervorsprüngen in die Höhe zu klettern. Er begab sich unverzüglich an die Arbeit. Dabei fiel ihm ein, daß er sich zum ersten Male als Einbrecher versuchte. Bisher waren seine Ausflüge in das Reich der Gesetzlosigkeit ausnahmslos vom Schreibtisch aus praktiziert worden.
Aber das hier lag außerhalb seiner gewöhnlichen ,Tätigkeit'. Hier ging es um viel, viel mehr. Als er schweratmend einen Balkon erreichte und sich über die Brüstung schwang, kam ihm zu Bewußtsein, daß er für ein Unternehmen dieser Art denkbar schlecht ausgerüstet war. Er besaß weder einen Nachschlüssel noch anderes Werkzeug. Sogar eine Taschenlampe hatte er vergessen. Nur an die Handschuhe hatte er gedacht.
Er klinkte vorsichtig die Balkontür auf. Zu seinem Erstaunen war sie nicht verschlossen. Als er vorsichtig die Dunkelheit eines fremden Zimmers betrat, hatte er für eine Sekunde das enervierende Empfinden, geradewegs in eine Falle zu tappen.
Sehen konnte er nicht das geringste. Im Hause war es ganz still. Während er mit der Rechten die Pistole umklammert hielt, tastete er sich mit der ausgestreckten Linken unendlich vorsichtig in die lastende Dunkelheit hinein.
Nach drei, vier Schritten blieb er stehen. Er hatte das Gefühl, nicht allein zu sein. Gab es ein Augenpaar, das ihn anstarrte, einen kaum hörbaren Atem, der sich mit ihm in den Rhythmus der Erregung teilte? Dieser Tag war einfach zuviel für mich, schoß es ihm durch den Sinn. Meine Nerven werden allmählich wacklig. Er ging weiter und stolperte. In seinem Magen breitete sich ein äußerst häßliches Gefühl aus, als ihm klar wurde, an welchem Widerstand seine Füße gescheitert waren. Unter ihm lag ein starrer, menschlicher Körper. Er war allein mit einem Toten.
*
Er verfluchte die Tatsache, daß er ohne Taschenlampe gekommen war und kramte in seinem Anzug nach dem Feuerzeug. Bevor er es anknipste, zögerte er einen Moment. War es nicht besser, einfach die Flucht zu ergreifen und das düstere Geheimnis dieses Zimmers zu vergessen?
Aber das ging nicht mehr. Er steckte schon zu tief in den Ereignissen drin, als daß er vor ihnen die Augen verschließen konnte. Im übrigen war es möglich, daß es sich hier um ein Opfer von Sir Macolm handelte. Wenn das zutraf, bedeutete das eine wesentliche Stärkung seiner eigenen Verhaltungsposition.
Im flackernden Licht des winzigen Flämmchens beugte er sich zu dem Toten hinab.
Als er das Gesicht des Mannes erkannte, wurde er von einer plötzlichen Erregung geschüttelt. Es war Sir Macolm.
Der Hausbesitzer lag mit weit offenen Augen und starrem Blick auf dem Boden; aus irgendeinem Grunde trug er kein Jackett. Die tödliche Kugel hatte ihn genau in Höhe des Herzens getroffen. Ashton richtete sich schweratmend auf. Wer war der Mörder?
Ashton löschte das Flämmchen und schob das Feuerzeug in die Tasche zurück. Ihm fiel ein, daß der Kommissar im Hotel nach Britta Britton gefragt hatte. War es möglich, daß sie den Mordanschlag auf Constance in einer Art Panik zu vergelten versucht hatte?
Was immer auch der Fall sein mochte: jetzt kam es darauf an, schnellstens die Flucht zu ergreifen. Er durfte hier nicht gesehen werden. Ashton betrat den Balkon. Er ließ seine Blicke über das dunkle Gartengrundstück schweifen und fragte sich, ob in irgendeinem der düsteren Schatten Sir Macolms Mörder lauern mochte.
Unsinn. Der Täter hatte keinen Grund, sich noch länger hier aufzuhalten. Ashton kletterte an der Hauswand nach unten. Wenig später verließ er das Grundstück. Eine Viertelstunde nach der Entdeckung des Toten hatte er sein Zimmer erreicht.
Sorgfältig bürstete er zunächst seinen Azug aus, an dem Spuren des schmutzigen Mauerwerkes haftengeblieben waren. Er hing den Anzug in den Schrank, nahm ein Bad und legte sich dann ins Bett. Das Radio spielte noch immer. Ashton fragte sich, ob der Butler wohl in der Zwischenzeit hier oben gewesen sein mochte. Er drückte auf die Klingel. Harvey erschien nur eine halbe Minute später.
„Bringen Sie mir einen Whisky, bitte", sagte Ashton. „Mit Soda und Eis. Täusche ich mich, oder hat vorhin das Telefon in der Halle geklingelt?"
Harvey sah erstaunt aus. „Das Telefon, Sir? Das halte ich für ausgeschlossen. Ich habe die ganze Zeit im Salon gesessen und mir erlaubt, das Fernsehprogramm
anzuschauen. Die Tür zur Halle war offen. Ich hätte das Klingeln bestimmt nicht überhört."
Ashton sagte: „Mit Soda und Eis. Täusche ich mich, „Dann habe ich mich wohl getäuscht. Bringen Sie mir jetzt den Whisky, bitte."
Nachdem der Butler gegangen war, versuchte Ashton Ordnung in seine Gedanken zu bringen. Soweit er es zu übersehen und zu beurteilen vermochte, war Sir Macolm der Mann, der den brutalen Mordanschlag auf Constance verübt hatte. Aber wessen Opfer war er nur wenige Stunden später geworden? Hatte Britta dabei die Hand im Spiel gehabt?
Nein, das erschien unglaubwürdig. Britte wußte unter Umständen noch gar nicht, was der Schwester widerfahren war. Sie hatte also nicht die geringste Ursache, Macolm zu töten. Im übrigen war es höchst unwahrscheinlich, daß die kühle, sachliche Britta Britton wegen des Anschlages auf Constance zur Mörderin geworden wäre. Aber wer war der Täter? Ashton überlegte. Sir Macolm war ein Erpresser; er besaß Feinde. Einer von ihnen hatte ihn getötet. Das war die einzige Erklärung. Es mußte durchaus kein Zusammenhang zwischen seinem Tod und dem Mordanschlag auf Constance bestehen. Wichtig war nur eins: er war tot.
Ashton lächelte düster. Sein gefährlichster Gegner war erledigt. Der Weg zu einer hoffentlich bald genesenden Constance schien frei . . . Das wog sogar den Umstand auf, daß er jetzt sicher gezwungen war, die von Macolm erpreßten zwanzigtausend Pfund abzuschreiben.
Ashton hatte einen unangenehmen Geschmack im Mund, als er daran dachte, womit Macolm im Falle seines gewaltsamen Todes gedroht hatte. Aber, so tröstete sich Ashton, er hatte die Geschichte mit dem Notar ja später selbst als Bluff und Erfindung hingestellt. Das schloß freilich nicht aus, daß die Polizei bei der Morduntersuchung im Hause Macolms auf die belastenden Fotos stoßen würde . . .
Ashton merkte, wie ihm bei diesem Gedanken kalter Schweiß auf die Stirn trat.
Die Fotos. Wie hatte er sie nur vergessen können? Er mußte sie in seinen Besitz bringen, noch ehe die Polizei den Mord entdeckte und mit ihren Routinenachforschungen begann. Aber wie sollte er das anstellen? Es war mit Sicherheit anzunehmen, daß Sir Macolm das Film- und Bildmaterial gut versteckt hatte. Möglicherweise befanden sich die Fotos sogar außerhalb der Wohnung. Ashton bezweifelte, daß der Butler eingeweiht war. Sir Macolm war der typische Einzelgänger gewesen.
Es klopfte. Der Butler brachte auf einem Tablett den Whisky. Ashton bedankte sich und führte das Glas an die Lippen.
Harvey räusperte sich. „Sie sehen blaß aus, wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf", meinte er besorgt.
Ashton erwiderte: „Ich hatte ein scheußliches Erlebnis. Sie werden von dem Ereignis in den Morgenzeitungen lesen. Constance Britton, eine gute Bekannte, wurde das Opfer eines scheußlichen Anschlages."
„Oh, das bedaure ich tief, Sir."
Ashton nahm einen weiteren Schluck. Über den Rand des Glases hinweg betrachtete er seinen Butler. Zum ersten Male ging ihm auf, daß er wenig oder gar nichts von Harvey wußte. Welche Gefühle oder Vorstellungen mochten sich hinter der Maske des perfekten Domestiken verbergen? Ahnte dieser Mann etwas von dem Doppelleben, das sein Herr seit Jahren führte?
„Wenn Sie nach unten gehen, Harvey, stellen Sie bitte das Telefon um. Ich möchte von hier aus einen Anruf tätigen."
„Sehr wohl, Sir."
Eine Minute später hatte Ashton Scotland Yard in der Leitung. Er erfuhr, daß Kommissar Morry noch nicht zurück sei. Nein, es lägen noch keine Informationen über den Ausgang der Operation an Miß Britton vor. Ashton bedankte sich und legte auf. Dann wählte er die Nummer des Hotels.
„Verbinden Sie mich mit dem Zimmer von Miß Britta Britton, bitte."
„Gern. Wen darf ich melden?"
„Ashton Cabott."
Es knackte ein paarmal in der Leitung, dann ertönte wieder die Stimme des Portiers.
„Bedaure, mein Herr, aber da meldet sich niemand. Darf ich eine Nachricht für das gnädige Fräulein hinterlassen?"
„Danke, nicht nötig."
Er legte auf.
Britta war also noch nicht zurückgekehrt. Wo steckte sie nur? Aus der Tatsache, daß sich niemand gemeldet hatte, ging klar hervor, daß die Polizei das Appartement bereits verlassen hatte. Es klopfte.
Harvey trat ein. „Es tut mir leid, nochmals stören zu müssen, Sir . . . aber es ist ein Besucher eingetroffen, der sich nicht abweisen lassen will. Ich habe ihm erklärt, daß Sie sich bereits zur Ruhe begeben haben. Er besteht trotzdem darauf, daß ich Sie von seinem kommen unterrichte."
Die Polizei! schoß es durch Ashtons Sinn. „Wer, zum Teufel, ist es?" fragte er.
„Mister Ferguson."
Ashtons Augen weiteten sich. „Ferguson?"
Er erinnerte sich, daß der Mann, der schon einmal das Opfer seiner Erpressungen geworden war, vor wenigen Tagen Gast der Burleys gewesen war. Eigentlich war es seiner Unterhaltung mit Ferguson zuzuschreiben, daß er sich so plötzlich für die schöne Constance Britton interessiert hatte. Ashton blickte auf die Uhr. Es war kurz vor Mitternacht. Was wollte Ferguson zu dieser ungewöhnlichen Stunde? Ashton kannte Ferguson vom Golf- und Tennisplatz, sie trafen sich gelegentlich auf Gesellschaften und Parties, verkehrten privat aber kaum miteinander.
„Führen Sie ihn in den Salon und bieten Sie ihm einen Whisky an", sagte Ashton brummig. „Ich komme gleich."
„Sehr wohl, Sir."
Nachdem Harvey verschwunden war, schlüpfte Ashton in den rotseidenen Morgenmantel und die schwarzen Lederslipper. Er verknotete den Gürtel des Mantels und legte am Schluß noch ein blaues Halstuch um. Er spürte eine seltsame Unruhe in sich, die immer stärker wurde. Fergusons Besuch zu dieser Zeit konnte keiner zufälligen Laune entspringen. Es mußte eine Sache von höchster Wichtigkeit sein. Das aber bedeutete sicher Ärger . . .
Ferguson erhob sich von seinem Platz, als Ashton den Salon betrat. Die Art, wie der Besucher lächelte, ließ Ashtons Sorgen rasch verschwinden. Ferguson zeigte sich ironisch-verbindlich wie eh und je.
„Ich bin untröstlich!" sagte er. „Natürlich lag es keineswegs in meiner Absicht, Ihre Nachtruhe zu stören. Aber konnte ich denn ahnen, daß Sie bereits zu Bett liegen würden? Bislang war ich der festen Überzeugung, daß es sich bei dem guten Ashton Cabott um einen typischen Nachtfalter handelt!"
Ashton rückte sich einen Sessel zurecht. Er zwang sich, das Lächeln des späten Besuchers zu erwidern. „Ich hoffe, Sie stören sich nicht an meiner etwas zwanglosen Aufmachung. Ich wollte Sie nicht lange warten lassen und solange keine Damen in der Nähe sind... Behalten Sie doch Platz, Ferguson. Hat Harvey Ihnen den richtigen Whisky gegeben? Ja? Das freut mich. Nun, wie geht es Ihnen?"
Ferguson setzte sich. Er trug einen tadellos geschnittenen dunklen Anzug mit Nadelstreifen.
Nadelstreifen.
Ashton durchzuckte es scharf. Aber dann beruhigte er sich rasch. Die Geschichte mit dem Nadelstreifenanzug war längst geklärt. „Wie sind Sie übrigens mit der schönen Constance vorangekommen?" fragte Ferguson spöttisch.
Ashton verzog das Gesicht. „Constance?" fragte er mit einem starren Lächeln, von dem er sehr wohl wußte, daß es höchst unnatürlich wirkte.
„Aber ja!" meinte Ferguson, der ein Bein über das andere schlug und sich mit verschränkten Armen in dem Sessel entspannt zurück lehnte. „Lag es nicht in Ihrer Absicht, um das Mädchen zu freien?"
Ashton merkte, daß ein leiser, aber scharfer Ärger in ihm aufstieg. „Wollen Sie sich über mich lustig machen?" fragte er. „Sie wissen anscheinend nicht, was geschehen ist. Constance Britton wurde das Opfer eines äußerst häßlichen Mordanschlages. Ihr Zustand ist ernst. Sie schwebt zwischen Tod und Leben."
Ferguson nickte. „Ich weiß, ich weiß..."
Ashton sprang auf. „Sie wissen es?" rief er. „Woher?"
„Warum ereifern Sie sich?" fragte Ferguson gelassen. „Behalten Sie doch Platz, mein Lieber."
Ashton setzte sich wieder. „Sprechen Sie endlich."
„Was gibt es da schon zu sagen? Ich bin davon unterrichtet, daß der heutige Anschlag nicht der einzige ist, der auf Constance Brittons Leben zielt. Der gefährlichste Anschlag auf ihr Leben ist noch in vollem Gange."
Ashton beugte sich heftig atmend nach vorn. „Noch im Gange?" fragte er erregt. „Haben Sie die Polizei schon davon unterrichtet?"
„Nein."
Ashton schluckte. Er schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. „Aber das ist unverantwortlich!" rief er. „Sie muß sofort davon in Kenntnis gesetzt werden! Es muß schnellstens alles getan werden, um Constances Lehen gegen jeden Übergriff und gegen jede Bedrohung zu schützen! Warum kommen Sie zu mir? Weshalb gehen Sie nicht zur Polizei?"
Ferguson lächelte spöttisch. „Erwarten Sie wirklich, daß ich der Polizei den Übeltäter präsentiere?"
„Allerdings!"
„Nun gut. Stellen Sie eine Telefonverbindung mit Scotland Yard her. Ich bin bereit, dem zuständigen Beamten zu erklären, daß es sich bei dem Täter um einen Mann namens Ashton Cabott handelt."
Zwischen Ashtons Augen steilte sich eine tiefe Falte. „Hören Sie, Ferguson! Wenn Sie betrunken sein sollten, darf ich Sie ersuchen, mein Haus sofort zu verlassen. Ich habe keine Lust, ein Opfer Ihrer dummen und recht geschmacklosen Scherze zu werden."
„Ich bin stocknüchtern", erklärte Ferguson.
„Wie Sie sehen, habe ich nicht einmal den Whisky angerührt, den mir Ihr Butler brachte. Aber ist es nicht wahr, daß Sie einen Anschlag auf Constance Brittons Leben planen?"
„Ich? Einen Anschlag? Sie müssen den Verstand verloren haben!"
„Sie wollen das Mädchen heiraten, nicht wahr? Sie wollen sie heiraten, um das Vermögen der Brittons in Ihren Besitz zu bringen. Das ist ein Anschlag, mein Lieber. . . ein Anschlag auf Constances Leben und Zukunft. Er ist mindestens ebenso gravierend wie eine Kugel."
Ashton erhob sich. Er wies mit der ausgestreckten Hand zur Tür.
„Gehen Sie, bevor ich den Butler rufe."
Ferguson blieb sitzen. Sein Lächeln wurde um eine Schattierung spöttischer.
„Sie sind in Ihrer Rolle gar nicht übel, Cabott. Ganz der tödlich beleidigte Gentleman. Ich begreife gut, daß es Ihnen gelingen konnte, die Spitzen der Londoner Gesellschaft jahrelang an der Nase herumzuführen. Mich inbegriffen!"
Ashtons Knie gaben nach. Er mußte sich wieder setzen.
„An der Nase herumzuführen?" wiederholte er schwach.
„Ja. Sie haben uns großartig geprellt. Sie haben uns die Komödie des bescheidenen, hilfsbereiten, geselligen und charmanten Gentleman vorgespielt. Sie hatten Erfolg damit. Es war mir und meiner Tüchtigkeit beschieden, Sie zu entlarven."
„Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen."
„Ich spreche von Ihrem kriminellen Doppelleben, Cabott!"
Ashton zog hörbar die Luft durch die Zähne. „Sie sollten mal zu einem Arzt gehen, Ferguson. Zu einem Psychiater. Ihr Fall ist ernst."
„Lassen Sie die Mätzchen. Sie wissen genau, daß Ihre Stunde geschlagen hat. Sie haben mich erpreßt. Sie haben andere erpreßt. Sie sind ein ganz gewöhnlicher Schwindler!"
Ashton war erstaunt, festzustellen, daß die Erregung allmählich von ihm abfiel. In seinen schlimmsten Angstträumen hatte er stets eine ähnliche Szene befürchtet und erwartet. Jetzt, da es soweit war, fühlte er sich beinahe frei. Ihm war, als sei eine Last von ihm genommen worden, die er jahrelang als schwere Bürde mit sich herumgeschleppt hatte.
„Wie haben Sie das erfahren?"
Ferguson griff zum erstenmal nach seinem Glas. Er roch jedoch nur daran und stellte es dann wieder ab.
„Damals, als mir durch die gemeine Erpressung zehntausend Pfund abgenommen wurden, schwor ich mir, den Übeltäter zu fassen und zu bestrafen. Es war mir unmöglich, die Polizei damit zu beauftragen, denn mir lag keineswegs daran, die Ursache der Erpressung publik werden zu lassen. Daher beauftragte ich einen anerkannt tüchtigen Privatdetektiv damit, die Spuren des Erpressers zu verfolgen."
„Das muß in der Tat ein tüchtiger Mann gewesen sein."
„Er ist es noch immer. Die Nachforschungen kosteten mich ein Vermögen . . . aber ich hatte Erfolg."
„Ich glaube nicht, daß Sie in der Lage sind, mir die Erpressung nachzuweisen."
„Ich habe nicht vor, Sie vor den Kadi zu zerren, Cabott. Es ist Ihr Glück, daß ich nicht daran interessiert bin, meinen Namen im Zusammenhang mit einer finsteren Erpressungsgeschichte in der Zeitung wiederzufinden."
„Was ist Ihre Absicht?"
„Ich sagte bereits, daß es mir darum geht, den Übeltäter zu fassen und zu bestrafen. Punkt eins ist erfüllt. Jetzt komme ich zu Punkt zwei... zu der Strafe."
„Sie wollen vermutlich das Geld zurück haben?"
„Das wäre noch keine Strafe. Ich verlange den doppelten Betrag!"
„Ist das alles?"
„Nein. Ich bestehe darauf, daß Sie sofort die unschuldige Constance Britton in Frieden lassen!"
„Sie haben kein Recht, diese Forderung zu stellen!"
Ferguson lächelte dünn und verächtlich. „Hören Sie auf, von Rechten zu sprechen. Sie sind der letzte, der das Recht anderer je achtete!"
Ashton biß sich auf die Unterlippe. „Mir scheint, daß Sie die Situation nicht richtig einschätzen, Ferguson. Die Partie zwischen uns steht remis. Sie wissen, daß ich Sie erpreßte, und mir ist bekannt, weshalb dies geschah. Wenn Sie wollen, daß ich meine Informationen für mich behalte..."
„Schluß damit!" unterbrach Ferguson. „Ich weiß inzwischen genug von Ihnen und Ihrem sauberen Lebenswandel, um Sie mit Ihren eigenen Waffen schlagen zu können. Mein Detektiv hat Sie lange und intensiv überwacht. Wünschen Sie, daß schon morgen Ihre Opfer einen Brief mit dem namentlichen Hinweis auf ihren Erpresser erhalten? Oder legen Sie Wert darauf, die Tonbandaufnahme des Gespräches zu hören, das zwischen Ihnen und Sir Macolm geführt wurde? Ich finde, daß diese Aufnahme allein die Kosten aufwiegt, die ich zu investieren gezwungen war. Zwei Galgenvögel unter sich. Einfach abstoßend. Widerlich!"
„Ein Gespräch zwischen Sir Macolm und mir auf dem Tonband?" fragte Ashton schwach.
Ferguson nickte grimmig. „Ich verdanke die Bandaufnahme einem hervorragenden Einfall des ungemein instinktivsicheren Detektivs, der genau spürte, daß es zwischen Ihnen und Macolm ernste Spannungen gab. Der Detektiv betrat eines Tages als Telefonarbeiter verkleidet Ihr Haus und installierte dort das Gerät. Es war mit einer Fernbedienung ausgerüstet, die durch elektrische Impulse von außerhalb gesteuert wurde. Zwei Tage später holte der Detektiv in der gleichen Verkleidung das Gerät wieder ab."
„Merkwürdig, daß Harvey mir nichts davon berichtete."
„Sicher hielt er die angebliche Überprüfung der Telefonanschlüsse für zu nebensächlich, als daß es sich lohnte, darüber zu sprechen."
Ashton war es plötzlich, als zerrisse ein Vorhang. Er erhob sich keuchend.
„Jetzt begreife ich die Zusammenhänge!" sagte er schweratmend. „Jetzt wird mir alles klar. Auf dem Band befindet sich das verdammte Gespräch, in dessen Verlauf ich Macolm bedrohte . . . Sie erkannten sofort Ihre Chance. Ihnen war klar, daß mich dieses Band, falls Macolm eines gewaltsamen Todes sterben würde, dem Henker ausliefern mußte. Darum töteten Sie Macolm!"
Ferguson befeuchtete sich die Lippen mit der Zungenspitze. Er sah im Gesicht ganz gelb aus. Anscheinend stand einer seiner gefürchteten Malariaanfälle bevor.
„Macolm ist tot?"
„Sie wissen es! Geben Sie doch zu, daß Sie ihn ermordeten, um mir eins auszuwischen. Sie wollen mich an den Galgen liefern! Wenn die Stunde der Exekution kommt, wünschen Sie genußvoll das langsame aber unaufhaltsame Vorrücken der Zeiger zu beobachten, während die alten, verschrobenen Tanten vor dem Gefängnis gegen die Todesstrafe protestieren!"
Ferguson schüttelte unwillig den Kopf. „Jetzt geht die Phantasie mit Ihnen durch, Cabott. Ich bin kein Sadist, wie Sie anzunehmen scheinen. Ich bin auch kein Mörder. Ich fordere Ihre Bestrafung, aber nicht Ihren Kopf. Sie haben mich schamlos erpreßt. Folglich sollen Sie ebenso schamlos erpreßt werden. Aber was ist mit Sir Macolm?"
Ashton ließ die Schultern sinken. Er fühlte sich leer und wie ausgepumpt.
„Erschossen."
„Woher wissen Sie es?"
„Ich war dort. Ich drang in seine Wohnung ein. Dabei stolperte ich in der Dunkelheit über seine Leiche."
Ferguson pfiff leise durch die Zähne. „Erwarten Sie, daß die Polizei an Ihre Unschuld glauben wird?"
„Die Polizei wird nie erfahren, daß ich dort war. Oder haben Sie die Absicht . . .?"
Ferguson zuckte mit den Schultern. „Schwer zu sagen. Die Neuigkeit ist wirklich überraschend. Macolm erschossen. Nach allem, was die Bandaufnahme verrät, muß ich annehmen, daß Sie eines Mordes durchaus fähig sind. Sir Macolm war Ihr erbitterter Gegner. Was liegt also näher als der Gedanke, daß Sie die Tat begingen?"
„Ich gebe zu, daß es eine Zeit gab, wo ich mich mit dem Vorsatz trug, Sir Macolm zu Leibe zu rücken. Aber ich schwöre Ihnen, daß ich an seinem Tod keine Schuld trage!"
„Ich weiß nicht recht, Cabott. Sie dürfen nicht erwarten, daß ich den Schwüren eines Erpressers allzu große Bedeutung beimesse."
„Tun Sie, was Sie für richtig halten."
Ferguson stand auf. „Wann kann ich das Geld abholen?"
„Nicht vor Ablauf einer Woche."
„So lange kann ich nicht warten."
„Sie haben keine andere Wahl. Sir Macolm hat mich bereits um zwanzigtausend Pfund gebracht."
„Sie Ärmster. Sie sind wirklich das Musterbeispiel des erpreßten Erpressers. Nun, ich gebe Ihnen eine Woche Zeit. Keinen Tag länger. Wenn ich bis dahin das Geld nicht erhalten habe . . ." Er unterbrach sich und schnippte vielsagend mit den Fingern.
„Sie bekommen das Geld. Aber Sie können nicht verlangen, daß ich Constance aufgebe."
„Tut mir leid, Cabott. Ich kann nicht zulassen, daß das junge Mädchen in die Hände eines Kriminellen gerät. Das ist meine Bedingung."
„Ich lehne sie ab."
„Das wird Ihnen nicht viel helfen."
„Hören Sie, Ferguson, ich biete Ihnen weitere zehntausend Pfund, wenn Sie mir ein wenig Entgegenkommen zeigen."
Ferguson schüttelte den Kopf. „Ich lasse nicht mit mir handeln", sagte er ernst. „Ich bin vermögend genug, um auf Geschäfte mit Erpressern verzichten zu können. Die zwanzigtausend Pfund, die ich Ihnen abzunehmen hoffe, stellen nichts weiter als eine Art Strafe dar. Genauso verhält es sich mit meiner Forderung, daß Sie Constance aufgeben. Darüber gibt es keine Debatten!"
„Eines würde mich interessieren. Wie kommt es, daß Sie über den Mordanschlag auf Constance informiert sind?"
„Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf darüber. Ich weiß es eben."
„Verstehe. Vermutlich haben Sie es von dem Barmixer des Hotels erfahren."
„Stimmt. Aber das ist gar nicht wichtig. Wichtig ist nur, daß Sie meine Bedingungen einhalten. Denken Sie an das Tonband und mein Beweismaterial."
„Warum bestehen Sie darauf, daß ich mich von Constance trenne?" fragte Ashton verzweifelt. „Es kann Ihnen doch völlig gleichgültig sein, wen ich heirate!
„O nein", erwiderte Ferguson lächelnd. „Sie irren sich. Da ich vorhabe, Miß Britta Britton zu ehelichen, werden Sie begreifen, daß mir daran liegt, keinen Erpresser in die Familie zu bekommen!"
*
„Sie haben nichts gehört?"
„Nicht das geringste, Sir."
Kommissar Morry stand an der halboffenen Balkontür und sah zu, wie die Fotografen ihre Stative und Apparate zusammen packten. Ein paar Beamte schnüffelten in dem Zimmer herum, während der Butler mit hochrotem Kopf Morrys Fragen beantwortete. „Ich halte es durchaus für möglich, daß Sir Macolm durch die Vordertür ins Haus gebracht wurde", meinte der Butler. „Er ging kurz vor sechs Uhr weg und erklärte, daß er erst spät zurückkommen werde. Ich setzte mich darauf hin in mein Zimmer und las ein Buch. Ich hatte zwar das Radio angestellt, aber die Musik war nicht so laut, daß sie einen Schuß zu übertönen vermocht hätte. Ich schmeichele mir, ein außerordentlich feines Gehör zu halben, Sir. Darum neige ich zu der Vermutung, daß man den armen gnädigen Herrn außerhalb des Hauses erschossen und erst dann nach hier gebracht hat. Schließlich war das nicht sehr schwierig, da er die Schlüssel in der Tasche trug."
„Ihre Theorie setzt voraus, daß es mindestens zwei Täter gibt", bemerkte der Kommissar. „Sir Macolm ist ein schwerer Mann. Weshalb hätten ihn seine Mörder ins erste Stockwerk tragen sollen? Auch das wäre kaum ohne auffällige Geräusche abgegangen. Sie behaupten jedoch, trotz Ihres feinen Gehörs nichts vernommen zu haben."
„Möglicherweise paßten die Täter die Zeit ab, als ich in der Küche war und mein Abendbrot zubereitete. Von draußen ist ja leicht zu erkennen, wenn in der Küche das Licht angeht. Wir haben einen Gasherd, der nicht gerade leise arbeitet."
„Ich frage mich, warum die Täter ihr Opfer ausgerechnet in dieses Zimmer legten . . . vorausgesetzt, daß Ihre Theorie stimmt. Das Zimmer wird, wie Sie selbst sagen, eigentlich nie benutzt."
„Es ist eines der Gästezimmer, Sir. Das letzte Mal war es vor zwei Jahren von einem Vetter des gnädigen Herrn bewohnt. Seit jenen Tagen steht es leer."
„Wie kommt es, daß Sie ausgerechnet heute Abend dieses Zimmer betraten? Wurde ein Gast erwartet?"
„Nein, Sir, aber ich bin außerordentlich zugluftempfindlich. Sobald ich den leisesten Hauch von Zugluft spüre, sehe ich mich nach der Ursache um. Ich entdeckte nirgendwo ein offenes Fenster . . . aber hier, in diesem Raum, stieß ich auf die offene Balkontür. Ich bin absolut sicher, daß sie noch am Vormittag verschlossen war."
„Wird hier denn nie gelüftet?"
„O doch, Sir. Einmal in der Woche. Die Putzfrau war vor drei Tagen hier. Wenn sie nach ihrem Weggang die Tür offen gelassen hätte, wäre mir das nicht entgangen."
Vom Balkon kam ein junger Beamter herein.
„Am Mauerwerk sind ein paar frische Kratzspuren. Es ist durchaus möglich, daß der Täter über den Balkon ins Zimmer gedrungen ist."
„Mit dem schweren Macolm?" fragte Morry. „Ausgeschlossen!" Er wandte sich wieder an den Butler. „Fahren Sie fort. Sie kamen herein, um nach dem Rechten zu sehen und entdeckten dabei nicht nur die offene Balkontür, sondern auch den Toten."
„So ist es, Sir. Es war ohne Zweifel der schwerste Schock meines Lebens. Ich rief sofort die Polizei an."
„Das war richtig. Denken Sie jetzt bitte einmal genau nach. Können Sie sich an irgendein hervorstechendes oder besonders auffälliges Ereignis erinnern? Vielleicht an einen Besucher, der sich merkwürdig benahm?"
Der Butler legte die Stirn in Falten. „Ja, ich weiß nicht recht . . ."
„Nun?"
„Ein Besucher, der den gnädigen Herrn zu sprechen wünschte, benahm sich in der Tat ein wenig merkwürdig. Aber er hinterließ keineswegs den Eindruck eines Gewaltverbrechers."
„Kennen Sie den Mann?"
„Ja, Sir. Er stellte sich nicht vor, aber ich hörte später, daß er Ashton Cabott heißt."
„Erwähnte Sir Macolm gelegentlich diesen Namen?"
„Nur einmal, Sir?"
„Wovon lebte Sir Macolm?"
„Von seinen Einkünften als Museumsdirektor und von den Zinsen seiner Erbschaft, die ihm sein Onkel vermachte."
„Führte er ein sehr aufwendiges Leben?"
„Nein, Sir. Er liebte zwar gutes Essen und teure Weine, aber im wesentlichen beschränkten sich seine Interessen auf die Gebiete, die mit seinem Beruf als Archäologe in Zusammenhang standen."
„Besprach Sir Macolm gelegentlich private Dinge mit Ihnen?"
„Nein, Sir. Er achtete streng auf die gebotenen Grenzen zwischen Herr und Diener."
„Soll das heißen, daß er arrogant war?"
„Nein, Sir. Ich beklage mich keineswegs. Wenn ich etwas hasse, so sind es die biederen Annäherungsversuche allzu sozial denkender Arbeitgeber. Ich bin, wenn ich mir die Bemerkung gestatten darf, ein Butler der alten Schule."
„Hatte Sir Macolm Feinde?"
„Nicht, daß ich wüßte, Sir."
„Vermochten Sie an ihm in letzter Zeit irgendwelche Veränderungen festzustellen?"
„Nein, Sir."
„Wann traf er das letzte Mal mit Miß Britton zusammen?"
„Darüber bin ich nicht informiert, Sir."
„Die junge Dame war demnach noch niemals hier im Hause?"
„Noch nie, Sir."
„Vielen Dank, das genügt."
Der Butler verbeugte sich und ging zur Tür. Er vermied es dabei, einen Blick auf seinen toten Herrn zu werfen. Hilfsinspektor May, ein hagerer, hochaufgeschossener Beamter in einem ziemlich mitgenommen aussehenden Trenchcoat, blickte dem Butler hinterher.
„Diese gräßlichen Stockfisch-Naturen!" sagte er, nachdem sich die Tür hinter dem Diener geschlossen hatte. Er äffte die Stimme des Butlers nach. „Wenn ich etwas hasse, so sind es die biederen Annäherungsversuche allzu sozial denkender Arbeitgeber! Trottel!"
Kommissar Morry lächelte zerstreut. „Was wollen Sie, May? Ein Diener hat eben auch seinen Stolz. Aber die Aussage hat uns keinen Schritt weiter gebracht. Fassen wir zusammen. Sir Macolm wurde voraussichtlich von einer Kugel des gleichen Kalibers getötet, die auch Constance Britton traf. Die Ballistiker werden hoffentlich sehr schnell ermitteln, ob die beiden Kugeln aus der gleichen Pistole abgefeuert wurden..."
„Ich finde, es ist von größter Wichtigkeit, daß wir endlich Britta Britton aufspüren", meinte May. „Wo kann sie nur stecken?"
Es klopfte. Die Tür öffnete sich und ein uniformierter Beamter betrat salutierend das Zimmer. „Wir haben gerade die Nachricht bekommen, daß die Operation an Miß Constance Britton zufriedenstellend verlaufen ist, Sir. Die Patientin wird voraussichtlich in ein oder zwei Tagen vernehmungsfähig sein."
„Gut. Rufen Sie das ,Carlton' an und fragen Sie, ob Britta Britton inzwischen zurückgekommen ist."
Der Beamte legte die Hand an den Mützenschirm und verschwand. „Ich glaube nicht, daß Britta in den Fall verwickelt ist", meinte May. „Warum hätte sie erst die Schwester und dann Sir Macolm aufs Korn nehmen sollen? Ich entdecke da kein plausibles Motiv."
„Warten wir Miß Constances Genesung ab", meinte der Kommissar. „In spätestens achtundvierzig Stunden wissen wir, wer auf sie geschossen hat."
Während der letzten Worte war Doktor Hamilton eingetreten. Er sagte: „Das kann ich Ihnen schon jetzt mitteilen. Es war Sir Macolm!"
„Sir Macolm?"
„Ja. Ich komme gerade vom Krankenhaus. Ich wollte die Operation abwarten, aber dann hielt ich es für richtiger, Ihnen die Neuigkeit sofort persönlich zu übermitteln. Die Verletzte erlangte vor dem Eingriff für ein paar Sekunden das Bewußtsein. Ich, stand neben ihr und hörte, wie sie den Namen des Täters preisgab. Dann wurde sie wieder ohnmächtig."
Die Männer starrten auf den Toten. „Nehmen wir an, er war es wirklich", sagte Hilfsinspektor May. „Wer hat ihn dann getötet?"
„Dahinter werden wir bald kommen", versprach der Kommissar.
Es klopfte, und die Tür öffnete sich. Der uniformierte Beamte trat ein.
„Miß Britton ist soeben in das Hotel zurückgekehrt, Sir", meldete er.
Morry wandte sich an May. „Machen Sie hier bitte weiter. Ich fahre ins ,Carlton'."
„All right, Kommissar."
„Wenn Sie etwas Wichtiges entdecken, rufen Sie mich dort an.”
„Okay."
Wenig später saß der Kommissar Britta Britton in ihrem Hotelzimmer gegenüber.
„Wie ich höre, sind Sie vor etwa zwanzig Minuten zurückgekehrt", sagte er, nachdem er dem Mädchen sein Beileid über den auf die Schwester verübten Anschlag ausgesprochen hatte.
„Ja, das stimmt."
Britta rauchte mit nervöser Hast eine Zigarette. Sie sah blaß und zerquält aus. Ihre rot umränderten Augen ließen erkennen, daß sie geweint hatte.
„Wenn ich doch nur auf Constance gehört hätte!" fuhr sie fort. „Es war zu spüren, daß sie etwas quälte. Während unseres ganzen Londoner Aufenthaltes war sie bedrückt. Sie fürchtete sich vor etwas. Ich hätte das respektieren und sie nach Hause schicken sollen. Oh, es ist schrecklich, einfach schrecklich!"
„Darf ich erfahren, wo Sie sich heute aufgehalten haben?"
„Ich war in Surrey; dort wohnt eine entfernte Verwandte meines Vaters. Ursprünglich wollte ich Constance mitnehmen, aber sie hatte eine Verabredung mit Mr. Cabott, und so fuhr ich schließlich allein."
„Sie haben also für die fragliche Zeit ein Alibi?"
Britta hob erstaunt die feinen Augenbrauen. „Ein Alibi?" fragte sie. „Natürlich. Aber was sollte ich damit? Glauben Sie etwa, ich könnte auf meine Schwester geschossen haben? Das wäre doch einfach absurd. Ich liebe Conny. Oder ist noch etwas passiert?"
„Allerdings."
„Spannen Sie mich nicht auf die Folter, Kommissar. Was ist geschehen?"
„Man hat Sir Macolm getötet."
Brittas Augen weiteten sich erschreckt. Ihre Unterlippe begann zu zittern.
„Sir Macolm . . . getötet?" würgte sie leise hervor.
„Erschossen."
„Aber das ist doch unmöglich."
„Er ist tot. Es hat den Anschein, daß mit derselben Waffe auf ihn geschossen wurde, die auch beim Anschlag auf Ihr Fräulein Schwester Verwendung fand. Wir nehmen an, daß es sich dabei um Sir Macolms Pistole handelte. Wir entdeckten in seinem Schreibtisch einen Waffenschein für eine Pistole des in Frage kommenden Kalibers, aber keine Pistole. Die Mordwaffe ist verschwunden."
„Soll das heißen . . . begann Britta stockend.
„Ja, das soll heißen, daß Sir Macolm auf Ihre Schwester geschossen hat und später mit der eigenen Pistole getötet wurde."
Britta schüttelte ungläubig den Kopf. „Das kann nicht wahr sein. Sir Macolm war ein Gentleman ... er wäre einer solchen Tat nie fähig gewesen."
Der Kommissar zuckte mit den Schultern. „Tut mir leid. Aber der Hinweis auf den Täter stammt von Ihrer Schwester. Kurz vor der Operation erlangte sie noch einmal das Bewußtsein. Dabei nannte sie den Namen des Täters."
„Hat sie ausdrücklich gesagt, daß Sir Macolm auf sie geschossen hat?"
„So habe ich den Doktor, der Zeuge der Aussage wurde, allerdings verstanden."
„Ich kann es nicht glauben. Sicher wollte sie etwas anderes erklären. Ich bin davon überzeugt, daß es sich um ein Mißverständnis handelt."
„Das wird sich bald herausstellen."
„Es gab für Sir Macolm nicht den geringsten Grund, auf meine Schwester zu schießen."
„Ich gebe zu, daß wir wegen des Motivs noch völlig im dunkeln tappen. Aber nehmen wir einmal an, Ihre Schwester hat recht, und Sir Macolm war wirklich der Täter. Nehmen wir weiter an, Sie haben dem fragwürdigen Impuls nachgegeben, den Mordanschlag auf die Schwester zu sühnen . . . wäre das nicht ein Motiv? Ich weiß, daß dieser allzu simplen Logik einige wesentliche Punkte gegenüberstehen. Erstens einmal dürften Sie kaum gewußt haben, daß auf Ihre Schwester geschossen wurde, und zweitens besitzen Sie ja offensichtlich für die fragliche Zeit ein Alibi. Sie verstehen sicher, daß ich trotzdem gezwungen bin, dieses Alibi routinemäßig zu überprüfen. Darf ich also die Adresse Ihrer Tante erfahren?"
„Es ist keine Tante. Ich erklärte Ihnen bereits, daß es sich um eine entfernte Verwandte handelt."
„Richtig. Wo wohnt sie?"
„In Surrey, Elmerton Road 24."
„Vielen Dank", sagte der Kommissar und trug die Anschrift in sein Notizbuch ein. Dann fragte er: „Sie haben Sir Macolm näher gekannt?"
„O ja. Wir waren sehr häufig zusammen. Er war, wie Sie sicher wissen, Museumsdirektor und Archäologe. Seine vorzüglichen Fachkenntnisse und sein liebenswürdiges Entgegenkommen waren eine große Hilfe für mich und meine Arbeit."
„Hatten Sie das Gefühl, daß er sich auch als . . . hm . . . Mann um Sie bemühte?"
„Nein, davon habe ich nichts bemerkt."
„War er der einzige Mann, mit dem Sie während Ihres Londoner Aufenthaltes Umgang hatten?"
„Ich habe durch meine Schwester ein paar Herren kennengelernt, die sich mehr oder weniger intensiv darum bemühten, die Zusage für ein Rendezvous zu erhalten. Ich gab den meisten einen Korb, weil mir klar war, daß ich nur als Ersatz und Lückenbüßer für Constance dienen sollte." Sie lächelte schwach. „Arme Conny. Sie kann nichts dafür, daß die Männer auf sie fliegen."
„Bitte denken Sie nach. Miß Britton. Erwähnte Sir Macolm in den letzten Tagen irgend etwas, das auf eine Bedrohung seiner Person schließen ließ?"
Britta legte nachdenklich die Spitze des rechten Zeigefingers an die Lippen.
„Ja, warten Sie. Er sprach ein paarmal davon, daß er viel Ärger mit einem bestimmten Mann habe. Da es sich um private Dinge zu handeln schien, drang ich nicht weiter in ihn."
„Nannte Sir Macolm einen Namen?"
„Ich glaube mich erinnern zu können, daß er einmal den Namen Cabott erwähnte. Das überraschte mich ein wenig, denn ein Bekannter meiner Schwester trägt den gleichen Namen. Wahrscheinlich handelte es sich um eine zufällige Namensgleichheit."
„Das ist nicht ausgeschlossen."
„Haben Sie schon etwas über den gestohlenen Schmuck in Erfahrung bringen können?"
„Noch nicht. Ich bin der festen Überzeugung, daß zwischen dem Anschlag auf Ihre Schwester, dem Mord an Sir Macolm und dem Schmuckdiebstahl ein innerer Zusammenhang besteht."
„Ist das Ihr Ernst?"
Kommissar Morry nickte und erhob sich. Britta stand gleichfalls auf und drückte die Zigarette in einem Ascher aus.
„Ich fürchte mich, Kommissar", sagte sie mit gehetzt klingender Stimme. „Die Ängste meiner Schwester und der Schmuckdiebstahl berührten mich kaum. Aber seitdem man gewagt hat, auf Conny zu schießen, ist mein Nervensystem erheblich durcheinander geraten." Sie blickte dem Kommissar angstvoll in die Augen. „Was soll ich bloß tun? Ich kann mich doch hier nicht verbarrikadieren!"
„Ich glaube nicht, daß Sie bedroht sind."
„So? Sind Sie überzeugt, daß es niemand darauf angelegt hat, die Britton- Schwestern zu töten? Weshalb, frage ich Sie, sollte der Täter auf Conny schießen und mich verschonen wollen?"
„Wir wissen doch, daß Sir Macolm auf Ihre Schwester geschossen hat. Sir Macolm ist jedoch tot!"
„Ich halte nicht viel von Connys Geständnis. Es kam möglicherweise im Fieber über ihre Lippen. Ich fürchte mich, Kommissar. Bitte postieren Sie heute Nacht einen Beamten vor meiner Tür."
Kommissar Morry seufzte. „Das wird sich kaum machen lassen. Wir stecken bis zum Hals in Arbeit und ich bin nicht befugt..."
„O bitte!" unterbrach ihn Britta mit flehender Stimme. „Nur diese eine Nacht!"
„Also schön . . . ausnahmsweise!"
Britta lächelte dankbar und streckte ihm eine Hand hin. „Das werde ich Ihnen nie vergessen, Kommissar!"
*
Je länger er darüber nachdachte, um so überzeugter war er davon, daß Gilbert Ferguson Sir Macolm ermordet hatte. Wenn sich Ferguson mit der Absicht trug, Britta Britton zu heiraten, war es für ihn wichtig gewesen, sich des gefährlichsten Nebenbuhlers zu entledigen. Ashton saß noch immer in dem kleinen Salon, wo Ferguson ihn verlassen hatte.
Er sah müde und verfallen aus und hatte das Gefühl, aus höchsten Höhen in die Niederungen des Elends gestoßen worden zu sein. Seinem Vermögen stand ein weiterer, entscheidender Aderlaß bevor, und die Zukunft, die sich durch die Möglichkeit einer Ehe mit Constance rosarot präsentiert hatte, war durch Fergusons Forderung in jähes Dunkel getaucht worden.
Er atmete schwer. Es gab nur einen einzigen Ausweg: Ferguson mußte weg. Ashton schob die Unterlippe nach vorn. War das überhaupt möglich? Ferguson war kein Dummkopf. Wenn er einen Detektiv beschäftigte, war auch anzunehmen, daß er sich in der jetzigen Situation durchaus der persönlichen Gefahr bewußt war, in der er schwebte. Gewiß hatte er entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen.
Trotzdem: Ferguson mußte weg.
Aber wie?
Ashton erhob sich entschlossen. Er erinnerte sich an einen Mann, der in Soho eine winzige Kneipe betrieb und allerlei Beziehungen zur Londoner Unterwelt hatte. Es wurde behauptet, daß dieser Mann jede Art von Geschäft und Auftrag vermitteln konnte.
Ashton verließ das Haus und fuhr mit dem Wagen nach Soho. Als er vor der Kneipe aus dem Wagen kletterte, war der Wirt gerade dabei, die Tür des Lokals zu schließen.
„Polizeistunde!" brummte er, als Ashton an ihn herantrat. „Ich kann Ihnen nichts mehr verkaufen."
Der Wirt war ein kleiner, muskulöser Mann mit einem kurzen, gedrungenen Nacken und schütterem Haar. Seiner platten Nase war anzusehen, daß sie schon manchen Faustkampf überstanden hatte. „Ich bin nicht gekommen, um etwas zu trinken."
Der Wirt musterte Ashton aus kleinen, verkniffenen Augen.
Ashton zog eine Fünfpfundnote hervor. „Ich werde Sie nicht lange aufhalten."
Der Wirt nahm ihm die Note ab und sagte: „Treten Sie ein."
Kurz darauf saßen sie in dem winzigen, verräucherten Lokal an einem Tisch, auf dem noch die Biergläser der Abendgäste standen. Der Wirt hatte die nackten, mit Seefahrtsmotiven tätowierten Arme auf die Tischplatte gelegt. Er betrachtete Ashton mißtrauisch.
„Also los . . . was gibt es?"
Ashton befeuchtete sich die Lippen. Er hatte sich noch nie in einer ähnlich makabren Situation befunden. Wenn das nun der falsche Mann war? Wie begann man solch ein Gespräch? Vielleicht beschäftigte sich der Wirt nur mit dem Verkauf von Rauschgift, vielleicht war es ein kleiner Hehler, möglicherweise sogar ein Spitzel der Polizei . . .
Man wußte bei diesen schmierigen Gesellen nicht, woran man war. Sie hielten die stets empfangsbereiten Hände nach allen Seiten offen hin.
Ashton gab sich einen Ruck.
„Ich kenne einen Mann, der verschwinden muß. Einen gewissen Gilbert Ferguson."
Der Wirt schwieg. Er blickte Ashton mit einem starren, grübelnden Blick an.
„Haben Sie mich verstanden?" fragte Ashton.
„Ich bin nicht taub. Okay. Ein Mann muß verschwinden. Was habe ich damit zu schaffen?"
„Ich hatte gehofft, Sie würden mir dabei behilflich sein können."
Der Wirt fuhr sich mit einem nicht ganz sauberen Finger unterhalb der Nase geräuschvoll hin und her. „Da sind Sie an die falsche Adresse geraten", sagte er dann. „Wofür halten Sie mich eigentlich? Für einen Menschenräuber?" Er stand auf und stemmte die muskulösen Arme auf den Tisch. „Verschwinden Sie! Machen Sie, daß Sie rauskommen!"
Ashton erhob sich. „Ist das Ihr letztes Wort?"
„Raus!"
„Ich kann verstehen, daß Sie auf diese Weise reagieren. Vielleicht halten Sie mich für einen Spitzel..."
Der Wirt kam um den Tisch herum. „Sie sind kein Spitzel", erwiderte er und griff nach Ashtons Jackettkragen, um den Stoff zwischen den Fingern zu prüfen. „Prima Ware! So was kann sich kein Polizeispitzel leisten. Sie sind nicht aus dieser Gegend, was?“
„Werden Sie mir helfen?"
„Nein. Ich will mit der Sache nichts zu tun haben. Hauen Sie endlich ab!"
„Ich wäre bereit, die Hilfe mit fünftausend Pfund zu honorieren", sagte Ashton, als sie auf die Tür zugingen.
Der Wirt blieb stehen. „Fünftausend?" fragte er lauernd.
„Ja."
„Für jeden?"
„Wie meinen Sie das?"
„Sie können nicht erwarten, daß ich mir bei dem Geschäft die Hände schmutzig mache. Ich kann es vermitteln. Das ließe sich für fünftausend machen. Aber was bekommt der Mann, der sich an diesen netten Ferguson heranmacht?"
Ashton sagte: „Ich kann nicht mehr als fünftausend zahlen. Das ist ein Vermögen!"
„Sie wissen, was in England beispielsweise auf Mord steht."
„Ich dachte, Sie könnten so etwas mit der notwendigen Diskretion arrangieren."
„Etwas geht immer schief."
Er öffnete die Tür und Ashton trat auf die Straße. Als er auf seinen Wagen zuging, rief der Wirt halblaut: „Moment mal . . . nur noch einen Augenblick!"
Ashton wandte sich um.
„Haben Sie es sich anders überlegt?"
„Kommen Sie herein!"
Ashton folgte der Aufforderung. Der Wirt schloß die Tür.
„Fünftausend, sagten Sie?"
„Genau. In bar. In kleinen Scheinen. Aber nicht einen Cent mehr!“
„Setzen wir uns."
Ashton nahm wieder an dem Tisch Platz, während der Wirt eine Flasche und zwei saubere Gläser holte.
„Sie trinken doch einen mit?"
„Worauf?" fragte Ashton.
Der Wirt grinste und hob die Flasche in die Höhe. „Auf Fergusons Ableben!"
*
Als er vor seinem Haus aus dem Wagen kletterte, graute bereits der Morgen. Ashton war müde, aber zufrieden. Er hatte mit dem Wirt alle Einzelheiten genau besprochen. Der Wirt bekam die Hälfte der vereinbarten Summe als Anzahlung. Er hatte zugesagt, den Auftrag innerhalb der nächsten zwei Tage, jedoch nicht vor vierzehn Uhr des anbrechenden Tages zu erledigen. Ashton beabsichtigte schon vorher zu seiner Tante nach Leeds zu fahren. Er wollte solange dort bleiben, bis die Zeitungen über die Sache Ferguson berichteten. Dann wollte er zurückkommen und dem Wirt den Restbetrag zahlen. Er war davon überzeugt, daß alles klappen würde.
Ashton betrat sein Zimmer und streifte das Jackett ab. Im gleichen Moment merkte er, daß etwas nicht stimmte. Er wandte sich mit einem Ruck um. Neben der Tür, an der Wand, lehnte Britta Britton. Sie hielt eine Pistole in der Hand, deren Mündung sie auf Ashton richtete.
Ashton gab sich keine Mühe, seine maßlose Verblüffung zu unterdrücken. „Was soll denn das bedeuten?"
Britta lächelte dünn, als sie sagte: „Sie haben mich lange warten lassen!"
„Wie sind Sie hier hereingekommen?"
„Durch das Fenster natürlich."
„Ich hatte keine Ahnung, daß Sie mich zu sprechen wünschen. Weshalb zielen Sie mit der Pistole auf mich?"
„Weil ich Sie zu treffen wünsche. Schauen Sie sich die Waffe genau an. In ihrem Magazin fehlen zwei Kugeln. Eine davon traf Constance, die andere tötete Macolm."
Ashton wich einen halben Schritt zurück. „Wollen Sie damit sagen..."
„Ich will damit sagen, daß zunächst Macolm in meinem Auftrag auf Constance schoß. Später, als er sich im Gästezimmer seines Hauses die ihm versprochene Belohnung abholen wollte, nahm ich die Pistole aus seiner Tasche und schoß auf ihn."
„Sie haben ihn getötet?" fragte Ashton ungläubig.
„Gewiß. Ich hätte auch Constance umgebracht, wenn Macolm nicht bereit gewesen wäre, mir diese Arbeit abzunehmen."
Ashton atmete heftig. Er suchte in den schönen, klaren Augen des Mädchens vergeblich nach den Spuren des Wahnsinns, der dieses Geschöpf gefangenzuhalten schien. Britta lehnte kühl und beherrscht an der Wand. Sie war offensichtlich frei von der leisesten Erregung.
„Warum sollte Constance sterben?" fragte er. „Warum?"
„Das ist leicht erklärt. Sie ist nur meine Halbschwester. Meine Mutter war in erster Ehe mit einem anderen Mann verheiratet. Constances Vater, mein Stiefvater, hat diesen Umstand in seinem Testament berücksichtigt. Ich werde nur ein Viertel des Vermögens erben... es sei denn, daß Constance stirbt."
„Sie haben wegen des Geldes diese Ungeheuerlichkeit verübt?"
„Was ist für Sie daran so erstaunlich?" fragte Britta kühl. „Haben Sie nicht aus dem gleichen Grund eine Unzahl von Verbrechen begangen? Macolm hat mich von Ihrem Vorleben genau unterrichtet. Ich muß sagen, daß Sie in der Wahl Ihrer Mittel niemals zimperlich waren. Aber kehren wir zurück zu Constance. Sie war mir stets im Wege. Sie ist jünger, schöner, umschwärmter. Sie bekam stets die Männer, nach denen es mich verlangte. Sie erhielt alles, was sie sich wünschte, während ich hart darum zu kämpfen hatte. Ihr fielen die Dinge einfach in den Schoß. Dafür haßte ich sie. Dafür hasse ich sie noch heute. Glauben Sie wirklich, ich sei eine ehrlich begeisterte Archäologin? Das ist bloß Tünche! Es war und ist der Versuch, Constance wenigstens auf einem Gebiet auszustechen. Ich wollte ihr meine geistige Überlegenheit beweisen. Aber sie hat meine diesbezüglichen Anstrengungen nie ernst genommen."
„Was habe ich mit all dem zu tun?"
„Sie müssen sterben, weil ich den Fehler beging, diese Pistole aus Macolms Wohnung mitzunehmen."
„Ich verstehe Sie nicht."
„Nein? Dann muß ich deutlicher werden. Ich brauche einen Schuldigen. Ich brauche einen Mann, der die Polizei auf eine falsche Spur bringt. Scotland Yard soll annehmen, daß Sie Macolm ermordet und auf Constance geschossen haben!"
„Das ist absurd! Constance wird nach ihrer Genesung aussagen, daß es Macolm war, der auf sie schoß."
Ein grausames Lächeln umspielte Brittas schöne Lippen. „Ich werde dafür sorgen, daß es nie zu dieser Aussage kommt."
„Sie wollen Constance nach dem Leben trachten?"
„So ist es. Ich bin ihre Schwester. Man wird mich zu ihr lassen. Ich werde ihr ein schnell wirkendes Gift einträufeln und man wird annehmen, daß sie an den Nachwirkungen der Operation gestorben ist."
„Das glauben Sie ja selbst nicht!"
„O doch. Übersehen Sie bitte nicht, daß die Polizei Sie tot in diesem Zimmer vorfinden wird. Auf dem Nachtschränkchen wird ein Zettel liegen, aus dessen Inhalt hervorgeht, daß Sie den Schmuck gestohlen, Macolm getötet und Constance zu erschießen versucht haben!"
„Ich werde diesen Zettel nicht schreiben. Selbst wenn ich ihn in der von Ihnen gewünschten Form abfaßte und man mich tot in diesem Zimmer fände, würde die Polizei doch sehr rasch die wahren Zusammenhänge erkennen. Es gibt kein Motiv, warum ich all dies getan und mich anschließend erschossen haben sollte!"
„Zerbrechen Sie sich über die Mutmaßungen der Polizei bitte nicht den Kopf. Ich brauche einen Schuldigen, und kein Motiv. Wenn die Polizei den Schuldigen hat, wird sie die Akte rasch schließen."
„Warum töteten Sie Macolm?"
„Er hatte das Pech, daß ich mich vor wenigen Tagen in einen Mann namens Ferguson verliebte. Nach allem, was Macolm von mir wußte, konnte ich ihm nicht den Laufpaß geben. Bis zu Fergusons Auftauchen war es meine erklärte Absicht, Sir Macolm zu heiraten. Ich kam zwar rasch dahinter, daß er ein Schurke war, aber ich begriff auch, daß es mir mit seiner Hilfe gelingen würde, das gesamte Britton- Vermögen an mich zu reißen. Wir entdeckten gewisse Gemeinsamkeiten. Es machte uns viel Spaß, Sie zu erpressen . . . und es brachte Geld! Die Idee mit dem Schmuckdiebstahl stammte von mir. Der Schmuck befindet sich in meiner sicheren Obhut. Er wird mir in Amerika eine Menge Geld bringen. Ich war klug genug, auch meine Preziosen .verschwinden' zu lassen, damit nicht der Schatten eines Verdachtes auf mich fiel."
„Das alles ist noch reichlich verworren", sagte Ashton, dem es darum ging, Zeit zu gewinnen. „Wenn ich Sie recht verstehe, baten Sie Macolm darum, auf Constance zu schießen..."
„Stimmt. Ich machte ihm klar, daß dies die Bedingung für unsere Eheschließung sei. Ich darf dabei nicht unerwähnt lassen, daß Macolm ziemlich verschossen in mich war, obwohl ihn auch die Britton- Millionen gereizt haben dürften. Ich gestattete ihm nie die kleinste Freiheit, versprach ihm aber meine Gunst für den Fall, daß er Constance aus dem Wege brächte. Zum abgesprochenen Termin erwartete ich ihn im Gästezimmer seines Hauses. Als er kam, um seine Belohnung zu kassieren, angelte ich die Pistole aus seiner Tasche und schoß!"
„Wie kommt es, daß der Butler den Schuß nicht hörte?"
„Er war, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt in der Küche."
Ashton betrachtete das Mädchen. Unter einer dreiviertellangen Stoffjacke trug sie eng anliegende Hosen aus einem olivgrünen Stoff. Die Füße steckten in flachen, bequemen Schuhen.
„Sie wundern sich über meine Aufmachung, nicht wahr?" sagte sie. „Ich mußte über einige Balkone und an einer Regenrinne herabklettern, um das Hotel verlassen zu können. Vor der Tür meines Zimmers sitzt nämlich ein Beamter von Scotland Yard und schläft. Wenn er in ein oder zwei Stunden mein Zimmer betritt, werde ich im Bett liegen und mich für seine treue, brave Wache bedanken. Es war meine Idee, dem Kommissar den Mann abzu- schmeicheln. Auf diese Nacht habe ich für die ganze Nacht das beste Alibi, das man sich denken kann . . . einen Polizisten!"
„Sie brauchen mehr als ein Alibi!"
„Ganz richtig. Darum habe ich dem Kommissar erklärt, ich hätte mich heute bei einer entfernten Verwandten in Surrey aufgehalten. Natürlich war ich nicht dort, wenigstens nicht zu der angegebenen Zeit. Die alte Dame existiert selbstverständlich. Es geht ihr nicht besonders gut und sie erklärte sich bereit, für eine einmalige Abfindung von hundert Pfund die von mir gewünschte Aussage zu machen."
„Sie haben wirklich an alles gedacht . . . nur an eins nicht!"
„Und das wäre?"
„Meine Wenigkeit."
„Sie? Haben Sie mich denn nicht verstanden? Ich werde Sie töten und hinterher alles so arrangieren, daß es wie ein Selbstmord aussieht."
Ashton grinste. „War es nicht Ihre Absicht, Ferguson zu heiraten?"
„Allerdings. Daran hat sich nichts geändert."
„O doch. Sie werden ihn nicht heiraten können, wenn Sie mir auch nur ein Haar krümmen!"
„Wie meinen Sie das?"
„Ich habe Fergusons Ableben beschlossen!"
„Warum?"
„Er war heute hier, um eine schon verjährte Erpressung mit einer Gegenerpressung zu beantworten."
„Gilbert? So etwas würde der nie tun!"
„Regen Sie sich nicht darüber auf. Es ging ihm wirklich nur darum, sich an mir schadlos zu halten. Ein Bestechungsversuch, der ihm viel Geld eingebracht hatte, wurde von ihm abgelehnt. Dummerweise bestand er darauf, daß ich mich von Constance löse. Da ich mit dieser Forderung gleichsam meine letzten Felle davonschwimmen sah, entschloß ich mich, die Wurzel des Hebels zu beseitigen..."
„Soll das heißen, daß es in Ihrer Absicht liegt, Gilbert zu töten? Daran werde ich Sie hindern!"
„Das können Sie nicht. Ich habe einen Mann aus Soho damit beauftragt, diese unangenehme Aufgabe für mich zu lösen. Ich komme gerade von ihm. Es ist alles genau abgesprochen. Ferguson wird auch nicht überleben, wenn ich den Befehl zurückziehe."
„Sie lügen!"
„Nein."
„Sie bluffen! Sie wollen mich nur erschrecken!"
Ja, ich bluffe, dachte Ashton. Wenn der Wirt die Anzahlung nicht bekommt, wird er keinen Finger rühren. Aber dieser Bluff ist meine letzte Möglichkeit, den Amoklauf dieser Wahnsinnigen zu stoppen.
„Es ist die reine Wahrheit", bekräftigte er.
„Sie wissen nicht, was die Wahrheit ist!"
Ashton zuckte mit den Schultern. „Was hätten Sie denn wohl an meiner Stelle getan? Ferguson verlangte zwanzigtausend Pfund in bar und meine Zukunft! Das ist ein bißchen viel, nicht wahr? Da er weder durch Geld noch durch gute Worte von seiner Forderung abzubringen war, blieb mir nichts anderes übrig, als seinen Abgang vorzubereiten."
Ashton sah, wie es in dem Gesicht des Mädchens arbeitete. Sie hatte eine unheimliche und schreckenerregende Aufgabe fast im Alleingang gelöst. Sie hatte einen Mann getötet und einen anderen dazu gebracht, auf die eigene Schwester zu schießen. Mit dem geplanten, vorgetäuschten Selbstmord wollte sie die Kette der furchtbaren Aktionen zum Abschluß bringen und sah sich nun plötzlich einem Hindernis gegenüber, das unüberwindlich schien.
Der heraufdämmernde Tag verdrängte mehr und mehr die Schatten der Nacht. Die Straßen und Gärten lagen noch immer im Dunkel, aber über den Dächern zeigten sich die ersten silbergrauen Streifen des anbrechenden Morgens.
Britta warf den Kopf in den Nacken. Es war offensichtlich, daß sie sich zu einem Entschluß durchgerungen hatte.
„Ich tötete Macolm, weil ich Ferguson liebe", sagte sie mit blitzenden Augen, „aber noch mehr als Ferguson liebe ich mein Leben. Darum muß ich jetzt auf Sie schießen, Cabott. Es ist mir keineswegs gleichgültig, ob ich damit Fergusons Leben auslösche oder nicht. Aber mir bleibt keine andere Wahl. Sie wissen zuviel, als daß ich es riskieren könnte, mit Ihnen einen Pakt zu schließen. Sie sind ein Erpresser! Sie würden die Informationen, die ich Ihnen gegeben habe, rücksichtslos ausbeuten!"
„Wir können uns einigen", gab Ashton nach.
Der Kragen klebte ihm am Hals. Jetzt, da die Entscheidung mit Riesenschritten auf ihn zueilte, fühlte er, wie seine Knie zu zittern begannen.
„Es gibt keine Einigung zwischen uns", entgegnete Britta. „Sie müssen sterben, Cabott!"
„Ich schwöre Ihnen, daß ich Sie nicht verraten würde", stammelte Cabott mit dicker Zunge. „Ich werde..."
„Zu spät!" unterbrach ihn das Mädchen.
„Nicht schießen!" schrie Cabott. „Nicht schießen!"
Er taumelte auf sie zu. Sein Mund und seine Kehle waren wie ausgedörrt. Britta hob die Pistole. Ihre Hand war ganz ruhig, als sie zielte. Dann krachte ein Schuß . . .
*
Britta schrie auf. Die Pistole entfiel ihrer Hand. Ashton, der in die Knie gesunken war, sah, daß das Mädchen die linke Hand um den rechten, von einer Kugel getroffenen Unterarm preßte. Durch die Balkontür trat ein großer, ernst aussehender Mann ins Zimmer. Er hielt noch immer die Pistole in der Hand.
„Kommissar Morry!" stöhnte Britta.
Der Kommissar trat ans Telefon und wählte eine Nummer. „Streifenwagen? Kommen Sie sofort zum Haus von Ashton Cabott! Vergessen Sie nicht, einen Doktor mitzubringen."
Er legte auf und schob die Pistole in seine Jackettasche.
„Ich muß mich entschuldigen", sagte er. „Ich hätte ein paar Sekunden früher eintreten sollen. Aber ich wollte mir von dem interessanten Zwiegespräch nichts entgehen lassen..."
Ashton erhob sich. Er konnte noch immer nicht begreifen, daß er mit dem Leben davongekommen war. „Haben Sie die ganze Zeit auf dem Balkon gestanden?" fragte er.
„Gewiß." Der Kommissar blickte das Mädchen an. „Ich folgte Ihnen von dem Hotel nach hier. Sie begingen den Fehler, um einen Posten für Ihr Zimmer zu bitten. Mir war sofort klar, daß es Ihnen nur um ein Alibi ging. Ihre Angstzustände waren miserabel geheuchelt. Ein Mädchen mit so kalten, klaren Augen fürchtet sich nicht ... es sei denn, sie wird gezwungen, dem Henker ins Auge zu blicken."
„Sie haben meinen Arm getroffen!" stöhnte Britta. „Warum haben Sie auf mich geschossen?"
„Ich wollte vermeiden, daß Sie zur Doppelmörderin werden", sagte Morry mit einer Stimme, die die strafende Endgültigkeit eines Urteilsspruches enthielt. Brittas Unterhaltung mit Ashton war das beste Geständnis, das er je gehört hatte.
E N D E